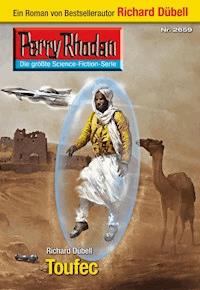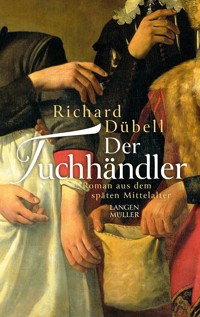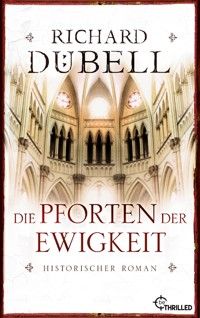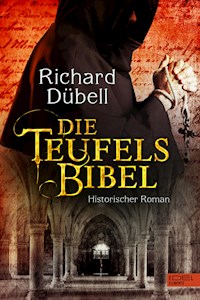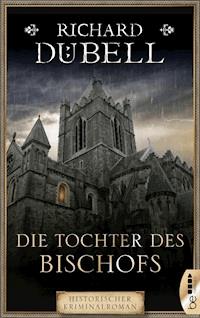9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Orphanus, der Einzigartige. Der bedeutendste Edelstein in der Reichskrone. Um kein anderes Juwel ranken sich so viele Legenden. Aus dem Blut und den Tränen der Jungfrau Maria soll er entstanden sein. Ein Zeichen göttlicher Legitimation soll er sein. Kaiser stehen und fallen mit diesem Stein. Und im Jahr 1208 verschwindet er ...
Als junger Mann stahl Walther von der Vogelweide einst den sagenumwobenen Edelstein Orphanus für seinen König Philipp von Schwaben. Er dichtete eines der bekanntesten Lieder über das Juwel und erklärte es darin zum Leitstern aller Fürsten. All das sollte dazu dienen, Philipps Herrschaft zu stabilisieren. Stattdessen endete sie in einer Katastrophe. Zwanzig Jahre später ist es Kaiser Friedrich, der den Stein für seine Zwecke nutzen will. Er zwingt Walther, sich auf die Suche zu machen. Eine hektische Jagd beginnt, deren Ausgang über das Schicksal des ganzen Reiches entscheiden könnte ...
Ein aufregender Abenteuerroman rund um die Machtkämpfe der Staufer und den berühmtesten Dichter des Mittelalters
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
INHALT
RICHARD DÜBELL
KRONE DESSCHICKSALS
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Kai Lückemeier, Gescher
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Einband-/Umschlagmotiv: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © shutterstock/BackgroundStore; shutterstock/Molodec; shutterstock/Andreas Zerndl; shutterstock/Pecold; shutterstock/Roberto Castillo
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2954-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Stefan (1957–2014)
Du bist jetzt dort, wo all die guten Geschichten sind:
In unseren Herzen und in unserer Erinnerung.
Für immer.
Für alle, die jemals die Liebe gewonnen,
und alle, die jemals die Liebe verloren haben.
Herrin, ich trag an der Last zu schwer.
Willst du mir helfen, dann hilf mir gleich.
Liebst du mich aber nun nicht mehr,
Führ ich für die Liebe nie mehr einen Streich.
Walther von der Vogelweide
Freie Übersetzung aus: Saget mir ieman, waz ist minne?
And said I that my limbs were old,
And said I that my blood was cold,
And that my kindly fire was fled,
And my poor wither’d heart was dead,
And that I might not sing of love --
Sir Walter Scott
The Lay of the Last Minstre
VORBEMERKUNG
Sämtliche Orte in dieser Geschichte tragen jene Namen, die wahrscheinlich um die Zeit der Romanhandlung herum gebräuchlich waren. Ich habe mich dabei von zeitgenössischen Urkunden, Hinweisen in alten Dokumenten, mittelalterlichen Münzprägungen sowie diversen Ortsnamens-Lexika leiten und meine Erkenntnisse, soweit es möglich war, von Historikern und Archivaren bestätigen lassen. Falls mehrere Namen gültig waren, habe ich den verwendet, der mir am besten gefiel.
Nachfolgend die Übersetzungen:
Elwangen
Ellwangen
Freisingen
Freising
Fuchtwang
Feuchtwangen
Herneberch
Henneberg
Lantshut
Landshut
Nuorenberc
Nürnberg
Papinberc
Bamberg
Rehperc
Hohenrechberg
Stoufen
Hohenstaufen
Virteburh
Würzburg
Wizinsten
Weißenstein
DRAMATIS PERSONAE
ERFUNDEN
VALERIA
Ihre Herkunft liegt im Dunkeln, aber ihr Ziel liegt klar vor ihr.
LAURIN
Der Gehilfe Walthers von der Vogelweide hätte gern die Klasse seines Meisters.
CYRA
Die Oberste der Hüterinnen hat sich ein einziges Mal in ihrem Leben verrechnet.
VATER MUNIBERT
Der Mann des Friedens lebt für eine Mission des Hasses.
HISTORISCH
WALTHER VON DER VOGELWEIDE
Der berühmte Minnesänger hat seinen Lebenstraum verloren.
OTTO VON HERNEBERCH, GRAF VON BOTENLOUBE
Walthers Kollege hat seinen Lebenstraum eingetauscht.
HEINRICH VON KALDEN
Der kaiserliche Marschall hat seinen Lebenstraum verdrängt.
GEROLD VON WALDECK
Der Bischof von Freisingen hat seinen Lebenstraum verkauft.
FRIEDRICH II. ROMANORUM IMPERATOR
Der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs braucht ein Symbol seiner Macht.
PHILIPP VON SCHWABEN
Der Sohn von Kaiser Barbarossa und König der Deutschen hat einmal zu viel Vertrauen gezeigt.
EIRENE VON BYZANZ
Die Tochter des byzantinischen Kaisers und Königin der Deutschen hat sich der großen Liebe ihres Lebens versagt.
ANNA VON REHPERC
Die Vertraute der Königin will einen Schmerz auslöschen, der seit zwanzig Jahren in ihrem Herzen sitzt.
HERMANN VON SALZA
Der Großmeisters des Deutschritterordens verachtet Walther von der Vogelweide.
LUDWIG VON WITTELSBACH I. DUX BAVARIAE
Der baierische Herzog richtet ein geheimes Treffen aus.
PROLOG
POST MISERABILE IERUSOLIMITANE1204 A. D.
1.
Konstantinopel brannte.
Neunhundert Jahre lang war die Stadt die Heimat der Christenheit gewesen. Neunhundert Jahre lang hatte sie Heiligkeit und Kunst gleichermaßen in ihren Mauern beherbergt. Neunhundert Jahre lang hatte sie den Glauben bewahrt, dem der Kaiser, dessen Namen sie trug, zum Sieg verholfen hatte.
Nun waren die Kreuzritter in ihren Gassen und schändeten sie. Sie nahmen der Stadt ihre Würde und entrissen ihr ihre Schätze. Ihre Symbole, auf denen die christliche Welt aufgebaut war, wurden gestohlen, verhökert, eingeschmolzen, zerschlagen. In den Pflasterrinnen schimmerte zerbrochenes Glas zusammen mit frischem Blut im Widerschein der Flammen. Wo man zuvor heilige Choräle gehört hatte, brachen sich nun die Schreie der gefolterten Nonnen an den Mauern.
Konstantinopel brannte.
2.
Vier schwer bewaffnete Männer huschten durch den Bukoleon-Palast.
»Bist du sicher, dass er hier ist?«, fragte der erste.
»Der Spion war sich sicher«, erwiderte der zweite.
»Hauptsache, irgendwer ist sich sicher«, knurrte der dritte.
»Jedenfalls ist es nicht sicher, hier länger zu bleiben als unbedingt nötig!« Die Stimme des vierten Mannes klang ein wenig dumpf, als käme sie unter einem Eimer hervor.
Vor wenigen Minuten hatten sich hier im Palast zwei Kaiserinnen den französischen Soldaten ergeben und um ihr Leben und das ihres Hofstaates gefleht. Jetzt waren die Plünderer am Werk, rissen seidene Wandvorhänge herunter, schlugen silberne und goldene Leuchter in Stücke, zerrissen Bücher und schnitten die Edelsteine aus ihren Buchdeckeln. Statuen aus Alabaster zersprangen auf dem Boden, kunstvoll bemalte Wandschirme lagen in Fetzen, Mobiliar mit Intarsien aus Elfenbein und Ebenholz wurde zerschmettert. Draußen erklang das Geheul des entfesselten Mobs – der französischen und venezianischen Soldaten, die die Stadt vergewaltigten.
Dies war ein Kreuzzug, ein heiliger Krieg gegen die Dekadenz des byzantinischen Imperiums, das sich eingebildet hatte, die Nachfolge Roms anzutreten. In einem Kreuzzug standen die Guten und Bösen von vornherein fest. Die Bösen waren die anderen. Man musste sich das vor Augen halten, wenn man Zeuge wurde, wie die Guten all das schändeten, was schön und edel war, draußen in den Gassen Frauen, Kinder und Greise erschlugen und die Nonnen in den Klöstern quälten.
Die Gesichter der vier Männer waren grimmig. Sie wichen den Plünderern aus und bahnten sich ihren Weg durch Seitengänge des Palastes. Die Fensteröffnungen ließen den Feuerschein der brennenden Stadt herein. Im roten Licht zuckten die Schatten. Hier und da lagen ganz stille Schatten; wenn man an ihnen vorbeilief, klebten die Stiefelsohlen in erstarrenden Pfützen fest. Trümmerstücke lagen herum, enthauptete Heiligenfiguren, zerbrochene Schmuckwaffen. An den Wänden klebten stinkende braune Schmierstreifen.
Der erste der vier Männer trug ein Schwert an der Seite, einen Dolch und eine Axt im Gürtel. Er war barhäuptig. In einer Hand hielt er statt eines Schildes seinen Helm. Die Kapuze des Panzerhemdes bauschte sich um seinen Hals. Er bog um eine Ecke, prallte zurück, hielt die anderen drei Männer auf und presste sich einen Finger auf die Lippen.
»Was ist?«, hauchte der zweite. Er war drahtig wie ein Windhund und ebenfalls mit einem Schwert bewaffnet. Auf seinem Waffenrock prangte ein golden eingesticktes Kreuz, um seinen Hals hing ein ebenfalls goldenes Kruzifix, und sein Haar war kurz geschnitten wie das eines Geistlichen. In den Knauf seines Schwerts war ein Edelstein eingearbeitet.
»Venezianer«, erklärte der erste Mann. Sein Name war Heinrich von Kalden. Eine Menge Menschen in seiner Heimat wären verblüfft gewesen, hätten sie gewusst, dass er hier war. Heinrich von Kalden war der Hofmarschall des deutschen Königs.
Der zweite Mann hieß Gerold von Waldeck und war Domherr in Freisingen. Er war der Einzige, der so etwas wie ein Wappen auf seiner Tunika trug: das goldene Kreuz. Auf den Kitteln der anderen drei Männer konnte man die fehlfarbenen Stellen sehen, wo sie ihre aufgenähten Wappenzeichen entfernt hatten. Niemand sollte wissen, wer sie waren.
»Der Teufel soll die Venezianer holen«, flüsterte Domherr Gerold.
Nicht nur Soldaten streiften auf Beutesuche durch Konstantinopel. Die Lagunenrepublik hatte ihre ganz eigenen Agenten auf den Kreuzzug mitgeschickt. Sie waren unbewaffnet, weil sie ein halbes Dutzend Elitesoldaten um sich hatten, die sie schützten, und weil sie die Hände frei haben mussten für die Listen, die sie mit sich schleppten.
Diese Venezianer waren Aasgeier. Sie waren von der Serenissima abkommandiert worden, um inmitten der ziellosen Plünderung jene Dinge an sich zu bringen, die auf den Listen verzeichnet waren. Die Listen stammten von Spionen in Konstantinopel und waren bereits vor Monaten nach Venedig gemeldet worden, als Konstantinopel noch geglaubt hatte, mit dem Rest der Christenheit gut Freund zu sein. Die Venezianer hatten die Erlaubnis, jedes beliebige Beutestück zu konfiszieren, wenn es sich auf einer Liste fand. Es war Teil der Abmachung mit den Anführern des Kreuzzugs, einer Vereinbarung, die dazu geführt hatte, dass die Kreuzritter bequem auf venezianischen Schiffen hierher gekommen und dass ihre Reihen durch die gut ausgebildeten venezianischen Soldaten verstärkt worden waren.
Für den Fall, dass ein siegestrunkener Plünderer ein Beutestück nicht hergeben wollte, waren die Elitesoldaten zur Stelle. Wer sich hartnäckig weigerte, musste die Erfahrung machen, dass man bei der Plünderung einer Stadt auch dann zu Tode kommen konnte, wenn der Widerstand des Gegners längst erloschen war und man eigentlich geglaubt hatte, es mit Verbündeten zu tun zu haben.
Auf den Listen standen die Dinge, die wirklich wertvoll waren – antike Schätze, Kunstgegenstände, Reliquien, Besitzdokumente, Handelsverträge. Der größte Schatz von allen stand nicht darauf, weil der venezianische Spion, der ihn entdeckt hatte, seine Information an jemanden weitergegeben hatte, der noch besser zahlte als die Serenissima.
Die vier Männer hatten den Auftrag, sich diesen Schatz zu holen. Ihrem Auftraggeber ging es dabei nicht um Vermögen. Der Schatz besaß die Macht, ein zerfallendes Reich zu retten.
Heinrich von Kalden, der Anführer der vier, raunte: »Wir müssen uns beeilen, sonst findet am Ende noch jemand anderer das verdammte Teil. Ich bin nicht sicher, ob wir wirklich die Einzigen sind, die darüber Bescheid wissen.«
Seine Begleiter nickten. Der dritte Mann trug langes dunkelblondes Haar. Er hatte sich wie der Hofmarschall die Panzerkapuze abgestreift. Die Hitze der brennenden Stadt ließ einem den Schweiß in Strömen in die Augen rinnen; unter einem Helm wäre man halb erstickt. Das hinderte den vierten Mann nicht daran, trotzdem voll gerüstet zu sein, mit übergestreifter Panzerkapuze, Panzerfäustlingen an den Händen, einem blanken Schild in der einen Hand und einem Streitkolben in der anderen. Er hatte sich einen Topfhelm übergestülpt, hinter dessen Sehschlitzen seine Augen funkelten.
»Was sagt er?«, klang seine Stimme dumpf unter dem Helm hervor.
Der dritte Mann neigte sich ihm zu und zischte: »Nimm endlich das Ding ab, Saladin, bevor du noch umfällst!«
»Ich fühle mich ausgezeichnet unter diesem Helm«, sagte der Mann namens Saladin würdevoll. Sein eigentlicher Name war Otto von Herneberch, Graf von Botenloube. Die meisten seiner Besitztümer lagen im Heiligen Land, was ihm den Spottnamen eingetragen hatte. Nur vier Menschen war es erlaubt, ihn damit aufzuziehen: Heinrich von Kalden, Gerold von Waldeck, dem amtierenden deutschen König Philipp von Schwaben und Walther von der Vogelweide, dem bekannten Sänger. Auch Otto von Herneberch hatte sich als Sänger einen Namen gemacht. Ungewöhnlicherweise hatte dies der Freundschaft zwischen ihm und Walther keinen Abbruch getan; sie war über den üblichen Kollegenneid erhaben.
Walther von der Vogelweide war der dritte Mann der kleinen Gruppe.
Sie schlichen auf Zehenspitzen an dem Raum vorbei, in dem einer der venezianischen Aasgeier mit seiner Eskorte stand und seine Liste studierte. Schließlich erreichten sie eine Kapelle in einem Seitenflügel des Palastes. Die Plünderer waren auch hier gewesen. Sie hatten selbst vor den drei Sarkophagen nicht haltgemacht, die an einer Seite standen. Mumifizierte Leichenteile lagen verstreut herum, zwei Heiligenfiguren fehlten die Hände, in denen sie wahrscheinlich vergoldete Symbole ihres Patronats gehalten hatten. Nur eine Ikone der Muttergottes war verschont worden. Sie war kunstlos gemalt, statt Blattgold hatte der Künstler ein dumpfes Gelb verwendet, das wuchtige Holzbrett, welches das Bild trug, war wurmstichig und verzogen. Der Maler hatte der heiligen Maria eine Träne auf die Wange gemalt; es war das einzige Detail, welches erahnen ließ, dass der Erschaffer dieses Kunstwerks etwas von seinem Handwerk verstanden hatte.
Der Domherr bekreuzigte sich.
Heinrich von Kalden streckte sich und nahm das Gemälde von der Wand. Hinter dem Bild fand sich eine Mauernische, und in der Nische stand ein Schmuckkästchen. Heinrich brachte es an sich.
»Donnerwetter!«, sagte Walther.
»Jesus sei Dank!«, sagte Domherr Gerold.
»Habt ihr was gefunden?«, fragte der Graf von Botenloube, der in die falsche Richtung schaute. Walther drehte seinen behelmten Kopf ungeduldig herum. »Oha!«
Heinrich wirkte unsicher. »Soll ich’s aufmachen?«
»Willst du es erst zu Hause öffnen und dann feststellen, dass ein vergammelter Fingernagel von einem x-beliebigen Leichnam drinliegt, den irgendein Betrüger als eine Reliquie des heiligen Nikolaus verkauft hat?«, fragte Gerold.
»Als Domherr solltest du nicht so despektierlich sprechen, Hochwürden.«
»Ich hab schon jede Menge Reliquien eingekauft, ich weiß, wovon ich rede.«
»Was hat er gesagt?«, fragte Otto von Herneberch. »Es ist nur ein Fingernagel drin?«
»Ich schwöre, ich nagle ihm den Helm auf den Schädel, wenn das so weitergeht!«, rief Walther.
Heinrich von Kalden öffnete das Kästchen. Es war nicht verschlossen gewesen. Sie beugten sich alle darüber. Otto von Herneberch stieß mit Walther von der Vogelweide zusammen und zerrte sich endlich auch den Helm vom Kopf. Er rutschte ihm aus den mit Schild und Streitkolben bewehrten Händen und schepperte auf den Boden. Otto beachtete ihn nicht. Er zog den Atem ein.
Heinrich sagte: »Nimm du ihn raus, Hochwürden.«
Der Domherr entgegnete: »Die Ehre gebührt dir, mein Freund. An dich ist der Auftrag ursprünglich gegangen.«
Otto von Herneberch sagte: »Jetzt nehmt ihn schon, damit wir hier endlich abhauen können.«
Eine Stimme bellte vom Eingang der Kapelle her in akzentreichem Französisch: »Keine bewegte sisch, verstande!?«
Drei venezianische Elitesoldaten standen im Eingangsportal. Einen halben Herzschlag später kamen drei weitere hinzu. Heinrich klappte das Kästchen mit einem Knall zu.
Otto von Herneberch fragte: »Was sagt er?«
Walther von der Vogelweide starrte ihn aufgebracht an. Otto zuckte mit den Schultern. »Ich kann kein Griechisch.«
Der Truppführer der Soldaten, ein Sergeant, streckte eine Hand aus. Die andere umfasste drohend den Griff seines Kurzschwerts. »Gebbe mir die Kästeschen!«
»Er will, dass wir ihm das Kästchen aushändigen«, sagte Walther.
»Jaja«, brummte Otto. »Diesmal hab ich’s auch verstanden.«
»Darauf kann er lange warten«, sagte Heinrich und spuckte aus.
Der Domherr wandte sich an den Soldaten und sagte auf Latein: »Darauf kannst du lange warten, mein Sohn.«
Der venezianische Sendbote, der die sechs Soldaten kommandierte, spazierte mit seiner über einen Stock gerollten Liste herein. Er überflog die Situation, dann sagte er auf Venezianisch und ohne seine Aufstellung zu konsultieren: »Macht die Idioten fertig.«
Der Sergeant schnaubte verächtlich und zerrte sein Schwert aus der Scheide. Seine Kameraden zückten ebenfalls ihre Waffen. Walther und Otto von Herneberch zogen sich hinter einen der Sarkophage zurück. Heinrich warf ihnen das Kästchen zu. Die Venezianer gaben dem im Weg liegenden Helm Ottos einen Tritt und näherten sich mit der grinsenden Bedrohlichkeit von Totschlägern, die ihren Gegnern zahlenmäßig überlegen und außerdem überzeugt sind, dass sie recht haben. Ottos Helm rollte scheppernd unter den Sarkophag.
»Was sagst du dazu, Hochwürden?«, fragte Heinrich.
»Der Herr sei mit uns«, erwiderte Gerold.
Sie zogen ihre Schwerter und warfen sich den Soldaten entgegen.
3.
Ascanio da Ponte, der venezianische Sendbote, hatte seinen Teil an Kämpfen gesehen. Auf den Turnierplätzen, wo die Ritter ihre hart trainierten Finten und Künste zeigten, wenn sie beim Fußkampf mit stumpfen Schwertern aufeinander losgingen, und im echten Gefecht, wenn aus den Finten und Künsten ein hektisches Ringen und Schlagen wurde, das jeden strohdreschenden Bauern beschämt hätte. Er war sogar Zeuge der schlimmsten Kämpfe geworden, die es gab: der erbarmungslosen Wortgefechte an der Notarsschule in Bologna, die er absolviert hatte. Man fand auf der ganzen Welt keine Klinge, die so scharf geschliffen war wie die Zunge eines missgünstigen Lehrers. Was er in der Kapelle im Bukoleon-Palast erlebte, war jedoch etwas ganz Neues.
Er hatte seine Soldaten hinterhergeschickt, als er die vier Männer aus dem Augenwinkel an der Kammer hatte vorbeischleichen sehen, in der er Beutegut überprüft hatte. Er hatte messerscharf geschlossen, dass jemand, der in einem Palast, in dem brüllende Übeltäter die Teppiche von den Wänden rissen, auf Zehenspitzen ging, etwas ganz Besonderes im Schilde führte. Und er hatte sich nicht getäuscht! Die Kapelle, in die die vier ihn unfreiwillig führten, hatte er bereits überprüft gehabt, aber dass hinter dem erbärmlichen Madonnenbild etwas versteckt sein könnte, darauf war er nicht gekommen. Ascanio hatte keine Ahnung, ob das Kästchen und sein Inhalt sich auf seiner Liste wiederfanden, aber das würde er herausfinden, wenn die vier Diebe erst einmal in Stücke gehackt waren.
Hatte er gedacht.
Und jetzt musste er mit ansehen, wie der Schwerbewaffnete und der Kerl, der aussah wie ein Pfarrer in Rüstung, sich durch seine Soldaten bewegten wie zwei Wirbelstürme durch ein Kornfeld. Kurzschwerter flogen links und rechts davon. Ascanio sah den Geistlichen einen gezielten Tritt zwischen die Beine eines Soldaten vollführen, und als dieser schielend auf die Knie sank, zeichnete der Pfarrer ihm fürsorglich ein Kreuz auf die Stirn. Der Schwerbewaffnete warf sein Schwert hoch in die Luft, und als sein Gegner ihm unwillkürlich hinterhersah, gab er diesem einen Faustschlag, der ihn fällte wie einen Baum. Dann fing er das Schwert rechtzeitig wieder auf, um den Hieb eines anderen Venezianers abzuwehren, sich halb um die eigene Achse zu drehen und dann auszutreten wie ein Maultier. Der Geistliche duckte sich unter dem Hieb einer Axt hindurch, kam wieder hoch, gab seinem Gegner eine Ohrfeige, duckte sich erneut, als das Beil in der Gegenrichtung zurücksauste, verteilte eine zweite Ohrfeige und nickte befriedigt, als die Breitseite der Axt, vom Schwung weitergetragen, mit dem Schädel des Soldaten dahinter kollidierte und diesen zu Boden sandte.
Ascanio riss seine Blicke von den beiden Berserkern los. Ihre Freunde machten nicht die geringsten Anstalten, ihnen zu helfen! Nachdem sie das Kästchen in aller Seelenruhe in mehrere Lagen Stoff gewickelt und in eine Ledertasche gesteckt hatten, betrachteten sie interessiert das Wüten ihrer zwei Kameraden. Als der letzte von Ascanios Soldaten floh, bückte sich der eine, ein Blondschopf mit langem Haar, kam mit einem Helm in einer Hand wieder in die Höhe und schleuderte ihn dem Fliehenden hinterher. Der schwere Helm traf den Soldaten am Hinterkopf und warf ihn gegen die Wand vor der Kapelle, wo er seufzend herunterrutschte und liegen blieb.
Stille trat ein. Ascanio war in eine Ecke zurückgewichen. Er umklammerte seine Liste und stierte die vier Männer an. Seine Soldaten lagen alle besinnungslos auf dem Boden, bis auf den einen, den der Tritt des Geistlichen ins Allerheiligste getroffen hatte; er wiegte sich auf den Knien vor und zurück und atmete schwer. Ascanio hörte ein Winseln. Ihm wurde klar, dass es von ihm kam.
Der Geistliche und der Schwerbewaffnete richteten ihre Aufmerksamkeit auf Ascanio. Ascanio sank auf die Knie. Seine Liste fiel zu Boden, als er die Hände faltete.
»Madonna santa«, stotterte er. »Madonna santa …«
Der Geistliche und der Schwerbewaffnete steckten die Schwerter ein, packten Ascanio unter den Achseln und zogen ihn hoch. Der Venezianer wusste, dass er jetzt sterben würde. Er hatte sich vorgenommen, einmal würdevoll und mit hoch erhobenem Kopf abzutreten. Er stellte fest, dass es leichter war, zu blubbern und um Gnade zu flehen.
Die beiden Männer schleppten ihn zu dem Sarkophag. Der Blonde und der andere stemmten sich gegen den verrutschten Deckel, bis ein Spalt entstand, durch den Ascanio hindurchpasste. Er wurde hineingeworfen. Der Deckel des Sarkophags rutschte zurück. Sie wollten ihn lebendig begraben! Er begann zu brüllen.
Der Deckel öffnete sich. Der Pfarrer sah zu ihm herein und gab ihm eine Ohrfeige.
»Du zählst jetzt bis tausend, mein Sohn, danach kannst du schreien, so viel du willst«, sagte er in fehlerfreiem Venezianisch. »Tust du es vorher, hängen wir deine jämmerliche sterbliche Hülle über dem nächstbesten Feuer an den Eiern auf!«
Ascanio gurgelte etwas.
Der Deckel schloss sich ein zweites Mal bis auf eine Handbreit, die offen blieb. Licht und Luft kamen herein. Ascanio hörte, wie sich Schritte entfernten. Er holte Luft, um zu schreien.
Das Gesicht des Pfarrers erschien im Spalt. »Tausend hab ich gesagt, mein Sohn. Das sollte man sich doch merken können.«
Das Gesicht verschwand. Ascanio lag schlotternd in seinem Sarkophag und lauschte.
4.
Der Soldat mit den geprellten Hoden war der Erste, der aufstehen konnte. Er sah sich um und folgte schließlich einer zittrigen Stimme zu einem Sarkophag. Er schob den Deckel zurück. Der Notar lag mit krampfhaft geschlossenen Augen darin, schützte seinen Schritt mit beiden Händen und begann zu kreischen: »Zweihundertzehn, Monsignore, ich bin erst bei zweihundertzehn, o Gnade, bittebitte … Gnade …!«
1. BUCH
DIE LIEBE EINES SÄNGERS1208 A. D.
1.
Anna von Rehperc starrte auf die Landschaft, die unterhalb ihrer Heimatburg in sanften Wellen auf einen im Sommerdunst schwimmenden Horizont zulief, nur unterbrochen von einzelnen Zeugenbergen, die sich wie Fremdkörper davon abhoben. Die steil auf der weit und breit höchsten Erhebung aufragende Burg Stoufen in der Nachbarschaft war ein kantiger Umriss im Nachmittagslicht, unwirklich wie die Erinnerung an einen verlorenen Schatz.
Oder an die verlorene Unschuld.
Anna krümmte unwillkürlich die Schultern nach vorne. Wenn sie so wie jetzt leicht vornübergebeugt stand, konnte sie jeden glauben machen, dass ihre Schwangerschaft höchstens im sechsten Monat war. Sie war eine schlanke Frau, an der zwei Geburten kaum Spuren hinterlassen hatten, und wie die beiden Male zuvor war sie auch dieses Mal nicht so rund geworden wie andere werdende Mütter, die sie kannte. Zudem waren für eine Frau von ihrer Statur ihre Brüste groß, und wenn sie das eigentlich enge Oberteil ihres Gewands auf eine ganz bestimmte Art schnürte, schienen ihre Proportionen zu stimmen und ihr Bauch flacher, als er in Wirklichkeit war. Dabei stand die Geburt unmittelbar bevor.
Ihr Herz verkrampfte sich vor Furcht wie jedes Mal, wenn sie daran dachte. Sie hatte Angst vor den Schmerzen, Angst vor den Umständen, unter denen die Geburt diesmal würde stattfinden müssen, aber am meisten Angst hatte sie davor, was nach der Geburt geschehen würde.
Vielleicht wieder eine Totgeburt? So wie die beiden anderen Male, als sie von ihrem Ehemann schwanger gewesen war …
Aber eigentlich war sie sicher, dass es diesmal keine Totgeburt würde. Nein, dieses Kind war von einem anderen. Dieses Kind würde leben.
Aber nicht lange, dachte sie. Wenn alles gut ging, würden Hildebrand von Rehperc, Hofmarschall von König Philipp, und seine Frau Anna eine dritte lebenslange Stiftung für eine Totenkerze in der Oberhofenkirche von Göppingen ausloben.
Wenn alles gut ging!?
Sie hatte ihre Unschuld wirklich in jeder Hinsicht verloren. Es war in drei Schritten geschehen. Zuerst hatte sie ihr Herz verschenkt; dann hatte sie ihre eheliche Treue drangegeben; und nun – bald – würde sie auch ihre Seele verspielen.
Und das alles eines Mannes wegen, der sie vermutlich schon vergessen hatte.
Sie spürte, wie das Kind in ihrem Leib um sich trat. Rücksichtslos wie dein Vater, dachte sie voller Zorn.
Aber wie hätte sie ihn halten sollen, selbst wenn sie gekonnt hätte? Ihn, der immer irgendeinem Traum nachjagte – dem Traum von der perfekten Musik, dem Traum von der perfekten Poesie …
Dem Traum von der perfekten Gefährtin.
Sie war nicht die perfekte Gefährtin gewesen, so viel stand fest. Und dabei hatte sie jegliche Zurückhaltung fallen lassen, als er und sie … oh, die Dinge, die sie getan hatten! Die Lust, die sie sich geschenkt hatten! War nicht wenigstens sie perfekt gewesen? Diese gemeinsame, fiebrige, vor nichts haltmachende, keine Furcht und keine Scham kennende Lust?
Wie so viele andere Frauen hatte sie ihn begehrt, lange bevor sie mit ihm geschlafen hatte. Nachher hatte sie ihn geliebt, hatte den Traum geliebt, in dem er sie mühelos tagelang hatte schweben lassen, den Traum davon, dass körperliche und seelische Erfüllung eins sein konnten, wenn ein Mann und eine Frau sich einander rückhaltlos hingaben.
Und nun war der Traum zu Ende, und sie hasste sich dafür, dass sie an den Traum geglaubt hatte, und hasste ihn dafür, dass er sie so weit gebracht hatte, an den Traum zu glauben. Hasste, hasste, HASSTE ihn.
Ein leiser, krampfartiger Schmerz lief durch ihren Körper. Schlagartig verschwand der Hass und machte der Furcht Platz. Bald … bald … und es gab nichts, was die Tragödie aufhalten würde.
2.
Es gab Träume, die trugen einem neue Lieder zu. Es gab Träume, die trugen einen in die Vergangenheit zurück. Und es gab Träume, die ließen einen schwitzend aufwachen und sich in der Schlafkammer umsehen und sich fragen, wo man eigentlich war.
Walther von der Vogelweide seufzte. In seinem Fall kam meistens noch die Frage hinzu, wer die Frau war, die neben ihm lag.
Er bemühte sich vergeblich, den Traum abzuschütteln, der ihn heute Morgen auf seinem Lager hatte erwachen lassen. Das Schlimmste war, dass er sich an dessen Einzelheiten nicht mehr erinnern konnte. Geblieben waren lediglich ein bedrückendes Gefühl und die Ahnung, dass der Traum mit den Geschehnissen in Konstantinopel vor vier Jahren zu tun hatte. Das Gefühl beherrschte ihn immer noch, auch jetzt, als er geistesabwesend in den Festsaal schlurfte und nicht auf die respektvollen Grüße reagierte, die man ihm entgegenbrachte.
Tränen waren nie ein gutes Omen. Eine Träne der Muttergottes schon gar nicht. Manchmal dachte er sich, es wäre besser gewesen, sie wären zu spät gekommen damals – oder die venezianischen Soldaten hätten ihnen die Beute abgenommen. Er wusste, dass die anderen drei ähnlich dachten, doch nur er hatte sein Unbehagen jemals ausgesprochen. König Philipp hatte nicht gut darauf reagiert.
Heute Morgen war er allein erwacht statt neben irgendeiner Frau, deren Name ihm nur deshalb wieder einfiel, weil sich auf ihn zwei Zeilen hatten reimen lassen. Nicht, dass es an Gelegenheiten gemangelt hätte. Die Festgesellschaft hier in Papinberc feierte seit Tagen, er hatte für seine Lieder donnernden Applaus erhalten, er war ein berühmter Mann, und wenn er alle die jungen und nicht mehr ganz so jungen Damen, die ihm schöne Augen gemacht hatten, erhört hätte, wäre er immer noch mit dem Liebesspiel beschäftigt, und eine imposante Auswahl weiblicher Schönheit würde weiterhin vor seiner Tür warten. Aber er hatte keine von ihnen erhört.
Nein, dachte er. Weil es nur eine gibt, die ich erhören möchte, und ich wäre das größte Schwein auf der Welt, wenn ich das täte.
»Herr Walther«, sagte jemand, und er blickte auf und in ein Gesicht, das von Wein und Soße glänzte. Es kam ihm vage bekannt vor. Auf der Brust der Tunika waren die Farben des Mannes eingestickt: ein silberner Adler mit einer roten Krone auf dem Kopf. Ach ja, der Bräutigam: der Herzog von Meranien. Was hier, in Papinberc, mit solchem Aufwand gefeiert wurde, war die Hochzeit von König Philipps Nichte Beatrix. Walther spürte wie einen kalten Schauer die verschüttete Erinnerung an seinen Traum. Er riss sich zusammen und neigte den Kopf.
»Durchlaucht …«
»Ihr habt mir gestern nicht mehr gesagt, wie Euch mein Lied gefallen hat!«
»Oh … verzeiht …«, sagte Walther und erinnerte sich vage daran, dass ihm beim improvisierten Vortrag mindestens eines der adligen Amateursänger schlecht geworden war.
»Und – wie hat es Euch gefallen?«
Walther setzte seine ehrlichste Miene auf. »Es hat mich bis in den Schlaf begleitet, Durchlaucht.«
»Und die Reime?«
Wer sein Leben als fahrender Sänger verdiente, vollführte einen täglichen Eiertanz, auch und vor allem, wenn man so bekannt war wie Walther von der Vogelweide. Huldigte man einem Brotgeber, kam man meistens nicht umhin, die Gegner des Brotgebers zu beleidigen. Huldigte man dann ihnen – zum Beispiel, wenn der vorherige Brotgeber von seinen Gegnern beseitigt worden war –, galt man als Fähnchen im Wind. Und für die außerordentliche Anstrengung, einen Fürsten, den man sich zum Feind gemacht hatte, mit Lyrik und Musik wieder auf seine Seite zu bringen, erhielt man nicht Lob, sondern Spott. Huldigte man keinem … war es nicht weiter von Belang, denn ein Sänger, der sich keinen Herrn suchte, hängte die Leier entweder schnellstens an den Nagel oder verrottete auf irgendeinem Schindanger, nachdem er den Hungertod gestorben war.
»Haben sich vortrefflich gereimt, Durchlaucht«, sagte Walther, der selbst, wenn er so geistesabwesend war wie heute, schwer dem Drang widerstehen konnte, seine Lobhudelei mit Sarkasmus zu garnieren – allerdings nur, wenn er sicher war, dass der Empfänger entweder Spaß verstand oder den Spott nicht kapierte.
Der Herzog von Meranien gehörte zur zweiten Kategorie. »Nicht wahr?«, strahlte er.
Walther ließ dem glücklichen Mann einige weitere sorgsam in Gift getauchte Lobpreisungen zuteil werden, bis er ihn los war. Dann setzte er sich abseits an die lange Tafel im Saal der kaiserlichen Pfalz, in dem König Philipp die Hochzeit seiner Nichte feiern ließ, und gab seinen Gedanken freien Lauf. Sie kreisten um seinen Traum und um … sie.
König Philipp war erst gestern Nacht in Papinberc eingetroffen. Ein Herrscher mit Gefolge reiste langsam, denn er wurde häufig aufgehalten – zumal, wenn er entlang des Weges seine Anhänger besuchen und darauf einschwören musste, ihm weiterhin die Treue zu halten. Philipp war der Sohn des verstorbenen Kaisers Barbarossa und der jüngere Bruder des ebenfalls verstorbenen Kaisers Heinrich – und auch er erhob Ansprüche auf die Kaiserkrone, die allerdings weiter gingen, als die Fürsten es sich träumen ließen. Der König und sein Gefolge hatten sich nur kurz zu den Feierlichkeiten gesellt, bevor die Gesellschaft zu Bett gegangen war. Walther war zu dieser Zeit schon in seiner Schlafkammer gewesen. Er war geflohen, sobald er von Philipps Ankunft gehört hatte.
Ihre Freundschaft hatte vor vier Jahren einen Dämpfer erfahren. Walther hatte sich von Philipp abgewandt und im Landgrafen von Thüringen, der dafür bekannt war, die Seiten im Thronstreit zwischen den Häusern der Staufer und der Welfen öfter zu wechseln als sein Leibhemd, einen neuen Gönner gefunden. Wer davon Notiz genommen hatte, schrieb es einigen Polemiken zu, die Walther gegen die Plünderung Konstantinopels verfasst hatte. Philipp hatte den Kreuzzug gegen die Heiden, der mit der Zerstörung des christlichen Ostrom geendet hatte, mitfinanziert, und alle hatten angenommen, dass er Walther deswegen gram war. Doch Philipp war von den Ereignissen in Konstantinopel genauso schockiert gewesen wie Walther, und es war auch nicht er gewesen, der den Sänger weggeschickt hatte, vielmehr war Walther bei Nacht und Nebel davongeschlichen. Heinrich von Kalden, Gerold von Waldeck und Otto von Herneberch hatten gedacht, Walther wäre wegen der Vorbehalte gegangen, die er gegen ihre gemeinsame Mission in Konstantinopel geäußert hatte – und gegen den Schatz, den sie mit nach Hause gebracht hatten. Auch sie hatten falsch gelegen.
Ich bin gegangen, um die Freundschaft, die Liebe und meine Ehre nicht zu verraten, dachte Walther. Aber das ging niemanden etwas an, nicht einmal die einzigen drei Freunde, die er besaß.
Jemand setzte sich neben ihn. Seufzend wandte er sich dem Neuankömmling zu. Wer auf einer solchen Feier Privatheit wollte, musste sie sich schaffen, indem er sich in einem Keller verkroch. Nicht einmal in seiner Kammer wäre Walther allein gewesen. Er teilte sie sich mit zwei Rittern aus dem Gefolge des Herzogs, von denen einer sich gestern so sehr den Magen verrenkt hatte, dass er immer noch im Bett lag. Heute Abend würden zwei weitere Männer dazukommen, aber auf deren Gegenwart konnte Walther sich wenigstens freuen: Heinrich und Graf Otto. Domherr Gerold, der vierte ihres Bundes, würde bei Bischof Ekbert von Papinberc nächtigen – wenn er sich die Mühe machte, zu Bett zu gehen.
Neben Walther hatte sich ein Jüngling niedergelassen: hübsch, mit kurz geschnittenem rotblondem Haar und strahlend blauen Augen. Der Jüngling lächelte breit und ratterte etwas in einer Sprache, die Walter nicht kannte.
»Ja«, sagte Walther und gab das Lächeln resigniert zurück, »wenn ich jetzt wüsste, was das heißen soll, dann könnte ich irgendetwas Sinnvolles darauf antworten.«
Der Jüngling lachte laut auf und sagte dann in holprigem Deutsch: »Das war Sizilianisch. Ich spreche mit jedem, den ich treffe, Sizilianisch zuerst, und hoffe, dass jemand mich versteht.«
»Weil Ihr den Klang Eurer Muttersprache vermisst?«
Der junge Mann legte den Kopf schief und musterte Walter. »Hm«, sagte er. »Bin überrascht. Ihr seid sehr … äh …«
»… scharfsinnig?«
»Eingebildet«, sagte der junge Mann.
Walther blinzelte überrascht. Hier nahm jemand kein Blatt vor den Mund! Er betrachtete den Burschen genauer, aber das Gesicht war ihm unbekannt. Die Tunika war aus feinem Stoff und wies keinerlei Waffenfarben auf.
»Wie seid Ihr daraufgekommen, dass Sizilianisch ist meine Muttersprache?«
»Weil Ihr auffällig normannisch ausseht – die helle Haut, das Haar, die Augen … und das Normannische, das in Frankreich gesprochen wird, ist mir bekannt. Bleibt als einziger Ort, an dem sich viele Normannen herumtreiben, Sizilien.«
»Ah«, machte der junge Mann. »Und ich dachte, dass ich hier in Deutschland wäre vollkommen unauffällig.«
»Das ist eine Einbildung«, sagte Walther freundlich.
Der junge Mann unterzog ihn erneut seiner ruhigen Musterung. Plötzlich schlug er ihm auf den Arm und lachte. »Das habe ich verdient, ja? Wer seid Ihr?«
»Ich bin Walther von der Vogelweide.«
Der junge Mann zuckte mit den Schultern. »Das hört sich so an, als ob ich müsste Euch kennen.«
»Als ob ich Euch kennen müsste.«
»Wie?«
»Ihr verdreht die Satzstellung.«
Walthers Gesprächspartner zeigte einen Anflug von Ungeduld. »Ist das wichtig?«
»Wenn Ihr hier vollkommen unauffällig sein wollt …«
»Irgendwie Ihr erinnert mich … nein, halt: Irgendwie erinnert Ihr mich an meinen Lehrer Berardo de Castagna. Richtig?«
»Was die Satzstellung betrifft: ja. Ansonsten – keine Ahnung. Ist es ein Kompliment, mit Eurem Lehrer verglichen zu werden?«
Der junge Mann dachte nach. »Ja«, sagte er dann schlicht.
Walther neigte den Kopf. »Dann nehme ich es gerne an. Ich bin Sänger. Und wenn Ihr aus Sizilien kommt, müsst Ihr mich nicht kennen.«
»Und wenn ich aus Deutschland käme?«
»Ich verkneife mir die Antwort, weil Ihr sonst wieder sagt, ich wäre eingebildet.«
»Ihr gefallt mir, Herr Sänger.«
Walther sagte aufrichtig: »Ihr mir auch, junger Herr aus Sizilien, der es trotz all der Worte, die seinem Mund entströmen, noch nicht geschafft hat, sich vorzustellen.«
»Wenn man es genau nehmen will, stamme ich aus Apulien.«
Walther zuckte mit den Schultern. Sein Gesprächspartner streckte eine Hand aus: »Ich bin Federico.«
Walther nahm die Hand. »Nur Federico?«
»Federico da Puglia, wenn Ihr wollt.«
»Was tut Ihr hier, Federico da Puglia?«
»Ich bin mit Philipp gekommen.«
»Mit Seiner königlichen Hoheit Philipp von Schwaben?«
»Genau, mit dem.«
»Hm. Kann ich etwas für Euch tun?«
»Nein, weshalb?«
»Wozu habt Ihr mich dann aufgesucht?«
»Ihr habt hier so allein gesessen, und die Leute haben immer wieder getuschelt und auf Euch gezeigt, da wollte ich wissen, wer Ihr seid.«
»Ah ja?«
»Und nun weiß ich, Ihr seid Walther von der Vogelweide, den man in Sizilien und Apulien nicht kennt, aber den man kennen muss, wenn man aus Deutschland kommt. Wisst Ihr, was es dort, wo ich herkomme, bedeutet, wenn ein Vogelkäfig ins Fenster gestellt wird?«
»Dass der Vogel mal frische Luft braucht?«
»Nein, dass sich hinter dem Fenster eine Frau befindet, die einen männlichen Besucher nicht unbedingt aus ihrer Kammer weisen würde.«
Walther fragte sich beunruhigt, ob das eine Anspielung war. »Ich bin nur deshalb darauf gekommen, weil es hauptsächlich die Frauen sind, die tuscheln und auf Euch zeigen«, erklärte Federico.
»Ich bin entzückt.«
Federico erhob sich lachend, und Walther erkannte erst jetzt, wie kräftig er gebaut war. Selbst in der locker fallenden Tunika wirkten seine Schultern breit. Auch Walther stand auf. Der junge Mann grinste zu ihm empor – er war mindestens einen Kopf kleiner als Walther, der beileibe kein Riese war. »Ich werde mich erinnern an Euch, Walther«, sagte er.
»Ich werde mich an Euch erinnern.«
»Das hoffe ich doch«, sagte Federico und gab Walther einen Rippenstoß. Danach schlenderte er davon, mit dem Gang eines Mannes, dem die Welt gehört und der jedes Stück davon genießt. Er konnte höchstens vierzehn oder fünfzehn Jahre alt sein; das Gesicht war noch glatt und vollkommen ohne Bartwuchs.
»Vogelkäfig und Vogelweide haben nichts miteinander zu tun!«, rief Walther ihm verspätet hinterher. Federico winkte nur belustigt, ohne sich umzudrehen.
Walther ließ sich wieder auf der Bank nieder und schüttelte den Kopf. Dann stellte er überrascht fest, dass die Unterhaltung seine Trübsal fortgeblasen hatte. Als König Philipp, seine Frau und der übliche Hofstaat in den Saal traten, blickte er auf, doch als er Heinrich von Kalden und Otto von Herneberch und gleich danach die drahtige Gestalt des Freisingener Domherrn hereinkommen und nach ihm Ausschau halten sah, erhob er sich grinsend und winkte ihnen zu.
3.
König Philipp war mittelgroß, blond und von schmaler Gestalt. Er war einunddreißig Jahre alt, sieben Jahre jünger als Walther, und wirkte in seiner schmucklosen Tunika wie ein Bursche, der gerade alt genug ist, um die Schwertleite zu empfangen. Ursprünglich war er für die kirchliche Laufbahn vorgesehen gewesen; der vorzeitige Tod seines großen Bruders Heinrich hatte es ihm ermöglicht, in die Welt zurückzukehren und sich die deutsche Krone aufzusetzen. Jetzt saß er auf einer Truhe und lächelte breit.
Walther, Heinrich von Kalden, Otto von Herneberch und Gerold von Waldeck wechselten Blicke. Die Hochzeitszeremonie war vorüber, das Bankett in vollem Gang, und da es Juni war und warm und man die Tische und Bänke auf den Platz hinausgestellt hatte, schallten Lärm und Musikfetzen und Gelächter durch das kleine Doppelfenster herein. Die vier Freunde hatten den König mit der unterdrückten Herzlichkeit begrüßt, die der Anwesenheit der anderen Leute im Saal geschuldet war. Philipp war der fünfte in diesem Freundeskreis, aber er war auch der König, und der Respekt musste gewahrt werden. Philipp hatte Geschenke verteilt – das Jagdrecht in einem königlichen Wald in der Nähe seiner Stammburg für Heinrich von Kalden; ein wunderschönes Schwert für Gerold von Waldecks Waffensammlung; ein perfekt gearbeiteter Helm für Otto von Herneberch; und für Walther eine kunstvoll gefertigte Quinterne aus honigfarbenem Holz, die bereits von einem von Philipps Hofmusikanten gestimmt worden war und einen warmen, schmeichelnden Klang hatte.
Schließlich war nur noch des Königs Leibdiener zugegen, der sich an den Reisetruhen zu schaffen machte. Er war völlig empfindungslos gegen den geradezu greifbar im Raum hängenden Wunsch der fünf Männer, endlich unter sich zu sein.
»Ihr seht angegriffen aus, Herr Walther«, sagte der König schließlich und rollte mit den Augen in Richtung seines Leibdieners, als ob es der unausgesprochenen Bitte, nur Belangsloses zu reden, noch bedurft hätte. »Dies ist eine Hochzeit. Meine Nichte sollte nur fröhliche Gesichter sehen.«
»Ich war wohl gestern zu fröhlich«, sagte Walther und tat so, als habe er zu viel getrunken.
Erneut trat Stille ein. Der Leibdiener sortierte des Königs Tuniken und summte selbstvergessen vor sich hin.
»Einen fleißigen Burschen habt Ihr da, Majestät«, sagte Gerold. »Er nimmt es sehr genau.«
Der Leibdiener verbeugte sich demütig, murmelte »Habt Dank für die Freundlichkeit, Hochwürden!«, und nahm es danach noch genauer. Heinrich von Kalden funkelte den Domherrn an. Dieser zuckte mit den Schultern.
Schließlich hielt es der König nicht mehr aus. Er beugte sich nach vorn. »Sie sind alle beeindruckt«, flüsterte er. »Jeder Einzelne, ob Freund oder Gegner. Ich habe ihn allen vorgestellt, und sie waren alle sprachlos. Der Weg hierher hat sich mehr als gelohnt.«
»Ihr habt ›ihn‹ allen vorgestellt?«, fragte Heinrich von Kalden.
»Ihr habt es also getan«, brummte Walther.
»Wie lange hätte ich Eurer Meinung nach noch warten sollen, Herr Walther?«
»Bis der Erlöser zurückkommt und die Tränen seiner Mutter abwischt.«
Der König lehnte sich zurück und schüttelte den Kopf. »Walther«, sagte er leise, »warum geht das jetzt wieder los?«
Der Leibdiener kam herüber und kniete vor dem König nieder. »Gibt es noch etwas für mich zu tun, Majestät?«
Philipp nickte. »Sag meinem anderen Besucher Bescheid, dass er vor der Tür warten soll. Und dann misch dich unter die Feiernden und lass es dir schmecken.«
Als sie unter sich waren, stand Philipp auf und machte ein paar rastlose Schritte durch den Raum. Plötzlich fuhr er herum und ballte die Fäuste. »Es ist der Stein, meine Freunde! All die Geschichten sind wahr! Der Waise! Er ist der Leitstern, dem die Fürsten der Welt folgen; den nur der Mann tragen darf, den Jesus Christus zu seinem Nachfolger auf Erden bestimmt hat.«
Walther schwieg. Er hoffte, dass einer der anderen etwas sagen würde. Bevor der König sie zu sich gebeten hatte, hatten sie Zeit gefunden, ein paar Worte zu wechseln. Sie alle spürten eine seltsame Gespanntheit, die sie sich nicht erklären konnten. Es hatte ihre Wiedersehensfreude deutlich gedämpft.
»Der Papst ist der Nachfolger Christi«, sagte Gerold von Waldeck schließlich.
»Der Papst ist nur …«
»… ja, ja«, seufzte Gerold. »Der Bischof von Rom.«
»Es ist der Kaiser, dem Jesus seine Herde anvertraut hat. So steht es schon in der Offenbarung!«
»Philipp«, sagte Gerold, »der Kaiser ist der Nachfolger der römischen Imperatoren, die die Christen gejagt haben!«
»Der Kaiser ist der Erbe von Konstantin dem Großen, zu dem Gott sagte: In meinem Zeichen wirst du siegen! Der Mann, der das Christentum gerettet hat. Der den Waisen als Erster als das erkannte, was er war. Glaubt ihr, seine Soldaten wären ihm nachgefolgt, nur weil er das Kreuz auf seine Fahne geheftet hatte? Die meisten seiner Männer wussten doch gar nicht, was es bedeutete! Nein, Freunde: Sie sind dem Waisen gefolgt, der in Konstantins Helm funkelte!«
»Das kannst du nicht wissen, Philipp«, widersprach Walther. Nun, da der Diener verschwunden war, ließen sie die Förmlichkeiten fallen, wie sie es immer taten, wenn sie unter sich waren; wie es der König wünschte.
»Was glaubst du, habe ich getan in den vier Jahren, seit ihr mir den Waisen gebracht habt? Ich habe nachforschen lassen. Ich habe jede Schriftrolle untersuchen lassen, die in Konstantinopel nicht verbrannt ist, ich habe meine Agenten nach Rom und nach Jerusalem gesandt. Dass das Wissen um den Stein in Vergessenheit geraten ist, liegt nur daran, dass die byzantinischen Kaiser ihn jahrhundertelang versteckt haben, statt ihn zu tragen. Und der Nachfolger der römischen Imperatoren, lieber Gerold, ist in Wahrheit der Papst. Die Kirche ist genauso organisiert wie das alte, heidnische Rom.«
Der Domherr verzog das Gesicht, aber er widersprach nicht. König Philipp hatte recht.
»Es wird schon einen Grund gehabt haben, warum die oströmischen Kaiser das Ding versteckt haben«, sagte Otto von Herneberch. »Wenn es wahr ist, dass der Stein für den wahren Nachfolger von Jesus Christus bestimmt ist, dann wird er dem, der das nicht ist und sich den Waisen anmaßt, wahrscheinlich schaden. Ich brauche dich nicht an das Alte Testament zu erinnern, um dir zu beweisen, dass Gott in solchen Fällen nicht zimperlich ist.«
»Gott der Herr ist gerecht«, sagte Gerold.
»Und nicht zimperlich«, beharrte Graf Otto.
»Willst du damit sagen, auf dem Stein liegt ein Fluch?«, fragte Heinrich.
»Unsinn!«, rief Philipp heftig. »Es gibt keinen Fluch. Ich trage den Stein seit Monaten direkt bei mir, und es ist mir nie besser gegangen. Noch vor ein paar Tagen haben Männer das Knie vor mir gebeugt, denen ich vorher Geschenke machen musste, nur damit sie ihre Lehenspflicht befolgten. Sie sind mir gefolgt und feiern jetzt mit mir, anstatt sich hinter ihren Rittern zu verbergen und Komplotte gegen mich auszuhecken.«
Die vier Freunde sahen sich an. »Du trägst ihn … bei dir?«, fragte Walther schließlich, seine Empfindungen schwankend zwischen Ehrfurcht und Horror.
Philipp lachte. »Nicht die ganze Zeit. Es liegt sich ziemlich hart darauf beim Schlafen.«
»Philipp, was immer all die Geschichten sagen: Der Stein ist aus dem Leid einer Mutter um ihren ermordeten Sohn geboren. Er ist ein Symbol für den Tod.«
»Er ist ein Symbol für die ewige Regentschaft im Zeichen Jesu!«
Heinrich kratzte sich nachdenklich am Kopf. »Hältst du es für richtig, den Fürsten den Waisen vorgeführt zu haben? Wir wissen noch immer nicht, ob er nicht seit seinem Verschwinden aus Konstantinopel gesucht wird. Dass wir nichts dergleichen gehört haben, heißt nicht, dass nicht doch im Verborgenen Männer unterwegs sind, um den Waisen zurückzubringen. Was immer er auch sonst sein mag, er war der Besitz des Mannes, der Konstantinopel seinen Namen gegeben hat. Auch wenn sie ihn nicht getragen haben, haben alle byzantinischen Kaiser doch stets gewusst, er war da – und einen Teil ihrer Macht aus diesem Wissen bezogen. Vielleicht sind vier Jahre vergeblicher Suche zu Ende gegangen, seit du den Stein herumgezeigt hast, und jetzt, in diesem Moment, sind schon Agenten unterwegs, um ihn sich zu holen?«
»Solange ihr bei mir seid, habe ich doch nichts zu befürchten, oder?«
Heinrich ballte aufgebracht die Fäuste. Walther sagte: »Philipp, jeder von uns würde sich bedenkenlos einer Lawine in den Weg stellen, wenn er dich damit retten könnte. Aber meinst du nicht, dass du das Schicksal herausforderst?«
»Was soll denn das, Freunde? Der Stein war neunhundert Jahre lang in Konstantinopel, und seht, wie es gediehen ist in all der Zeit.«
»Und sieh, wie es unterging in Feuer und Blut«, sagte Otto von Herneberch düster.
Philipp blinzelte überrascht und schwieg. Graf Otto wand sich unbehaglich, als ihm klar wurde, dass er das ausgesprochen hatte, worum all die anderen in ihren Reden einen Bogen gemacht hatten.
»Wisst ihr«, sagte König Philipp nach ein paar Herzschlägen, »eigentlich hatte ich gehofft, dass ihr eure Meinung geändert hättet. Aber es ist immer noch das Gleiche wie vor vier Jahren.«
»Wir wären schlechte Freunde, wenn wir nicht aufrichtig zu dir wären«, erwiderte Walther und verdrängte den Gedanken, dass es durchaus ein paar Dinge gab, in denen er, Walther, nicht aufrichtig zu seinem König war.
Philipp atmete tief ein und wieder aus. Dann winkte er sie heran. Als sie in einem engen Kreis zusammenstanden, schaute er einem nach dem anderen ins Gesicht. Dann brach er plötzlich in Lachen aus. »Ihr seid vier Waschweiber!«, rief er vergnügt. »Und ihr glaubt immer noch, ich bin zu dämlich, um einen Fuß richtig vor den anderen zu setzen! Heinrich – als mein großer Bruder starb und ich die Krone nahm, hast du mich beiseitegezogen und mir erklärt, dass die Königswürde Hunderte von Jahren alt sei und dass man sie auch so lange getragen haben müsse, um sich ihrer würdig zu verhalten.«
Heinrich von Kalden räusperte sich.
»Und du, Hochwürden? Hast du nicht gesagt, ich solle auf meine Ausbildung in der Kirche nicht zu stolz sein, weil sie vom Studieren kluger Bücher käme, wohingegen das Wissen eines guten Königs vom Studium der Welt kommen müsse?«
»Du warst so nass hinter den Ohren wie ein Welpe«, brummte Gerold.
»Und du, Walther? Und du, Saladin?«
»Ich weiß, was wir gesagt haben, Philipp«, wehrte Walther ab. »Jeder von uns hat es nur gut gemeint!«
»So gut, wie ihr es jetzt meint, da bin ich mir sicher. Nur – ich bin nicht mehr der Welpe von damals. Glaubt ihr wirklich, ich hätte den Stein den Fürsten gezeigt? Männern, die mir in den letzten Jahren nur deshalb die Treue gehalten haben, weil mein Widersacher, der Herzog von Braunschweig, arrogant ist und ihnen nicht genügend schmeichelt!«
»Aber du hast doch …«
Philipp lächelte. »Seht ihr, ihr traut mir immer noch jede Dummheit zu. Nein, meine Freunde. Für den Waisen ist die Zeit noch nicht gekommen, das weiß ich genauso gut wie ihr.« Er musterte Walther lange. »Dafür sollt ihr auch erst noch sorgen – du und Saladin.«
Die beiden Sänger warfen sich verwirrte Blicke zu. Heinrich und Gerold runzelten die Stirnen.
»Ich will euch zeigen, wen ich meinen sogenannten Verbündeten vorgestellt habe.« Der König stand auf, schritt zur Tür und öffnete sie. Ein junger Mann, der sich lässig gegen den Türrahmen gelehnt hatte, straffte sich und trat auf Philipps Wink herein. Er gab die Blicke der vier Männer offen zurück.
»Niemand weiß, dass er hier ist, außer den Fürsten, die ich auf der Reise hierher besucht habe. Meine Freunde, das ist der Mann, für den ich die Krone trage, bis er alt genug ist, sie sich selbst zu nehmen. Alle Welt glaubt, er unternimmt eine ausgedehnte Jagdtour mit seinen Falken durch Apulien, doch in Wahrheit ist er hier, um seine künftigen Verbündeten kennenzulernen. Meine Freunde – ich stelle euch meinen Neffen Friedrich von Stoufen vor, euren zukünftigen König, Kaiser und den Menschen, auf den der Waise jahrhundertelang gewartet hat.«
Der junge Mann verbeugte sich. Dann lächelte er Walther an. »Nun, darf ich hoffen, dass Ihr Euch erinnert an mich?«
»Schon wieder die Satzstellung verdreht«, sagte Walther, weil es nichts anderes zu sagen gab. Das unheilvolle Gefühl, dass sich eine Katastrophe anbahnte, war nun so stark, dass er das Pochen seines Herzens spürte. Gemeinsam mit den Freunden beugte er das Knie vor dem jungen Mann, dem König Philipp den Arm um die Schultern gelegt hatte.
»Bis ich die Kaiserkrone trage, Onkel, ist es noch ein weiter Weg«, sagte Federico.
»Du wirst ihn zurücklegen«, erwiderte Philipp gut gelaunt. »Ich werde dafür sorgen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.«
Ein Eiszapfen senkte sich in Walthers Herz, als ihm die unbeabsichtigte Doppelbedeutung von Philipps Worten aufging.
Heinrichs Gedanken gingen in eine andere Richtung. »Du meinst … du willst auf die Kaiserkrone verzichten?«, fragte er fassungslos.
Philipp zuckte mit den Schultern. »Ich wollte sie nie.«
»Aber du hast …«
»Alles nur um seinetwillen«, erklärte Philipp und deutete auf den jungen Federico. »Doch wenn ich ihn offen unterstützt hätte, wäre er jetzt wahrscheinlich schon tot. Entweder hätten sich die Fürsten und die Kirche zusammengetan und ihn ermorden lassen oder einen Krieg gegen ihn geführt, der ganz Süditalien verwüstet und mit seinem Tod am Galgen geendet hätte. Ich habe das einmal versucht, gleich nachdem mein Bruder Heinrich verstarb. Danach wusste ich, dass ich das Ganze vorsichtiger anpacken musste. Mein Neffe hier ist der gewählte römisch-deutsche König und der einzige Mann, der des Kaiserthrons würdig ist. Ich habe nie etwas anderes geglaubt.«
Walther starrte den jungen Mann ratlos an. Federico hob eine Braue, dann grinste er plötzlich und zwinkerte dem Sänger zu.
»Dies ist mein Plan«, sagte Philipp. »Ich möchte, dass du, Walther, und du, Saladin, heute ein paar Verse über den Waisen zum Besten gebt, gleich nach dem Mittagmahl. Dann sind die Gäste satt und zufrieden und hören zu.«
»Es gibt keine Lieder über den Waisen«, unterbrach Walther.
Philipp strahlte. »Genau deshalb sollt ihr welche dichten! Am liebsten wäre mir, ihr würdet es in Form eines Wechselsangs tun, damit die Zuhörer den Eindruck gewinnen, dass das Wissen über den Stein weit verbreitet ist und nur sie noch nichts davon gehört haben. Das wird natürlich keiner zugeben wollen, daher werden alle mit den Köpfen nicken und darüber diskutieren, und so werden sich die Informationen über den Waisen verfestigen, ohne dass wir noch etwas dazutun müssen. Wenn ihr den Gesang wie einen Wettstreit anlegt, bei dem ihr euch gegenseitig von der Macht des Waisen zu überzeugen sucht, werdet ihr damit auch das Publikum überzeugen.«
»An dir ist ein Dichter verloren gegangen«, murmelte Gerold.
»Nein, mein Freund, ich habe nur während meiner Ausbildung bei den Disputationen über die Worte der Bibel genau aufgepasst.« Philipp rieb sich die Hände. »Ich werde bewusst nach dem Mahl abwesend und für niemanden zu sprechen sein, damit ich nachher sagen kann, ich hätte von nichts gewusst. Wenn ich dann wieder zum Vorschein komme, werde ich den Waisen bei mir haben – und ihn Friedrich zum Geschenk machen. Das wird eine doppelte Überraschung für die Gäste sein: Zuerst bekommen sie den Stein zu sehen, und gleich darauf den Sohn des letzten Kaisers, von dem jeder glaubt, er sei weit weg in seinem eigenen Königreich jenseits der Alpen und nicht mehr von Belang beim Rennen um die Krone. Sie werden alle ziemlich ratlos sein, und das ist gut so, denn ratlose Menschen versammeln sich gerne hinter einem Führer, wenn er nur entschlossen genug auftritt.«
»Ich bin nicht sicher, ob ich mir soll die Legitimation holen von einem Stein, von dem ich bis heute noch nie etwas gehört habe«, sagte Federico stolz.
Philipp winkte ab. »Die Hälfte der Kaiserwürde hat mit Symbolen zu tun, mein Junge. Mach dir nur keine Sorgen.«
»Und du gehst nun davon aus, dass uns bis heute Mittag etwas Vernünftiges eingefallen ist zu dem vermaledeiten Ding«, sagte Otto von Herneberch.
»Wenn nicht euch, wem dann? Bitte, Freunde! Was ist euch lieber – die Herren mit einer kleinen List zu einen oder ihnen zuzusehen, wie sie gegeneinander Krieg führen? Denn Krieg wird es geben, wenn sich die Frage der Nachfolge meines Bruders nicht bald eindeutig klärt. Die Fürsten werden das Reich auseinanderreißen im Kampf zwischen dem Herzog von Braunschweig und mir. Wenn es einen unblutigen Weg gibt, das zu verhindern und zugleich den Mann auf den Thron zu bringen, dem er gebührt …«
Walther warf dem jungen Federico einen Blick zu. Dieser erwiderte ihn unbefangen. Ja, dachte Walther, ich glaube dir sogar, Philipp, mein Freund und König. Dein Neffe ist tatsächlich der Mann, der noch nachträglich das Geschlecht der Staufer als des Kaiserthrons würdig legitimieren könnte. »Also gut«, sagte er.
Philipp nickte dankbar. »Es ist der letzte Dienst, den ich von euch erbitte, Freunde«, sagte er. Walther wusste, wie es gemeint war: Wenn Federico – dann unter dem Namen Friedrich, den schon sein verehrter Großvater getragen hatte – ausreichend etabliert war, würde Philipp abdanken, und dann wären er und sie nur noch Männer unter Gleichen. Dennoch lief ihm wie bereits vorher ein Schauer über den Rücken.
Gerold wandte sich an Federico. »Nun, junger Freund: Um Kaiser sein zu können, braucht man einen Traum. Was ist Euer Traum?«
»Ich habe keine Träume, ich habe Ziele.«
Gerold lächelte ein wenig herablassend. Federico zögerte einen Moment, dann fuhr er fort: »Ich möchte Jerusalem für die Christenheit zurückgewinnen, und zwar auf eine Weise, die den Frieden im Heiligen Land dauerhaft sichert.«
»Das wollten schon viele.«
»Aber ich kann es«, sagte Federico.
»Und wie?«
Nun lächelte der junge Mann genauso herablassend wie zuvor Gerold.
Dieser schüttelte den Kopf. »Was ist mit den Zielen, die Eure Vorgänger hatten – Friede im Reich, Einigkeit der Fürsten, Aussöhnung mit der Kirche und all das?«
»Ich habe mir vorgenommen, die schwierigen Aufgaben zu lösen.«
»Viele Eurer Vorgänger sind an diesen Zielen gescheitert.«
»Ich scheitere lieber beim Griff nach den Sternen.«
»Du lieber Himmel!« Gerold blickte zu Philipp, der nicht aufgehört hatte zu grinsen. Walther hatte während der kurzen Auseinandersetzung Federicos Mienenspiel beobachtet. Er meint es so, wie er es sagt, dachte er. Er ist überzeugt, dass man die Dinge dort anpackt, wo sie am meisten Mühe bereiten – weil die kleinen Probleme sich dann von allein lösen.
Was bedeutet das für mich? Wo sollte ich meine Probleme anpacken? An der Stelle, an der ich mich niederknie und meiner einzigen großen Liebe gestehe: Mein Leben ist Euer, mein Herz schlägt nicht, wenn es nicht für Euch schlägt, meine Musik klingt nicht, wenn ich sie nicht für Euch singe …
»Heinrich, du musst mir helfen«, sagte Philipp und holte Walther aus dem Strudel heraus, in den seine Gedanken geraten waren, und damit zurück zu den kleinen Problemen der Gegenwart. »Einen Mann habe ich nicht angetroffen – den Pfalzgrafen von Bayern, Otto von Wittelsbach. Auf seine Zustimmung kommt es mir besonders an. Ich habe ihn beleidigt, als ich seine Verlobung mit meiner Tochter Beatrix aufgelöst habe, aber er ist mir bis dahin immer treu gewesen. Ich hoffe, er überwindet seinen Stolz und trifft noch hier ein. Wenn er es tut, sorg dafür, dass er mich sprechen kann, egal zu welcher Tageszeit.«
»Und warum hast du die Verlobung aufgelöst, wenn der Mann dir war immer treu?«, fragte Federico.
Philipp sah ihn von unten herauf an. »Weil Beatrix zehn Jahre alt ist und der Pfalzgraf fast vierzig und ihre Tränen mich überzeugt haben, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen hatte.«
Walther konnte sehen, dass die Antwort Federico nachdenklich machte. Walther hatte Spott von dem jungen Mann erwartet oder wenigstens die Bemerkung, dass der einzige Lebenssinn von Töchtern darin lag, günstig verheiratet zu werden. Dass er es nicht tat, gab Anlass zur Hoffnung, dass er ein König werden würde, der Menschen nicht nur als Figuren auf einem Spielbrett betrachtete.
Womöglich taten sie tatsächlich das Richtige, indem sie Philipps Bitte folgten. Womöglich lag doch kein Fluch auf dem Waisen, wenn mit seiner Hilfe ein Mann wie Federico – Friedrich von Stoufen – auf den Thron kam. Aber wie auch immer: Sie waren Philipps Freunde, sie waren seine Gefolgsleute, und sie würden seinem Wunsch nachkommen. Sie waren ihm treu.
Alle, bis auf mich, dachte Walther. Und es spielt keine Rolle, dass ich meinem Verlangen nie nachgegeben und stattdessen Freundschaft, Liebe und Ehre gerettet habe. Dort, wo es darauf ankommt, bin ich dir untreu geworden: in meinem Herzen.
4.
Der Papinbercer Dom war seit dem Brand vor über zwanzig Jahren eine Baustelle. Das Feuer hatte nur die Außenmauern des Baus übrig gelassen, die das Domkapitel mit einem Holzdach versehen hatte, damit die Gottesdienste weitergehen konnten. Dann war eine Weile nichts mehr geschehen, bis vor acht Jahren Kaiserin Kunigunde heiliggesprochen worden war. Der damalige Bischof Timo und das Domkapitel hatten alles Geld zusammengekratzt und mit der Wiedererrichtung des Ostchores und der Osttürme begonnen, damit die heilige Kunigunde eine würdige neue Ruhestätte erhalten konnte. Unter dem jetzigen Bischof Ekbert verliefen die Bauarbeiten eher zäh. Ekbert, der sich nur zu außergewöhnlichen Anlässen in seiner Bischofsstadt aufhielt, war mit dem Domkapitel zerstritten und dieses wiederum unter sich. Die Gelder flossen nicht mehr so reichlich. Walther ahnte, dass König Philipp neben den vielen anderen Gesprächen, die die Hochzeitsfeierlichkeiten seiner Nichte begleiteten, auch das eine oder andere mit den Vertretern des Domkapitels führen würde.
Obwohl kein Gottesdienst stattfand, war der Papinbercer Dom gut besucht. Gotteshäuser waren im Allgemeinen auch außerhalb der Messzeiten voller Leben: Gläubige, die mit ihren Fürbitten in die Kirche kamen und Gott mit dem Kauf teurer Kerzen in Zugzwang zu bringen versuchten; Bettler, die sich den Umstand zunutze machten, dass sich unter den Augen des gemarterten Christus niemand leichten Herzens der Todsünde Geiz schuldig machte; Müßiggänger, die sich dem Irrglauben hingaben, dass sie in der Kirche nicht so sehr auffielen wie draußen in den geschäftigen Gassen; und Kleriker aller Sorten und Hierarchien, die überzeugt waren, dass weder der Herr noch seine Herde ohne sie auskamen. Hier in Papinberc trieben sich sogar mehr Leute als gewöhnlich in der dunklen, noch immer rußgeschwärzten Halbruine herum, als ob die Besucher durch ihre bloße Anwesenheit demonstrieren wollten, dass sie weiterhin Hoffnung in die Fertigstellung des Neubaus setzten.
Walther liebte die Stimmung in Kirchen außerhalb der Messzeiten. Die Schritte der Anwesenden hallten im Gewölbe, das Gemurmel der Gebete war wie das sanfte Rauschen einer weit entfernten Meeresbrandung, Weihrauch, Talg, Unschlitt und Kerzenwachs verwoben sich zu einer einzigartigen Geruchsmischung, und jeder Stein, jedes Fresko, jede Deckenrippe und jede Heiligenfigur war aufgeladen mit der spirituellen Aura des geweihten Ortes. Selbst im Papinbercer Dom war noch ein Hauch dieser sakralen Atmosphäre zu spüren, trotz der Brandschäden, der Finsternis und des Geruchs nach altem Rauch.