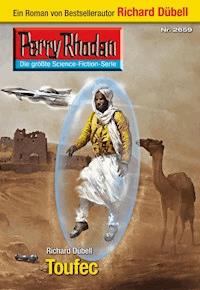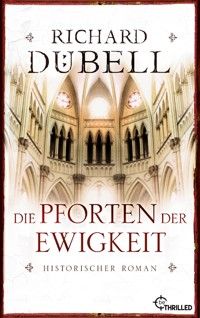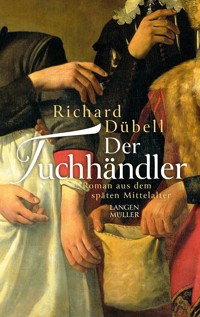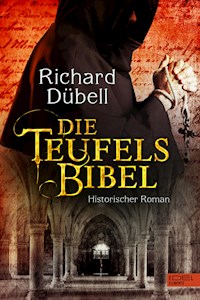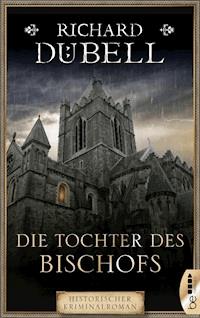4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter Bernward
- Sprache: Deutsch
Der Tuchhändler ermittelt in der Lagunenstadt
Venedig, 1478. Aus den trüben Wassern der Lagune wird die Leiche eines Kindes geborgen - vor den Augen des deutschen Tuchhändlers Peter Bernward. Bald darauf kommen zwei weitere Kinder ums Leben: Gassenjungen, die als Zeugen gesucht wurden. Wussten sie zu viel? Bernward beschließt, den wenigen Hinweisen nachzugehen. Dabei dringt er tief in das Räderwerk der Macht vor, mit der Venedig seit 400 Jahren den Handel in Europa kontrolliert - und gerät in ein Netz aus Verbrechen und Intrigen, das die dunkle Seite der Stadt offenbart ...
Ein farbenprächtiger historischer Kriminalroman vor der Kulisse Venedigs.
Weitere Abenteuer mit Peter Bernward bei beTHRILLED: Das Spiel des Alchimisten und Der Sohn des Tuchhändlers.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber das BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungZitateDRAMATIS PERSONAEPrologErster TagKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Zweiter TagKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Dritter TagKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Vierter TagKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Letzter TagKapitel 1Kapitel 2NachwortDanksagungQuellenangabenAbbildungsverzeichnisÜber dieses Buch
Der Tuchhändler ermittelt in der Lagunenstadt
Venedig, 1478. Aus den trüben Wassern der Lagune wird die Leiche eines Kindes geborgen – vor den Augen des deutschen Tuchhändlers Peter Bernward. Bald darauf kommen zwei weitere Kinder ums Leben: Gassenjungen, die als Zeugen gesucht wurden. Wussten sie zu viel? Bernward beschließt, den wenigen Hinweisen nachzugehen. Dabei dringt er tief in das Räderwerk der Macht vor, mit der Venedig seit 400 Jahren den Handel in Europa kontrolliert – und gerät in ein Netz aus Verbrechen und Intrigen, das die dunkle Seite der Stadt offenbart …
Über den Autor
Richard Dübell, geboren 1962, lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Niederbayern und ist Träger des Kulturpreises der Stadt Landshut. Er zählt zu den beliebtesten deutschsprachigen Autoren historischer Romane. Seine Bücher standen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurden in 14 Sprachen übersetzt. Mehr Informationen über den Autor finden Sie auf seiner Homepage: www.duebell.de
RICHARD DÜBELL
Die schwarzen Wasser vonSan Marco
beTHRILLED
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2002 by Richard Dübell, München
Published by arrangement with Michael MellerLiterary Agency, München
Copyright © 2002/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Claudia Alt
Umschlaggestaltung: U1berlin / Patrizia di Stefano unter Verwendung von Motiven © shutterstock: photocell | JopsStock | LadyMary; © pixabay: Alois Wonaschuetz
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5398-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Sarah und Mario
Cui bono?Marcus Tullius Cicero
Wer die Leiter hält, ist so schuldig wie der Dieb.Deutsches Sprichwort
DRAMATIS PERSONAE
Peter BernwardDer Kaufmann lässt sich nicht nach Hause schicken
Paolo CalendarDer Polizist muss sich zwischen Pflichterfüllung und Gewissen entscheiden
Jana DlugoszPeters Gefährtin geht einen Weg für zwei ganz allein
Leonardo FalierDer Zehnerrat kennt jedes Rädchen in der Mechanik der Macht
BarberroDer Sklavenhändler versucht einer geschäftlichen Vereinbarung nachzukommen
FiuzettaDie junge Kurtisane sieht keine Zukunft für sich
Enrico DandoloEin bankrotter Kaufmann sucht nach seinem Schutzbefohlenen
Andrea DandoloDer junge Novize steht vor dem Wiedereintritt in die Welt
Michael und Clara ManfridusHerbergswirte
MoroManfridus’ Haussklave
Caterina, Fratellino, Maladente, VentrecuoioGassenratten
Doge Giovanni Mocenigo(historisch)
Rara de Jadra(historisch)
Heinrich Chaldenbergen(historisch)
Er wusste nicht, wie lange er schon am Ufer stand.
Es war nicht von Bedeutung. Nur eines zählte: das Unglück, das er über seine Familie gebracht hatte.
Das Wasser, das mit trägen Bewegungen gegen das Schilf schlug, war beinahe klar; nur der Sand, den die Wellen vom Grund hoben und der zwischen den Klingen der Schilfhalme schwebte, trübte es leicht. Es roch nach Salz, sterbenden Pflanzen und totem Getier, kaum anders, als wenn man in der Abenddämmerung am Arsenal entlangging und eine von San Michele her wehende Brise den Geruch nach heißem Pech, geschnittenem Holz und fauligem Brackwasser in die Gassen der Stadt verdrängte. Doch das Arsenal war weit entfernt, südwärts, durch das Kanalgewirr von Murano – zwei oder drei Stunden für den geschickten Ruderer einer gondola und weitaus länger für jemanden mit einem schwerfälligen sàndolo.
Was ihn betraf, hätte das Arsenal am anderen Ende der Welt sein können und die Stadt mit ihm.
Halb im Schilf versteckt, unter den tief hängenden Ästen einer
Weide, lag der sàndolo, mit dem er hergekommen war. Libellen tanzten darüber und schossen mit pfeilschnellen Bewegungen über den lang gezogenen Rumpf, landeten und starteten auf den gekreuzten Rudergriffen. Durch den Spalt im Boden des Boots drang langsam Wasser ein. Noch lag es nicht viel tiefer, aber die Axt, mit der er das Leck in das Boot geschlagen hatte, war bereits versunken.
Er starrte in die Bucht hinaus und dachte an seine Schwäche, daran, dass das alles nicht passiert wäre, wenn er nur einmal versucht hätte, seine Gefühle zu beherrschen.
Das Wasser erwartete ihn.
Erster Tag
1
Der schwarze Sklave, das Faktotum in Michael Manfridus’ Herberge, eilte herein und flüsterte seinem Herrn etwas ins Ohr. Manfridus erbleichte und warf Enrico Dandolo einen betroffenen Blick zu, und ich ahnte, dass alle Ratschläge, die ich ihnen hätte geben können, vergeblich gewesen wären.
Die Ratschläge, wie Enrico Dandolo seinen seit zwei Tagen verschwundenen Neffen Pegno wiederfinden könnte.
Moro, der schwarze Sklave, richtete sich auf und stürzte wieder hinaus, von Enrico Dandolo beunruhigt beobachtet. Dandolos Nervosität war ihm bereits anzumerken gewesen, als wir einander vorgestellt worden waren, und das Erscheinen von Manfridus’ Haussklaven hatte sie eher noch verstärkt. Michael Manfridus räusperte sich. Er sah mich verlegen an und wandte sich dann zögernd an Dandolo. Er hatte keine guten Neuigkeiten erfahren.
Als er schließlich in dem für mich nur schwer verständlichen venezianischen Dialekt, den er so gut beherrschte wie die Einwohner der Lagunenstadt, zu sprechen begann, weiteten sich Dandolos Augen, und er sank in sich zusammen. Manfridus verzog das Gesicht voller Mitleid.
»Was ist passiert?«, fragte ich.
Manfridus schob die Oberlippe vor. »Im Arsenal wurde vor etwa einer Stunde eine Leiche geborgen; Wachen haben sie im See San Daniele gefunden. Es handelt sich um einen Jungen.«
»Pegno«, sagte ich grimmig.
Manfridus zuckte unglücklich mit den Schultern. Dandolo starrte mit leerem Blick vor sich hin, doch dann raffte er sich auf. Er erhob sich von der Bank, sagte etwas zu Manfridus und wandte sich dann mir zu. Manfridus stand ebenfalls auf.
»Messèr Dandolo will sofort zum Arsenal und nachsehen, ob der Tote wirklich sein Neffe ist. Er fragt, ob Sie mitkommen.«
»Was kann ich schon tun? Ich weiß nicht mal, wie der Junge aussieht.«
»Messèr Dandolo hält große Stücke auf Sie. Ich komme ebenfalls mit und werde übersetzen.«
Dandolo hielt nur deshalb große Stücke auf mich, weil Manfridus ihm meine Person in den glühendsten Farben geschildert hatte. Der Mann hatte mich nie zuvor im Leben gesehen, Manfridus hingegen hatte jedes noch so entstellte Detail von Janas und meiner Verwicklung in den Aufstand gegen Lorenzo de’ Medici in Florenz mit Begeisterung aufgenommen und Dandolo eine entsprechende Beschreibung von mir gegeben: Peter Bernward, der Aufklärer auch der verwickeltsten Fälle, der Mann, der Lorenzos Rachedurst die Stirn geboten hatte; überflüssig zu erwähnen, dass kaum etwas von dem, was in der deutschen Kolonie Venedigs über Jana und mich erzählt wurde, auch nur annähernd der Wahrheit entsprach. Doch nun war nicht der richtige Zeitpunkt, Manfridus und Dandolo darüber in Kenntnis zu setzen. Ich seufzte und stand ebenfalls auf.
Dandolo brachte ein dankbares Lächeln zustande, das die dunklen Ringe unter seinen Augen und die Fahlheit seines Gesichts noch betonte.
»Sono lo zio«, sagte er langsam und faltete die Hände. »Sono com’ un altro papa. Sono responsabile. Sono disperato.«
»Er sagt, er ist …«, begann Manfridus.
»Ich habe ihn schon verstanden.«
Dandolo nahm seinen gestreiften Stoffhut, dessen Farben mit seinem Gewand und der gefältelten Tunika harmonierten, und drückte ihn an seine Brust. Er war entweder rettungslos eitel, oder er hatte sich für das Treffen mit mir besonders zurechtgemacht; er war eine elegante, vor Geschmeide funkelnde Erscheinung, schwarz und rosafarben. Ich konnte beides nicht leiden. An seiner Hüfte blitzte das Gehänge eines Schmuckdolchs mit den Ringen an seinen Fingern und der Kette um seinen Hals um die Wette. Er atmete tief ein und schritt dann zur Tür von Manfridus’ Schankstube. Manfridus rief nach jemandem von seinem Gesinde.
»Sollte Jana erwachen, lassen Sie ihr bitte ausrichten, wo ich bin«, bat ich ihn. »Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen macht.«
Manfridus nickte und machte gleichzeitig ein schuldbewusstes Gesicht. »Das ist mir peinlich. Neben dem ganzen Unglück der Dandolos habe ich gar nicht mehr an Ihre Gefährtin gedacht. Wie geht es ihr jetzt? Meine Frau kümmert sich um sie, als wäre sie ihre Schwester, das kann ich Ihnen versichern.«
»Ich weiß es zu schätzen.«
»Machen Sie sich keine Sorgen, wahrscheinlich hat die Reise sie erschöpft.«
»Natürlich.« Ich fragte mich, ob meine Erwiderung ebenso platt klang wie Manfridus’ beruhigende Worte. Natürlich war ich besorgt. Wahrscheinlich hatten sich Manfridus’ Gedanken bereits wieder dem näher liegenden Unglück zugewandt, denn sein Gesicht wirkte verschlossen. Er war jemand, der irgendetwas tun musste, wenn ihn eine Situation beunruhigte. Ich kenne Männer, die Holz zu hacken beginnen, andere gehen in den Stall und striegeln ihr Pferd. Der untersetzte Manfridus gehörte zu denjenigen, die ihren Mund in Tätigkeit versetzen: Er fischte eine Nuss vom letzten Jahr aus einer Tasche, knackte sie umständlich und begann dann, hastig darauf herumzukauen.
»Armer Junge«, seufzte er. »Ich hoffe bloß, dass nicht er es ist, den sie im Arsenal gefunden haben.«
Ich wies auf Dandolo, der draußen in das nachmittägliche Sonnenlicht blinzelte und den Hut auf den Kopf stülpte. »Er jedenfalls glaubt es schon.«
Enrico Dandolo eilte uns voran; die Schritte seiner schmalen, spitzen Schnabelschuhe klapperten auf dem Kopfsteinpflaster und trugen ihren Teil bei zu dem Lärm, der in der Stadt widerhallte. Venedigs Gassen waren zu jeder Tageszeit voller Menschen. Das Fehlen der Ochsenkarren und der Fuhrwerke, hoch beladen mit Heu, Holz oder Lebensmitteln, war wohltuend – die Venezianer lieferten einen großen Teil ihrer Vorräte über die schiffbaren Kanäle an, deren Netzwerk beinahe vor jedes Haus führte. Die Stadt wirkte deshalb jedoch nicht weniger bevölkert. Die Gassen waren so eng, als wären sie lediglich ein Vorwand für die städtebauliche Notwendigkeit gewesen, festen Boden aufzuschütten, um die ersten Häuser zu errichten. Diese wandten demnach auch ihre Prachtseiten dem Wasser zu und kehrten ihre abweisenden rückwärtigen Mauern gegen das Volk, das durch die Gassen lief.
Michael Manfridus’ Herberge – nicht die einzige der Stadt, deren Besitzer aus dem Deutschen Reich stammte, aber sicher eine der besten – lag im Stadtsechstel von Cannareggio, ein paar Schritte von einem kleinen Platz mit einer altertümlichen Kirche entfernt, die den heiligen Aposteln gewidmet war, abseits vom Hauptstrom der Passanten. Von seinem Haus war es nicht mehr weit zu der mächtigen hölzernen Zugbrücke, die als einzige über den Canàl Grande führte. Der große Kanal wand sich als flussbreiter Wasserweg durch das Herz der Stadt, ein elegant geschwungener Schnitt mit zwei engen Kehren, in denen die sestieri San Polo und San Marco lagen, das beliebteste Wohnviertel und das politische Machtzentrum der Venezianer. San Polo schmiegte sich in die Westkehre des Kanals und wandte sich dem Festland zu, während San Marco in der engeren Ostkehre lag und damit auf die Lagune und das offene Meer führte. Selbst mir, der Venedig vor diesem Besuch nur einmal gesehen hatte, war die Symbolik klar.
Über tiefer gehende Kenntnisse der Stadt und ihrer Geografie verfügte ich nicht; ich wusste lediglich, dass Cannareggio nördlich von San Polo und San Marco lag und im Vergleich zu diesen beiden sestieri zu den eher stillen und bescheideneren Gegenden zählte. Mein – unser – erster Besuch in der Lagune hatte vor nur wenigen Wochen stattgefunden. Nun war es kurz nach Pfingsten. Unser erster Aufenthalt hätte der Abschluss von Janas fast dreijähriger Reise durch das Heilige Römische Reich sein sollen, wenn sie nicht die Botschaft vom Tod ihres Vaters überrascht hätte. Der Tod von Karol Dlugosz machte Jana zur Erbin des reichen Handelshauses Dlugosz, und ihre Vettern legten ihr in ihrer unverschämten Botschaft nahe, zurückzukehren und die Verantwortung in die Hände eines männlichen Verwandten zu legen. Selbstverständlich war Jana einer anderen Strategie gefolgt und hatte sofort einen Geschäftsabschluss geplant, der den Reichtum ihres Hauses für die nächsten Generationen hätte sichern sollen – wenn uns nicht der Aufstand der Familie Pazzi in Florenz dazwischengekommen wäre und ich nicht all meine Anstrengungen darauf hätte konzentrieren müssen, Janas Verurteilung wegen einer Beteiligung an dieser Verschwörung zu verhindern und den Schuldigen zu finden, der sie als Sündenbock vorgeschoben hatte.
Nun waren wir ein zweites Mal hier – ungeplant, von Janas plötzlicher Erkrankung zu einem Aufenthalt gezwungen, der weder ihr noch mir sonderlich gelegen kam. Vor zwei Tagen waren wir abends in Manfridus’ Herberge eingetroffen, und der Herbergswirt, bei dem wir während unseres ersten Aufenthalts in Venedig darauf gewartet hatten, dass sich für uns die Teilnahme an einer Reisegruppe ermöglichte, in deren Schutz wir nach Florenz hatten gelangen können, hatte uns überschwänglich willkommen geheißen. Er erkannte uns wieder, doch nicht nur das, er hatte die gewaltig aufgeblähten Schilderungen von der Verschwörung gegen Lorenzo de’ Medici und Janas und meiner Rolle darin gehört und wähnte sich nun in Gegenwart einer bedeutenden Persönlichkeit, als er mir begeistert die Hand schüttelte.
Ich betrachtete ihn, während wir uns mit Enrico Dandolo durch das Gedränge schoben. Manfridus war ein Mann von gedrungener Statur, mit gewelltem Haar – dessen Ergrauen er mit den kosmetischen Färbetricks der Frauen eher erfolglos bekämpfte –, mit einem offenen Gesicht, unruhigen Händen und einem leicht hinkenden Gang durch eine lang verheilte Verletzung, und ich fragte mich einen Moment, ob wir nicht besser daran getan hätten, im Fondaco dei Tedeschi um Logis zu bitten.
Ich war undankbar. Clara Manfridus, die aus Mailand stammende Frau des Herbergswirts, hatte sich Janas sofort in einer rührenden Art und Weise angenommen und ließ sie kaum einen Moment aus den Augen. Julia, Janas Zofe, war am Vortag unaufhörlich mit geröteten Wangen und aufgelöstem Haar zwischen der Küche und dem leer stehenden Speicherraum unter dem Dach hin und her gelaufen, in dem Manfridus Jana, Julia und mich untergebracht hatte. Julia hatte Besorgungen erledigt, die Clara Manfridus ihr zum Wohle Janas aufgetragen hatte, Tränke und Suppen nach ihren Rezepten zubereitet und kaum Zeit gefunden, auch nur für wenige Augenblicke auszuruhen. Im Fondaco wäre uns keine auch nur annähernd so beflissene Hilfe zuteil geworden.
Dandolo stieß mit einer Dienstmagd zusammen, die mit einem Korb weißer Laken um eine der abrupt auftauchenden Ecken trat und einer Gruppe sich angeregt unterhaltender Patrizier in dieselbe Richtung auswich wie Dandolo. Ich hörte, wie er sich wortreich entschuldigte und sich scheinbar anschickte, die verstreuten Laken aufheben zu helfen, bevor er weitereilte. Wir umrundeten die Frau, die mit wütendem Gefuchtel die anderen Passanten davon abzuhalten versuchte, in der engen Gasse über die Tücher zu laufen. Die meisten bemühten sich, rücksichtsvoll an ihr vorbeizugehen, doch es gab Fehltritte, und die aufgebrachte Dienstmagd kommentierte jeden von ihnen mit wütendem Schimpfen. In Sekundenschnelle entstand ein Auflauf, der den schmalen Durchlass vollends verstopfte. Dandolo drängelte sich weiter vorn mit neuerlichen Entschuldigungen durch ein Häuflein Männer, die stehen geblieben waren, um den Vorfall zu beobachten, und warf uns einen ungeduldigen Blick zu. Ich sah die Spitze des Campanile, der sich gegenüber dem Palazzo Ducale auf dem Markusplatz erhob, vor uns über die Dächer ragen.
»Wir gehen doch zum Markusplatz. Warum nehmen wir nicht eine der Hauptgassen?«, fragte ich Manfridus. »Wir kämen zweimal so schnell voran.«
»Das ist die Salizzada San Lio, die Hauptverbindung von der Rialto-Brücke zum Markusplatz.«
Wir wandten uns scharf nach Osten, bevor wir den großen Platz erreichten, in ein weiteres Gewirr von Gassen, Gässchen und kleinen Brücken, in dem die Betriebsamkeit etwas nachließ. Dandolo führte uns durch Seitengassen, die so eng waren, dass man die Hauswände mit ausgestreckten Armen hätte berühren können – zuweilen sogar mit ausgestreckten Ellbogen. Sie waren kühl und so dunkel, dass einzig die Wasserlachen, die den Himmel hinter den hoch aufragenden Hauswänden widerspiegelten, sie ein wenig erhellten. Wir kamen auf einem der kleineren Plätze heraus, die man hier campo nannte, auf dem sich ein vollkommen eingerüsteter Bau erhob. Jemand ließ ein bereits vorhandenes Gebäude erneuern. Das Holz des Gerüsts war grau und silbern von der Seeluft geworden; der Bau zog sich offenbar schon über viele Jahre hin. Ein kleines Grüppchen von Nonnen schritt davor auf und ab und schien den nicht feststellbaren Baufortschritt zu inspizieren.
Dandolo führte uns um eine Ecke und dann um eine weitere – Abbiegungen, die man erst bemerkte, wenn der Vordermann abrupt um sie herum verschwand. Bis zu diesem Moment wirkte es, als liefe man in eine Sackgasse hinein, deren Wände, kaltrote Ziegel oder schmutzig grauer Stein, scheinbar zusammenrückten. Plötzlich standen wir auf der breiten gemauerten Uferpromenade, die beim Markusplatz begann und am Kanal von San Marco entlang nach Osten führte. Wir hatten den belebten Markusplatz umgangen, vor dem ein wahrer Wald von Schiffsmasten auf der Mündung des Canàl Grande in den Kanal von San Marco tanzte.
Nach der Kühle und dem dumpf-feuchten Geruch in den Gassen waren das Sonnenlicht und die leichte salzige Brise eine Wohltat. Die Nachmittagssonne glitzerte auf dem Kanal und wob Lichtreflexe um die Insel von San Giorgio Maggiore, deren prachtvolles Benediktinerkloster sich eine Viertelmeile entfernt gegenüber dem Markusplatz aus dem Wasser erhob. Dazwischen ankerten oder fuhren Wasserfahrzeuge in allen Größen und Arten: schreiend bunte gondole, mächtige Koggen sowie prachtvolle venezianische Galeeren, die mit ihren Ruderreihen über den Kanal glitten wie riesenhafte Insekten auf tausend Beinen. Eine Reihe in einheitlichen Farben gestrichener gondole schwamm als plumpes Verkehrshindernis in all diesem Gewirr, ihre sonstige Eleganz verschenkt an die von ihnen gebildete Kette, über der ein quer über alle Boote hinweg gespanntes Tuch ein Familienwappen zur Schau stellte. Das Wappen war in den gleichen Farben wie die Gondeln gehalten, und wer die Prozession nicht wegen ihrer trägen Auffälligkeit im wimmelnden Schiffsverkehr beachtete, der wurde durch die gleichmäßigen, von den Bootsführern geschlagenen Trommeltakte auf sie aufmerksam gemacht.
Dandolo widmete dem Anblick keine Sekunde. Er wischte sich über die Stirn und trocknete sich die Hand gedankenlos an seiner Tunika ab, bevor er uns zunickte und gleichzeitig ostwärts wies. Der Kai beschrieb eine lang gezogene Kurve; Ladekräne und Speichertürme ragten in einiger Entfernung hinter den Häusern empor, Schiffe drängten sich im Wasser in ähnlicher Zahl wie vor dem Markusplatz, und über die Köpfe der Flanierenden hinweg sah ich, wie sich eine hölzerne Zugbrücke erhob.
»Das ist das Arsenal«, sagte Manfridus. »Nur, wie sollen wir hineinkommen?«
»Ist es denn nicht zugänglich?«
»Wo denken Sie hin? Das ist unmöglich. Das Arsenal ist das Herz der venezianischen Seemacht. Niemand kommt dort hinein, der nicht das Vertrauen des Senats oder wenigstens der patroni dell’Arsenale genießt.«
»Offenbar hat es ein kleiner Junge geschafft.«
»Und mit dem Leben bezahlt.«
Wir kamen gerade rechtzeitig. Die Zugbrücke führte über einen breiten Kanal, der in gerader Linie bis zu einem vergatterten Tor verlief. Das Tor selbst war eine mächtige Holzkonstruktion zwischen zwei gedrungenen Türmen, auf denen ich einige Wachen entdeckte, und versperrte den Kanal in seiner ganzen Breite. Am Ostufer des Kanals folgte ein gepflasterter Weg seinem Verlauf bis zu dem Tor. Die Türme stellten lediglich die Endpunkte einer langen Mauer dar, die sich sowohl nach Westen wie nach Osten fortsetzte. Kurz vor dem Tor führte ein hoher Steg vom Uferweg wieder hinüber auf die andere Seite und zu einem kleinen Platz. Hier befand sich, bewacht von seinem schmucklosen Torbau, der Fußgängereingang zum Arsenal. Nachdem wir uns durch die widerwillig beiseite rückende Menge bis dorthin geschoben hatten, begann Enrico Dandolo mit dem halben Dutzend Männer zu diskutieren, die mit Schwertern und Spießen bewaffnet waren und dafür sorgten, dass keiner dem Tor zu nahe kam. Sie schüttelten ungerührt die Köpfe.
Dann jedoch traten drei weitere Männer aus dem Inneren des Arsenals, die etwas mit einem Leintuch Verhülltes auf einem Brett zwischen sich trugen. Die Wächter machten den Weg frei; auch Dandolo wich zurück. Der Anführer der drei Männer sah sich um, als beunruhige ihn der Auflauf vor dem Tor. Er war groß und schlank, hatte ein schmales, fein geschnittenes Gesicht und hielt sich auffallend gerade. Sein Haar begann zu ergrauen; es musste einmal von jenem Schwarz gewesen sein, das früh zum Erbleichen neigt. Ich schätzte ihn um zehn Jahre jünger als mich. Er war barhäuptig und trug schlichte, dunkle Kleidung, an der wenige Farben und gar kein Schmuck auffielen. Er bewegte sich mit unterdrückter Energie, schien konzentriert und wütend zugleich zu sein.
Dandolo fasste sich ein Herz und trat vor, wobei er sich bemühte, nicht zu dem Brett hinunterzusehen, das die beiden anderen Männer – ihrer Kleidung nach Wächter des Arsenals wie die Burschen vor dem Tor – auf den Boden gelegt hatten. Was darauf lag, sah aus wie ein mit einem Tuch verhüllter Mensch. Es war ein Mensch. Es war die Leiche eines Jungen, der wahrscheinlich Pegno Dandolo hieß und von dem sein Onkel gehofft hatte, ihn durch meine klugen Ratschläge lebend wiederzufinden.
Der Mann mit den grau melierten Haaren wechselte ein paar Worte mit Dandolo, dann kniete er neben dem Leichnam nieder und forderte Dandolo auf, es ihm nachzutun. Der Kaufmann zögerte sichtlich. Ich erwartete fast, ihn einen Rat suchenden Blick in unsere Richtung werfen zu sehen, aber er schien Manfridus und mich vergessen zu haben. Schließlich sank er in die Knie wie ein Verurteilter, der den Schwertstreich des Scharfrichters erwartet.
Ein Teil des Tuches wurde zurückgeschlagen. Die Männer rings um uns stellten sich auf die Zehenspitzen, um etwas zu sehen. Ich selbst verzichtete auf den Anblick eines Gesichts, das zu einem Körper gehörte, der mindestens zwei Tage im Wasser gelegen hatte. Dandolo blickte auf das Brett hinunter, und seine Züge erstarrten.
2
Während wir alle um den Leichnam herumstanden, spürte ich plötzlich das wohl bekannte sachte Zupfen an der Börse, beinahe zu sanft, um wahrgenommen zu werden. Ich griff nach hinten, bekam ein dünnes Handgelenk zu fassen und zerrte den dazugehörigen Menschen hinter meinem Rücken hervor. Mein Fang quiekte erschrocken. Ich hatte einen Jungen erwischt; als ich die Hand hob, mit der ich sein Gelenk umfasst hielt, lösten sich seine Beine vom Boden, und er baumelte vor mir in der Luft. Er war höchstens halb so groß wie ich und wog weniger als ein Vogel. Er starrte mich aus weit aufgerissenen Augen an.
»Lass den Unfug«, brummte ich, doch er begann schon zu zappeln und zu schreien: »Perdona, messère, perdoname, perdoname!«
Manfridus drehte sich überrascht um, und auch die anderen Umstehenden wandten sich uns zu. Ich stand da mit meiner kläglichen Beute, deren Füße noch immer nicht den Boden berührten. Die ersten grimmigen Mienen waren zu erkennen. Ein Beutelschneider, ein Dieb, und sein potenzielles Opfer hatte ihn gefangen. Das neue Ereignis löste das alte ab, und Neugier verwandelte sich in Lust an der Gewalt. Ich hatte nicht nur einmal gesehen, was die wütende Menge mit einem ertappten Dieb anstellte, bevor die Stadtknechte Gelegenheit bekamen, ihn abzuführen.
Der Junge starrte vor Schmutz. Er trug ein vielfach durchlöchertes Hemd, das ihm kaum über die Knie reichte, und darüber ein Wams, das ehemals aus Samt gewesen und nun so zerschlissen war, dass seine bloße Oberfläche nur da und dort ein Fleckchen Samtstoff aufwies und eher an das Fell eines räudigen Hundes erinnerte. Mit Ausnahme von Hemd und Wams war er nackt. Seine Füße waren ohne Schuhe und so schwarz, als sei er damit durch ein Kohlenlager gelaufen. Ähnlich schmutzig waren seine Arme, die nur bis zu den Ellbogen von seinem Hemd bedeckt wurden. Seine Fingernägel waren lang und abgesplittert, mit Rändern wie die Grabeschaufeln eines Maulwurfs. In seinem Gesicht lagen verschiedene Schichten von Schweiß, Essensresten, Straßenschmutz und Tränen, vielfach übereinander gelagert und wie eingebrannt in die Haut, umrahmt von Haaren, die ihm steif vom Kopf abstanden. Er war höchstens zehn Jahre alt, viel zu klein für sein Alter, und sein Antlitz war das eines alten Mannes. Er roch säuerlich nach ungewaschenem Körper und durchdringend nach Angst. Ich stellte ihn auf den Boden zurück.
Der grauhaarige Mann wandte sich von Enrico Dandolo ab und schritt eilig herüber. Er musterte mich von oben bis unten. Der Junge drehte sich vorsichtig zu ihm um und zuckte zusammen, als sei er ihm bekannt. Der Mann betrachtete ihn mit steinernem Blick. Das Handgelenk des Jungen in meinem Griff fühlte sich so zerbrechlich an wie Glas. Ich ließ ihn los und trat beiseite.
»Verschwinde«, sagte ich, »mach schnell. Sparisci, si?«
Der Mann packte den Jungen am Genick, bevor dieser eine Bewegung machen konnte. Dann heftete er seinen Blick auf mich. Seine Augen waren dunkelbraun und tief vor Zorn.
»Nicht so schnell«, sagte er zu meiner Überraschung nahezu akzentfrei. Michael Manfridus schob sich mit sorgenvoller Miene näher heran.
»Was wollen Sie von dem Kleinen?«, fragte ich.
»Das frage ich Sie.«
»Er hat versucht, mich um meine Börse zu erleichtern.«
»Keine große Überraschung.« Er schüttelte den Jungen, der erstarrt in seinem Griff hing wie ein Hase in der Pranke des Schlächters, und zischte ihm ein paar Brocken auf Venezianisch zu. Der Junge machte ein ängstliches Geräusch.
»Ich lege keinen Wert darauf, ihn verhaften zu lassen. Mir ist nichts abhanden gekommen.«
»Ich glaube nicht«, erwiderte der Mann mit kalter Förmlichkeit, »dass es in Ihrem Ermessen liegt, ob der Junge für seine Tat büßt oder nicht. Hier gelten die Gesetze der Serenissima, nicht die des Fondaco dei Tedeschi.«
»Herr Bernward ist nur auf der Durchreise«, kam Manfridus zu Hilfe und vergaß in seiner Aufregung, dass er mit dem Mann auch in seiner Muttersprache reden konnte. »Er gehört nicht zum Fondaco.«
»Was ändert das?«
Der Junge versuchte die Hand abzuschütteln, was ihm beinahe gelang, doch der Grauhaarige fasste rasch nach. Sein Griff war nicht so fest gewesen, wie es den Anschein hatte. Er packte den Burschen an den knochigen Schultern und drehte ihn zu sich herum; dann ging er in die Hocke, bis ihre Augen auf gleicher Höhe waren. Der Junge fixierte ihn und wurde unter dem Schmutz in seinem Gesicht sichtbar bleicher. Der Mann brachte seinen Mund nahe an das Ohr seines Gefangenen. Von der Ferne sah es aus, als würde ein Vater seinem Sohn eine gut gemeinte Lektion erteilen. Doch das Lächeln des Mannes war ohne Wärme. Der Junge wagte nicht, sich zu rühren.
»Der tedesco hat dich gerettet«, sagte der Mann so deutlich, dass selbst ich es verstand. »Für heute. Bedank dich bei ihm.«
Er richtete sich auf und ließ den Jungen los. Die Umstehenden, die unsere Auseinandersetzung verfolgt hatten, atmeten enttäuscht ein. Der Junge starrte von ihm zu mir. Ich trat beiseite, und er schoss an mir vorbei und rannte über den Platz, so schnell ihn seine dürren Beine trugen. Ich rieb meine Handflächen aneinander. Wo sie ihn berührt hatten, spürte ich eine feuchte, schweißige Schmutzschicht.
»Sie waren nicht halb so grob, wie Sie getan haben«, sagte ich.
Der Mann zuckte mit den Schultern und sah mich ohne Freundlichkeit an. »Morgen versucht er es bei einem anderen, übermorgen wird er erwischt und so verprügelt, dass er nicht mehr gehen kann; in einer Woche ist er entweder erschlagen, erstochen oder ertränkt worden.«
Er wandte sich ab und spähte zu Enrico Dandolo hinüber, der mit der Hand vor dem Mund und grünlichem Gesicht auf dem Boden kauerte. Mein Gegenüber straffte sich und kehrte zu ihm zurück, ohne mir noch einen Blick zu gönnen.
»Wer war das?«, fragte ich Manfridus.
»Einer von den Polizisten des Senats. Ich kenne seinen Namen nicht. Man muss die Sache ganz schön hoch hängen, wenn sich einer dieser Kerle einmischt. Im Allgemeinen ermitteln sie nur bei Hochverrat oder bei Dingen, die wichtige auswärtige Beziehungen betreffen. Das hier ist außergewöhnlich. Vielleicht liegt es daran, dass noch nie zuvor jemand ins Arsenal eingedrungen ist, selbst wenn er dafür sein Leben gelassen hat.«
»Die Polizisten sind nicht beliebt?«
Manfridus schüttelte den Kopf. »Der Volksmund nennt sie inquisitori. So benehmen sie sich auch; als hätten sie ihre Anweisungen direkt vom Papst und alle anderen seien Ketzer. In den letzten Jahren hat man ihre Befugnisse ziemlich ausgeweitet.«
Dandolo richtete sich auf und taumelte zur Seite. Einer der Arsenalwächter fing ihn auf. Dandolos Brust hob und senkte sich, Tränen schimmerten in seinen Augen. Der Polizist sah ihn abwartend an.
»Si«, hörte ich Dandolo erstickt sagen. »É mio nipote.«
Der Polizist warf ihm ein paar Worte hin, die Dandolo zurückzucken ließen.
»Macht er ihm jetzt Vorwürfe, dass sein Neffe im geheimsten Bereich Venedigs ertrunken ist?«, fragte ich verärgert.
Manfridus schüttelte den Kopf. »Nein, er wollte von ihm wissen, woran er seinen Neffen erkannt hat. Die Leiche hat wohl kein Gesicht mehr – die Krebse und die Fische, Sie verstehen.« Er verstummte und kramte in seiner Tasche nach einer neuen Nuss. Er sah nicht weniger grün aus als kurz zuvor Dandolo.
Dieser stotterte empört; der Polizist schnitt ihm das Wort ab.
»Er will einen weiteren Zeugen haben, der den Toten identifiziert.«
Der Kaufmann breitete die Arme aus und schüttelte den Kopf. Er machte den Eindruck eines Mannes, dem Unrecht widerfahren ist und dem man es mit noch größerem Unrecht vergilt. Er warf einen Blick zu uns herüber und deutete auf mich. Der Polizist folgte seinem Fingerzeig und verzog das Gesicht, bevor er uns zu sich heranwinkte. Die Zuschauer bildeten eine Gasse, und Manfridus und ich stapften hinüber. Mit gewisser Erleichterung sah ich, wie sich einer der Wächter des Arsenals bückte und das zerstörte Gesicht der Leiche wieder verhüllte.
»Messèr Dandolo hat den Toten als seinen Neffen erkannt«, erklärte der Polizist ohne Einleitung. »Er sagt, er wollte Sie damit beauftragen, nach ihm zu suchen.«
»Das ist übertrieben. Er wollte mich um Rat fragen, wie er seinen Neffen wiederfinden könnte. Wir hatten gerade begonnen, darüber zu reden, als die Nachricht vom Fund der Leiche eintraf.«
»Weshalb hat er sich an Sie gewandt?«
»Das fragen Sie am besten ihn selbst. Ich bin ihm wohl empfohlen worden.« Ich deutete auf Manfridus, der verlegen zusammenzuckte. »Das ist Michael Manfridus, der Herbergswirt, bei dem wir Logis genommen haben.«
»Ich kenne den Mann«, sagte er, ohne Manfridus eines Blickes zu würdigen. Der Herbergswirt schien sich zu fragen, ob er sich über seinen Bekanntheitsgrad freuen oder vielmehr beunruhigt sein sollte, dass ein ihm unbekannter Polizist wusste, wer er war. Die Schalen einer dritten Nuss fielen zu Boden. »Wen meinen Sie mit ›wir‹?«
»Meine Gefährtin und mich.«
»Gefährtin?«
Ich verdrehte die Augen. »Vielleicht hatte Pegno ein Muttermal oder etwas Ähnliches, an dem Dandolo ihn erkannt hat«, erklärte ich.
»Ihr Name lautet … Bernward?« Der Mann stolperte ein wenig über den unvenezianischen Namen.
»Das ist richtig. Herr Manfridus kann für mich zeugen.« Manfridus nickte würdevoll. »Und mit wem habe ich das Vergnügen?«
Er sah durch mich hindurch, ohne mir zu antworten. Nicht ich war es, dem hier die Rolle des Fragestellers zukam.
»Ich wusste nicht, dass die Namen der Inquisitoren so geheim sind, dass sie sie selbst schon vergessen haben.«
Michael Manfridus holte überrascht Luft. Beinahe hätte er mir auf die Zehen getreten. In den Augen des Polizisten regte sich etwas.
»Ich bin kein Inquisitor.«
Ich wandte seine eigene Taktik an und starrte durch ihn hindurch, ohne auf ihn einzugehen.
»Ich bin milite Paolo Calendar«, sagte er schließlich widerwillig. »Ich ermittle in diesem Todesfall.«
»Es wird wohl nicht viel zu ermitteln geben. Messèr Dandolo hat erklärt, der Tote sei Pegno.«
»Er kann sich an kein Muttermal erinnern, das seine Aussage untermauern würde.«
»Dann sollten Sie wirklich einen zweiten Zeugen holen.«
»Was ist mit den anderen Verwandten? Den Eltern des Jungen? Haben die Sie nicht um Rat gefragt?«
»Vielleicht wurde Enrico Dandolo zum Sprecher der Familie ernannt.«
»Hat man Ihnen das so mitgeteilt?«
»Hören Sie, ich kenne den Mann noch nicht viel länger als Sie.«
»Ich kenne ihn gut genug.« Calendar wandte sich zu Dandolo um und erteilte ihm eine Anweisung. Dandolo hob zum Protest an, aber Calendar ließ sich auf keine Diskussion ein. Einer der Arsenalwächter trabte eilig davon.
»Sie holen jemanden aus Pegnos Elternhaus«, sagte Michael Manfridus.
»Dieser Kerl hat ein Herz aus Stein. Soll Pegnos Mutter hier vor allen Leuten versuchen, ihr Kind zu identifizieren, dem die Fische das Gesicht weggefressen haben?«
»Monna Laudomia wird niemals hierher kommen. Sie ist die Frau eines Patriziers; sie zeigt sich nicht in der Öffentlichkeit, wenn es nicht gerade um einen Kirchenbesuch geht.«
»Wer soll dann kommen? Ich dachte, Pegnos Vater sei mit dem Schiff unterwegs?«
»Pegnos jüngerer Bruder, Andrea. Er ist zwölf. Er ist Novize bei den Benediktinern auf San Giorgio Maggiore, aber seit Messèr Fabio verreist ist, hält er sich zu Hause auf. Ich denke, der Wächter hat den Auftrag, ihn zu holen.«
»Das ist doch keine Sache, die man einem Kind zumutet.«
Manfridus zuckte mit den Schultern. Mein Ärger auf Calendar wuchs zunehmend. Es gereichte der Serenissima und ihren Beamten zur Ehre, wenn sie bei der Untersuchung eines Unglücksfalles alle Register zogen, doch für meinen Geschmack übertrieb der Polizist. Zumindest hätte er dafür sorgen können, dass die unselige Geschichte mit der Identifizierung des Leichnams in der Abgeschlossenheit des Arsenals geschah und nicht hier vor aller Augen.
In die Menge geriet Bewegung, als ein Wächter von der Gasse her, die in westlicher Richtung von dem kleinen Platz wegführte, um die Ecke bog.
In seiner Begleitung befanden sich zwei Jungen, die ebenso zerlumpt waren wie der, der mir die Börse hatte stehlen wollen. Der Wächter rief Calendar etwas zu. Die Jungen stolzierten mit so deutlich zur Schau getragener Gelassenheit neben ihm her, dass man ihre Furcht und Aufregung in jeder Geste erkennen konnte.
»Das ist ja verrückt«, staunte Manfridus. »Die beiden haben sich als Zeugen gemeldet.«
Tatsächlich hätten sie die Brüder des Jungen sein können, der mich zu bestehlen versucht hatte. In ihrem Elend und Schmutz glichen sie ihm beinahe bis aufs Haar. Das Einzige, was sie unterschied, war, dass einer der beiden statt eines Hemdes einen ledernen Brustpanzer trug, der an seinem dürren Körper nicht anders hing als an der Kleiderstange des Söldnerhauptmanns, dem er vor hundert Jahren gehört haben mochte. Calendar sah ihnen mit finsterer Miene entgegen.
»Ich glaube nicht, dass es hier für mich noch viel zu tun gibt«, meinte ich zu Manfridus. »Ich möchte zur Herberge zurückkehren.«
»Finden Sie den Weg allein?«
»Also, Herr Manfridus, bei allem Respekt! Sie haben mich hierher geschleppt, da bringen Sie mich bitte auch wieder zurück. Ich finde in diesem Labyrinth keine hundert Schritte weit, ohne mich zu verlaufen.«
»Ich muss Ihnen einmal erklären, wie man sich hier zurechtfindet«, erklärte er seufzend. »Wenn man’s weiß, ist nichts dabei.«
»Sollte ich lange genug hier sein, dass es sich lohnt, sage ich Bescheid.«
Er lächelte und wandte sich von der Befragung der beiden kleinen Zeugen ab, deutlich enttäuscht, seine Neugier nicht befriedigen zu können. Wir drängelten uns durch die Menge hinaus, und die von uns hinterlassene Lücke schloss sich sofort. Ich drehte mich ein letztes Mal um und sah, dass Calendar uns nachblickte, während der Junge mit dem Lederpanzer seine Geschichte hervorsprudelte. Der Polizist sah aus, als sei er an unserem Abgang wesentlich mehr interessiert als an der Aussage des Gassenjungen.
Erst jetzt fielen mir auf dem Rückweg zwischen all den Patriziern in ihren teuren Gewändern, zwischen den Seeleuten, Bewaffneten und Dienstboten, den Mönchen und Priestern sowie den wenigen Frauen – fast ausnahmslos in der Kleidung von Bediensteten – die Gassenjungen auf. Sie waren überall, wo sich ein größerer campo auftat, zumeist zu zweit oder zu dritt, zerlumpte, zierliche Gestalten, die sich an den Hauswänden herumdrückten wie ihre eigenen Schatten und allen Blicken auswichen. Sie erinnerten mich an die Ratten, die man in unbelebten Gassen in der Abenddämmerung sieht: scheu und zugleich jederzeit bereit zuzufassen, wenn sie Beute wittern. Die meisten Sklaven, die von den reichen Patriziern für teures Geld direkt von den Galeeren weg gekauft wurden, führten ein behüteteres Dasein als sie, deren Eltern vermutlich bereits ein ähnliches Leben geführt hatten.
Schweigsam stapfte ich an Manfridus’ Seite dahin und spürte noch immer das knochige Gelenk des Gassenjungen in meiner Hand. Als hätte ich versucht, einen kleinen Vogel festzuhalten.
3
In der Trinkstube der Herberge saß der Arzt, den ich über Michael Manfridus herbeordert hatte, vor einem Becher Wein. Er war ein korpulentes Männchen mit einem zerknautschten Gesicht und einer knolligen Nase, ganz in Schwarz gekleidet und sich seiner Bedeutung absolut sicher. Als er uns hereinkommen sah, blickte er auf, als hätten wir ihn in einer tiefsinnigen Betrachtung gestört. Dann erinnerte er sich offenbar daran, dass ich es gewesen war, von dem er das Geld für seinen Besuch erhalten hatte, und begann auf mich einzureden. Manfridus machte ein peinlich berührtes Gesicht und schien nichts mehr zu fürchten, als mir womöglich die Diagnose eines Frauenleidens übersetzen zu müssen. Er eilte um Hilfe in die Küche der Herberge, wo seine Frau lautstark rumorte.
Clara Manfridus übertrug mir die Worte des Arztes mit säuerlicher Miene: »Er sagt, Ihre Gefährtin leidet an den Nachwirkungen der Reise. Anders als bei einem Mann sind die inneren Organe der Frau nicht fest an ihrem Platz, deshalb können sie bei harten Stößen durcheinander geraten und Unwohlsein verursachen. Er meint, Frauen sollten aus diesem Grund nicht reisen, sondern zu Hause bleiben. Er sagt, wenn Ihre Gefährtin ein paar Tage ruhig liegt, dann gleiten die Organe von allein wieder an ihren richtigen Platz, und alles ist in Ordnung.«
Der Arzt schob die Lippen vor und nickte gönnerhaft, als sei ihm eine Diagnose aus seinem eigenen Mund in jeder Sprache verständlich und zeuge außerdem von tiefer Einsicht in die Anatomie des Menschen.
»Er empfiehlt einen Aderlass. Er hat damit nur auf Sie gewartet, weil es nicht schicklich wäre, den Aderlass in Abwesenheit des Ehemannes auszuführen. Ich habe darauf verzichtet, ihm Ihre besonderen Familienverhältnisse zu erläutern.«
»Einen Aderlass? Nach einem Schwächeanfall?«
»Der Kerl würde selbst einen Bluter zur Ader lassen, wenn ihm nichts anderes einfällt. Sie haben Ihr Geld zum Fenster hinausgeworfen.«
»Ihr Mann hat mir den Arzt empfohlen.«
»Ihn trifft keine Schuld. Er hätte Ihnen jeden beliebigen Arzt empfehlen können. Jeder hätte eine andere fantastische Erklärung gehabt, die alle gleich weit von der Wahrheit entfernt gelegen hätten.« Sie wandte sich zu dem Arzt um und redete mit honigsüßem Lächeln auf ihn ein. Er riss die Augen auf, machte eine indignierte Miene, schüttelte den Kopf und verneigte sich schließlich zum Abschied knapp vor mir. Beim Hinausgehen trank er noch schnell den letzten Schluck Wein aus seinem Becher.
»Ich habe ihm gesagt, dass bei Ihnen zu Hause andere Sitten herrschen und Sie sich erst noch bedenken müssen. Das schafft ihn uns vom Hals.«
»Und jetzt? Was geschieht weiter?«
»Ich werde mich selbst darum kümmern. Ihr Männer habt keine Ahnung, was eine Frau braucht.«
Sie schritt brüsk an ihrem Mann vorbei, eine schlanke Frau mit herben, doch ansprechenden Gesichtszügen, die gewohnt war, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Vermutlich machte sie das zur Außenseiterin unter ihren Geschlechtsgenossinnen; es sei denn, man erkannte ihre Herkunft aus dem als exotisch geltenden Herzogtum Mailand als mildernde Umstände an. Ich fragte mich, ob ihre deutlich zur Schau getragene Verärgerung mit dem Arzt oder mit mir oder mit der Welt im Allgemeinen zu tun hatte. Manfridus stand in der großen Bogenöffnung zur Küche und warf mir ein entschuldigendes Lächeln zu, während er auf einer seiner hilfreichen Nüsse herumkaute. Ich stieg die enge Treppe zum Dachgeschoss hinauf, um endlich das zu tun, wonach es mir am meisten verlangte: nachzusehen, wie es meiner Gefährtin ging.
Jana saß halb aufgerichtet auf dem Lager, das Clara Manfridus und Julia ihr bereitet hatten. Sie war blass, aber bei unserer Ankunft in Venedig hatte sie noch schlechter ausgesehen. Die Schatten unter ihren Augen waren nicht mehr ganz so tief, und sie hatte sich schon wieder weit genug erholt, um sich von Julia kämmen zu lassen. Sie genoss die Bewegungen sichtlich, mit denen Julia den Kamm durch ihr honigfarbenes Haar gleiten ließ. Als ich mit dem üblichen Gepolter zur Tür hereinkam, blickte sie auf. Die venezianischen Architekten hatten ihre Türdurchlässe für deutlich schmalere Schultern als die meinen konstruiert, und es gab kaum eine Tür, in der ich in meiner aufwändigen florentinischen Kleidung nicht zuerst hängen blieb, bevor ich mich hindurchwinden konnte.
Ich sah Jana an, und eine Woge der Liebe für sie überkam mich gleichzeitig mit der Sorge, die seit dem Tod meiner Frau Maria vor neun Jahren meine stete Begleiterin geworden war. Auf dem Weg von Florenz nach Venedig hatte sich Janas Gesundheitszustand rapide verschlechtert, und kurz vor der Lagunenstadt hatte ich sie ohnmächtig in der Tragesänfte gefunden, die seit einigen Tagen ihr Pferd ersetzt hatte. Ich wusste nicht einmal, wie lange sie schon so in der Sänfte gelegen hatte, von den Schritten der beiden Maultiere grob herumgestoßen. Ich schüttelte sie so lange und schrie auf sie ein, bis sie wieder zu sich kam, wobei mein eigener Herzschlag in meinen Ohren mir kaum weniger laut als mein Gebrüll erschien.
Ich schrieb ihre schlechte Verfassung der Aufregung in Florenz zu. Jana stellte diesbezüglich keinerlei Vermutungen an. Sie war der Meinung, es würde sich von allein herausstellen, woran sie litt, und bis dahin bräuchte sie nur Ruhe. Ich war überzeugt, dass sie etwas vor mir verbarg, und dies diente nicht gerade dazu, meine Sorge zu schmälern.
Jana öffnete die Augen und lächelte mich an.
»Wie geht es dir?«, fragte ich.
»Jeden Tag besser. Ich habe sogar Hunger. Wie ein Bär, wenn du es genau wissen willst.«
»Clara Manfridus hält den Arzt für inkompetent.«
Jana lachte. »Ich verzeihe dir, dass du ihn auf mich losgelassen hast. Aber Clara hat Recht.«
»Hat er dich überhaupt untersucht?«
»Er wollte warten, bis mein Ehegatte oder wenigstens ein männlicher Verwandter im Raum wären. Als Clara ihm erklärte, dass du mit ihrem Mann geschäftlich unterwegs seist und deine Rückkehr lange dauern könnte, erklärte er sich schließlich bereit, mir den Puls zu fühlen.« Sie riss einen Wollfaden ab, der von ihrem Handgelenk herabhing. »Er band mir diesen Faden um und versuchte, meinen Herzschlag darüber zu spüren. Er war peinlichst bemüht, mich nicht zu berühren.«
»Glaubt er, du hast etwas Ansteckendes?«
»Aber nein. Clara hat mir erläutert, dass man es hier mit der Schicklichkeit sehr genau nimmt. Es hat schon mehr als ein Arzt seine Zeit im Gefängnis verbracht, weil man ihn beschuldigte, sich einer Patientin zu sehr genähert zu haben.«
»Indem er ihr den Puls fühlte!«
Sie zuckte mit den Schultern und lächelte gleichzeitig. »Darf ich dich daran erinnern, dass man bei euch mit dem Nachthemd badet vor lauter Schamgefühl?«
»Das hast du mir gründlich ausgetrieben.«
»Keinen Tag zu früh. Nachdem ich ihm dann den Gefallen getan hatte, ihn einen Blick auf meinen Urin werfen zu lassen, verließ er mich und ging nach unten, um auf den Herrn der Schöpfung zu warten.«
»Ich – nun, besser gesagt, Clara – hat ihn von weiteren Pflichten entbunden.«
»Das sieht ihr ähnlich.« Sie wandte sich an Julia und rieb sich den Bauch. »Ich habe jetzt genug von der Suppe. Sei so gut und kümmere dich darum, dass ich heute noch etwas Anständiges in den Magen bekomme. Wenn du etwas auf dem Markt kaufen musst, frag Clara um Rat, und lass dir Geld geben. Sie soll es auf unsere Rechnung setzen.«
Julia nickte und drückte sich an mir vorbei zur Tür hinaus. Ich setzte mich zu Jana auf das Lager und nahm eine ihrer Hände in die meinen. Ich versuchte, nicht allzu sorgenvoll zu klingen; ich wusste, wie sie es hasste, wenn ich meinen schwarzen Gedanken zu sehr nachgab.
»Jana …«
»Also, was wollte Manfridus so Wichtiges von dir? Ich hoffe, du hast ihm gesagt, dass seine Frau mich besser pflegt als meine eigene Mutter.«
Ich seufzte. »Ich habe ihn und seine Familie in den Himmel gehoben. Manfridus hat geschäftliche Kontakte zu einer Patrizierfamilie namens Dandolo; alter Adel, sie stammen von dem Dogen Enrico Dandolo ab, der vor fast dreihundert Jahren Konstantinopel besiegt und den Reichtum Venedigs begründet hat.«
»Das ist ein Kontakt, den man pflegen sollte.«
»Manfridus pflegt ihn auch ganz beträchtlich. Er hat der Familie sogar schon den weisen Rat des unvergleichlichen Schurkenfängers Peter Bernward angeboten.«
»Was meinst du damit?«
»Heute besteht die Familie Dandolo im Wesentlichen aus zwei Brüdern: Fabio und Enrico. Beide sind Kaufleute; Fabio ist mehr, Enrico weniger erfolgreich. Fabio hat seinen ältesten Sohn Pegno ins Haus seines Onkels Enrico gegeben, angeblich, um dort das Handwerk zu lernen. Enrico hat nur Töchter, und ich nehme an, nach Enricos Tod sollen die Häuser so zu einem zusammengeführt werden.«
»Und in der Zwischenzeit erhält Pegno Einblick in alle geschäftlichen Transaktionen, sodass Fabio das Geschäft seines Bruders steuert, noch bevor dieser weiß, wie ihm geschieht.«
»Ich kann mir schon vorstellen, dass du hinter jedem familiären Schachzug gleich eine Intrige siehst.«
Sie winkte ab. »Wo liegt nun das Problem, das du lösen sollst?«
»Das Problem ist, dass Pegno vor zwei Tagen spurlos verschwunden ist.«
Janas Augen weiteten sich. »Der Erbe der beiden Häuser? Fürchten die Familien jetzt, dass er sein künftiges Vermögen mit schlechten Frauen und Saufbrüdern durchbringt?«
»Das ist noch nicht alles«, sagte ich grimmig. »Vor wenigen Stunden hat man eine Leiche aus dem See im Arsenal geborgen. Enrico ist überzeugt, dass es sich um Pegno handelt.«
»Du meine Güte! Ist der junge Mann von seinen Saufkumpanen erschlagen worden?«
»Jana, Pegno war ein Kind, gerade mal vierzehn Jahre alt.«
Sie verzog das Gesicht in echtem Mitgefühl. »O Peter, das tut mir Leid.«
Ich zuckte mit den Schultern, aber die Sache ließ sich nicht so leicht abstreifen, wie ich glauben machen wollte. Ich beschloss, wieder zu meinem ursprünglichen Thema zurückzukehren.
»Jana, geht es dir wirklich besser?«
»Natürlich!« Sie strich mir über die Wange. Ich hielt ihre Hand fest. Sie lächelte. »Weißt du übrigens, wen sie zum Dogen gewählt haben, während wir in Florenz waren?«
»Nein, woher sollte ich?«
»Giovanni Mocenigo.«
Ich lachte laut auf, und Jana spitzte schmollend die Lippen. »Wenn er erfährt, dass ich hier bin, lässt er uns aus der Stadt prügeln.«
»Jede schlechte Tat rächt sich. Du hättest bei unserem ersten Besuch hier, als er noch Kaufmann war, vielleicht doch nicht die Gewürzhändler in der Lagune bestechen und ihm das Geschäft vermasseln sollen.«
»Dass mich diese kleine Finte mein Lebtag verfolgt, habe ich nicht geahnt«, stöhnte sie halb zum Spaß. »Jedenfalls ist es mit der Geschäftemacherei hier vorbei. Sobald mein Name irgendwo laut wird, wird er Mittel und Wege finden, den Handel zu hintertreiben. Denn verziehen hat er mir sicher noch nicht.«
»Was willst du tun? Dich im Bett verstecken, solange wir hier sind?«
»Nie im Leben! Ich habe die Nase voll vom Herumliegen.« Sie gönnte mir einen Augenaufschlag. »Du hast auch nichts getan, um mir die Zeit hier zu verkürzen.«
»Jana«, rief ich halb entrüstet, »du warst krank. Du hast die meiste Zeit geschlafen.«
»Nun bin ich wach.«
Ich beugte mich vor, um sie zu küssen. Die Tür sprang auf, und Julia kam herein. Sie räusperte sich. »Es gibt Fisch und eingelegtes Gemüse«, meldete sie. »Aber nur, wenn Sie zuvor die Buchweizensuppe essen, sagt Monna Clara.«
Jana ächzte und sah mich an wie eine leidende Märtyrerin. »Dann werde ich wohl meine Toilette machen, damit ich nach unten gehen kann.«
Ich stand auf und küsste sie zum Abschied auf die Stirn. Julia machte sich bereits an einer von Janas neuen Reisetruhen zu schaffen. Unsere alten Besitztümer waren dem Aufstand in Florenz zum Opfer gefallen, aber Lorenzo de’ Medici hatte es sich nicht nehmen lassen, uns den Verlust zu ersetzen. Das Ergebnis war, dass wir alle – Julia eingeschlossen – schöner und kostspieliger gekleidet waren als je zuvor. Beim Hinausgehen wurde mir bewusst, dass auch mein zweiter Versuch, Jana eine ehrliche Aussage zu ihrem Gesundheitszustand zu entlocken, von ihr erfolgreich durchkreuzt worden war.
Auf halbem Weg kam mir Clara Manfridus entgegen. Sie führte eine ältere, füllige Matrone in schlichten Gewändern und eine junge, blassgesichtige Frau mit einer kugeligen Kopfbedeckung die Stufen hinauf. Die beiden Frauen senkten den Blick, als ich mich an ihnen vorbeischob. Clara Manfridus nickte mir kurz zu und setzte den Weg mit ihren Begleiterinnen fort. Eine von ihnen hinterließ den schweren Duft eines Blumenparfüms, der in der muffigen Luft des engen Treppenhauses hängen blieb. Es bedurfte keiner Erklärung, um zu begreifen, dass die drei zu Jana unterwegs waren. Clara Manfridus hatte die Sache in die Hand genommen und den Arzt gegen eine Kräuterkundige ausgetauscht. Aus unerfindlichem Grund fühlte ich mich plötzlich als Außenseiter in einer Sache, die nur die Frauen etwas anzugehen schien, und zu meiner Sorge gesellte sich ein eifersüchtiger, kleinlicher Ärger.
Zweiter Tag
1
Am nächsten Morgen führte uns der dreizehnjährige Marco Manfridus zum Campo San Polo, um mit uns den Auftritt einer Schauspieltruppe zu besuchen. Er war gestern in die Schankstube geplatzt, während wir aßen, und hatte seinen Vater atemlos um die Erlaubnis gebeten, mit seinen Freunden die Aufführung sehen zu dürfen. Manfridus hatte vehement abgelehnt, und das Gesicht des jungen Burschen war so lang geworden, dass Jana sich einmischte und anbot, dass wir ebenfalls das Stück ansehen und auf Marco Acht geben würden. Es handelte sich laut Marcos Aussage um die Lebensgeschichte des heiligen Markus, und da sei es nur zu verständlich, dass der junge Mann sich für das Stück interessiere. Ich wusste nicht, ob Michael Manfridus’ Weigerung der Befürchtung entsprang, sein Sohn würde Unfug anstellen, oder ob er vom gestrigen Fund des Leichnams noch zu sehr erschüttert war; jedenfalls hatte er nach Janas Angebot kein überzeugendes Argument mehr parat und gab nach. Außerdem zeigte uns sein unterdrücktes Grinsen, als Marco Manfridus freudestrahlend in die Küche hinausschoss, dass er es seinem Sohn in Wahrheit von Herzen gönnte.
Der Campo San Polo lag westlich von der Rialto-Brücke, erreichbar durch eine gepflasterte Hauptgasse ähnlich der, die uns gestern zum Markusplatz geführt hatte – ein Pfad, der sich nach jeder Ecke zu unterschiedlicher Weite öffnete oder verengte und ebenso viele Abbiegungen und seitlichen Versatz hatte wie Pflastersteine auf seinem Boden. Ich versuchte vergeblich, mir die vielen Kreuzungen zu merken, durch die uns Marco führte; am Ende blieb nur die Erinnerung an die Kirche mit der großen Uhr und dem weit ausgreifenden Portikus gleich nach der Brücke, in dessen Schatten die Geldwechsler und Bankiers saßen, sowie eine kleine Brücke mit der Bezeichnung ponte delle tette, deren Namen Marco unbefangen mit der Häufung von Freudenhäusern in ihrer unmittelbaren Umgebung erklärte. Der campo war gepflastert, ein weiter, unregelmäßig geformter Platz, der sich überraschend öffnete, nachdem man halb gebückt unter finsteren Arkaden hindurchgekrochen war, die sich sottoporteghe nannten, weit verbreitete Ergänzungen des Gassennetzes darstellten und manchmal weniger als schulterhoch direkt durch die Häuser hindurchzuführen schienen. Der Campo San Polo stand an Größe dem Markusplatz nur wenig nach. An ein paar Stellen wucherte Gras aus weiten Spalten zwischen dem Pflaster, und die Behörden hatten angeordnet, eine kleine Hand voll Bäume stehen zu lassen, die ihre frühmorgendlich langen Schatten über den Boden warfen.
An der Westseite des Platzes, halb vor einer scheinbar neu gebauten Kirche und einem weiteren Stadtpalast, erhob sich die Bühne der Schauspieler. Diese war fast mannshoch, sodass es auch dem Hintersten eines großen Publikums möglich sein würde, die Vorführungen mitzuverfolgen. Es musste sich um eine bekannte Truppe handeln, denn ihre Bühnenausrüstung beschränkte sich nicht auf die üblichen naiv bemalten Säcke, die Wände, Säulen oder Wälder darstellten sollten – zu ihrer Bühne gehörte ein wenigstens drei Mannshöhen großer Aufbau, der weit auf den Platz hinaus mit einem Gerüst abgestützt war, eine himmelblaue protzige Bemalung zeigte und an seiner der Bühne zugewandten Seite aus Holz ausgesägte weiße Wolken an verschieden langen Stangen trug, sodass dieser Himmel tatsächlich eine Tiefenwirkung besaß und an Echtheit kaum zu überbieten war. Um die Bühne herum waren Bahnen aus Sackleinen angebracht, die bis auf den Boden reichten, und der Raum unter der Bühne diente den Männern und Frauen als Aufenthalts- wie als Schlafraum. Die meisten Stoffe waren hochgeschlagen, um das Licht des frühen Vormittags in den finsteren Verschlag zu lassen. Eine der heruntergelassenen Leinwände war mit einem Wappentuch zusammengeheftet, als legte der Besitzer des Wappens großen Wert darauf, es jedem Besucher des Schauspiels zu zeigen, und ich verbrachte einige ergebnislose Minuten damit, nachzudenken, wo ich es schon einmal gesehen hatte.
Obwohl wir zu früh dran waren, befand sich schon eine Menge Volk auf dem Campo San Polo. Marco Manfridus drängte sich unbekümmert hindurch und interessierte sich für alles, was auch nur entfernt mit dem Treiben der Schauspieler in Verbindung zu stehen schien. Ich warf Jana einen Seitenblick zu, doch die Hast des Jungen schien ihr nichts auszumachen; sie lächelte mit erhitzten Wangen und raffte ihr Kleid, wenn der unebene Boden sie stolpern ließ.
Die Menschenmenge hatte auch die üblichen Bettler angezogen, die sich langsamer als wir durch das Gedränge schoben und um Almosen baten. Die Krüppel hatten sich dicht vor der Bühne versammelt, von wo man sie ohne Zweifel beim Beginn der Aufführung vertreiben würde; doch noch humpelten oder krochen sie oder wälzten sich herum, um ihre Gebrechen zu zeigen. Eine Frau hatte sich das schmutzige Kleid bis fast zum Schoß hochgeschlagen und die Ärmel aufgekrempelt. Die Haut an ihren Beinen und Armen war wund, von Pusteln und Geschwüren übersät, sie heulte in einem monotonen Klagelied, und selbst die anderen Krüppel machten einen Bogen um sie. Die Bürger warfen von ferne Münzen vor die Füße der Jammergestalten und bemühten sich ansonsten, sie zu ignorieren. Auch die Gassenjungen waren allgegenwärtig; ich rückte meine Börse nach vorn, hielt die Hand darauf und bat Jana, ebenfalls Acht zu geben. Ich wusste nicht, ob der Bursche darunter war, der mich zu bestehlen versucht hatte, aber ich sah eine magere Gestalt mit einem ledernen Wams und erkannte einen der eifrigen Zeugen von gestern wieder.
Eine Konstruktion nicht unähnlich der eines Galgens stand an einer Seite der Bühne und ragte mit dem Arm über den Wolkenhimmel hinaus. Durch zwei wuchtige Eisenringe am Ende des Arms führte je ein dick eingefettetes Seil, an dem eine Art lederner Harnisch hing. Über ein Rad am Fuß der Bühne ließen sich die Seile auf- oder abwickeln. Eine zweite Maschine mitten unter der Bühne bestand aus einer kleinen Plattform und einer komplizierten Mechanik, deren Seilzüge und Steingewichte dazu dienten, jemanden durch eine Falltür auf der Bühne so schnell wie möglich nach oben zu befördern. Die dritte Apparatur war einfach: Zwischen den Wolken hing eine Schale, die über ein Seil, das durch den Bühnenhintergrund nach unten auf den Boden führte, ausgekippt werden konnte.
Ein halbes Dutzend junger Burschen im Alter zwischen etwa zehn und sechzehn Jahren kümmerte sich um die Belange der Schauspieler oder schleppte Kulissen heran.
Wegen des erbaulichen Charakters des Stücks hatten einige Bürger ihre Frauen und Töchter mitgebracht, und vor allem Letztere machten den Jungen verstohlen schöne Augen. Marco Manfridus versuchte ergebnislos, die Blicke einer zarten blonden Schönheit auf sich zu lenken, und machte ein eifersüchtiges Gesicht. Einer der Jungen, ein schmaler, dunkler Kerl von höchstens vierzehn Jahren mit einem wilden Haarschopf und strahlend blauen Augen, wurde von einem älteren Mann angesprochen, und was dieser zu sagen hatte, hörte sich offenbar so interessant an, dass der Junge das tönerne Gefäß in seiner Hand vergaß und zuhörte. Der Mann machte einen Scherz, und der Junge lachte.
Ich hatte den Mann zuerst für einen Söldnerhauptmann gehalten: Er trug einen festen ledernen Harnisch mit beweglichen Schulterstücken, enge Hosen und hohe Stiefel, doch er hatte zu große bronzene Manschetten an den Handgelenken und zu viele Ringe an den Fingern, um wirklich einer zu sein. Sein Kopf war kahl geschoren und sein Gesicht im Seitenlicht der noch tief stehenden Sonne ein Abbild der Ausschweifung. Vielleicht stellte er einen der Folterknechte dar, die dem heiligen Markus zu seinem würdigen Abgang verhalfen.
»Hast du die Apparaturen gesehen?«, fragte Jana. »Wozu sind sie gut?«
»Mit dem Galgen kann man die Himmelfahrt von Heiligen oder den Abstieg von Engeln aus den himmlischen Gefilden simulieren.«
»Und die Plattform?«, erkundigte sich Marco.
Ich spähte unter die Bühne. Die zwei Muskelpakete, die die bewegliche Plattform bedienten, kurbelten sie hinauf und hinunter und ließen die Falltür klappern, misstrauisch beobachtet von einem bärtigen jungen Mann mit langem Haar. »Ich habe keine Ahnung. Du bist doch hier zu Hause.«
»Ich sehe so etwas zum ersten Mal.« Er grinste Jana dankbar an. »Dank Ihnen.«
Der alte Mann, der für die Bedienung des Galgens ausersehen war, nahm davon Abstand, dessen Funktion zu überprüfen. Er saß auf dem Boden, mit dem Rücken an sein Gerät gelehnt, und ließ das Keifen eines alten Weibes über sich ergehen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Schließlich wandte sich die Alte ab, nicht ohne vorher auf den Boden gespuckt zu haben. Als Kommentar darauf gab der Mann ein markerschütterndes Rülpsen von sich.
»Der ist ja stockbesoffen«, staunte Jana. Marco Manfridus kicherte. Als ich mir ansah, welche Aufgabe dem betrunkenen Alten an dem Galgen zugedacht war, ließ sich eine unheilvolle Ahnung nicht ganz verdrängen.
Ich achtete zunächst nicht weiter darauf, als sich etwas abseits heftige Stimmen erhoben; die Atmosphäre unter den Schauspielern, so kurz vor der Aufführung, schien für Streitereien wie geschaffen zu sein. Doch dann sah ich aus dem Augenwinkel, wie jemand zu Boden gestoßen wurde. Einige andere bemerkten es ebenfalls, und sofort bildete sich ein Kreis von Neugierigen.
Ein beleibter Mann mit den bunten Kleidern der Schauspieler, aber ohne die grelle Schminke im Gesicht, stand neben dem Jungen mit dem Tongefäß. Der Kerl mit dem Lederharnisch rappelte sich soeben vom Boden auf. Der Schauspieler trat einen Schritt zwischen den Jungen und ihn und hob drohend eine Faust. Der zu Boden Gestoßene bewegte sich bedächtig, aber seine Langsamkeit zeugte nicht von körperlicher Schwäche. Der dicke Schauspieler beging einen fatalen Fehler, wenn er meinte, er könnte seinen Gegner ein zweites Mal bezwingen. Der Mann im Lederharnisch wischte sich Staub vom Hosenboden; seine Hände wirkten steif vor mühsam unterdrückter Wut. Um ihn herum waren Münzen verstreut, und eine offene Börse lag zu seinen Füßen. Er bückte sich, um sie aufzuheben, und ich erwartete, dass er dem Dicken den Kopf in den Leib stoßen würde, doch er richtete sich wieder auf und sah sich scheinbar suchend um. Ich spürte, wie Jana ihre Hand auf meinen Arm legte.
»Er hat ein Messer im Stiefel«, flüsterte sie. »Als er sich aufrichtete, habe ich es gesehen. Der Dicke hat sich übernommen.«
Plötzlich erstarrte der Mann mit dem Lederharnisch. Ich folgte seinem Blick. Zwischen den Neugierigen stand eine dunkle, schlanke Gestalt und betrachtete den Zwischenfall mit ausdrucksloser Miene: Paolo Calendar. Es schien, als würde dem Lederträger die Luft abgelassen. Er maß sich mit Calendars Blick, verlor und sah zu Boden, als würde er überlegen, ob er die zerstreuten Münzen aufheben wolle. Dann warf er die leere Börse weg und stapfte schwerfällig davon. Als ihm ein paar Zuschauer nicht rechtzeitig auswichen, stieß er sie durch einen Ruck mit der Schulter unsanft beiseite.
Calendar missachtete die neugierigen Blicke der Leute. Die Menge begann sich zu zerstreuen, und er schlenderte zu uns herüber. Er nickte Marco zu, ignorierte Jana und wandte sich an mich. »Was tun Sie hier?«
»Ich habe vor, mich am Martyrium des heiligen Markus zu ergötzen. Was bedeutete dieser Auftritt eben?«
Die Aufmerksamkeit der Umstehenden hatte sich inzwischen auf uns verlagert, doch Calendar tat weiterhin, als würde er es nicht bemerken. »Sie sind immer dort, wo Sie nicht hingehören.«
»Der Kerl mit dem Lederharnisch schien Sie zu kennen. Warum haben Sie ihm nicht geholfen? Der Dicke hat doch mit dem Streit begonnen.«
»Der ›Kerl‹ ist Barberro, der Sklavenhändler«, erwiderte Calendar und vermied dabei jede Betonung.
Ich sah zu dem Jungen hinüber, der zerknirscht dastand, während der dicke Mann ihm eine Standpauke hielt. Ganz offensichtlich handelte es sich bei dem Dicken um den Anführer der Schauspieler. Die Münzen aus der Börse, die die Nächststehenden mittlerweile eingesteckt hatten, waren offensichtlich ein Kaufangebot des Sklavenhändlers gewesen. Jana machte ein verächtliches Geräusch.
»Hat es sich geklärt, ob der Tote aus dem Arsenal Pegno Dandolo war?«, fragte ich.
»Ich dachte, Sie haben mit der Sache nichts zu tun.«
»Der Junge tut mir Leid.«
»Passen Sie auf Ihre Börse auf«, sagte Calendar und schob sich durch die Zuschauer. Ich sah ihm hinterher; er ging in dieselbe Richtung wie Barberro.