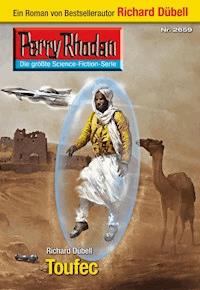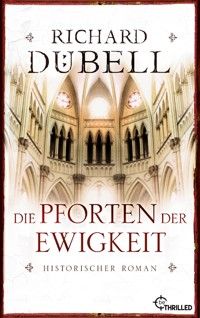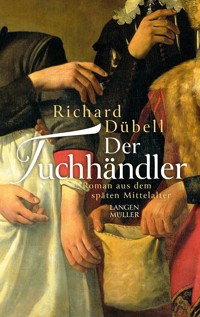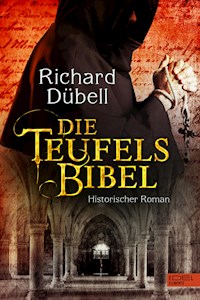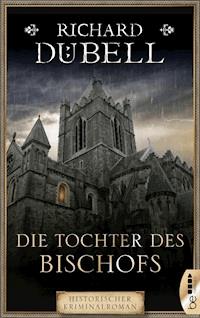9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Berlin in den Zwanziger Jahren: Der atemlose Tanz auf dem Vulkan Berlin 1921: Der erste Weltkrieg ist seit drei Jahren zu Ende und wirft dennoch lange Schatten, auch auf die Familie von Briest. Otto und Hermine von Briest stehen kurz vor dem Bankrott. Alle Hoffnungen liegen nun auf Tochter Luisa, die beim Film Karriere machen soll. Trotz Inflation und Wirtschaftskrise strömen die Menschen in die Varietés, die Lichtspielhäuser und auf die neu entstandenen Autorennstrecken. Auch Luisa von Briest ist dem Rausch der Geschwindigkeit verfallen. Sie hat sich in einen erfolgreichen Rennfahrer verliebt. Doch ein Rausch birgt auch Gefahren - nicht nur in der Liebe: Am Horizont ziehen bereits die dunklen Wolken des Nationalsozialismus auf, und die Familie von Briest sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. Der fulminante Höhepunkt von Richard Dübells "Jahrhundertsturm"-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Die Weimarer Republik 1921: Der Erste Weltkrieg ist seit drei Jahren zu Ende und wirft dennoch lange Schatten, auch auf die Familie von Briest. Otto und Hermine von Briest stehen kurz vor dem Bankrott. Ihre Tochter Luisa hofft auf eine Karriere beim Film. Trotz Inflation und Wirtschaftskrise strömen die Menschen in die Varietés, die Lichtspielhäuser und auf die neu entstandenen Autorennstrecken. Dort versucht sich Max Brandow zu beweisen, der Ziehsohn der Briests. Otto und Hermine haben ihn vor einem Ende in der Gosse bewahrt. Max bindet ein Versprechen an die Briests und vor allem an Luisa, dem er alles unterordnet – auch sein persönliches Glück. Den Rausch der Geschwindigkeit sucht auch Sigurd von Cramm, dessen Familie mit den Briests seit Generationen verfeindet ist. In den extremen politischen Strömungen der Zeit findet er eine neue Heimat – und eine Möglichkeit, den Untergang der Briests voranzutreiben.
Der Autor
Richard Dübell, geboren 1962, lebt in Landshut. Als Autor von historischen Romanen stürmt er seit Jahren die Bestsellerlisten. Mit Der Jahrhundertsturm und Der Jahrhunderttraum legte er den Grundstein für die große Deutschland-Saga, die nun mit Das Jahrhundertversprechen fortgesetzt wird.
Besuchen Sie den Autor unter: www.duebell.de
Von Richard Dübell sind in unserem Hause bereits erschienen:
Der Jahrhundertsturm · Der Jahrhunderttraum · Allerheiligen · Himmelfahrt
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1601-7
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Juni 2018
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © getty images/Heritage Images/Kontributor
(Hintergrund, Auto); getty images/ClassicStock/© H. Armstrong Roberts (Frau)/ © akg-images (Innenklappen: Stadtansicht)
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Wenn ich alle Gründe aufzählen würde, warum ich ihr danken möchte, würde diese Danksagung länger als der Roman.
Daher nur: Danke, Christine. Du bist die Liebe meines Lebens. Und ohne Dich gäbe es die nachfolgende Geschichte gar nicht.
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild.
1. Korinther 13,12
Ein gegebenes Versprechen ist eine unbezahlte Schuld.
William Shakespeare
1
Der Junge rannte um die Ecke und blieb schlagartig stehen, als er sah, dass in der Agentur Licht brannte. Er stützte die Hände auf die Knie und schüttelte den Kopf. Er hätte erbittert geflucht, wenn er dafür genügend Luft gehabt hätte. Aber er keuchte und rang nach Atem. Er war die ganze Strecke vom Stadtschloss her gelaufen.
Der Junge hieß Max Brandow und war vierzehn Jahre alt. Das Haus, in dem das Licht brannte, stand an der Ecke Friedrichstraße/Taubenstraße. Es beherbergte die Detektivagentur von Otto und Hermine von Briest. Max hatte gehofft, dass die Briests am Abend zuvor schon aus Berlin abgereist wären und die Agentur über Weihnachten geschlossen hätten. Er hatte einen Fehler gemacht. Er hätte nicht hoffen, sondern die Briests warnen sollen. Verdammt!
Aber gestern Nachmittag hatte er zum ersten Mal seit Tagen wieder etwas Warmes zu essen bekommen. Die Revolutionäre von der Volksmarinedivision, die sich im Stadtschloss einquartiert hatten, hatten eine ganze Anzahl von Gassenjungen in das besetzte Gebäude geholt und ihr Essen mit ihnen geteilt. Viele Matrosen wussten, was es bedeutete, im Dezember ohne warme Kleidung und ohne Nahrung durch Berlin zu streifen. Es hatte auch Bier gegeben. Max hatte einiges davon getrunken und es danach nicht mehr über sich gebracht, am Abend noch einmal durch Regen und Kälte loszulaufen und die Briests über das zu benachrichtigen, was er gehört hatte. Er war davon ausgegangen, dass Otto angesichts des Datums – zwei Tage vor dem Heiligen Abend – und der Situation in der Stadt ohnehin mit seiner Familie auf sein Gut bei Genthin fahren würde. Er hatte sich getäuscht. Er hätte Otto von Briest besser kennen müssen. Er hatte einen riesendämlichen Fehler begangen. Aber er würde ihn wiedergutmachen! Keuchend, mit schmerzenden Füßen und Seitenstechen setzte er sich wieder in Bewegung und lief über die Friedrichstraße, um zu klingeln. Vom Stadtschloss her glaubte er, den Tritt von marschierenden Stiefeln zu hören und vereinzeltes Gewehrfeuer. Es war natürlich nur Einbildung, weil der Schall nicht so weit trug. Oder doch? Max wusste, wie sich Gewehrfeuer in den Gassen einer Stadt anhörte. Der Krieg war zu Ende, aber die Gewalt war weitergegangen und hatte sich von den Schützengräben der erstarrten Front in die Häuserschluchten der Reichshauptstadt begeben.
Anfang Oktober hatte das Deutsche Reich um einen Waffenstillstand nachgesucht. Ende Oktober hatte die Oberste Heeresleitung den Rückwärtsgang eingelegt und die Fortführung des Kriegs befohlen, weil ihr die Waffenstillstandsbedingungen der Alliierten als unannehmbar erschienen. Der in Kiel liegenden Kaiserlichen Flotte war befohlen worden, zu einer Schlacht gegen die britische Flotte auszulaufen. Die Matrosen hatten gemeutert. Sie hatten nicht in einer sinnlosen Schlacht geopfert werden wollen. Sie wollten nach Hause, so wie die Soldaten an der Front. Sie wollten ein Ende des Kriegs, so wie ihre Familien zu Hause. Sie wollten den Kaiser abgesetzt und eine neue Regierung an der Macht sehen, die nach vier Jahren Krieg endlich den Frieden brachte.
Ihre Befehlsverweigerung hatte eine Revolution ausgelöst, die innerhalb weniger Tage das Deutsche Kaiserreich hinwegfegte. Kaiser Wilhelm war ins niederländische Exil geflohen, nachdem Reichskanzler Max von Baden, ohne die kaiserliche Entscheidung abzuwarten, seine Abdankung publik gemacht und das Ende der Monarchie verkündet hatte. All das hatte man erfahren können, wenn man wie Max auf der Straße lebte und die Zeitungen von vorgestern, mit denen man sich vor der Kälte schützte, auch als Lektüre nutzte.
Seitdem versuchte das Reich, sich neu zu finden: als reine Demokratie, wie sie der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vorschwebte; oder als sozialistische Republik nach sowjetischem Vorbild, wie der Spartakusbund forderte. Die Verrohung der nach vier Jahren Krieg heimgekehrten Soldaten, die Demagogen auf beiden Seiten, die Verachtung des Volks gegenüber den Politikern, das Gefühl der Bürgerschaft, von einem Schandfrieden gedemütigt worden zu sein, und die Erkenntnis des Proletariats, dass es nach jahrzehntelanger Ausbeutung und den unvorstellbaren Gräueln des Kriegs jetzt noch schlechter dastand als zuvor, verhinderten eine Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln. Eine brodelnde Gerüchteküche tat ein Übriges, die Aggressivität zu schüren. Und nicht zuletzt versetzten die vielen Todesfälle, die die Spanische Grippe seit Mitte des Jahres gefordert hatte, und die Angst vor einem noch stärkeren Aufflammen der Epidemie die Menschen in einen Zustand ständiger Panik.
Schon während des Matrosenaufstands im November hatte es Tote gegeben. Und dann wieder, als am Nikolaustag demonstrierende Spartakisten mit der regierungstreuen Soldatenwehr des Stadtkommandanten zusammengestoßen waren. Seitdem war die Lage nicht besser geworden. Die Volksmarinedivision hatte sich im Stadtschloss verschanzt und wollte es erst räumen, nachdem der lange ausstehende Sold bezahlt worden war. Die Volksbeauftragten, die die Regierung bildeten, und der von ihnen beauftragte Stadtkommandant versuchten, die Revolutionäre mit Drohgebärden und gleichzeitigen Zugeständnissen zur Räumung des Schlosses zu bewegen.
Heute, am 23. Dezember 1918, würde eine Abteilung der Volksmarinedivision zur Kommandantur marschieren, um ihren Forderungen nötigenfalls mit Gewalt Nachdruck zu verleihen. Und Max Brandow, der von diesen Plänen gestern Abend erfahren hatte, war losgerannt, um den einen Mann in Berlin und dessen Familie zu warnen, der immer gut und anständig zu ihm gewesen war.
2
Es war noch schlimmer, als Max gedacht hatte. Nicht nur Otto und seine Frau Hermine waren in der Agentur, sondern auch deren Tochter Luisa. Max hatte bislang nur Bilder von ihr gesehen; Otto, ein Freund moderner Techniken, hatte in jedem Lebensjahr eine Fotografie von ihr anfertigen lassen und Max den Stapel einmal gezeigt. Luisa war jetzt knapp elf Jahre alt. Max wusste, dass Otto und Hermine hart im Nehmen waren und sich bei Gefahr durchaus behaupten konnten. Aber das Mädchen? Ihm wurde übel bei dem Gedanken, dass er es versäumt hatte, die Briests gestern zu warnen, als noch Zeit genug gewesen wäre, gefahrlos abzureisen. Luisa, die neben ihrer Mutter in der geöffneten Tür im ersten Stock stand, schaute Max mit großen Augen an.
»Maxe, was machste denn hier – und so abjehetzt«, sagte Hermine erstaunt. Max hatte sie vom ersten Kennenlernen an dafür geliebt, dass sie ihren Berliner Dialekt nie vollständig unterdrücken konnte, selbst nach so langer Ehe mit dem perfekt Hochdeutsch sprechenden Otto von Briest nicht. »Brauchste was? Ich dachte, Otto hätte gesagt, du wärst über Weihnachten gut uffjehoben bei Verwandten aufm Land?«
Ja, dachte Max, das hab ich deinem Mann gesagt, weil ich nicht wollte, dass ihr euch Gedanken macht, ob ich Weihnachten in der Gosse verbringe oder nicht. Aber für derartige Überlegungen war jetzt keine Zeit.
»Bist du Max Brandow?«, fragte Luisa. Sie streckte dem schwitzenden Max die rechte Hand hin. »Ich bin Luisa. Ich hab schon von dir gehört.«
Max, von der Freundlichkeit Luisas überrascht, schüttelte ihr unwillkürlich die Hand und fragte sich dann, ob seine Pfote sich wirklich so dreckig und verschwitzt anfühlte, wie er befürchtete. »Mensch, Frau von Briest!«, stieß er dann hervor. »Ihr müsst hier weg! Wisst ihr denn nich, wat hier los is?«
Die Agentur bestand aus mehreren Räumen in zwei Stockwerken des Gebäudes. Im ersten Stock waren das Zimmer der Sekretärin sowie zwei weitere Räume, in denen Gehilfen arbeiteten. Im zweiten Stock hatten Otto und seine Frau zwei kleine Büros. Diese Büros waren die Keimzelle der Agentur, damals, als sie noch von ihrem Gründer Edgar Trönicke geführt worden war. Edgar war einer der ersten Privatdetektive Berlins gewesen. Otto und Hermine waren in seine Fußstapfen getreten; Hermine war Edgars Sekretärin gewesen, bevor Otto sie geheiratet hatte. Die Treppe zum zweiten Stockwerk herab kamen jetzt schnelle Schritte.
Max drehte sich um und sah Otto von Briest hinter sich stehen. Otto musste die letzten Worte von Max gehört haben. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen.
»Weißt du was Neues, Max? Komm mit rein. Willst du was Heißes zu trinken? Wir haben Tee.«
»Ick will nüscht, ick will nur, det Se Ihre Familje nehmen und schleunigst verschwinden!«, drängte Max.
»Du bist ganz nass«, sagte Otto. »Komm erst mal rein. Auf ein paar Minuten kommt’s wohl nicht an.«
Max’ Bauchgefühl sagte ihm, dass es wahrscheinlich schon auf ein paar Minuten ankam. Aber er hatte der Wärme und der Illusion von Familie, die die Detektivagentur Briest für ihn bedeutete, noch nie widerstehen können. So nahm er Ottos Gelassenheit als willkommene Ausrede dafür, diese Illusion eine kurze Weile aufrechterhalten und genießen zu können, bevor er wieder in die Kälte hinausmusste, und folgte den Briests und ihrer Tochter in die Agentur hinein.
Auf dem Tisch der Sekretärin stand ein kleiner Stapel bunt eingepackter Geschenke. Nun wusste Max, was die Briests aufgehalten hatte. Sie hatten Weihnachtsgeschenke für ihre Mitarbeiter gepackt. Wahrscheinlich hatten sie den Angehörigen der Agentur für heute freigegeben, damit diese Weihnachtsbesorgungen machen konnten – was immer das karge Hungerleiderangebot der Berliner Bäcker und Metzger hergab. Morgen würden die Mitarbeiter noch ein paar Stunden in der Agentur verbringen, während die Briests schon auf ihrem Gut waren; dann würden sie die für sie gedachten Geschenke vorfinden und für den Heiligen Abend mit nach Hause nehmen, nachdem sie die Detektei über die Feiertage geschlossen hatten. Max schluckte, als er die Namenszettel auf den Geschenken sah und auch einen entdeckte, auf dem in kindlicher Schrift – wahrscheinlich Luisas Hand – sein Name stand. Die Briests hatten auch letztes Weihnachten an ihn gedacht, als ihre »Zusammenarbeit« noch ganz frisch gewesen war. Trotzdem überraschte ihn die großzügige Geste. Erneut krümmte er sich innerlich bei dem Gedanken, dass er diese großartigen Menschen in Gefahr gebracht hatte, weil er gestern zu bequem gewesen war, noch einmal in die Dezemberkälte hinauszulaufen.
»Die Matrosen im Stadtschloss wollen det Schloss erst räumen, wennse ihre fällige Löhnung gekriegt haben«, sagte Max. »Denn sollnse die Schlüssel dem Stadtkommandanten aushändjen.«
»Ich weiß«, sagte Otto ernst. »Ich habe gehofft, dass sich beide Seiten darauf einigen können, damit der Ausnahmezustand endlich endet und es über Weihnachten kein Blutvergießen gibt … aber wenn ich dich so ansehe, befürchte ich, dass die Vernunft hüben wie drüben dazu nicht ausreicht, oder?«
»Die Matrosen trauen dem Stadtkommandanten nich. Gestern ham se beschlossen, det se det Schloss lieber eenem von den Volksbeauftragten überjeben, eenem Typ namens Emil Barth, von dem se glooben, det er eijentlich einer von ihnen ist.«
»Barth ist bei der USPD«, sagte Hermine. »Er ist ein Spartakist, der so tut, als wäre die Revolution ganz alleene auf seinem Mist gewachsen.«
»Das wird Stadtkommandant Wels nicht zulassen«, sagte Otto. »Gott, wieso müssen die Dinge immer bis zum Äußersten überreizt werden!«
»Es kommt noch schlimmer«, sagte Max düster. »Die Matrosen haben det gestern Abend schon an die Kommandantur übermittelt, und Wels hat jeantwortet, det se die Auszahlung der Löhnung verjessen können, wennse die Schlüssel zum Schloss nich an ihn übergeben.«
»Und nun?«
»Nu«, sagte Max und öffnete die Eingangstür wieder, »marschiern een paar Abteilungen von den Revolutionären zur Kommandantur und wollen Wels zwingen, die Pinke rauszurücken, und wenn det passiert, denn werden die Kugeln fliegen und denn wird die janze Untern Linden een Schlachtfeld werden wie Flandern 1917. Un det Se mit Ihrer Familje zum Bahnhof Friedrichstraße kommen, müssen Se Untern Linden überqueren, wa? Also lassen Se uns abhauen, solang et noch jeht – oder verbarrikadieren Se sich in der Agentur!«
Otto überlegte nur ein paar Sekunden lang. »Wenn das passiert, ist in Berlin nichts mehr sicher«, sagte er dann. »Wir müssen hier raus, aufs Gut. Zieht euch an. Max, du holst dir noch den Tod in den dünnen nassen Sachen. Schnapp dir den Mantel da von der Garderobe. Wir meiden die Friedrichstraße. Lasst uns hintenrum zum Bahnhof laufen, über die Kanonierstraße und die Dorotheenstädter Kirche.«
»Sie ham doch ne Wumme«, sagte Max und schlüpfte dankbar in den Mantel. »Nehmse se sicherheitshalber mit.«
»Garantiert nicht«, sagte Otto. »Wer in einem Konflikt eine Waffe zückt, muss auch damit schießen.«
»Die anderen ham die Waffen schon lange jezückt«, murmelte Max. Er war nicht sicher, ob Otto ihn gehört hatte. Luisa sah ihn an und schluckte. Er merkte auf einmal, wie viel Angst das Mädchen hatte, und wollte sie beruhigen. Er zwang ein Lächeln auf sein Gesicht. »Keene Sorge, Frollein von Briest, wenn wa jetzt abhauen, passiert Ihnen nüscht.«
Luisa wollte etwas antworten, aber Hermine schnitt ihr das Wort ab, indem sie ihre Tochter einfach dem aus der Tür tretenden Otto hinterherschob. Dann fühlte sich Max gepackt und ebenso resolut zur Tür hinausbefördert. Hermine folgte als Letzte.
»Ick mache die Nachhut!«, protestierte Max.
»Unsinn. Los jetzt, nehmt de Beene in die Hand. Luisa – alles wird gut!«
»Ja, Mama.«
Otto rief über die Schulter: »Max, du kommst mit uns nach Gut Briest. Wenn in Berlin die Kugeln fliegen, will ich dich in Sicherheit wissen.«
»Det jeht doch nich«, stieß Max hervor.
Otto antwortete nicht. Er stieg ohne Hast, aber auch nicht langsam, die Treppe hinunter. Max hörte, wie Hermine hinter ihm die Eingangstür zur Agentur absperrte. Luisa folgte ihrem Vater die Stufen hinunter, die linke Hand am Geländer. Max konnte sehen, dass ihre Handknöchel blau waren vor Kälte und Nervosität. Der Mantel war Max zu groß, und er roch nach Zigarrenrauch, Rasierwasser und feucht gewordener Wolle. Max’ Herz, das sich mittlerweile beruhigt gehabt hatte, klopfte nun erneut vor Erregung. Die Wärme des schweren Kleidungsstücks ließ den Schweiß bei ihm ausbrechen. Auf halbem Weg die Treppe hinunter drehte er sich um, um zu sehen, ob Hermine hinterherkam. Sie war dicht hinter ihm und nickte ihm zu. Auf den Kopf hatte sie sich einen runden Hut gestülpt, mit Federn auf der Krone. Er hatte abgestoßene Kanten, und die Federn waren zerzaust. In seiner Nervosität schien es Max, als sähe er auf einmal Details, die ihm bisher entgangen waren und die auch die Düsternis des Treppenhauses nicht verbergen konnte: dass Hermines Stiefeletten an den Kappen rissiges Leder aufwiesen; dass der Mantel, den Luisa trug, unten am Saum angestückelt worden war; dass keiner der drei Handschuhe bei sich hatte, weil sie als entbehrliche Kleidungsstücke galten und infolge der allgemeinen Knappheit vom Kriegsversorgungsamt beschlagnahmt worden waren. Bei Max’ bisherigen Begegnungen mit den Briests hatte er immer vorausgesetzt, dass sie wohlhabend waren. Sie besaßen ein Gut auf dem Land und betrieben in Berlin eine Detektei, sie arbeiteten mit Banken und Versicherungen zusammen und konnten es sich leisten, für Informationen Geld zu bezahlen … sie hatten auch Max für seine Spitzel- und Botendienste immer anständig bezahlt … und abgesehen davon war Max jeder Mensch wohlhabend erschienen, der ein eigenes Dach über dem Kopf besaß … doch jetzt wurde ihm zum ersten Mal bewusst, dass auch die Briests unter der Not der Zeit zu leiden hatten, dass sie alle drei hager waren und dass ihre Kleidung bessere Zeiten gesehen hatte.
»Was gibt’s zu kieken?«, fragte Hermine. »Pass auf, dass de nich die Treppe runterfällst.«
Max zuckte zusammen und blickte wieder nach vorn. Otto öffnete die Haustür und spähte hinaus. Durch die geöffnete Tür drangen Geräusche von draußen herein: entferntes Geschrei und das Knattern von Maschinengewehren. Luisa gab einen entsetzten Laut von sich und blieb wie angewurzelt stehen. Sie griff hinter sich und bekam Max’ Hand zu fassen. Max nahm an, dass sie gedacht hatte, ihre Mutter sei hinter ihr und sie habe nach deren Hand gegriffen, aber sie ließ Max nicht los, und er nahm die kalte Hand des Mädchens fester in die seine. Otto nahm Blickkontakt mit Max, dann mit seiner Frau auf.
»Wenn wir draußen sind, gehen wir so schnell wie möglich. Nicht laufen. Wer läuft, fällt umso schneller auf.«
Max nickte. Er sah Hermine ebenfalls nicken. Luisa starrte ihren Vater an.
»Max bleibt an deiner Seite, Sternchen«, sagte Otto und lächelte sie an. »Hab keine Angst. Es ist nicht ganz einfach, aber wir sind nicht in Lebensgefahr. Und wir beschützen dich.«
Luisa schluckte. Max spürte, wie sich ihre Finger um seine Hand krallten.
»Alles klar?«, fragte Otto.
»Bring uns nach Hause, mein Schatz«, sagte Hermine.
Otto zog die Tür ganz auf und winkte sie alle hinaus.
Die Friedrichstraße war in beiden Richtungen fast ausgestorben. Es gab keine Fuhrwerke, keine Omnibusse, keine Automobile, nur vereinzelte Fußgänger, deren graue und braune, vom Krieg modisch gemachte Kleidungsfarben sie uniform und gesichtslos aussehen ließen. Der Regen war noch stärker geworden und verwandelte den frühen Vormittag in eine zeitlose, trübe Halbdämmerung.
Max und die anderen wandten sich nach links, in die Taubenstraße, in der überhaupt kein Leben zu sehen war. Die Häuserfassaden waren dunkel von Regen und Vernachlässigung. Von den hohen Wänden hallte das Gewehrfeuer wider. Max war klar, dass es von der Stadtkommandantur her kommen musste. Die revoltierenden Matrosen, die dorthin marschiert waren, lieferten sich ein Gefecht mit der republikanischen Soldatenwehr. Es würde wieder Tote geben. Es würden wieder Männer sterben, die den Krieg gegen den Feind überlebt hatten, nur um zu Hause von den ehemaligen Kameraden erschossen zu werden.
Luisa hastete ungeschickt neben Max her. Sie hielt immer noch seine Hand fest. »Ich kann nicht so schnell!«, sagte sie keuchend.
»Ick zieh Ihnen, Frollein, keene Sorge«, beruhigte Max sie.
»Passt du wirklich auf mich auf?«
»Versprochen, Frollein. Großes Ehrenwort.«
»Die ganze Zeit?«
»Für immer«, sagte Max.
»Warum sagst du ständig ›Frollein‹ zu mir? Ich heiße Luisa.«
Die nächste Kreuzung war schon die mit der Kanonierstraße. Dort mussten sie sich nach rechts wenden und ihrem Verlauf nach Norden folgen. Wie weit war es von hier zum Bahnhof Friedrichstraße? Einen Kilometer? Max machte sich bereit, Luisa nötigenfalls zu tragen. Ihm fiel ein, dass, wenn die Gefechte sich ausweiteten, vielleicht der Bahnverkehr zum Erliegen kam – oder dass irgendwelche Putschisten den Bahnhof besetzten. Dann hätte er die Briests mitten ins Chaos gelockt. Sein Magen krümmte sich zusammen.
Sie bogen um die Ecke, in die Kanonierstraße hinein. Instinktiv waren sie dicht zusammengeblieben, eine Gruppe aus vier Menschen, die sich geschlossen und schnell vorwärtsbewegte. Jetzt blieben sie wie ein Mann stehen, als seien sie gegen eine Mauer geprallt.
Weiter vorn, bei der Jägerstraße, war ein kleiner Trupp Bewaffneter in die Kanonierstraße gebogen. Sie waren in südlicher Richtung unterwegs. Max kannte sich gut genug aus, um zu ahnen, dass sie zur Reichskanzlei unterwegs waren. Die Männer gehörten zur Volksmarinedivision. Vermutlich hatten sie den Befehl, die Telefonzentrale in der Kanzlei unter Kontrolle zu bringen und die Regierung festzusetzen. Sie waren erhitzt und ungepflegt und bis an die Zähne bewaffnet. Im ersten Affekt hatten ein paar von ihnen die Gewehre erhoben, als sie Max und die anderen erblickt hatten. Jetzt senkten sie sie wieder, aber sie waren unschlüssig. Ihr Vormarsch geriet ins Stocken.
»Wir gehen einfach ganz ruhig auf die andere Straßenseite«, murmelte Otto.
Er tat einen Schritt. Die Revolutionäre hoben die Gewehre wieder und zielten. Otto erstarrte.
»Gütiger Gott«, flüsterte Hermine.
»Ihr da – stehen bleiben!«, rief einer der Männer, der offensichtlich der Anführer war. An Rangabzeichen war es nicht zu erkennen. Die meisten der Matrosen trugen zwar ihre Käppis, aber ihre Mäntel waren ein Sammelsurium aus Militär- und zivilen Kleidungsstücken.
Luisa wimmerte.
»Wir bleiben ganz ruhig«, sagte Otto. Max hatte ihn noch nie so ernst gesehen. Als die Matrosen heran waren, setzte Otto ein Lächeln auf. »Fröhliche Weihnachten, meine Herren«, sagte er.
Die Matrosen waren junge Männer in den Zwanzigern, denen die schlechte Ernährung Kerben in die Wangen gezogen hatte und deren Augen fiebrig glühten vor Schlafmangel und Nervosität. Ein paar von ihnen sahen Otto verwundert an, einer erwiderte das Lächeln, aber keiner von ihnen sprach. Das Reden besorgte ihr Anführer.
»Papiere«, forderte er barsch und streckte die Hand aus.
Max sah Otto zögern. Die Matrosen hatten keinerlei Polizeibefugnis. Ihre Forderung, Ausweispapiere sehen zu wollen, entbehrte jeder Grundlage. Aber die Gewehre in ihren Händen und die Anarchie, die in Berlin herrschte, gaben ihnen jedes Recht, das sie sich nehmen wollten. Otto holte langsam seine Brieftasche heraus und überreichte sie dem Anführer.
Der schlug sie auf, nahm wortlos alles Papiergeld heraus, das sich darin befand, und steckte es in die Tasche. Er machte keinen Anschein, dass ihn der Diebstahl irgendwie verlegen machte. Max fragte sich, ob Otto das beabsichtigt hatte – eine elegante Bestechung, um die Männer friedlich zu stimmen. Es wirkte nicht so, als hätte es funktioniert. Der Anführer betrachtete Ottos Ausweis, dann sah er fragend auf.
»Meine Familie«, sagte Otto. »Wir wollen zum Bahnhof, über Weihnachten nach Hause fahren.«
»Gut Briest«, sagte der Anführer der Matrosen. »Genthin. Wo soll das sein?«
»An der Elbe. Richtung Brandenburg, und dann noch zwanzig Kilometer weiter.«
Einer der Matrosen schnappte sich den Ausweis, den der Anführer noch nicht zurückgegeben hatte, und starrte hinein.
»Du kriegst die Motten!«, rief er. »Das sind ja von und zus!«
»Geben Sie den Ausweis zurück, Matrose!«, sagte der Anführer scharf.
Der Matrose ignorierte ihn. »Von und zus!«, wiederholte er stattdessen. »Das Pack, das uns in die Scheiße geritten hat. Und ganz Deutschland mit dazu.«
Ein paar Männer murrten. Die Blicke wurden feindselig.
Einer sagte: »Die Politiker ham uns in die Scheiße geritten. Und die Juden.«
»Die Politiker sind fast alle von und zus, und die Juden finanzieren die Schweine! Mach die Augen auf, du Narr!«
Der Anführer nahm den Ausweis wieder an sich. Er wirkte unschlüssig.
Max’ Mut sank. Ein Vorgesetzter, der sich seiner Männer sicher war, hätte die Situation im Griff gehabt. Aber so, wie die Dinge standen, konnte alles Mögliche passieren. Er spürte förmlich, wie sich in den übermüdeten, fanatisierten Revolutionären Wut aufbaute und die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden. Ohne sich in militärischen Belangen allzu gut auszukennen, ahnte er, dass der Anführer jetzt seine Männer hätte stillstehen lassen sollen. Ihr soldatisches Training hätte die Oberhand gewonnen, und sie hätten gehorcht, während Max und Ottos Familie unbeschadet hätten weitergehen können. Aber der Anführer tat nichts. Er ließ sich von den unausgesprochenen Wünschen seiner Männer leiten.
»Sie sind verhaftet«, sagte er und steckte Ottos Ausweis ein.
»Sie können uns nicht verhaften«, sagte Hermine, deren Impulsivität sich meistens nicht lange im Zaum halten ließ. »Sie sind ja keene Polizisten, wa?«
»Halten Sie den Mund«, sagte der Anführer.
»Ja, halt die Klappe, Adelsschickse«, knurrte der Mann, der vorher Ottos Ausweis an sich genommen hatte.
»Ich dulde nicht, dass Sie meine Frau beleidigen!«, sagte Otto. Er starrte den Matrosen an. »Sie werden sich sofort entschuldigen, Sie Flegel.«
Der Matrose starrte vollkommen überrascht zurück. Seine Hände an der Waffe zuckten. Max flehte innerlich, dass der Anführer der Matrosen jetzt endlich Führungsqualität zeigte, doch er schnauzte nur Otto an: »Sie halten auch den Mund!«
Die Augen des Matrosen verengten sich. »Wie hast du mich grade genannt?«, fragte er gefährlich leise.
Otto ließ sich nicht einschüchtern. »Ich habe Sie einen Flegel genannt, und das sind Sie, wenn Sie sich nicht entschuldigen. Ihre Not gibt Ihnen nicht das Recht, so ungehobelt zu sein.«
»Ich krieg die Motten«, sagte der Matrose, indem er sich halb zu seinen Kameraden umdrehte. Er wirkte wie jemand, der vor Erstaunen nicht weiß, was er tun soll. Doch Max erkannte, dass der Matrose es in Wahrheit ganz genau wusste. Er wollte Otto warnen und ließ Luisas Hand los, um den Detektiv beiseitezuziehen. Er war zu langsam. Der Matrose drehte sich plötzlich um und stieß Otto nach einem raschen Schritt den Gewehrkolben ins Gesicht.
Otto war schneller. Er wich zur Seite aus. Der Matrose stieß noch einmal zu. Otto wich zur anderen Seite aus. Dann trat er hastig außer Reichweite und hob die Hände. »Hören Sie auf!«, sagte er. Der Matrose stand mit halb erhobenem Gewehr und wutverzerrtem Gesicht da. »Befehlen Sie Ihren Männern, sie sollen ruhig sein!«, sagte Otto zum Anführer der Revolutionäre.
Der Anführer sagte: »Ich lasse mir doch von Ihnen keine Anweisungen geben. Los, Männer, führt sie ab. Wir nehmen sie mit zur Reichskanzlei.«
Die Matrosen traten vor, bis auf den einen, den Otto mit seiner blitzschnellen Reaktion düpiert hatte. Er hatte das Gewehr sinken lassen und wrang es nun mit beiden Händen. Sein Gesicht war rot vor Zorn, und sein Brustkasten hob und senkte sich.
Zwei Männer packten Otto an den Oberarmen. Er wehrte sich nicht. Ein Matrose trat zu Hermine, zögerte kurz, als seine gute Erziehung sich bemerkbar machte, verdrängte sie dann und ergriff Hermine extra grob am Arm. Zwei weitere Männer streckten die Hände nach Max aus, und einer sprang zu Luisa herüber.
Luisas Nerven rissen. Sie warf sich herum und rannte mit fliegenden Armen und pumpenden Beinen weg, stumm vor Panik.
»Luisa!«, brüllte Otto. Er holte Atem, um etwas hinzuzusetzen, aber einer der Matrosen schlug ihn mit der Faust in den Bauch. Otto krümmte sich zusammen. Max wusste nicht, was Otto seiner Tochter hatte hinterherrufen wollen: Bleib stehen? Oder: Lauf schneller …!?
Der Matrose, der Otto angegriffen hatte, hob das Gewehr an die Wange. Hermines Augen weiteten sich. Der Matrose grinste böse.
Für Max ging alles ganz langsam vor sich. Er wich den Männern aus, die ihn packen wollten. Er sah, wie der Matrose das linke Auge schloss, um zielen zu können. Er folgte dem Gewehrlauf mit den Blicken und sah, dass Luisa das Ziel war. Er duckte sich unter einem zugreifenden Arm hindurch. Der Matrose drückte den Gewehrkolben fester an die Wange. Hermines Mund öffnete sich zu einem Schrei. Otto versuchte, den Kopf zu heben. Der Matrose hob den Gewehrlauf ein Stück höher. Max sprang über ein Bein, das ihm einen Tritt versetzen wollte.
Der Matrose legte den Finger auf den Abzug und atmete aus.
Max wusste, dass er ihn niemals rechtzeitig erreichen konnte, um den Gewehrlauf nach oben zu schlagen und Luisa zu retten.
Er konnte nur eines tun.
Er dachte daran, dass Otto gesagt hatte, er wolle Max mit aufs Gut nehmen, damit er über Weihnachten in Sicherheit war. Er dachte daran, dass Otto der verängstigten Luisa versichert hatte, Max würde an ihrer Seite bleiben.
Er dachte an das Große Ehrenwort, das er ihr gegeben hatte.
Der Finger des Matrosen krümmte sich.
Max war nicht an Luisas Seite geblieben. Er hatte sie losgelassen, um Otto beizustehen. Hätte er sie nicht losgelassen, hätte die Panik sie nicht überwältigt. Dann wäre sie nicht weggelaufen. Dann hätte der Matrose keine Gelegenheit gehabt, auf sie zu schießen. Er hatte sein Versprechen nicht gehalten.
Max sah die schmale, rennende Gestalt Luisas, deren Mantel flatterte und deren Beine auf das Pflaster trommelten. Er drehte sich um und sah die Mündung des Gewehrs, die direkt auf den Rücken des fliehenden Mädchens zielte.
Zu diesem Zeitpunkt flog Max schon. Er hatte sich vom Boden abgestoßen und segelte in einem weiten Hechtsprung durch die Luft. Er war an den einzigen Ort gesprungen, den er erreichen konnte, um Luisa zu retten.
Er sprang mitten in die Schusslinie hinein.
Er hörte den Knall. Er sah die Rauchwolke und das Aufblitzen des Mündungsfeuers.
Er spürte, wie ihn etwas aus der Bahn warf. Es fühlte sich an wie einer der Tritte, die die älteren Gassenjungs ihm verpasst hatten, bevor er alt und hart genug geworden war, zurückzutreten.
Er fühlte, wie er aufs Pflaster schlug, ungeschützt, ungebremst, weil plötzlich alle Kraft seine Gliedmaßen verlassen hatte.
Er fühlte Bedauern, dass er nun doch nicht das Weihnachtsfest auf Gut Briest verbringen würde. Dann kam ihm der Gedanke, dass er die Briests nie wiedersehen würde. Der Gedanke war plötzlich unerträglich.
Schmerz pulste mit einem jähen Schock durch seinen Körper. Der Schmerz war auch unerträglich.
Dann entfernte sich alles in rasender Geschwindigkeit – der Schmerz, die Trauer, die Umgebung samt den Revolutionären und den entsetzten Briests, und mit dem allerletzten Aufblitzen seines Geistes kam der Gedanke hoch, dass er eigentlich gerne hätte leben wollen.
Dann …
… nichts.
1
Otto von Briest öffnete die Eingangstür des Guts und schnupperte. Es roch nach nichts Besonderem. Er hatte gehofft, es würde irgendwie nach Essen riechen. Er hatte einen Bärenhunger, weil das Mittagessen des gestrigen Tages die letzte halbwegs anständige Mahlzeit gewesen war, die er zu sich genommen hatte. Er war über Nacht in der Agentur in Berlin geblieben und hatte dort auf dem Sofa im Warteraum geschlafen. Dass er nichts gegessen hatte, lag zum einen daran, dass er in Arbeit erstickt war, zum anderen an der prekären finanziellen Lage, in der sich die Briests befanden. Otto wollte Geld sparen.
Wenn wenigstens die Arbeit, in die er sich vergraben hatte, etwas abgeworfen hätte, dachte er. Aber sie hatte nichts mit einem Auftrag zu tun gehabt. Es gab so gut wie keine Aufträge mehr. Es gab nur den Kredit, den Otto dem Bankhaus Alfred Kron schuldete und den er schon seit Monaten nicht mehr hatte bedienen können. Die Arbeit war gewesen, die Bilanz des Guts und der Agentur zum wiederholten Mal durchzufilzen und nach Möglichkeiten zu suchen, Geld zu sparen. Geld, das dann in die Rückzahlung des Kredits gesteckt werden konnte. Alfred Kron hatte sich bis jetzt extrem geduldig gezeigt. Otto wusste nicht, wie lange die Geduld des Bankiers noch vorhalten würde.
Es war der 23. September 1921, der Krieg war seit drei Jahren vorbei, und Deutschland stand noch näher am Abgrund als damals.
Otto hängte seinen Mantel an den Haken. Früher hatte ihm ein Hausdiener den Mantel abgenommen, wenn er hereingekommen war. Der Hausdiener war in den Krieg eingezogen worden und dort gefallen, und die Briests hatten keinen neuen Diener mehr eingestellt. Vom Gutsgesinde gab es nur noch die Köchin, die im Armenhaus gelandet wäre, wenn die Briests ihr gekündigt hätten, und den Verwalter, ohne dessen Hilfe Otto das Gut schon längst hätte verkaufen müssen. Otto wollte die Tür zum Salon öffnen, doch sie wurde schon von innen geöffnet. Luisa stand vor ihm.
»Guten Abend, Papa«, sagte sie höflich.
Otto tat das Herz weh, sie so blass und dünn zu sehen. »Guten Abend, Sternchen«, sagte er. »Freust du dich auf morgen und übermorgen?«
Hermine tauchte hinter Luisa auf, ebenso blass und dünn. »Es gibt kalte Küche«, sagte sie zur Begrüßung. »Ich hoffe, du hast in Berlin etwas Anständiges zu beißen bekommen.«
»Ja«, log Otto. »Kein Problem.«
»Na gut. Komm, kriegst erst mal ’nen Kuss. Luisa, sagst du der Köchin Bescheid, dass der Herr heimgekommen ist?«
Der Herr, dachte Otto resigniert. Der Herr ist schon zwei Monate mit dem Lohn für die Köchin und dem Verwalter im Rückstand. Daran ist nichts Herrliches.
Auf dem Teetisch lag ein Brief. Hermine deutete darauf, während Luisa in Richtung Küche verschwand. »Der ist von der Bank. Von Alfred Kron.«
Otto starrte sie an. »Was steht drin?«
»Ich hab ihn nich uffjemacht. Hatte nicht genug Traute, um ehrlich zu sein.«
Otto und Hermine sahen sich an. Sie ahnten beide, was in dem Brief stand. »Vielleicht ist es eine Einladung zum Bankenball?«, scherzte Otto.
»Mit uns als Ehrengästen«, meinte Hermine.
Otto seufzte und griff nach dem Brief.
»Lass ihn liegen bis nach dem Essen«, sagte Hermine. »Schlechte Nachrichten kannste noch früh genug lesen.«
Otto öffnete den Brief. »Bringen wir’s hinter uns«, sagte er.
Der Brief war kurz und mit der Maschine getippt. Aber es war eine handschriftliche Notiz auf einem gesonderten Zettel beigefügt. Der Zettel trug die Handschrift Alfred Krons. Otto las ihn zuerst; Hermine las über seine Schulter mit.
»Es tut mir von Herzen leid«, schrieb Alfred Kron. »Bitte vergessen Sie nicht, dass ich Ihr Freund bin. Aber ich konnte es nicht mehr länger hinausschieben, ohne mich an den anderen Kunden zu versündigen. Wenden Sie sich jederzeit an mich, wenn ich Ihnen auf andere Weise helfen kann.«
Otto legte den Zettel weg. Er brauchte den Text des formellen Briefs nicht mehr lesen. Er hatte ohnehin gewusst, was er besagte. Hermine hatte es ebenfalls gewusst.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Hermine.
Otto konnte hören, wie sie sich bemühte, in ihrer Stimme keine Panik mitschwingen zu lassen. »Ich weiß es nicht«, antwortete er. »Dem Schlimmsten in die Augen schauen, nehme ich an.«
Hermine stöhnte auf. »Det kannste nich tun, Otto! Das Gut ist dein Geburtshaus. Auf dem Friedhof liegen deine Eltern und Großeltern.«
Otto nahm den offiziellen Brief und las ihn nun doch. Das Bankhaus Alfred Kron informierte die Eheleute Otto und Hermine Briest, dass der fällige Kredit nicht länger gestundet werden konnte und aufgrund der ausstehenden Tilgungen und Zinsen gekündigt wurde. Er war in einer Summe bis spätestens 2. November zu begleichen, andernfalls man sich gezwungen sehe, zur Wahrung der Interessen der Bank einen Finanzverwalter mit dem Zwangsverkauf von Gut Briest zu beauftragen.
»Det kannste nich zulassen, Otto«, flüsterte Hermine.
»Was soll ich dagegen tun? Wir bekommen nicht mal einen Auftrag, einen verlorenen Schlüssel zu suchen. Und das Gut wirtschaftet seine Kosten seit dem letzten Kriegsjahr nicht mehr herein. Wir müssen die Wahrheit akzeptieren.«
»Und was ist die Wahrheit?«
Otto gestikulierte zu dem Brief. »Die kannst du hier drin nachlesen.«
»Nein. Sag sie mir. Was ist die Wahrheit? Was möchtest du tun?«
Otto holte tief Luft. »Die Wahrheit ist: Wir müssen das Gut …« Seine Stimme brach plötzlich. Er schüttelte den Kopf und versuchte, seine Verzweiflung nicht zu zeigen. Der Brief verschwamm ihm vor den Augen.
»Du kannst es nicht mal aussprechen, Otto«, sagte Hermine leise. Sie setzte sich auf Ottos Schoß und zog seinen Kopf an ihre Schulter. Er atmete ihren Duft ein wie jemand, der am Ersticken ist und plötzlich Frischluft spürt. »Es muss eine andere Möglichkeit geben«, sagte sie und strich ihm übers Haar. »Gib das Gut nicht auf. Es ist nicht nur dein Erbe. Es ist auch unser Zuhause. Wir müssen einfach von irgendwoher genug Geld bekommen, um wenigstens ein paar Kreditraten zahlen zu können. Dann kündigt Kron den Kredit nicht, und wir können uns wieder aufrappeln.«
»Wo soll das Geld denn herkommen, Hermine? Das Gut ist am Ende. Wenn wir ein paar Hektar Grund verkaufen könnten, ich würde es tun. Aber wer kauft zurzeit Ackerland? Oder Wald? Wir können auch nichts verpachten, weil es den Pachtbauern noch schlechter geht als uns. Wir könnten vielleicht ein, zwei Waldstücke roden, damit wir mehr anbauen können … aber bis die Äcker genügend Ertrag bringen, vergehen zwei Jahre, und außerdem ist das Saatgut so teuer, dass wir uns das auch nicht leisten können. Wir könnten höchstens aufhören, Kartoffeln zu essen, und die Dinger stattdessen in die Erde stecken.«
»Wenn wir die Kartoffeln vom Speiseplan streichen«, sagte Hermine, »haben wir die halbe Woche nichts zu essen.«
Otto nickte. »Damit bleibt die Agentur. Wir sind auf Versicherungsbetrug spezialisiert. Der ist derzeit rar gesät. Der Versailler Friedensvertrag hat Deutschland fast die gesamte Handelsflotte gekostet. Die Schwerindustrie liegt am Boden, und was noch funktioniert, arbeitet für die Siegermächte. Es gibt keine Flugzeuge, keine Zeppeline, die Bahn fährt für die Alliierten … es gibt buchstäblich nichts, was sich versichern ließe, oder wofür sich ein Betrug lohnt. Ganz Deutschland lebt von der Hand in den Mund.«
Otto hätte noch hinzufügen können, dass das wenige, was in Deutschland erwirtschaftet wurde, von den Reparationszahlungen aufgefressen wurde. Im Vertrag von Versailles hatte das militärisch geschlagene Deutsche Reich die alleinige Kriegsschuld auf sich nehmen und extrem harten Reparationsforderungen zustimmen müssen. Zunächst – im Januar dieses Jahres – war eine Summe von zweihundertsechsundzwanzig Milliarden Goldmark festgelegt worden, zahlbar in zweiundvierzig Jahresraten, zuzüglich zwölf Prozent des Werts aller deutschen Exporte während dieser Zeit. Die Regierung unter Reichskanzler Fehrenbach hatte protestiert und einen Gegenvorschlag auf den Tisch gebracht. Die Alliierten hatten darauf mit der Besetzung von Städten im Ruhrgebiet geantwortet, die Kommunisten hatten versucht, das deutschlandweite Entsetzen über die Höhe der Forderungen für eine erneute sozialistische Revolution auszunutzen, und im Mai legten die Alliierten in einer Konferenz in London eine neue, verringerte Summe fest: hundertzweiunddreißig Milliarden Goldmark. Die Annahme dieses Zahlungsplans war ultimativ gefordert worden. Die Regierung hatte nur ein paar Tage Zeit bekommen, ihn anzunehmen. Tat sie das nicht, sah das Ultimatum eine vollständige Besetzung des Ruhrgebiets vor. Reichskanzler Fehrenbach und sein Kabinett waren unter diesem Druck zurückgetreten, die neue Regierung unter Reichskanzler Joseph Wirth hatte den Zahlungsplan schließlich unterschrieben. Es gab keinen Zweifel, dass das Land dieser Verpflichtung nicht nachkommen konnte. Deutschland war so pleite wie die Briests … und die Briests so pleite wie fünfundneunzig Prozent der Bevölkerung Deutschlands.
»Otto – glaubst du, dass wir einen Fehler gemacht haben?«
Otto machte eine hilflose Handbewegung. »Fehler?«, wiederholte er laut. »Womit? Dass wir mein Erbe übernommen haben? Dass wir die Agentur weitergeführt haben? Dass wir es nicht geschafft haben, den Krieg zu verhindern? Oder dass du und ich ihn nicht gewonnen haben?«
»Du musst mich nicht anschreien, ich hab nichts Böses gesagt.«
»Ich bin nicht sauer.« Otto stieß die Luft aus. »Entschuldige bitte.«
Hermine strich Otto über den Arm. »Wir können doch nich eenfach akzeptieren, dass wir erledigt sind!«, murmelte sie.
»Nein«, sagte Otto. »Wir können das Gut verkaufen, dann sind wir wenigstens einen Großteil unserer Schulden los.« Diesmal hatte er es über die Lippen gebracht. Ihm war übel. Wenigstens hatte er jetzt keinen Hunger mehr.
Die Köchin kam herein und brachte Teller, Besteck und das karge Abendmahl, das aus Fisch, Käse und im Ofen aufgebackenem Brot bestand. Hermine räusperte sich, stand von Ottos Schoß auf und strich ihr Kleid glatt.
»Wo ist Luisa?«, fragte sie.
»Det gnädige Frollein holt Herrn Max aus der Scheune, weil er nich mitjekriegt hat, det der gnädige Herr nach Hause gekommen ist und det es nu Abendbrot gibt.«
»Max?«, fragte Otto erstaunt. »Ich dachte, der bleibt heute in Berlin, weil das Rennen morgen so früh startet?«
Hermine lächelte trotz des sorgenvollen Gesprächs von vorhin. »Er ist heute Nachmittag angekommen und meinte, die anderen Mechaniker sollten ooch mal was arbeiten. Er wollte auf dem Gut übernachten und fährt morgen mit dem ersten Zug wieder nach Berlin.«
»Warum tut er sich das denn an? Wenn er in der Agentur übernachtet hätte, hätte er ausschlafen können.«
»Otto – er ist einfach gern hier. Freu dich doch. Wir sind alles, was er hat. Seien wir doch froh, dass er uns als seine Familie akzeptiert hat. Wir stehen für immer in seiner Schuld.«
»Ich freue mich doch, wenn er hier ist. Ich wünsche mir ja nur, dass er morgen ausgeruht ins Automobil steigt. Es ist sein erstes Rennen.«
»Er fährt ja nur mit. Lenken tut der Fahrer.«
Otto zuckte mit den Schultern und lächelte. »Er wird schon wissen, was er tut. Er hat ja lange genug ohne meinen schlauen Rat überlebt, und da war er noch ein Kind.«
»Egal ob er weiß, was er tut, oder nicht – tun wird er’s so oder so«, sagte Hermine. Sie gab Otto einen zärtlichen Knuff. »Was det betrifft, könnte er fast von dir sein.«
»Wohl eher von dir.«
»Na, denn sind wir mal eenfach froh, dass er so gut zu uns passt.«
»Was macht er denn in der Scheune?«, fragte Otto.
»Die Strohpresse macht doch Mucken. Er versucht, sie zu reparieren. Manchmal hab ich det Jefühl, er versucht, Levin zu ersetzen.«
Ottos Lächeln verschwand. »Ja«, sagte er. »Levin.«
Hermine senkte den Kopf.
Otto verfluchte sich innerlich, dass er auf Hermines harmlose Bemerkung so betroffen reagiert hatte. Aber er vermisste seinen jüngeren Bruder, das ließ sich nicht leugnen. Der Abschied von Levin war ihm sehr schwergefallen. Er war froh, als er die Eingangstür und die Stimmen von Luisa und Max hörte, weil er wusste, dass sich das ganze Abendessen lang das Gespräch ausschließlich um Automobile und das bevorstehende Eröffnungsrennen auf der AVUS drehen würde. Es war eine willkommene Ablenkung von den schweren Gedanken. Schwer würde der Abend danach von allein wieder werden, wenn er und Hermine den beiden schilderten, was die Bank ihnen geschrieben hatte und was die Konsequenzen daraus sein mussten.
»Weißt du, dass dein Gesicht sich entspannt, wenn du die Stimme von Max hörst?«, fragte Hermine.
»Er hat uns Luisas Leben geschenkt«, erwiderte Otto. »Und er wäre beinahe dabei draufgegangen. Er hat es nur überlebt, weil er mindestens zehn Schutzengel an seinem Krankenlager stehen hatte.«
»Wovon einer Luisa war«, sagte Hermine und lächelte ebenfalls. »Max zu uns zu holen, war das Beste, was wir in den letzten Jahren getan haben.«
»Das sagst du nur, weil du schon vergessen hast, dass ich dich jeden Tag in den Arm nehme und küsse.«
»Das«, sagte Hermine, »jehört ooch zu den guten Dingen, mein Lieber. Und dass de bloß nich damit aufhörst, wa!«
2
Max Brandow neigte nicht zu Albträumen. Es kam allerdings vor, dass er, wenn er sich gedanklich intensiv mit etwas zu beschäftigen versuchte, dabei abdriftete und Erinnerungen, Eindrücke und Gefühle sich zu einem Tagtraum vermischten. Diese Tagträume waren nicht immer angenehm. Ein Großteil seiner Erinnerungen – die an die ersten vierzehn Jahre seines Lebens – war von Angst, Kälte, Hunger und Lieblosigkeit geprägt. Wenn sein Verstand dann damit beschäftigt war, diese Erinnerungen zu verdrängen, übernahm sein Instinkt das Ruder und traf eine Entscheidung zu dem Thema, über das er hatte nachdenken wollen. Der Instinkt lag nicht immer richtig; aber es kam selten vor, dass Max ihm nicht folgte. Der Instinkt hatte ihn vierzehn Jahre lang überleben lassen. Er besaß eine mächtige Stimme.
Jetzt saß Max im Licht einer Laterne in der Scheune vor der Strohpresse, einen Schraubenschlüssel in der einen und eine Zange in der anderen Hand, und starrte blicklos auf den eingestanzten Schriftzug LANZ auf dem metallenen Rahmen des Geräts. Er hatte sich hierher zurückgezogen, um für sich zu sein. Eine schmerzhafte Mischung aus Erinnerungsfetzen brodelte in seinem Geist. Das beklommene Tischgespräch drüben im Gutshaus war daran schuld. Die guten Erinnerungen vermischten sich mit den schlechten.
Was war eine gute Erinnerung? Das Gelächter der Passanten, als er, knapp sechs Jahre alt, am Spandauer Westbahnhof Schnürsenkel verhökert hatte mit dem halb weinerlichen, halb augenzwinkernden Werbespruch Koofen Se mir doch wat ab, mein Vater is drei Jahre vor meine Geburt jestorben? Oder war das eine schlechte Erinnerung, weil er seinen Vater auch in Wirklichkeit nie kennengelernt hatte?
Oder war es eine gute Erinnerung, dass seine Mutter einmal, ein einziges Mal, genügend Geld gehabt hatte, um zu Weihnachten den Ofen in dem Dachzimmer, in dem sie mit ihren vier Kindern hauste, zu heizen und ein kleines Weihnachtsmahl zu bereiten?
Nein, das war auch keine gute Erinnerung. Im Frühjahr danach waren seine Mutter und Max’ drei kleine Geschwister an Typhus gestorben. Nur Max hatte überlebt, als hätte ein besonderes Schicksal ihn aufsparen wollen. Er war acht Jahre alt gewesen. Er hätte es dem Schicksal damals nicht übel genommen, wenn es ihn auch geholt hätte.
Was war eine gute Erinnerung? Es gab ein paar, die rundum gut waren. Die erste Begegnung mit Otto von Briest, als dieser ihn, während er an einer Ecke im Scheunenviertel herumlungerte, zu sich gerufen hatte. Frierste? Haste Hunger?, hatte Otto in einer nicht sehr überzeugenden Nachahmung des Berliner Dialekts gefragt.
Wenn Se ’nen Bubi brauchen, gehnse in die Bülowstraße, hatte Max unfreundlich geantwortet.
Otto hatte gelächelt. Nein, ich brauche jemanden, der mich warnt, wenn ich gleich in diese Kaschemme hier gehe.
Warnt wovor?, hatte Max gefragt.
Vor den Typen, die vielleicht anrücken, wenn ich dort drin Apachen-Erich hochnehme.
Biste ’n Polyp?, hatte Max hervorgestoßen und war einen Schritt zurückgewichen.
Nein, ich bin ein Plattfuß.
Weswegen willste den Erich hochnehmen?
Such dir was aus!
Dann hatte Max’ Instinkt eine Entscheidung getroffen und ihn veranlasst zu sagen: Na jut, ick pfeife dreimal, wenn wer anrückt, und denn nehm ick die Beene in die Hand. Deshalb: Vorkasse, Meister, wa?
Wenn du rennen musst, renn hierhin, hatte Otto gesagt und ihm eine Visitenkarte der Agentur in die Hand gedrückt – zusammen mit einem Geldschein. Es ist dann noch ein warmes Essen für dich mit drin. Kannst du die Adresse lesen?
Es war niemand angerückt. Apachen-Erich, der als Anführer eines Ringvereins für Zuhälter und Schwindler, den »Apachen«, und für seine gnadenlose Brutalität bekannt war, war so alkoholisiert gewesen, dass er sich nicht hatte wehren können. Von den anderen Zechern in der Kneipe war ihm niemand beigesprungen, und es hatte auch niemand seine Vereinskumpane alarmiert. Max hatte seine Entlohnung trotzdem behalten dürfen, und Otto hatte ihn nachher trotzdem zum Essen eingeladen. Es war der Beginn ihrer Zusammenarbeit gewesen. Und ihrer Freundschaft.
Ja, das war eine gute Erinnerung. Denn die Wahrscheinlichkeit war groß, dass Max heute nicht mehr leben würde, wenn er Otto nicht getroffen hätte.
Was ihn automatisch zur besten Erinnerung führte, die er besaß. Sie war die beste, obwohl sie mit Schmerzen verbunden war und einem mehrtägigen Kampf ums Überleben.
Max schreckte auf, als er Luisas Stimme hörte. Er drehte sich um und sah sie im Eingang zur Scheune stehen.
»Max? Es ist doch viel zu dunkel, um noch was zu arbeiten. Und du musst morgen früh raus.«
»Ick dachte, ick könnte det olle Ding noch hinkriegen.«
Luisa trat näher. Sie schüttelte den Kopf. »Du dachtest, du könntest hier allein sein, aber ich hab dich gestört.«
Max erwiderte nichts.
»Du brauchst dich nicht zu verkriechen, wenn du über was nachdenken willst. Rede mit uns. Rede mit mir. Wir sind eine Familie. Wir halten zusammen.«
Max musterte sie schweigend. Luisa war jetzt vierzehn Jahre alt. Er war siebzehn. Was Überlebensinstinkt und das betraf, was man die Weisheit der Gasse nannte, war er gefühlt zwanzig Jahre älter als sie. Was die Klugheit der Gefühle anging, war sie ihm um mindestens die gleiche Anzahl an Jahren überlegen. Seit drei Jahren lebte er mit den Briests auf ihrem Gut. In diesen drei Jahren hatte er sich angewöhnt, auf Luisa zu hören, wenn es um Herzensthemen ging.
Luisas Augen glänzten im Laternenlicht. Es standen immer noch Tränen darin. Sie hatte geweint, als Otto ihnen eröffnet hatte, dass er womöglich das Gut verkaufen musste, dass sie zwar nach anderen Möglichkeiten suchten, aber dass die Chancen schlecht standen und sie nicht mehr viel Zeit hatten. In Max’ Mitte hatte sich bei diesen Worten ein gähnendes Loch aufgetan; er hatte das Gefühl gehabt, dieses Loch sauge ihn ein. Das Gut war die erste wirkliche Heimat für ihn gewesen, seit seine Mutter und seine Geschwister verstorben waren und der Hauswirt ihn auf die Straße gesetzt hatte. Er wollte es nicht verlieren. Und er wollte erst recht nicht, dass die Briests es verloren. Er war in die Scheune gegangen, um über Möglichkeiten nachzudenken, ihnen zu helfen, aber dann hatte das Erinnerungsgebrodel die Gedankengänge überschwemmt. Auch sein Instinkt war noch zu keiner Lösung gekommen, außer der, dass es seine Aufgabe war, diese Lösung zu finden. Die Briests hatten ihm ein Heim geboten und eine Familie. Er stand für immer in ihrer Schuld. Er musste einen Weg finden, ihre Güte zu vergelten.
Luisa sagte: »Versprichst du mir, dass du nicht an das denkst, was Papa heute erzählt hat, wenn du morgen und übermorgen fährst? Du musst dich auf die Strecke konzentrieren. Ich hab Angst, dass sonst etwas passiert.«
»Ick fahr ja nur mit«, sagte Max. »Bakatsch ist der Pilot.«
Er verschwieg, dass Hans Bakatsch wahrscheinlich halb betrunken fahren würde. Im Stillen plante er bereits, Bakatsch ins Steuer zu greifen, wenn dieser die Kontrolle über das Automobil zu verlieren drohte.
Max und Hans Bakatsch arbeiteten für die Dinos-Automobilwerke. Die Firma saß in Charlottenburg und war noch neu am Markt. Sie hatte es noch nicht geschafft, einen der in den letzten Jahren im Motorsport bekannt gewordenen Fahrer für sich zu interessieren: Christian Lautenschlager, Otto Salzer, Willy Poege, den jungen Fritz von Opel, Edmund Orska. Die fuhren für die großen Automobilhersteller: Benz & Cie., die Nationale-Automobil-Gesellschaft, für die Opel-Werke. Bakatsch war im Weltkrieg Flieger gewesen und hatte ein Alkoholproblem daraus mitgebracht. Aber er fuhr gut, wenn er halbwegs nüchtern war. Der Chefkonstrukteur der Dinos-Werke, Richard Loeb, hatte vermutlich keine große Auswahl gehabt … und die Loeb-Werke, aus denen die Dinos-Automobilwerke hervorgegangen waren, hatten während des Kriegs Flugzeugmotoren hergestellt, wodurch womöglich eine Art Alte-Kameraden-Loyalität zwischen Loeb und dem ehemaligen Flieger Bakatsch entstanden war. Max wusste es nicht. Er war froh, sich bei Dinos zum besten Mechaniker emporgearbeitet zu haben, sodass er, obwohl er noch nicht einmal volljährig war, die Ehre hatte, als Begleitmechaniker beim Rennen an diesem Wochenende mitzufahren.
»Komm wieder rein«, sagte Luisa.
Max sah sich um. Auf einmal wollte er gar nicht mehr hier sein, allein in der Scheune mit dem Ungetüm von Maschine. Er seufzte. Er wollte Luisas Bitte folgen. Doch wenigstens den Schein wollte er wahren, obwohl er wusste, dass Luisa ihn mühelos durchschaute. »Eenmal probier ick noch wat, und denn komm ick«, versprach er.
Luisa nickte und verließ die Scheune. Max wandte sich der Strohpresse zu, aber er ließ die Werkzeuge wieder sinken, kaum dass er sie angesetzt hatte. Luisa hatte seine Gedanken auf das morgige Rennen gelenkt, und nun mischten sich dessen Eindrücke in den Strudel in seinem Kopf.
Das Rennen war die Eröffnungsveranstaltung für die neue Autobahn im Berliner Südwesten – die AVUS, die eine insgesamt neunzehn Kilometer lange Schleife von Charlottenburg bis Nikolassee und zurück beschrieb. Sie war noch vor Kriegsbeginn durch die Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße GmbH begonnen worden, um die international bedeutungslose deutsche Autoindustrie zu fördern. Nach dem Krieg und in der derzeitigen desolaten Situation Deutschlands hatten fast alle diesen Traum aufgegeben, bis auf den Großindustriellen Hugo Stinnes, der durch private Investitionen, Engagement seiner Unternehmen und riskante Kredite dafür gesorgt hatte, dass die Bauarbeiten wieder aufgenommen und vollendet wurden. An diesem Wochenende, dem 24. und 25. September 1921, würde sie mit einem innerdeutschen Autowettbewerb dem Publikum übergeben werden, mit dem sogenannten Grunewald-Rennen, zu dem fast alle Automobilhersteller des Landes ein oder zwei Prototypen an den Start geschickt hatten. Durch den Krieg und seine Folgen hatte Deutschland auch in der Automobilherstellung den Anschluss an den Rest der Welt verloren. Das Rennen war eine Chance zu zeigen, welche Kraft und welcher Erfindungsreichtum trotz allem Chaos in deutschen Unternehmen steckte, mit der Hoffnung, dass ausländische Geldgeber investieren und die Wirtschaft ankurbeln würden. Für die Berliner war das Autorennen eine Abwechslung von der täglichen Not. Die Autobahn würden nur die wenigsten von ihnen wirklich benutzen, wenn sie für den Verkehr freigegeben war. Die Maut kostete pro Durchfahrt zehn Mark. Das konnten sich nur die Allerreichsten leisten.
Aber wie konnte Max morgen auf die Rennbahn gehen, wenn er wusste, dass die Briests einen hoffnungslosen Kampf um ihr Heim kämpften – um ihr Heim und seines? Er sollte sich lieber darum kümmern, wie er ihnen helfen konnte. Er wusste nicht genau, auf welche Summe sich der Kredit belief, den Otto nicht zurückzahlen konnte, oder wie hoch die monatlichen Raten waren. Auf jeden Fall musste der Kredit beträchtlich sein. Wie kam man auf die Schnelle zu so viel Geld?
Ein Überfall auf die Post oder eine Bank, flüsterte die Stimme, die aus der Erfahrung seiner ersten vierzehn Jahre sprach. Oder man müsste irgendeinen reichen Trottel reinlegen und um seine Habe erleichtern …
Max schüttelte sich. Dorthin wollte er nicht zurück. Er hatte selbst in der größten Not damals vor ein paar Dingen zurückgeschreckt und lieber gehungert, als sich etwas Geld durch Gewalt oder Erpressung zu verdienen. Jemanden, der mit seinem Geld nicht umgehen konnte oder es bedenkenlos ausgab, weil er zu viel davon hatte, hereinzulegen und auszunehmen war etwas anderes … aber auch davon hatte Max abgeschworen, als er zu den Briests gekommen war. Nein, es musste eine andere Möglichkeit geben. Aber welche?
Er hatte keine Ahnung. Frustriert legte er das Werkzeug weg, ging zurück ins Haus, wusch sich die Hände und trat dann in den Salon, um Gute Nacht zu sagen. Hermine nahm ihn in die Arme, Otto versicherte ihm, dass er sich keine Sorgen zu machen brauche – auch wenn sie das Gut verlören, würde er immer bei ihnen ein Dach über dem Kopf haben; er war Teil der Familie, und die Familie hielt zusammen. Dass Otto unbewusst das wiederholte, was Luisa vorhin in der Scheune zu Max gesagt hatte, trieb ihm fast die Tränen in die Augen. Als er ins Bett ging, war er noch mehr als zuvor entschlossen, das Geld irgendwie aufzutreiben.
Er schlief sofort ein, obwohl sein Magen angesichts der Sorgen rumorte und sein Hirn sich wund anfühlte vom Nachdenken. Auch das war eine Errungenschaft des Lebens in der Gasse: Man schlief, wenn man gerade konnte, und man schlief sofort ein, weil die Schlafperiode meistens kurz war.
Am nächsten Morgen erwachte er mit einem schlechten Geschmack im Mund, einem bohrenden Druck im Magen und der Lösung für das Problem. Er starrte mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit. Wieso war er nicht gleich darauf gekommen?
Vermutlich, weil sein Instinkt ihm gesagt hatte, dass diese Lösung ihn mit relativ großer Wahrscheinlichkeit das Leben kosten würde. Sein Instinkt war immer darauf bedacht, ihn zu retten. Dennoch hatte er im Schlaf diese Idee durchgelassen. Der Instinkt sah offenbar auch keine andere Möglichkeit. Und schließlich war auch Max’ Überlebensinstinkt es gewöhnt, zugunsten der Briests zurückzustecken.
Es war ja nicht das erste Mal, dass Max spontan seinen Kopf riskierte, um den einzigen Menschen zu helfen, die er liebte.
3
Max wartete bis zum Spätnachmittag des ersten Renntags, dann weihte er Luisa in seinen Plan ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die Rennen bereits gefahren. Es hatte keine Zwischenfälle gegeben, aber auch keine Überraschungen. Den Geschwindigkeitsrekord hatte Fritz von Opel aufgestellt, der bekannteste unter den angetretenen Fahrern: Er hatte ein Tempo von beinahe hundertneunundzwanzig Stundenkilometern erreicht. Der Konsens unter den anderen Fahrern war, dass dieser Rekord auch am folgenden Tag nicht würde gebrochen werden. Die Mechaniker waren bis auf einen Mann derselben Meinung. Dennoch wollten es alle versuchen.
Hans Bakatsch und Max Brandow in ihrem dunkelblau lackierten Dinos waren im Mittelfeld gelandet. Bakatsch war damit zufrieden und strebte auch für den nächsten Tag keine andere Platzierung an. Richard Loeb hatte sein Fahrer-Mechaniker-Team gewarnt, den Wagen überzustrapazieren. Das Rennen sollte für die Dinos-Werke Erfahrungswerte bringen, nicht den Sieg.
Max stimmte damit nicht überein. Ein Platz im Mittelfeld reichte ihm nicht aus. Er war der eine unter den Mechanikern, der glaubte, dass von Opels Rekordmarke geknackt werden konnte. Und er wollte, dass der dunkelblaue Dinos 10/30 der Wagen war, mit dem der Rekord gebrochen wurde.
»Du bist wahnsinnig!«, rief Luisa, als Max halbwegs mit der Erläuterung seines Plans fertig war.
»Schsch! Nicht so laut!«
Sie standen hinter einem der Kioske, in denen Würstchen, Buletten und Bier verkauft wurden. Auf der Tribüne spielte eine Blaskapelle mit großem Enthusiasmus, sodass man selbst hier noch die Köpfe zusammenstecken musste, um einander zu hören. Dennoch hatte Max Panik, dass jemand ihr Gespräch belauschen könnte.
»Das funktioniert nie!«, zischte Luisa.
»Bakatsch ist doch jetzt schon halb hinüber. Er ist mit vier Bier im Ranzen gefahren und hat seitdem sicher noch zwee getankt. Ich muss ihn gar nich ma groß überreden, det er sich so viel hinter die Binde kippt, bis er nicht mehr stehen – und morjen nicht fahren kann. Det kriegt er fast von alleene hin.«
»Aber du kannst doch nicht fahren.«
»Ick fahr besser als Bakatsch!«, behauptete Max und wusste, dass er damit gewaltig übertrieb.
»Max, ich will das nicht!«
»Von der Siegprämie kannste dir ’n halbes Haus koofen! Det saniert deine Eltern erst mal. Selbst die Hälfte davon reicht, det die Bank erst mal zufrieden ist!«
»Aber Max …«
»Ick hab doch nüscht Böses vor. Det kriegt doch eh keener mit. Unter der Mütze und mit der Brille und mit all dem Öl und Dreck im Jesichte sieht een Fahrer aus wie der andere.«
»Aber …«
»Ick zieh det durch, Luisa. Ick will euch helfen, und det is die einzige Schangse, die ick hab. Bitte wünsch mir Glück, statt dass de auf mir einredest, det ick es lassen soll!«
Du würdest noch viel mehr auf mich einreden, wenn du wüsstest, wie hoch das Risiko tatsächlich ist, dachte Max. Nicht weil ich nicht fahren könnte – sondern weil die Rennbahn eine Zumutung ist. Neben dem Rekord von Fritz von Opel war der Zustand der AVUS gestern Abend fast das einzige andere Gesprächsthema unter den Fahrern gewesen. Der Teerbelag wurde bei Belastung weich und rutschig, und die offensichtlich ungenügende Bodenverdichtung und die hastig geflickten Kriegsschäden hatten mörderische Bodenwellen verursacht. Tatsächlich waren die Verhältnisse lebensgefährlich.
Luisa sah Max durchdringend an. Über ihr Gesicht huschten Gefühle so schnell wie Wolken im April. Plötzlich stieß sie hervor: »Wenn du aufgeregt bist, berlinerst du wieder so schlimm wie am Anfang.«
Max wusste nicht, ob er lachen oder sich über die unpassende Bemerkung ärgern sollte. Dann wurde ihm klar, dass Luisa in ihrer Beklommenheit das Erstbeste gesagt hatte, was ihr in den Sinn kam. Er erinnerte sich daran, dass Otto ihm einige Zeit nachdem er auf Gut Briest eingezogen war angeboten hatte, mit ihm Hochdeutsch zu üben – nicht, weil er ihm das Berlinisch austreiben wollte oder sich dafür schämte, sondern weil er der Meinung war, Max würde sich später leichter tun, wenn er beides beherrschte. Er erinnerte sich daran, wie eine amüsierte Hermine gesagt hatte: Weeßte, mein Schatz, det haste schon bei mir nich hinjekriegt!, und wie Luisa verkündet hatte, dass sie mit Max üben würde. Mit diesen Erinnerungen im Herzen sagte er: »Det bildste dir nur ein, wa!«, und grinste breit.
Nach dem Gespräch mit Luisa und nachdem er sie beschworen hatte, Otto und Hermine nichts zu verraten, suchte er nach Hans Bakatsch. Er brauchte nicht weit zu gehen. Bakatsch saß auf einer der Bänke vor einem Bierausschank, hatte ein halb leeres Glas vor sich stehen und schien auf gutem Weg zu sein, nicht nur das sechste, sondern bereits das zehnte Bier dieses Tages zu konsumieren. Er trug immer noch den weißen, ölbesprenkelten Overall, in den sich die meisten Fahrer zwängten, und hatte seine Lederkappe mit der Brille neben sich liegen. Sein Gesicht und seine Hände hatte er gereinigt, nur den Hals hatte er vergessen. Zwischen seinem sauberen Kinn mit dem blauen Bartschatten und dem Kragen seines Overalls war ein Streifen schwarz verschmierter Haut zu sehen.
»Maxe!«, sagte er gut gelaunt. »Komm, setz dich. Wieso haste dich schon umgezogen? Haste dich mit ’nem Mädel getroffen, du eitler Tropf?« Er lachte, um zu zeigen, dass er es nicht böse meinte.
Max, dem es das Einfachste schien, so wenig wie möglich über seine Beziehung zu den Briests zu erzählen, grinste nur und bejahte die Frage. Es war ja nicht einmal gelogen.
»Willste ’ne Molle?«, fragte Bakatsch.
»Klar.«
Bakatsch schnippte eine Münze über den Tisch, trank sein Glas mit einem Riesenschluck leer und drückte es Max in die Hand. »Bring mir auch noch eine mit.«
»Klar, Hans.«