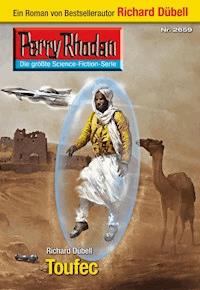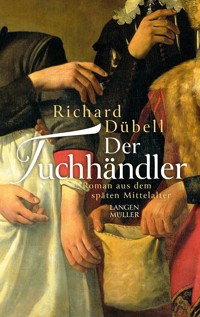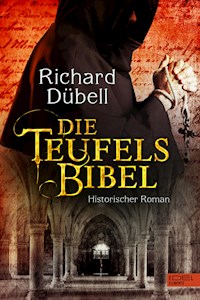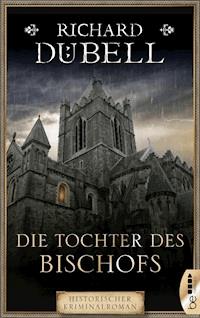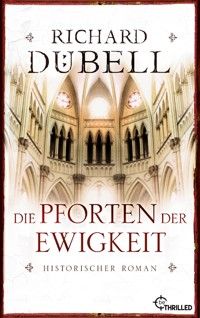
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane von Bestseller-Autor Richard Dübell
- Sprache: Deutsch
Ein Reich ohne Kaiser, drei Männer auf der Spur eines Vermächtnisses und eine starke Frau mit einem ungewöhnlichen Plan.
1250. Friedrich II. ist tot, das Reich in Aufruhr.
Nur einer kennt das letzte Geheimnis des Kaisers: Rogers de Bezers, ein Katharer. Er begibt sich auf die Spur des Geheimnisses, das sein Leben für immer verändern wird.
Zur gleichen Zeit macht sich eine Zisterzienserin auf, in der Abgeschiedenheit des Steigerwaldes eine neue Zelle zu gründen. Um eine Mitschwester vor der Inquisition zu bewahren, muss ihr Orden berühmt werden. Das Mittel: der Bau eines prächtigen Klosters. Als die Menschen im Ort Schwester Elsbeths Pläne ablehnen, greift sie auf die Hilfe dreier Fremder zurück. Einer von ihnen ist Rogers de Bezers. Elsbeth ahnt nicht, was ihn wirklich nach Wizinsten geführt hat ...
»Einer der besten Mittelalterromane der letzten Jahre!« WAZ WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1208
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
ÜBER DIESES BUCH
1250. Friedrich II. ist tot, das Reich in Aufruhr.
Nur einer kennt das letzte Geheimnis des Kaisers: Rogers de Bezers, ein Katharer. Er begibt sich auf die Spur des Geheimnisses, das sein Leben für immer verändern wird.
Zur gleichen Zeit macht sich eine Zisterzienserin auf, in der Abgeschiedenheit des Steigerwaldes eine neue Zelle zu gründen. Um eine Mitschwester vor der Inquisition zu bewahren, muss ihr Orden berühmt werden. Das Mittel: der Bau eines prächtigen Klosters. Als die Menschen im Ort Schwester Elsbeths Pläne ablehnen, greift sie auf die Hilfe dreier Fremder zurück. Einer von ihnen ist Rogers de Bezers. Elsbeth ahnt nicht, was ihn wirklich nach Wizinsten geführt hat …
Richard Dübell
DIE PFORTEN DER EWIGKEIT
Historischer Roman
Für all diejenigen, die in einer dunklen Zeit Dinge schufen, vor denen wir heute nur staunend und demütig stehen können
VORBEMERKUNG
Sämtliche Ortsnamen in dieser Geschichte werden so dargestellt, wie sie wahrscheinlich um die Zeit der Romanhandlung herum gebräuchlich waren. Ich habe mich dabei von zeitgenössischen Urkunden, Hinweisen in alten Dokumenten und mittelalterlichen Münzprägungen leiten und, soweit es möglich war, meine Erkenntnisse von verschiedenen Historikern und Archivaren bestätigen lassen. Falls mehrere Namen gültig waren, habe ich den verwendet, der mir am besten gefiel.
Nachfolgend die Übersetzungen. Ein (occ.) hinter dem Namen bedeutet, dass der Städte- oder Ortsname in Occitan angegeben ist, also der Sprache der Katharerländer des Langue d’Oc.
al-Qahira
Kairo
Ascesi
Assisi
Bezers (occ.)
Béziers
Bilvirncheim
Bilversheim
Carcazona (occ.)
Carcassonne
Chum
Como
Coburc
Coburg
Colnaburg
Köln
Damietta
Damiette
Ebra
Ebrach
Friûl
Friaul
Habisburch
Habsburg
Latezanum
Latisana
Lewinsten
Löwenstein
Lignan
Lignano
Lintpurc
Limburg
Milan
Mailand
Montsegur (occ.)
Montségur
Narbona (occ.)
Narbonne
Nuorenberc
Nürnberg
Papinberc
Bamberg
Sirmiù
Sirmione
Swartza
Schwarzach (Fluss)
Swartzenberc
Schwarzenberg
Staleberc
Stollberg
Steygerewalt
Steigerwald
Terra Sancta
Palästina/Israel (eigtl. »Heiliges Land«, m.a. Sprachregelung zur Zeit der Kreuzzüge)
Tolosa (occ.)
Toulouse
Turgovia
Thurgau
Venexia
Venedig
Virteburh
Würzburg
Wizinsten
Weißenstein
Welschenbern
Verona
KARTE VON WIZINSTEN UND UMGEBUNG
DRAMATIS PERSONAE
SCHWESTER ELSBETH
(geb. Yrmengard von Swartzenberc)
Die junge Zisterzienserin baut ein Kloster und träumt von dem Mann, der ihr einst das Leben gerettet hat.
CONSTANTIA WILTIN
Die schönste Frau Wizinstens hat die dunkle Seite ihrer Seele kennengelernt – und will den Menschen vernichten, der ihr dies ermöglicht hat.
MEFFRIDUS CHASTELOSE
Der Notar Wizinstens hat die ganze Stadt in seiner Gewalt, nur nicht seine Gefühle für die Frau, die er liebt.
RUDEGER
Constantias Ehemann trifft eine folgenschwere Fehlentscheidung.
WALTER LONGSWORDUND GODEFROY ARBALÉTRIER
Der englische Ritter und der Johannitersergeant erweisen sichals treue Gefährten.
SCHWESTER HEDWIG
Die Zisterziensernovizin sieht das göttliche Licht.
SCHWESTER LUCARDIS
(geb. Mechthild von Swartzenberc)
Die Äbtissin des Papinbercer Zisterzienserinnenklosters pflegt ungewöhnliche Beziehungen.
EVERWIN BONESS
Der Bürgermeister von Wizinsten hat Probleme mit seiner Verdauung.
MEISTER WILBRAND BLUSKOPF
Der Baumeister des Klosters sieht sich selbst als Künstler und überschätzt sich dabei stark.
DANIEL BIN DANIEL
Der Vorsteher der Judengemeinde Papinbercs ist überzeugt, dass es mehr gute als schlechte Menschen gibt.
HERTWIG VON STALEBERC
Der junge deutsche Ritter trägt das Geheimnis eines sterbenden Kaisers ins Heilige Land.
PFARRER FRIDEBRACHT, LUBERT GRAMLIP, WOLFRAM UND JUTTA HOLZSCHUHER, MARQUARD, PETRISSA UND VOLMAR ZIMMERMANN
Einige Bürger der Stadt Wizinsten.
AL-MALA’IKA
Der freundliche Mann ist ebenso schnell mit einem Lächeln wie mit einer tödlichen Klinge zur Hand.
ABU TURAB
Der Bandit versteht etwas vom Feilschen.
MEISTER HARTMANN
Der Assistent des Bischofs von Papinberc ist so unauffällig, dass man ihn selbst übersähe, wenn man allein mit ihm in einem Raum wäre.
ULRICH VON WIPFELD
Der Knappe erweist sich als zu begeisterungsfähig.
HISTORISCHE PERSÖNLICHKEITEN
ROGERS DE BEZERS
Der Sohn des berühmtesten Katharerfürsten des Langue d’Oc will den Untergang seiner Welt verhindern.
RUDOLF I. VON HABISBURCH
Der Graf ist überzeugt, dass die Zeit reif ist für sein Geschlecht – und er tut alles, um diese Überzeugung wahr werden zu lassen.
KAISER FRIEDRICH II. VON HOHENSTAUFEN, AUCH GENANNT FEDERICO IL STUPOR MUNDI
Das Staunen der Welt erlischt und nimmt ein Geheimnis mit ins Grab.
HEINRICH I. VON BILVIRNCHEIM
Der Bischof von Papinberc ist nur einem treu ergeben: seiner Geldtruhe.
RAMONS II. TRENCAVEL
Der berühmteste Katharerfürst des Langue d’Oc hat nur noch das Ziel, seine Familie zu behüten.
SARIZ DE FOIS
Die Frau von Ramons und Mutter Rogers’ bangt um die beiden Männer, die ihr alles bedeuten.
GUILHELM DE SOLER
Der ehemalige Waffengefährte von Ramons ist nur noch ein Schatten seiner selbst.
OLIVIER DE TERME, ROGERS DE COSERAN, ARSIUS DE MONTESQUIOU, PEIRE DE FENOLHET
Einige hochrangige Katharerfürsten.
KONRAD IV. VON HOHENSTAUFEN, KÖNIG VON DEUTSCHLAND, JERUSALEM UND SIZILIEN
Der Sohn von Kaiser Friedrich II. agiert nicht immer geschickt.
MANFREDO LANCIA, FÜRST VON TARENT, KÖNIG VON SIZILIEN
Der Halbbruder von König Konrad hält seinem Vater Kaiser Friedrich II. die Treue.
BERARDO DE CASTAGNA,RICCARDO DE MONTENERO
Die letzten treuen Freunde von Kaiser Friedrich II.
LOCUS HORRORIS
WINTER 1250
»… auf dass Wir noch zu leben scheinen, auch wenn Wir dem irdischen Leben entrückt sind.«
Friedrich II. von Hohenstaufen, Kaiser des Heiligen Römischen Reichs
1. CASTEL FIORENTINO, APULIEN
Manchmal – zu ganz seltenen Gelegenheiten – tauchte das vorwurfsvolle Gesicht des Mannes, den er ermordet hatte, vor dem inneren Auge Graf Rudolfs von Habisburch auf.
Oh, getötet hatte er viele Männer, und auch einen Anteil an Frauen und Kindern. Wer Schlachten schlug und Städte eroberte, konnte nicht immer einhalten, wenn ihm jemand vor die Klinge lief, der eigentlich unschuldig war. Aber kaltblütig ermordet hatte er bislang nur einen Menschen. Hugo von Teufen hatte versucht, ihn ins Straucheln zu bringen auf dem Weg zur Macht. Hugo hatte es bereut, aber da war es zu spät gewesen, weil seine Eingeweide sich bereits auf dem Boden vor ihm gekräuselt hatten und das Leben durch seine verkrampften Finger rann. Danach hatte Graf Rudolf sich unter den Schutz des Hauses Hohenstaufen stellen müssen. Natürlich hatte der Kaiser nicht erfahren, wer der wirkliche Mörder Hugos gewesen war; Rudolf hatte die Schuld auf Hugos Verwalter geschoben, einen entfernten Verwandten des Hauses Habisburch, und so getan, als schütze er den Mann aus Familienräson. Den Verwalter hatte danach niemand mehr zu Gesicht bekommen, und der Kaiser war auf die vermeintlich noble Geste Rudolfs hereingefallen.
Warum fiel ihm jetzt Hugo von Teufen wieder ein? Ach ja – weil er liebend gern das eine oder andere Gesicht um diese essensbeladene Tafel herum so gesehen hätte wie zuletzt Hugos Fresse: vor Entsetzen verzerrt, während um ihn herum das Blut eine stinkende Lache bildete. Er musterte die Männer verstohlen: Berardo de Castagna, die alte Schildkröte, auf deren Gesicht immer noch Spuren der Erleichterungstränen zu sehen waren; Riccardo de Montenero, die vertrocknete Bohnenstange; Manfredo, der grinsende junge Trottel; direkt neben ihm noch so ein nassforscher Jüngling, Hertwig von Staleberc, einer von denen, die den Kram glaubten, den ihnen Sangesvögel wie jener Wolfram ins Ohr trällerten, von wegen edlem Rittertum und der Suche nach dem heiligen Gral … und all die anderen verfluchten Idioten, die sich freuten, weil der Kaiser dem Tod erneut ein Schnippchen geschlagen zu haben schien. Er hasste sie alle.
Und er, Rudolf IV. Graf von Habisburch, Kyburc und Lewinsten, Landgraf von Turgovia? Er musste sich mitfreuen, weil das Überleben des Kaisers bedeutete, dass noch nicht alles verloren war, dass er den Kaiser würde überreden können, ihm den Schutz seines Geheimnisses anzuvertrauen. Des Geheimnisses, das über den Fortbestand des Reichs entscheiden würde – und aus wessen Haus der neue Kaiser stammte. Graf Rudolf hatte keine Schwierigkeiten zuzugeben, dass Letzteres ihm am meisten am Herzen lag.
Rudolf war überzeugt, dass der nächste Kaiser ein Banner mit einem flammendroten Löwen tragen müsse. Ebenso überzeugt wie damals, als er gewusst hatte, dass Hugo von Teufen aus dem Weg geräumt werden müsse.
»Es ist Gottes Wille«, flüsterte der Erzbischof von Palermo. »Unser Herr und Freund Federico ist der vom Herrn Gesalbte, der Jahrtausendkaiser. Auch der König von Frankreich hat sich auf seine Seite gestellt, kaum dass er aus dem Heiligen Land zurück war, und Rom die Schuld am Scheitern seines Kreuzzugs gegeben. Der König von England hat dem Papst sogar Asyl verweigert.«
Rudolf starrte missmutig auf die Brotscheibe vor sich auf dem Tisch. Einer der Dienstboten huschte herbei und legte ihm ein weiteres safttriefendes Stück Braten vor. Rudolf hatte keinen Appetit, aber er hatte Lust, seine Zähne in Fleisch zu schlagen und es vom Knochen zu zerren und zu zerbeißen, um seinen Zorn abzureagieren.
»Der Papst weiß selbst, dass er am Ende ist«, erklärte Riccardo de Montenero. »Sonst hätte Innozenz IV. nicht die Friedensverhandlungen angeboten, zu denen wir unterwegs waren, bevor der Kaiser von der Krankheit befallen worden ist …«
»Von der Gottes Güte ihn jetzt hat genesen lassen«, warf Berardo de Castagna ein.
»Dank sei dem Herrn«, sagte eine brüchige Stimme.
Alle sprangen auf. Der Kaiser stand am Eingang zum großen Saal, seinen Kammerdiener an der Seite. Rudolf fühlte beinahe so etwas wie Bestürzung. Federico lächelte, doch er sah schrecklich aus, das Gesicht hager und zerknittert; die Darmkrämpfe hatten Falten in seine Mundwinkel gekniffen, und das blonde Haar war fast vollkommen ergraut. Er hatte sich in dickes Fell gehüllt wie ein fröstelnder alter Mann. Die anderen hatten seinen Verfall die letzten Wochen über miterlebt und waren weniger überrascht als Rudolf.
Manfredo sprang auf und hob seinen Kelch: »Auf den wahren Kaiser des Heiligen Römischen Reichs!« Die Augen des jungen Mannes waren feucht. Rudolf kannte – und verachtete – Manfredos Treue zu seinem Vater. Er war sicher, wären die anderen nicht gewesen, hätte Manfredo sich auf den Kaiser gestürzt und laut »Papa!« gerufen. Er rollte die Augen und hob seinen Kelch, um nicht aufzufallen.
Der Kammerdiener winkte den Mundschenk heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Das Gesicht des Mundschenks wurde lang. »Birnen … mit … Zucker?«, stotterte er.
»Wenn es möglich wäre …«, erklärte Federico mit der Freundlichkeit, die er seinen Dienstboten stets entgegenbrachte.
Unwillkürlich warf der Mundschenk dem Leibarzt des Kaisers einen Blick zu, der mit am Tisch saß. Der Leibarzt strahlte. »Wenn Seine Majestät es wünschen.«
Es war offensichtlich, dass der Mundschenk gerne gefragt hätte, wo um alles in der Welt er im Dezember Birnen hernehmen sollte und ob der Kaiser beim nächsten Mal nicht vielleicht vorher Bescheid geben könnte, bevor er eine unbedeutende Burg in einem unbedeutenden Abschnitt Apuliens heimsuchte und dann nach Zucker verlangte. Doch der Mundschenk verbeugte sich nur. »Majestät werden keinen Grund zur Beschwerde haben.«
»Wie sollte er auch?«, lächelte der Leibarzt. »Wo sein Appetit doch bedeutet, dass er über den Berg ist.«
Graf Rudolf ließ sich auf seinen Platz zurücksinken und beobachtete, wie der Kaiser sich in den hochlehnigen Stuhl am Kopfende der Tafel setzte. Er senkte den Kopf, als Federico die Blicke um den Tisch wandern ließ, denn er fürchtete, seine Augen würden seine wahren Gefühle verraten. Die Brotscheibe war völlig vom Bratensaft durchweicht, das Fett auf dem Fleisch begann zu erkalten. Er schob das Brot vom Tisch auf den Boden. Mit den Füßen scharrte er die triefende Masse beiseite, doch der aufgeregte Anprall muffig riechender Körper gegen seine Beine und das Jappen und Jaulen verrieten, dass die Hunde sich schon darum balgten. Graf Rudolf verteilte ein paar Tritte, ohne hinzusehen. Das raufende Hundeknäuel rollte ein paar Stationen weiter und zwang Riccardo di Montenero, die Füße zu heben. Wenn Rudolf nicht so schlechter Laune gewesen wäre, hätte er böse gegrinst. Er biss in den Braten und schmeckte unter den Gewürzen und der Soße, dass das Fleisch einen Stich hatte. Wütend schluckte er den Bissen hinunter, den er im Mund hatte, und legte den Batzen zurück auf den Tisch.
Merkten sie überhaupt nicht, dass sie alle eine erbärmlich schlechte Komödie spielten? Der Kaiser wollte Birnen mit Zucker, weil es ihm besser ging? Hatten sie denn noch nie einem Menschen beim Sterben zugesehen? Der Mundschenk war davongeeilt, um die Bediensteten der Burg in die Hintern zu treten und ihnen alle Strafen der Hölle anzudrohen, damit sie ja ein paar Birnen und die letzten Vorräte Zucker fanden, und wenn sie sie einem Verhungernden in dem Dorf zu Füßen der Burg aus dem Maul ziehen mussten. Der Leibarzt strahlte fröhlich, der alte Erzbischof lächelte und bekreuzigte sich ein ums andere Mal, der dumme Manfredo ließ kein Auge von seinem Vater. Und der Kaiser selbst …
… hatte immer noch die Macht, sie alle mit seiner eigenen Überzeugung zu verzaubern, selbst wenn jeder, der genau hinsah, hätte erkennen können, dass der Tod ihm nur die Hand von der Schulter genommen hatte, damit er mit der Sense besser ausholen konnte. Doch keiner sah genau hin – außer Rudolf.
Er fühlte den Blick Kaiser Federicos auf sich ruhen. Unwillkürlich setzte er sich gerader hin und verachtete sich selbst dafür.
»Der Graf von Habisburch sieht so ärgerlich aus, als ob man ihm sein eigenes Pferd zum Essen vorgesetzt hätte«, sagte eine Stimme. Gelächter erhob sich. Rudolf suchte nach dem Sprecher. Er fand ein grinsendes, soßenglänzendes, jugendlich-verwegenes Gesicht.
»Herr Hertwig von Staleberc sieht so fröhlich aus, als ob ihm mein Pferd schmecken würde«, erwiderte Rudolf. Er fasste den jungen Ritter auf der anderen Seite der Tafel ins Auge, während das Gelächter noch lauter wurde und Hertwig gutmütig nickte und so tat, als gebe er sich geschlagen. Dann senkten sich die Brauen des jungen Mannes, als Rudolfs Blick ihn traf. Rudolf gab sich keine Mühe, sein Lächeln in etwas anderes zu verwandeln als das, was es war: Zähnefletschen.
»Das war schlagfertig!«, rief jemand. »Die Herren sollten ein jeu-parti wagen!«
Das fehlte noch: ein jeu-parti – ein Lied, das zwei Sänger gegeneinander sangen; einer sang eine Zeile, und der andere musste eine Antwortzeile darauf finden, die den ersten Gedanken weiterentwickelte und sich am besten auch noch darauf reimte. Manche Duellanten hatten schon ganze Abende mit ihren Stegreifballaden gefüllt, während die Zuhörer Trost im Wein suchten. Und das mit dem dummen Grünschnabel Hertwig von Staleberc? Das Bürschchen machte auch noch ein Gesicht, als könnte es sich vorstellen, darauf einzugehen, aber ein zweiter Blick in Graf Rudolfs Miene belehrte Staleberc offensichtlich eines Besseren. Er lehnte sich zurück und ignorierte die Aufforderung, indem er sich ein neues Stück Fleisch auftun ließ.
Rudolf fühlte die Blicke des Kaisers erneut auf sich ruhen. Er wandte Federico absichtlich den Rücken zu. Graf Rudolf hatte den Schutz des Hauses Hohenstaufen unter anderem deshalb akzeptiert, weil er es für schwach und abgehalftert hielt und überzeugt war, dass sein eigenes Geschlecht zur Führung des Reichs auserkoren war. Er hatte mit dem Kaiser sogar den Kirchenbann geteilt. Er hatte ihn in den Niedergang begleitet, anstatt seinen eigenen Namen zu Ruhm und Ehre zu führen. Wann kam endlich die Stunde der Belohnung dafür?
Als er hörte, dass der Kaiser ein Gespräch mit Riccardo de Montenero begann, musterte er ihn verstohlen. Da saß der Herr des Reichs, dünn und ausgemergelt, seine einstige kühne Schönheit vergangen in einem Leben aus Kampf und drei Wochen krampfartigen Darmentleerens. Rudolf hatte gehört, dass der Kaiser in seiner Kammer bereits sein Sterbegewand hatte bereitlegen lassen – eine graue Zisterzienserkutte. Ha! Gab es denn keinen Spiegel in der Schlafkammer des Kaisers, in dem er hätte sehen können, wie durchsichtig er bereits war? Wenn Rudolf etwas an Kaiser Federico geschätzt hatte, dann seinen Pragmatismus. Er konnte nicht in den Spiegel gesehen haben, sonst hätte er sich nicht hierhin gesetzt und alle glauben gemacht, das Leben würde weitergehen.
Hoffentlich hat er die Zisterzienserkutte noch nicht wieder weglegen lassen, dachte Rudolf gehässig. Er sah das graue Kleidungsstück vor Augen und verzog den Mund. Zisterzienser. Von all den Orden, die in Kutten und Tonsuren und entweder im Schlamm der Schweineställe, die ihre Klöster waren, oder im Saus und Braus ihrer Abteien die göttliche Vollendung suchten, waren dem Kaiser ausgerechnet die Zisterzienser ans Herz gewachsen. Weil sie die Einzigen gewesen waren, die in den grausamen Feldzügen der Kirche gegen die südfranzösischen Ketzer, denen heimlich das Herz des Kaisers in den letzten Jahren gehört hatte, verhältnismäßig vernünftig und milde vorgegangen waren? Rudolf wusste es nicht. Er wusste nur, dass der Krieg gegen die Albigenser oder Katharer (die Reinen! Pah!) tatsächlich mehr als grausam gewesen war; wusste es aus allererster Hand, sozusagen – dies war ein Geheimnis, das er dem Kaiser nie verraten hatte.
Und Rudolf wusste noch etwas. Er hasste keinen hier am Tisch mit solcher Inbrunst wie Kaiser Federico, Friedrich II. von Hohenstaufen, den Ketzer, den Antichrist, das Staunen der Welt – auch wenn dieser den morgigen Abend nicht mehr erleben würde.
2. ZISTERZIENSERINNENABTEI SANKT MARIA UND THEODOR, PAPINBERC
Schwester Elsbeth rannte den Gang entlang, der zum Hospiz führte. In ihrem Ohr hallte das Gespräch, das sie soeben mit Schwester Lucardis geführt hatte, der Äbtissin des Zisterzienserinnenkonvents Sankt Maria und Theodor in Papinberc.
»Aber warum ich, ehrwürdige Mutter?«
»Weil Bischof Heinrich eine starke Abneigung gegen unsere Schwester infirmaria hat, seit ihr Vater damals in seine Entführung und Freilassung gegen ein horrendes Lösegeld verwickelt war. Wenn er bei seiner jährlichen Besichtigung merkt, dass ich ihr zwischenzeitlich die Leitung des Hospizes anvertraut habe, können wir die Hoffnung begraben, dass er seine Geldzuwendungen erhöht.«
»Warum hast du ihr dann diese Stellung gegeben?«
»Weil sie die Beste ist.«
»Und warum sollen meine Novizinnen und ich dann den Bischof im Hospiz herumführen, ehrwürdige Mutter?«
»Weil du dafür die Beste bist.«
So weit war das Gespräch gut verlaufen. Elsbeth hatte sich sogar beinahe geschmeichelt gefühlt. Sie war jung für eine Novizenmeisterin – noch keine zwanzig Jahre alt. Aber das gesamte Kloster Sankt Maria und Theodor war ein sehr junges Kloster. Lucardis, die Äbtissin, war Mitte zwanzig. Die Regel der Zisterzienserinnen lautete, dass eine Äbtissin mindestens dreißig Jahre alt sein musste, aber das Papinbercer Zisterzienserinnenkloster war nicht immer regelkonform aufgestellt. Nicht einmal Bischof Heinrich von Bilvirncheim hatte Einspruch erhoben, als Lucardis vor zwei Jahren von ihrer Vorgängerin vorgeschlagen worden war. Die neue Äbtissin war bekannt dafür, einen Sinn für Zahlen zu haben, besonders wenn diese mit Finanzen verbunden waren. Der Bischof liebte es, wenn wenigstens in einem Bereich seiner weit gespannten Verantwortlichkeiten halbwegs Gewinne erwirtschaftet wurden.
Die Hierarchie von Sankt Maria und Theodor war flach – es gab die sacrista, die die Schlüsselgewalt und die Aufsicht über die liturgischen Gefäße innehatte, Um- und Neubauten beaufsichtigte und für die Herstellung der Hostien verantwortlich war; die cantrix als Chorleiterin und Bibliothekarin und direkte Vertreterin der Äbtissin – der Einfachkeit der regulae benedicti folgend, besaß das Zisterzienserinnenkloster weder Priorin noch Subpriorin –; die infirmaria; die vestiaria, in deren Verantwortungsbereich sämtliche Kleidung und die Tischtücher fielen; die celleraria für alle Verpflegungsfragen und die portaria, die über den Zugang von und zur heillosen Welt außerhalb der Klostermauern wachte. Bis auf die Pförtnerin waren alle Frauen noch jung.
Schwester Elsbeth, die scholastica oder Novizenmeisterin, war die Jüngste von ihnen. Die Postulantinnen und die Novizinnen, die das Kloster nach der ersten Begegnung mit der Schwester Pförtnerin vor Ehrfurcht und Angst erstarrt betraten, schlossen sie meist schon beim ersten Gespräch ins Herz.
»Bis jetzt hast immer du die Gespräche mit dem Bischof in deiner Zelle geführt«, hörte Elsbeth sich während der Unterredung mit der Äbtissin sagen und erinnerte sich an die leichte Panik in ihrer Stimme, während ihr der Atem beim Laufen langsam knapp wurde. Sankt Maria und Theodor war ebenso eng wie verwinkelt und in den Kaulberg hineingebaut. Das Kloster war als eine Art späte Idee um das ursprüngliche Hospiz herum entstanden, und wenn Elsbeth den Treppen und Fluren folgte, um an einen Ort zu gelangen, der von der Idealvorstellung eines Klosters her ganz woanders hätte liegen müssen, empfand sie meistens den dringenden Wunsch, den Konvent vollkommen umzubauen. Dieses Mal wünschte sie sich jedoch nur, so schnell wie möglich ins Hospiz zu gelangen. Die Erinnerung an den Schreck der Äbtissin überlagerte kurz das Echo des zuvor geführten Gesprächs: »Lauf, Elsbeth, lauf!«
»Ich habe Bischof Heinrich vor ein paar Wochen gebeten, das Hospiz mit vier Pfund jährlich zu unterstützen«, hatte Lucardis erklärt. »Ich habe ihm erläutert, dass wir mit dieser Investition einen kleinen Anbau errichten und einen Trakt für Adlige und wohlhabende Bürger schaffen können. Dann würden diejenigen von ihnen, die unsere Brüder in benedicto auf dem Michaelsberg auf Wartelisten gesetzt haben, weil ihr Hospiz überfüllt ist, stattdessen zu uns kommen. Das Hospiz von Sankt Maria und Theodor würde den Ruf verlieren, ein Pflegeheim nur für die Armen zu sein, und mehr Zuwendungen würden fließen, und …«
»… aus vier Pfund Unterstützung im Jahr würden acht Pfund Dividende.«
Lucardis hatte gelächelt. »Offenbar hat Vater auch dich neben einem Geldwechslertisch gezeugt. Das wirft ein merkwürdiges Licht auf die nächtlichen Angewohnheiten unserer Eltern.«
»Ich stehe nur lange genug unter deinem schlechten Einfluss, Schwesterherz.«
Die Äbtissin und die Novizenmeisterin waren Schwestern nicht nur im übertragenen Sinn als Klosterangehörige, sondern auch im wirklichen Leben, als Lucardis noch Mechthild von Swartzenberc geheißen hatte und Elsbeth Yrmengard von Swartzenberc. Von Kindesbeinen an waren die beiden unzertrennlich gewesen. Es hatte niemals Geheimnisse zwischen ihnen gegeben.
Das hieß, bis vor einiger Zeit hatte es niemals Geheimnisse zwischen ihnen gegeben. Bis zu jenem Tag in Colnaburg.
»Hast du Schwester Hedwig in Sicherheit gebracht?«, hatte Lucardis gefragt.
»Ja, natürlich.«
Und dann war eine junge Schwester in die Zelle der Äbtissin geplatzt und hatte keuchend gemeldet, dass der Bischof samt Gefolge eingetroffen sei.
»Wie – samt Gefolge? Was für ein Gefolge?«
»Seine Ehrwürden hat Propst Rinold, seinen Assistenten und seinen Kämmerer mitgebracht.«
»Den Kämmerer? Albert Sneydenwint? Heiliger Benedikt!«
Elsbeth hatte die junge Klosterschwester argwöhnisch gefragt: »Habe ich dich nicht gebeten, auf Schwester Hedwig achtzugeben?«
»Ja, Schwester Elsbeth. Aber dann hat die Schwester Pförtnerin mich beauftragt, die Mutter Oberin zu informieren, und ich habe Schwester Hedwig ins Hospiz geschickt, weil ich mir dachte, dort passt bestimmt jemand auf sie auf.«
Elsbeth und Lucardis hatten sich bestürzt angesehen.
»Albert Sneydenwint im Hospiz?«, hatte Lucardis hervorgestoßen, während Elsbeth gleichzeitig gekeucht hatte: »Schwester Hedwig im Hospiz?«
Das war der Zeitpunkt gewesen, an dem die Äbtissin gesagt hatte: »Lauf, Elsbeth, lauf!« Und als sie losgerannt war, hatte ihr Lucardis noch hinterhergerufen: »Sneydenwint darf unter keinen Umständen in den Trakt für die Geisteskranken! Unter gar keinen Umständen!«
3. ZISTERZIENSERINNENABTEI SANKT MARIA UND THEODOR, PAPINBERC
Hedwig war Schwester Elsbeths besonderer Schützling. Die junge Nonne fiel überall auf, wo sie sich auch befand. Sie war blass und zart, aber von solcher Blässe, dass sie zwischen den anderen Gesichtern herausleuchtete, und von solcher Zartheit, dass selbst die dünne graue Kutte wie ein Gewicht auf ihren Schultern zu lasten schien. Hedwig hatte … nun: Zustände. Ein solcher Zustand hielt mehrere Stunden bis zu zwei Tagen an und zeichnete sich nach außen dadurch aus, dass das Mädchen regungslos an irgendeinem Platz saß oder stand und ins Leere starrte. Wenn man Hedwig beiseiteschob oder auf die Beine stellte, wandelte sie ein paar Schritte weiter und blieb dann wieder stehen. Wenn man sie in einer Fensternische abstellte, setzte sie sich auf die Mauerbank und saß dort, bis man sie vertrieb oder bis ein Regenguss die Steine so schlüpfrig machte, dass sie zu Boden rutschte. Sie aß nicht; wenn man ihr etwas in den Mund schob, blieb es dort. Zu Beginn ihrer Zeit im Kloster wäre sie beinahe erstickt, als Elsbeth ihr einen Bissen Brot zwischen die Zähne gesteckt hatte. Danach war Elsbeth dazu übergegangen, den Bissen vorher zu zerkauen und dem Mädchen dann den Brei zu verabreichen. Das Ergebnis blieb das gleiche – wenn man der widerstandslosen Hedwig nach einer Weile den Mund öffnete, rann der Inhalt einfach heraus. Es grenzte an ein Wunder, dass sie in diesen Phasen weder verhungerte noch verdurstete.
Was ebenfalls ohne Hedwigs eigenes Zutun aus ihrem Mund während dieser Phasen rann, waren Worte. Ströme von Worten. Gott war das Licht. Gott war die Reinheit. Das Ziel aller menschlichen Seelen war es, dereinst in diesem Licht aufzugehen und die Welt der Schatten und der Dunkelheit auszulöschen. Gott war gut.
Das Problem war, dass aus Hedwigs Worten – an die sie sich nicht erinnerte, wenn sie wieder zu sich gekommen war – klar herauszuhören war, dass ihr Gottesbegriff nicht mit dem zusammenpasste, für den die Kirche stand. Jahwe, der Gott des Alten und Neuen Testaments, war damit nicht gemeint. Er gehörte zu der Welt der Schatten. Er war ein böser Geist. Die ganze Schöpfung war böse. Am Anfang war nicht das Wort gewesen, sondern das Licht, und es war gefangen worden in der Kreation aus Stein und Erde und Wasser und Blut … und Dunkelheit und Arglist.
Es war die Lehre, die die albigensischen Ketzer von Böhmen über Deutschland bis nach Frankreich getragen hatten; die Lehre, die die Romkirche veranlasst hatte, einen der blutigsten Kreuzzüge zu unternehmen, den sie je geführt hatte. Die Ketzer waren mit Feuer und Schwert bekämpft worden. Sie hatten sich gewehrt, sie waren unterlegen gewesen, sie waren so gut wie ausgerottet. Sie hatten zu Hunderten auf den Scheiterhaufen der Sieger gebrannt. Elsbeth hatte Hedwigs Eltern niemals kennengelernt – das Aufnahmegespräch hatte Äbtissin Lucardis geführt. Doch sie mutmaßte, dass diese dem ketzerischen Gedankengut ebenfalls nahestanden und ihre Tochter deshalb nach Sankt Maria und Theodor gesandt hatten, damit sie dort geschützt war.
Hedwig hielt sich seit dem vergangenen Frühjahr in Sankt Maria und Theodor auf. Als sie zum ersten Mal in einer ihrer Trancen gesprochen hatte – vollkommen klar und zusammenhängend, auf keinen Fall misszuverstehen –, hatte Elsbeth sich geschworen, ihr diesen Schutz, wenn nötig, persönlich zu bieten. Der Schwur hing mit Colnaburg zusammen. Es war Elsbeth absolut klar gewesen, was geschehen würde, wenn Bischof Heinrich von Bilvirncheim das junge Mädchen sprechen hörte. Der Mann war einer der engsten Vertrauten von Kaiser Federico gewesen und hatte ihn dann verraten, angeblich wegen zu großer Nähe zu ketzerischem Gedankengut. Er würde sich nicht vor Hedwig stellen oder vor das Kloster, das ihr Zuflucht gab. Im Gegenteil, er würde dafür sorgen, dass sie alle ins Feuer gehen mussten.
Als Elsbeth schweratmend in das Hospiz platzte, standen ihre Novizinnen und die Besucher in einer Gruppe am einen Ende des Raumes und steckten die Köpfe zusammen. Zu ihrem Entsetzen wurde ihr klar, dass die Mädchen in Abwesenheit ihrer Meisterin versuchten, die Fragen des Bischofs zu beantworten. Schlitternd kam sie zum Halten, atmete einmal tief durch, strich ihren Habit glatt und schritt dann auf die Gruppe zu.
»Ah«, sagte ein Mann mit feistem, glänzendem und offensichtlich frisch rasiertem Gesicht. Er trug eine reich bestickte Kappe, die auf seinem Kopf balancierte wie ein aufgeplusterter Vogel auf einem Standbild, und eine mit breiten gold-roten Schrägstreifen gemusterte Tunika. Vermutlich hätte man ihn im Dunkeln gesehen. Elsbeth kam er vage bekannt vor, aber sie war viel zu aufgeregt, um darüber nachzudenken. Alle anderen, vor allem der in Schwarz gekleidete Bischof und der ebenso nüchterne Propst, wirkten neben ihm wie Vogelscheuchen. »Ah, eine weitere heilige Schwester.«
Elsbeth verneigte sich. »Ich bin die sacrista von Sankt Maria und Theodor.«
»Und die Schwester scholastica, wie ich gehört habe«, schnarrte Bischof Heinrich und streckte die Hand mit dem Bischofsring zum Kuss aus. Der Gedanke, dass die Frauen des Konvents in der Kunst des Lesens und Schreibens unterwiesen wurden, erfüllte ihn offensichtlich nicht mit Freude. »Eure Mutter Oberin hat viel Vertrauen in Euch.«
»Ich danke Euch, ehrwürdiger Vater«, erwiderte Elsbeth und verneigte sich auch vor Propst Rinold. Dieser nickte, als ob ihn das alles nichts anginge. In gewisser Weise hatte er recht damit. In anderen Frauenklöstern wurde der Propst, also der Mann, der der Äbtissin in allen weltlichen Dingen ihres Konvents zur Seite stand, vom Mutterkloster entsandt. Die besondere Stellung von Sankt Maria und Theodor als dem Bistum Papinberc unterstellt hatte dem Bischof die Aufgabe der Entsendung übertragen, und er hatte einen der Männer erwählt, dem er Geld schuldete – vermutlich in der Hoffnung, dass der Propst dabei genug Geld für sich abzweigen konnte, um des Bischofs Schulden gnädig zu vergessen. Dass Bischof Heinrich dies sogar nach seinem ersten Gespräch mit Lucardis immer noch gehofft hatte, war erstaunlich. Propst Rinold hatte nie erkennen lassen, ob die Geschicklichkeit der Äbtissin, mit der diese ihn jedes Mal ausmanövrierte, wenn er sich in die Geschäftsangelegenheiten des Klosters einmischte, ihn verärgerte oder amüsierte. Jedenfalls hatte er den Bischof seine Schulden nicht vergessen lassen.
Der vierte Mann in der Gruppe war so unscheinbar, dass Elsbeth einmal mehr kämpfen musste, um sich an seinen Namen zu erinnern. Mit ihm verhielt es sich so, dass man überrascht war, wenn er sich nach einem Besuch verabschiedete, weil man gar nicht wahrgenommen hatte, dass er da war. Wäre er alleine irgendwo aufgetreten, hätte es sein können, dass man mitten im Gespräch den Raum verließ, einfach weil man seine Anwesenheit vergessen hatte. Für Elsbeth war es ein Rätsel, dass er noch nicht in irgendeiner Gasse über den Haufen geritten worden oder unter die Räder eines Karrens gekommen war. Reiter und Karrenlenker hätten nachher, ohne zu lügen, behaupten können, ihn einfach nicht gesehen zu haben. Endlich fiel ihr wieder ein, wie er hieß. Sie nickte ihm zu: »Meister Hartmann.«
Der junge Mann nickte zurück und lächelte. Elsbeth wusste nicht einmal, ob er ein Angehöriger des Klerus oder ein Laie war.
»Ah …«, sagte der dicke Mann. »Ein außergewöhnlicher Name – Scholastika. Ich hatte eine Tante, die hieß Clementia.«
»Scholastika bedeutet Schulmeisterin«, knurrte der Bischof. »Die Schwester hier …«
»Schwester Elsbeth«, sagte Elsbeth.
»… ist gleichzeitig für die Betreuung und für die Ausbildung der Novizinnen zuständig.«
»Meine Schwiegermutter heißt Elsbeth«, eröffnete der dicke Mann. »Oder eigentlich nicht. Eigentlich heißt sie Gertrud. Klingt aber so ähnlich, oder? Haha!«
Für einen Augenblick trat die Art von Stille ein, die sich auch über einen Thronsaal senkt, wenn dem König beim Niedersetzen die Hosennaht zerreißt. Jedem war klar, dass Albert Sneydenwint seinen Posten als Kämmerer des Bischofs nicht aufgrund besonderer geistiger Fähigkeiten erhalten hatte. Wahrscheinlich war er ein weiterer Gläubiger Heinrichs. Dann räusperte sich der Bischof, wippte auf den Zehenballen und sagte: »Sacrista und scholastica in einem, eh? Wollen wir mal sehen, wie gut Ihr in beidem seid, Schwester. Wer weiß, was numquam reformata quia numquam deformata bedeutet …?«
Elsbeth, die sich zwar nicht vorstellen konnte, welche Gefahr von dem dicken Kämmerer ausgehen konnte, wenn er in den Raum für die Verrückten geriet – außer, dass man ihn dortbehielt –, der aber dennoch die Warnung ihrer großen Schwester in den Ohren klang, nickte erleichtert. Wenn der Bischof die Mädchen hier zu ihrer Bildung zu befragen wünschte, war er vielleicht gar nicht wirklich am Hospiz interessiert und würde es mit seinen Trabanten bald wieder verlassen. Dann würde weder Albert Sneydenwint in Gefahr geraten, den Trakt für die Verrückten zu betreten, noch würde der Bischof der jungen Hedwig über den Weg laufen. Und was das Wissen der Mädchen betraf, nun, da brauchte sie sich keine Sorgen zu machen, es sei denn, der Bischof geriet an die eine ihrer Schülerinnen, der sie bereits eingeschärft hatte, sich im Hintergrund zu halten und ja nicht aufzufallen …
»… ja, Ihr da hinten, junges Fräulein. Nein, hinter Euch steht niemand mehr. Ich meine Euch. Nun? Eh?«
… was offensichtlich ein Fehler gewesen war. Elsbeth schloss die Augen.
»Wie lautet Euer Name?«
»A… Adelheid, ehrwürdiger Vater.«
Albert Sneydenwints rundes, von der Rasur geschundenes Gesicht leuchtete auf. Elsbeth fragte sich unwillkürlich, wer von seinen Verwandten entfernt so ähnlich hieß wie Adelheid.
»Nun? Eure Antwort?«
»Äh …«, machte Adelheid und verstummte dann.
»Ein guter Anfang, meine Liebe. Und wie geht es weiter?«
»Vielleicht dürfte ich anmerken …«, warf sich Elsbeth in die Bresche.
Bischof Heinrich schüttelte unwillig den Kopf. Er war ein unscheinbarer kleiner Mann, dem irgendjemand einmal gesagt hatte, Schwarz lasse ihn majestätisch aussehen, und der beim Reden beständig auf den Fußballen wippte. Alles in allem gab dies ihm das Aussehen einer Krähe, die aufgeregt nach Futter pickt. Es war offensichtlich, dass Bischof Heinrich die Frage der Äbtissin nach den vier Pfund Unterstützung jährlich abschlägig zu bescheiden gedachte, aber zu feige war, es ohne einen Grund zu tun, und sei er vorgeschoben. Elsbeth hatte plötzlich das Gefühl, eine der Mäuse zu sein, die die Schausteller auf den Jahrmärkten vorführten. Die Mäuse mussten einen Hindernislauf absolvieren. Die Hindernisse bestanden aus Schlagfallen, die von einem Zuschauer aus dem Publikum ausgelöst werden konnten. Der Schausteller setzte die Maus in den Parcours, sie rannte los, und der Kandidat versuchte, mit dem Auslösen der Fallen schneller zu sein als die Maus. In der Regel war die Maus sehr schnell. Manchmal waren die Kandidaten schneller. Ihre Augen pflegten genauso zu funkeln wie die des Bischofs, dessen Blicke auf Elsbeth ruhten, obwohl sein eigentliches Opfer die junge Adelheid war.
»Ah, was sehe ich denn da?«, knödelte Albert Sneydenwint.
Der Bischof hatte nicht vor, sich ablenken zu lassen. »Ich warte …«, sagte er mit gefährlicher Stimme.
»Äh … äh … reformata … reformiert … äh … äh … deformata … hmmm …«
»Das ist doch wirklich nicht so schwer, Fräulein Adelheid.«
»Mein Vater sagt immer, dass es genügt, wenn Frauen den Mund halten, anstatt fremde Sprachen zu lernen!«, platzte das Mädchen heraus.
Bischof Heinrich, der mit Sicherheit in seinem tiefsten Herzen der gleichen Meinung war, zeigte sich dennoch unnachgiebig. »Euer Vater, Fräulein Adelheid, ist nicht hier!«
Eine andere Novizin hob schüchtern die Hand. »Darf ich, ehrwürdiger Vater …?«
»Nein!«
»Niemals reformiert, da niemals deformiert«, sagte Elsbeth, die es nicht länger mit ansehen konnte. »Entschuldigt, ehrwürdiger Vater. Ich habe mir erlaubt, meinen Schülerinnen zuerst die Grundlagen des Ordens von Cîteaux zu vermitteln.«
»Ihr solltet auf die anderen Orden achten, Schwester Scholastika. Die Zisterzienser sind nicht im Besitz der allein seligmachenden Weisheit.«
»Ich weiß, was das ist«, sagte Albert Sneydenwint und deutete auf eine flache Unterlage, auf der ein säuberlich zu einem Kegel aufgeschichtetes Häuflein dunkler Materie ruhte.
»Ihr habt recht, ehrwürdiger Vater«, erwiderte Elsbeth und verbeugte sich. »Umso mehr, da es wichtig ist, die Gefahr hinter dem Motto der Karthäuser zu erkennen: Stagnation. Christ zu sein bedeutet, an sich und seinem Glauben zu arbeiten. Wer auf die göttliche Weisheit vertraut, hat keine Furcht, sich Veränderungen zu stellen, weil auch jede Veränderung von Gott kommt.«
»Wahr gesprochen, Schwester Elsbeth.« Der Bischof lächelte verzerrt. Elsbeths Herz sank noch weiter. Nicht einmal Lucardis schaffte es für gewöhnlich, sich in derartiger Geschwindigkeit jemanden zum Feind zu machen.
»Es ist nur immer das Griechische, das mich durcheinanderbringt«, klagte Adelheid.
Albert Sneydenwint tauchte den Daumen und die ersten zwei Finger der rechten Hand in den dunklen Staub, nahm eine Prise auf und hob sie an die Nase. »Das sind feinstgemahlene Kräuter und Kristalle, die man zur Erstellung von Heilelixieren verwendet.« Er schnupperte gewaltig. »Aah …«
»Das ist Asche aus dem Ofen in der Latrine, wo wir immer die Exkremente verheizen«, sagte die Novizin, die Sneydenwint am nächsten stand.
»Ah … aaargh …!«, machte der Kämmerer und krümmte sich unter einem donnernden Niesanfall. Als er wieder gerade stehen konnte, tränten seine Augen. Er wischte die Finger an seiner Tunika ab. Von der Nase quer über die Oberlippe zog sich ein feucht gewordener, dicker Streifen aus Ruß. Die Novizin neben ihm unternahm einen halbherzigen Versuch, ihn darauf aufmerksam zu machen, ließ die Hand dann aber wieder sinken. Elsbeth wusste plötzlich, warum sie den Kämmerer zunächst nicht hatte zuordnen können: Bis jetzt hatte er immer einen Bart um Oberlippe und Kinn getragen.
Sneydenwint strahlte, während ihm die Tränen über die Wangen liefen. »Das wusste ich natürlich«, krächzte er. »Wusste ich natürlich. Aber verbrannt ist gereinigt, was? Aaargh …!« Er nieste erneut.
»Wie ist Euer Name?«, fragte der Bischof und wippte in Richtung der Novizin, die versucht hatte, Adelheid zu Hilfe zu kommen.
»Reinhild, ehrwürdiger Vater.«
»Was bedeutet locus horroris?«
»Als Bruder Robert vor über hundertfünfzig Jahren sein Kloster Molesme mit einundzwanzig Getreuen verließ, um ein neues Kloster zu gründen, das sich wieder streng nach den apostolischen Werten richten wollte, suchte er dafür einen Ort des Schreckens und der öden Einsamkeit, ehrwürdiger Vater!«
Der Bischof kniff ein Auge zusammen. »Und was sind die apostolischen Werte?«
»Die apostolischen Tugenden sind simplicitas, castitas und paupertas«, sprudelte Reinhild hervor. »Die Mönche um Robert de Molesme beabsichtigen, ihnen wieder in aller Strenge zu folgen. Sie gaben ihrem neuen Kloster keinen Namen, aber weil seine Lage mitten in einem Sumpf war, wo viel Röhricht wuchs, wurde es unter den frommen Menschen in der Umgebung unter dieser Bezeichnung bekannt: Cîteaux – der Ort, an dem das Röhricht wächst.« Reinhild verstummte und holte sogleich wieder Luft. »Weil Röhricht nämlich auf Französisch cistels heißt.« Sie sprach es in aller Unschuld aus, wie es ihre Muttersprache ihr befahl: zistls.
»Reinhild, damit hast du die nächsten drei Fragen des ehrwürdigen Vaters vorweggenommen«, sagte Elsbeth. Reinhild senkte den Kopf und errötete. Bischof Heinrich räusperte sich, und Elsbeth wurde klar, dass er gar nicht genug von den Zisterziensern wusste, dass er die Fragen hätte stellen können, die Reinhild beantwortet hatte. Im Geiste sah sie, wie der Bischof auf einer imaginären Sündenrolle einen weiteren schwarzen Punkt unter den Namen Elsbeth malte. Vorsichtig ließ sie die Blicke von einem der Männer zum anderen wandern. Propst Rinolds Gesicht wirkte wie die Vorlage für ein Kirchenfenster zu einer neuen Kardinalstugend: unendliche Langeweile. Albert Sneydenwint strahlte ungebrochen debile Fröhlichkeit aus. Hartmann sah aus wie immer, also so, dass man sofort vergaß, wie er aussah. Bischof Heinrich …
»… das ist also das Hospiz, eh?«, brummte der Bischof.
»Ja, ehrwürdiger Vater«, antwortete Elsbeth, nachdem sie erkannt hatte, dass nach diesem ersten Satz nichts mehr kam. »Möchte der ehrwürdige Vater es besichtigen?«
»Wir haben nur ganz wenige an Seuchen Erkrankte hier«, sagte Reinhild wie auf ein Stichwort hin. Elsbeth hätte sie küssen mögen. Und den alten Mann ein paar Lager weiter vorne gleich mit, der den Augenblick dazu nutzte, zu röcheln und zu husten wie einer, der in der nächsten Minute vor seinen Schöpfer treten wird, und dann nach einem markerschütternden Räuspern in einen neben ihm befindlichen Napf zu spucken, wo der Auswurf hörbar einschlug. Na gut, wenigstens umarmen hätte sie ihn mögen.
»Äääh …«, machte der Bischof, »ich meine … aah, ich sehe, dass man sich hier um jeden Leidenden kümmert.« So wie er es sagte, klang es wie ein Vorwurf.
»Vor Gott und im Schmerz sind wir alle gleich«, erklärte Elsbeth.
Aus der Richtung eines anderen Lagers erklang ein lautstarker Furz und gleich darauf ein erleichtertes Aufseufzen. Entweder fielen einem die Geräusche, die die Insassen des Hospizes machten, im Alltag nicht auf, oder die Kranken hatten alle den stummen Wunsch Elsbeths aufgefangen, dass der Besuch sich schleunigst verabschieden möge, und bemühten sich, ihren Beitrag dazu zu leisten. Bischof Heinrich biss die Zähne zusammen. Das gelangweilte Gesicht des Propstes bekam einen gequälten Ausdruck. Albert Sneydenwint grunzte amüsiert und wedelte mit der Hand vor der Nase herum.
»Wenn Ihr wollt … ich kann Euch die Leute alle vorstellen …«, sagte Elsbeth und machte eine einladende Bewegung in Richtung des Husters. Die diebische Freude, die sie dabei empfand, würde sie beichten müssen, aber sie würde dies bei dem schwerhörigen alten Pfarrer tun, den die Äbtissin für diese Pflicht sorgfältig aus dem zur Verfügung stehenden Personal des Bistums ausgewählt hatte. Die wirklichen Beichtgespräche führte Lucardis mit ihren Schützlingen selbst, auch wenn dies der Regel nach nicht vorgesehen war.
Der Bischof wippte unentschlossen. »Ich möchte mich auch noch mit der Mutter Oberin unterhalten. Und es sind ohnehin nicht viele Betten belegt.«
Geh nur, dachte Elsbeth, geh. Meinen Segen hast …
»Oh, die Abteilung für die geistig und seelisch Erkrankten ist viel stärker belegt«, sagte Adelheid in aller Unschuld.
Einen Moment lang stand alles auf der Kippe. Elsbeth war in ihrer einladenden Handbewegung erstarrt. Die Novizinnen schlugen sich entweder die Hände vor den Mund oder schlossen die Augen. Adelheids Gesicht zog sich in die Länge und begann zu erröten. Bischof Heinrich und Propst Rinold achteten nicht auf das dämmernde Entsetzen in der Miene des jungen Mädchens. Sie dachten offenbar das Gleiche: Herr, verschone uns vor den Verrückten, wenn schon die normal Kranken so unappetitlich sind.
Dann kippte die Situation auf die falsche Seite. Albert Sneydenwint sagte: »Was, Verrückte gibt’s hier auch? Den Bereich muss ich sehen, vielleicht ist da noch Platz für meine Schwiegermutter.« Er sah sich suchend um. »Wo ist das?«
»Es ist ganz am anderen Ende des Klosters«, stotterte Adelheid im Versuch, etwas zu retten.
Eine Tür an der Seite des Krankensaals öffnete sich, und eine Klosterschwester kam mit ein paar Decken im Arm heraus. Aus dem Raum dahinter hörte man jemanden rufen: »Aber ich bin Kaiser Rotbart!«, und jemand anderen brüllen: »Ich bin so SCHWACH!« Die Tür schloss sich wieder. Es fiel auf, dass sie dicker war als üblich und mit Eisenbändern verstärkt.
Bischof Heinrich sah von Adelheid zu Elsbeth.
»Sie meint: am anderen Ende des Saals«, knirschte Elsbeth.
Adelheid ließ die Schultern sinken. Der Bischof zog die seinen entschlossen in die Höhe. »Das müssen wir nicht mehr sehen«, sagte er.
Gesegnet seist du, dachte Elsbeth.
»Ich schon«, sagte Albert Sneydenwint. Er watschelte bereits auf die Tür zu. Bischof Heinrich und Propst Rinold wechselten einen Blick und folgten ihm verdrossen. Vielleicht schuldete auch der Propst dem Kämmerer Geld.
»Verzeihung«, flüsterte Adelheid, als die Novizinnen, angeführt von Elsbeth, den Abschluss machten. Elsbeth ignorierte sie.
Albert Sneydenwint kämpfte mit der Tür, die einen besonderen Schließmechanismus hatte und nicht so ohne weiteres zu öffnen war. Die beiden Klosterknechte, die auf der anderen Seite standen, der Tür den Rücken zugewandt und das Treiben in dem Saal für die geistig und seelisch Erkrankten beobachtend, traten erstaunt beiseite, als die ganze Kongregation eintrat. Der Bischof verteilte einen nachlässigen Segen in ihre Richtung. Dann blieb er stehen und starrte. Elsbeth, die die Tür aufgehalten hatte, ließ sie zufallen.
»Oh, Verzeihung!«
»Keine Ursache«, sagte Hartmann, dem sie die Tür quasi ins Gesicht hatte fallen lassen und der sie nun vorsichtig schloss.
Bis auf wenige Ausnahmen waren die Lager entweder belegt, oder die Decken darauf waren zerknüllt und unordentlich aufgeworfen. Bischof Heinrichs Augen folgten einer Klosterschwester, die die Decken auf einem Lager ordnete, misstrauisch beobachtet von einem älteren Mann an ihrer Seite. Als sie das Lager verließ, riss er alles wieder auseinander, betrachtete es und begann dann zu weinen. Ein großer, hagerer Bursche mit glühenden Augen schlurfte an ihnen vorüber und murmelte: »Ich bin so schwach!« Er kreuzte auf geraden Linien durch den Raum wie ein Bischof über das Schachbrett. Ein Dritter hielt sich an einem Besen fest, mit dem er einen winzigen Fleck des ohnehin sauberen Bodens kehrte, den Blick stur nach unten gerichtet. Er bückte sich, rieb mit dem Finger über die gekehrte Stelle, leckte ihn ab, nickte zufrieden und machte sich über den nächsten Quadratzoll her. An einem der Fenster stritten sich eine dicke alte Frau und ein dünner alter Mann.
»Du bist nicht Kaiser Rotbart«, sagte die dicke Frau. »Das wüsste ich. Kaiser Rotbart ist mein Gemahl. Du bist hässlich. Du bist nicht mein Gemahl.«
Der Bischof wandte sich mit offen stehendem Mund an Elsbeth. Diese zuckte mit den Schultern. »Tatsächlich sind sie Mann und Frau«, sagte sie. »Es kommt selten vor, aber manchmal erwischt es gleich zwei auf einmal.«
Ein weiterer Patient stellte sich vor dem Propst auf und gaffte ihn an. Einer seiner Finger steckte bis über das erste Fingerglied in seiner Nase. Er holte den Finger heraus, betrachtete den reichen Aushub und steckte ihn sich in den Mund. Dann gaffte er weiter. Der Propst schluckte trocken und schüttelte sich.
Der hagere Bursche kam wieder entlang und blieb vor dem Popelesser stehen, der ein Hindernis auf seinem Weg darstellte. »Ich bin so schwach!«, stöhnte er. Der Popelesser wanderte ohne Eile davon. Der hagere Mann schlurfte auf einer perfekten Geraden durch den Saal bis zu einer Wand, machte kehrt und lief in leicht verändertem Winkel weiter, wie ein Ball, der unermüdlich von Hindernissen abprallt und nicht langsamer wird. Bischof Heinrich blinzelte fassungslos.
»Wenn der ehrwürdige Vater den Raum wieder verlassen …«, begann Elsbeth.
Der Einzige, der nicht erstarrt das Geschehen betrachtete, war Albert Sneydenwint. Er schritt mit sichtlichem Vergnügen durch den Saal, sah den Menschen ins Gesicht, betrachtete ihr Tun, und als einer ihm einen Stein reichte, verbeugte er sich sogar. Der Patient strahlte und übergab ihm einen weiteren Stein.
»Sollen wir ihn nicht zurückholen?«, brummte einer der beiden Klosterknechte in Elsbeths Ohr. »Das kann gefährlich werden.«
»Nur, wenn einer ihm was zu schnupfen gibt«, sagte Elsbeth sarkastisch. Dann fiel ihr wieder ein, weshalb sie alles hätte tun sollen, um den Besuch von diesem Raum hier fernzuhalten, und sie fügte hinzu: »Ja, hol ihn zurück! Schnell!« Ohne abzuwarten, ob der Klosterknecht die widersprüchlichen Anweisungen befolgte, hastete sie los.
Später dachte sie, dass dieser eine Moment womöglich darüber entschieden hatte, wie der Tag enden sollte. Hätte sie ihn nicht mit der sarkastischen Bemerkung verschwendet, wäre alles anders gekommen.
Albert Sneydenwint war auf seinem Weg des Lächelns bei dem Mann angekommen, der sich kleinweis mit seinem Besen voranarbeitete. Den Kopf noch immer nach unten gesenkt, sah dieser plötzlich Sneydenwints Füße in seinen schnallen- und ösenbewehrten Stiefeln vor sich und blieb stehen. Als Elsbeth sich in Bewegung setzte, schraubten sich die Blicke des Mannes mit dem Besen langsam an Sneydenwints rundlicher Form in die Höhe, bis er ihm in die Augen sah. Er richtete sich auf. Das Gesicht des Patienten war hager und eingefallen, mit einem zotteligen Bart und zotteligen Haaren, grau wie seine Hautfarbe, grau wie die formlose Tunika, die hier jeder trug. Er kniff ein Auge zu und musterte den Kämmerer.
Sneydenwint nickte fröhlich. »Ah, hier glänzt aber alles«, verkündete er jovial.
Der Mann mit dem Besen legte den Kopf schief und kniff probehalber das andere Auge zu.
Elsbeth war beinahe heran. »Herr Notarius, bitte tretet einen Schritt …«, begann sie. Sie sah aus dem Augenwinkel, wie der Klosterknecht sie überholte.
Der Mann mit dem Besen leckte sich über den Daumen und verstrich den Schmutz auf Sneydenwints Oberlippe, bis er aussah wie ein schlecht gemalter Schnurrbart. Er hob eine Braue.
Sneydenwint sagte über die Schulter, ohne sich umzudrehen: »Ach was, der gute Mann ist doch völlig harmlos.« Er lächelte immer noch.
Der Besenträger leckte sich erneut über den Daumen und zog den Schmutzstreifen um das Doppelkinn Sneydenwints herum. Elsbeth dämmerte etwas, ohne zu wissen, was es war. Die Augen des Besenträgers gingen langsam auf und wurden rund. Gleichzeitig zog sich seine Oberlippe von den Zähnen zurück. Der Klosterknecht verharrte neben Sneydenwint, hielt Elsbeth mit einem ausgestreckten Arm zurück und sagte betont ruhig: »Bitte tretet langsam zurück, Herr.«
»Sneydenwint«, flüsterte der Mann mit dem Besen. Sneydenwint stutzte. Sein Lächeln machte einer erstaunten Miene Platz. »Sneydenwint!«, schrie der Besenträger.
Der Besen war plötzlich ein Knüppel und schwang herum. Sneydenwint duckte sich überraschend behände. Der Besenstiel traf den neben ihm stehenden Klosterknecht mit einem trockenen Geräusch am Kopf. Der Mann drehte eine halbe Pirouette und fiel Elsbeth in die Arme. Sie hörte undeutlich, wie die Novizinnen bei der Tür erschrocken aufschrien, dann ging sie mit dem bulligen Knecht zu Boden. Die Besenbürste brach ab und landete klappernd vor den Füßen des hageren Burschen, der beständig durch den Raum wandelte.
»SNEYDENWIIINT!!«
»Heilige Maria!«, hörte Elsbeth den Kämmerer quieken. Sie arbeitete sich unter dem besinnungslosen Klosterknecht hervor, nur um zu sehen, wie Sneydenwint sich unter einer neuen Attacke duckte. Der Besenträger schwang sein nun zu einem Stock gewordenes Arbeitsgerät mit waagrechten Bewegungen wie eine Sense. »Heilige Maria, der Mann ist verrückt.«
»Ich erschlag dich, Sneydenwint!«
Der hagere Bursche war stehen geblieben und starrte die Reisigbürste vor seinen Füßen an. »Ich bin so schwach!«, rief er.
Der zweite Klosterknecht überwand seine Erstarrung und eilte herbei. Der Besenträger holte ein drittes Mal aus. Sneydenwint fiel auf den Hintern und entging so erneut einem Schlag, der ihm vermutlich den Kopf von den Schultern geholt hätte. Der Besenstiel pfiff, als er durch die Luft sauste.
»He!«, rief der zweite Klosterknecht. Er versuchte, um den hageren Burschen herumzurennen, der das Bruchstück fixierte, dann packte er ihn kurzerhand bei den Schultern und versuchte ihn wegzuschieben.
Der hagere Bursche hob den Klosterknecht hoch, als ob er ein kleines Ferkel wäre, und warf ihn zwischen zwei Lagerstätten. »Ich bin schwach!«, röhrte er. Der Klosterknecht riss bei der Landung zwei Insassen des Verrückten-Traktes zu Boden. Während der eine zu fluchen begann, schlang der andere Arme und Beine um den Klosterknecht und bedeckte sein Gesicht mit triefenden Küssen.
»Fahr zur Hölle, Sneydenwint!«
Sneydenwint warf sich zur Seite und landete auf dem Bauch. Der Besenstiel traf knallend den Fußboden und zersplitterte. Sneydenwint krümmte sich zusammen und barg den Kopf in seinen Armen. Sein beträchtliches Hinterteil ragte in die Höhe. Die knielangen Schöße der Tunika fielen nach vorn und entblößten eine Bruche, die verrutscht war und einen Teil einer haarigen Backe zeigte. Die Novizinnen kreischten und bedeckten die Augen mit den Händen. Die Schnüre eines der spack sitzenden Beinlinge lösten sich, und der Stoff, der allzu lange großer Spannung ausgesetzt gewesen war, rollte sich von seinem strammen Oberschenkel nach unten. Weitere Teile haariger männlicher Anatomie zeigten sich. Die Novizinnen hörten nicht mehr auf zu kreischen.
»Heilige Maria!«, schrie Sneydenwint.
»Jetzt ist Schluss!«, brüllte Bischof Heinrich.
»Ich bin so SCHWACH!«
Der Besitzer des ehemaligen Besens starrte auf das halblange spitze Bruchstück, das er in der Faust hielt, und dann auf Sneydenwints hochgereckten Hintern. Seine Augen verengten sich.
»Aufhören!«, donnerte der Bischof.
»Lasst mich los, ihr Narren!«, kreischte der Klosterknecht, dessen Gesicht troff. Mittlerweile hatte der zweite Verrückte sein Fluchen eingestellt und sich der Kussorgie angeschlossen.
Elsbeth tat einen Satz, gerade als der Besenträger seinen abgebrochenen Besenstiel wie eine Lanze hob, um zuzustoßen. Sie schlüpfte unter seinem Arm hindurch und stellte sich mit ausgebreiteten Armen vor Sneydenwint. Die Stoßbewegung hielt eine Handbreit vor Elsbeths Brust inne. Die Spitze war so scharf wie die einer echten Lanze. Sie schielte sie an. Der Besenträger riss die Hand zurück, dann schmetterte er das Besenstück zu Boden.
»Gottverdammt, Mädchen!«, brüllte er. »Bist du wahnsinnig? Beinahe hätte ich dich erwischt!«
Elsbeth fühlte sich, als ob ihr Herz ausgesetzt hätte. Jetzt pumpte es einen heißen Schwall Blut in ihren Körper. Ihr wurde schwindlig. »Lasst den Mann in Ruhe, er hat Euch nichts getan«, hörte sie sich wie von weitem sagen.
»Ja, bei der heiligen Maria«, winselte Sneydenwint auf dem Boden.
»Nichts getan?«, schrie der Besenträger. »Nichts getan!?« Spucke flog von seinen Lippen. »Ha! Nichts getan!« Er ließ die Schultern sinken und schüttelte den Kopf. »Nichts getan …« Er sah sich um und schien sich plötzlich gewahr zu werden, dass alle ihn anstarrten: der Bischof, der Propst, die Novizinnen, die Krankenschwestern, die anderen Patienten. »Was glotzt ihr so?«, rief er, doch es war zu erkennen, dass seine Wut verpufft war. »Seid ihr blöde oder was?«
Reinhild und eine andere der Novizinnen kamen herbei und führten den Besenträger sanft zur Seite. Er war folgsam wie ein Lamm. Sneydenwint schien er schon vergessen zu haben. Der Kämmerer seinerseits kauerte noch immer auf dem Boden, lüftete seine edleren Teile und fürchtete offenbar weitere Schrecknisse. Adelheid hastete heran, stellte sich neben ihn und zerrte mit abgewandtem Blick so lange an Sneydenwints Tunika, bis er wieder einen schicklicheren Anblick bot. Dann räusperte sie sich und stieß ihn schließlich, den Kopf immer noch abgewendet, mit dem Fuß an.
»Er ist weg!«, flüsterte sie dröhnend.
Bischof Heinrich lief puterrot an. »Der Mann ist gemeingefährlich!«, brüllte er. »Er gehört sofort aufgehängt! Verbrannt! Gevierteilt!«
»Er ist nicht bei Sinnen«, sagte Elsbeth. »Er ist nicht für seine Taten verantwortlich.«
»Er hätte beinahe meinen Kämmerer umgebracht!«
»Heilige Maria!«
»Woher kannte er Herrn Sneydenwint?«, fragte Elsbeth. »Wir haben ihn noch nie so zornig gesehen. Was ist zwischen den beiden geschehen?«
Der Bischof richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Als er erkannte, dass ein paar der Novizinnen ihn immer noch überragten, begann er erneut zu wippen. »Das hat ein Nachspiel«, flüsterte er. »Was sind das hier für Zustände, eh? Mörder werden in einem Hospiz versteckt, das ich mit meinem eigenen Geld finanziere! Ich werde dem einen Riegel vorschieben. Und Euren Namen merke ich mir, Schwester Elsbeth! Eh …?«
Er gaffte eine zierliche Gestalt an, die die ganze Zeit über im Hintergrund des Raumes gestanden hatte und niemandem aufgefallen war – ein blasses Mädchen, das förmlich in dem düsteren Saal leuchtete und nun zielsicher auf den Bischof zukam. Sie ging nicht, sie schwebte. Als sie an Sneydenwint vorüberschritt, warf sie ihm nicht einmal einen Blick zu. Sneydenwint starrte zu ihr hoch. Seine Augen rollten. Er musste glauben, das Zeitliche gesegnet zu haben und nun den ersten Engel zu erblicken.
»Licht …«, hauchte die zarte Gestalt und wandelte an Bischof Heinrich vorbei. »Das Licht ist alles, und ohne das Licht ist alles nichts. Die Farben eines Schmetterlingsflügels schillern nur, weil das Licht der Reinheit sie erleuchtet. Alles andere …«, sie vollführte vage Gesten hin zu Dingen, die sie gar nicht zu sehen schien: zur Figur des Gekreuzigten im Herrgottswinkel des Raumes, zu dem schimmernden Kruzifix an seinem Goldkettchen um den Hals des Bischofs, »… ist nur der trügerische Schatten, den das Licht wirft und in dem Kälte und Dunkelheit wohnen.«
Elsbeth schlug die Hände vors Gesicht. Schwester Hedwig, die keinen Augenblick innegehalten hatte, schwebte mit leichten Schritten bis zur nächsten Wand, blieb stehen, drehte sich um und lächelte leer.
»Das ist … Ketzerei …«, ächzte der Bischof erstickt. Er warf sich herum und stapfte aus dem Raum, dicht gefolgt von Propst Rinold. Hartmann folgte ihm vermutlich auch, aber keiner hätte darauf schwören können.
Albert Sneydenwint blieb zurück. Nach einer Weile blickte er sich um. Zögernd rappelte er sich auf, stellte sich hin, klopfte sich den Staub von den Knien, zerrte seine Tunika gerade, räusperte sich … und rannte dann mit rudernden Armen zur Tür hinaus, dem Bischof hinterher. Der herabgerollte Beinling flatterte um seinen Stiefel.
»Ich bin erledigt«, sagte jemand. Schwester Elsbeth war nicht erstaunt festzustellen, dass sie selbst es gewesen war.
4. WIZINSTEN
Vor Dir, Gott, allmächtiger Vater, bekenne ich meine Schuld …
Die Worte dröhnten in Constantia Wiltins Ohren, obwohl sie sie nur in Gedanken sprach. Sie ertränkten alle anderen Geräusche außer dem Schnaufen ihres Vaters, mit dem dieser das Mittagsmahl in sich hineinschaufelte. Das Schicksalsrad hatte Johannes Wilt im Gefüge ihrer Heimatstadt Wizinsten nach oben gedreht; es war ein wohlhabender Mann aus ihm geworden, aber obwohl er sich Mühe gab, konnte er seine Herkunft nicht leugnen. Er war nun Patrizier, aber sein Magen war Handwerker geblieben, und so stellte sich bei ihm regelmäßig kurz nach dem Mittagshappen der Appetit ein, den ein Handwerker empfand, der vom frühen Morgengrauen an vor seiner Arbeit saß und keine Zeit hatte, diese für das Terzmahl zu unterbrechen. So kam es, dass regelmäßig um das Nonläuten herum Meister Johannes Wilt Speck, Würste und Brot auf den Tisch packen ließ und dem Terzmahl vom Morgen und dem Happen vom Mittag das an Nahrung hinzufügte, was die jahrelange Gewöhnung seines Verdauungstraktes noch zu benötigen meinte. So war aus dem einstmals dünnen Mann ein Koloss geworden. Eine weitere Gewohnheit, die Johannes Wilt nicht hatte ablegen können: Er stöhnte und schnaufte beim Essen und spachtelte es mit einer Geschwindigkeit in sich hinein, als fürchte er nach den fünf Jahren, die seit seinem Aufstieg vergangen waren, immer noch, jemand könne ihm das Essen wieder wegnehmen. Constantia bekam regelmäßig einen engen Hals, wenn sie das Mahl mit ihren Eltern teilte und den Tröpfchen auswich, die ihr Vater versprühte.
Vor Dir, Gott, allmächtiger Vater, und vor der seligen Jungfrau Maria, dem heiligen Erzengel Michael, dem heiligen Johannes dem Täufer, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus und allen Heiligen, bekenne ich, dass ich gesündigt habe …
O Gott, wie sollte sie das nur beichten? Fünf Jahre hatte sie es nicht gebeichtet, hatte die Schuld der Verstocktheit und der fehlenden Buße zu ihrer Sünde hinzugeladen, und nun sollte sie das alles bekennen? Sie, die der Pfarrer erst vor kurzem ein leuchtendes Beispiel für die anderen jungen Frauen in Wizinsten genannt hatte in ihrer Befolgung der Gebote? Wenn er sie nicht nach dieser Beichte aus der Kirche trieb, dann würde ein Blitzstrahl Gottes sie von dort hinausschleudern.
»Mmf«, stöhnte Johannes Wilt, schmatzte, hustete mit vollem Mund und stopfte sich einen weiteren Bissen hinein. »Mmmf!«
»Es ist so still um diese Tageszeit«, sagte Guda Wiltin, Constantias Mutter. »Das Läuten fehlt einem immer noch.«
Wie ihr Mann war auch Guda Wiltin irgendwie in der Vergangenheit hängengeblieben. Bei ihr äußerte es sich darin, dass sie manchmal Bemerkungen wie diese einstreute, die sich anhörten, als spräche sie von jüngst vergangenen Dingen. In Wahrheit vermisste sie das Läuten ungefähr seit der Zeit, als Constantia sich angewöhnt hatte, bei der Beichte einen wesentlichen Punkt auszulassen. Das Läuten war das Gebimmel der Klosterglocke gewesen.
»Mmf!«, sagte Johannes. »Rudeger hat ’n neuen Gerber angeheuert.« Speckstückchen sprühten von seinen Lippen. »Er baut sein Geschäft auf. Das lob ich mir an ’nem Mann, der bald mein Schwiegersohn sein wird.« Er angelte sich eine neue Wurst und beäugte seine Tochter über sie hinweg. »Warst du schon bei der Beichte, Mädel?«
»Ja … äh … ich wollte warten, bis …«
»Die Beichte is ’n Sackerment, genauso wie die Ehe«, sagte Johannes und biss von der Wurst ab. »Ohne das Sackerment der Beichte is’ das Sackerment der Ehe mpfgrmpf …!« Irritiert fasste er sich in den Mund und zog einen Knorpel heraus, der in die Wurst eingearbeitet worden war. Er zerquetschte ihn zwischen den Fingerspitzen und legte ihn dann auf den Tisch. »… ’n Scheiß«, sagte er. »Ohne das eine is’ das andre ’n Scheiß. Hat Hochwürden Fridebracht gesagt, und der Mann is’ immerhin unser Pfarrer. So!«
»Er hat nicht Scheiß gesagt«, erwiderte Guda pikiert.
»Er hat’s gedacht«, nuschelte Johannes. Ein weiterer Bissen reduzierte die Wurst in seiner Faust auf einen kläglichen Zipfel. Er rülpste markerschütternd und schüttelte sich. »O Mann, das hat beim Weg nach unten besser geschmeckt.«
»Es fehlt einem einfach, wenn man so dasitzt und alles ist so still«, sagte Guda.
Dies wäre der Augenblick für Constantia gewesen, um ihren Eltern zu gestehen, dass sie die Beichte, ohne die das Sakrament der Ehe mit ihrem zukünftigen Mann Rudeger einzugehen von vornherein eine Sünde gewesen wäre, nicht ablegen konnte. Was vor fünf Jahren passiert war, hatte sie so tief in ihrem Herzen verschlossen, dass sie es an manchen Tagen selbst vergessen hatte. Es durfte nie ans Licht kommen – nicht ihretwegen, nicht ihrer Eltern wegen, und auch nicht Rudegers wegen. Wie sollte sie ihm nur … wie konnte sie es nur anstellen, dass er in der Hochzeitsnacht nicht … o heilige Maria voll der Gnaden, wie konnte eine Situation nur so verfahren sein, dass man sich in der eigenen Ausweglosigkeit wand wie eine Schlange, die jemand ins Feuer geworfen hatte! War das der Lohn für die Sünde, die sie begangen hatte? Und auch diese Frage konnte sie niemandem stellen, weil es bedeutet hätte, jenes Geschehen offenzulegen … in dessen Mittelpunkt Constantia gestanden und das drei Menschen in den Ruin getrieben hatte …
»Ich habe noch keine Zeit gehabt, mit Hochwürden zu sprechen«, flüsterte sie mit gesenktem Blick. Die Eltern anzulügen war ebenfalls Sünde, und umso mehr, als es ihr mittlerweile gelang, ohne dabei zu erröten.
Johannes und Guda achteten nicht auf sie. Jemand polterte und hustete vor der Tür und trat dann ein. Gudas Gesicht hellte sich auf. Johannes schnappte sich eilig die letzte Wurst.
»Gott schütze dieses Haus«, sagte der Besucher.
Constantia stand auf und machte einen Knicks. Johannes wies mit großspuriger Geste – und der Wurst in der Faust – auf den verwüsteten Tisch und die wenigen Essensreste darauf. »Setz dich, Everwin. Lang zu!«
Everwin Boneß schüttelte den Kopf, setzte sich aber. Er starrte Guda an, nickte ihr zu und sah sofort wieder weg. Er wirkte nervös. Eigentlich wirkte er stets nervös. Er war der Bürgermeister von Wizinsten, nun schon im fünften Jahr hintereinander wiedergewählt, und er machte immer noch den Eindruck, als erwarte er jeden Moment abgesetzt zu werden. Mit seinem dünnen Haar und dem spitzen Gesicht ähnelte er einem träge gewordenen Frettchen …
Etwas krachte und verklang mit einem Flöten. Everwin zuckte entschuldigend die Achseln und wetzte mit dem Hintern auf der Bank hin und her. Schaler Geruch stieg auf.