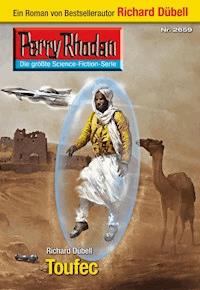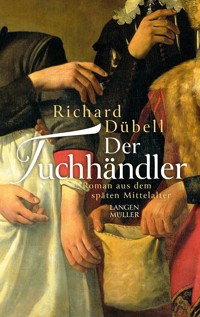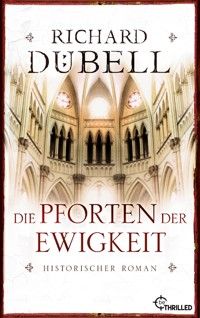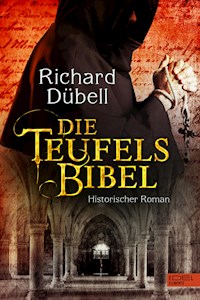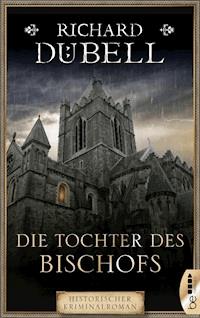9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1348: Die Pest zieht ihre mörderische Spur durch Europa. Im Chaos gehen Glaube, Menschlichkeit und Hoffnung verloren.
Aber ist die Krankheit wirklich eine Strafe Gottes? Oder steckt ein teuflischer Plan dahinter? Stimmt es, dass ein selbsternannter Todesengel seine Anhänger aussendet, um die Krankheit zu verbreiten?
Als die junge Adlige Gisela und der jüdische Abenteurer Joseph auf die Spur der "Jünger Azraels" stoßen, beginnt ein Wettlauf gegen den Schwarzen Tod ... und eine unmögliche Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
1348: Die Pest zieht ihre mörderische Spur durch Europa. Im Chaos gehen Glaube, Menschlichkeit und Hoffnung verloren. Aber ist die Krankheit wirklich eine Strafe Gottes? Oder steckt ein teuflischer Plan dahinter? Stimmt es, dass ein selbsternannter Todesengel seine Anhänger aussendet, um die Krankheit zu verbreiten? Als die junge Adlige Gisela und der jüdische Abenteurer Joseph auf die Spur der »Jünger Azraels« stoßen, beginnt ein Wettlauf gegen den Schwarzen Tod … und eine unmögliche Liebe.
ÜBER DEN AUTOR
Richard Dübell, geboren 1962, ist Träger des Kulturpreises der Stadt Landshut und des Literaturpreises »Goldener Homer«. Er zählt zu den beliebtesten deutschsprachigen Autoren Historischer Romane. Seine Bücher standen auf der Bestsellerliste des Spiegel und wurden in vierzehn Sprachen übersetzt. Mittlerweile schreibt er auch erfolgreich für Kinder und Jugendliche. Mehr Informationen über den Autor finden Sie auf seiner Homepage: www.duebell.de.
RICHARD DÜBELL
BOTE DES FEUERS
Historischer Roman
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Katharina Rottenbacher, Berlin
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Einband- / Umschlagmotiv: © shutterstock/Alberto Masnovo, Trymyr, Thammanoon Khamchalee, David Woods, Faber1893
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6080-6
www.luebbe.de
www.lesejury.de
»Der Mensch ist sein eigener Teufel.«
Indisches Sprichwort
»Und Jehova sprach zu Mose und zu Aaron: Nehmet eure Fäuste voll Ofenruß, und Mose streue ihn gen Himmel vor den Augen des Pharao; und er wird zu Staub werden über dem ganzen Lande Ägypten und wird an Menschen und Vieh zu Geschwüren werden, die in Blattern ausbrechen im ganzen Lande Ägypten.«
Exodus 9; 8,9
»So müßt ihr nun machen Bilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land verderbt haben, daß ihr dem Gott Israels die Ehre gebt.«
1 Samuel 6, 5
Für Christine: Inspiration, beste Freundin,Gefährtin meiner Seele – und meine einzige,wahre Liebe.
SCHAUPLÄTZE DER HANDLUNG
Die Ortsnamen in diesem Roman sind möglichst so wiedergegeben, wie sie im 14. Jahrhundert in Chroniken auftauchen oder wie sie in der regionalen Sprache hießen. Nachfolgend eine kleine Übersetzungshilfe:
»über dem Prenner«
Brennerpass
A Saera (ligur.)
Serra Riccò
A Spèza (ligur.)
La Spezia
Aquilee (furlan)
Aquileja
Arbénga (ligur.)
Albenga
Ast (piemont.)
Asti
Bonasseua (ligur.)
Bonassola
Bròn (oltrepad.)
Broni
Bugasku (ligur.)
Bogliasco
Caignan (ligur.)
Carignano, Stadtteil von Genua
Cavlimor (piemont.)
Cavallermaggiore
Cividât (furlan)
Cividale del Friuli
Chasarisches Meer
Schwarzes bzw. Asowsches Meer
Clävai (ligur.)
Chiàvari
Coni (piemont.)
Cuneo
Corcaigh (irisch)
Cork
Fràra
Ferrara
Gaillimh (irisch)
Galway
Glemone (furlan)
Gemona
Ineja (ligur.)
Oneglia, heute Stadtteil von Imperia
Lissandria (piemont.)
Alessandria
Marsiglia
Marseille
Narbona
Narbonne
Nêuve (ligur.)
Novi Ligure
Piaśëinsa (piacentino)
Piacenza
Pordenon (furlan)
Pordenone
Puncrùn (oltrepad.)
Pontecurone
Rodano
Rhône
Rosciggion (ligur.)
Rossiglione
Saña (ligur.)
Savona
Sanrému (ligur.)
San Remo
Sant Denêl (furlan)
San Daniele del Friuli
Sant Michêl (furlan)
San Michele al Tagliamento
Sant Vît (furlan)
San Vito al Tagliamento
Sant Zorç (furlan)
San Giorgio della Richinvelda
Serra Vallis
Serravalla Scrivia
Spiareti (ligur.)
Ospedaletti
Stradéla
Stradella
Tiliment (furlan)
Tagliamento (Fluss)
Trevixo (venetisch)
Treviso
Turtona (piemont.)
Tortona
Udin (furlan)
Udine
Vallecrösa (ligur.)
Vallecrosia
Vicènsa (venetisch)
Vicenza
Vintimiggia (genov.)
Ventimiglia
Vughera (oltrepad.)
Voghera
Warmaisa
Name der jüdischen Gemeinde von Worms
Venedig müsste eigentlich getreu dieser Vorgabe als Venexia geschrieben werden, aber darauf habe ich verzichtet, weil Venedig nicht nur ein Städtename, sondern auch ein Begriff ist. Genua hat nach allem, was ich herausfinden konnte, auch im Mittelalter schon Genua geheißen. Bei Avignon war ich unsicher (die provenzalische Schreibweise wäre Avignoun), habe mich dann aber wie bei Venedig für die bekannte Namensform entschieden, weil Avignon als Stadt des päpstlichen Exils ebenfalls nicht nur ein Städtename, sondern ein Begriff ist.
1. BUCH
DIE FAUST GOTTES
»Der Todesengel wird durch ihre Reihen schreiten wie damals, als der Herr ihn gegen die Ägypter sandte.«
Gabriele de Mussis, Medicus
1
PLONK!
Nummer sieben, dachte Gisela.
Sie hörte, wie das Steinchen vom gespannten Darm im Fensterrahmen abprallte und an der schrägen Gebäudemauer nach unten hüpfte.
Sie lauschte dem ruhigen Atmen ihrer Magd, das mit jedem der sechs vorhergehenden PLONK! kurz gestockt und gleich danach wieder eingesetzt hatte. Gisela drängte sich der Wärme des schlafenden Körpers neben ihr entgegen und fror trotzdem.
PLONK!
Offensichtlich war sie nicht die Einzige, der kalt war. Der Sängerknabe im Hof unter ihrem Fenster schien die Kälte allmählich auch zu spüren. Die Abstände zwischen den Steinchenwürfen gerieten immer kürzer. Der Januar hier in den Bergen des Friaul wurde vom Frost beherrscht.
Beim zehnten Stein fange ich an zu schreien, dachte Gisela. Dann sollen die Burgwachen den Kerl meinetwegen über die Mauer werfen.
Es musste um die vierte Stunde nach Mitternacht sein, also schon fast wieder Morgen. Wahrscheinlich standen im großen Saal der Burg jetzt die ersten Dienstboten von den Strohschütten auf und schürten das Feuer im Kamin wieder hoch. Den Winter über ging es niemals ganz aus. Es hätte mehrere Tage gedauert, um wenigstens einen Hauch Wärme in den Saal zu bringen, wenn man ihn hätte auskühlen lassen, und darauf war niemand erpicht.
Der Mann unten im Hof, den Gisela bei sich hartnäckig den »Sängerknaben« nannte und der in Wahrheit Tristan de Gurize hieß, war ein Schlitzohr. Er machte sich Hoffnungen auf Giselas Hand, und sei es über den Umweg, sie zu kompromittieren, indem er sie mit den Steinchenwürfen dazu brachte, ihn in ihre Kammer zu bitten. Gisela machte sich da keinerlei Illusionen. Sie war zwar keine Schönheit, aber sie konnte musizieren und sich intelligent unterhalten und war von ihrer Mutter in allen Fertigkeiten unterwiesen worden, die man als Burgherrin kennen musste. Doch Tristan wollte sie nicht wegen ihrer Qualitäten. Er interessierte sich nur für das Erbe der wohlhabenden Sippe der d’Osoppo, Giselas Familie. Seit Giselas Verlobung aufgelöst worden war, hatten sich derartige Burschen mit der gleichen Hartnäckigkeit auf der Burg eingestellt, mit der Fliegen um einen Honigtopf kreisten.
PLONK!
Gisela war die einzige Erbin des Besitzes der d’Osoppo. Sie fühlte die Verantwortung, die deshalb auf ihr lastete, in jeder wachen Stunde. Sie hatte sie bisher mit Leidenschaft und Engagement getragen. Den Besitz zu erhalten, zu vermehren und den Namen ihrer Familie mit Ruhm und Wohlstand zu versehen war für sie keine Bürde gewesen, sondern eine Selbstverständlichkeit. Sie wäre ihr mit dem Schwert in der Hand nachgekommen, wenn sie ein Mann gewesen wäre.
Neuerdings war sie allerdings nicht mehr so sicher, zu welchen Opfern sie wirklich bereit war. In den letzten Monaten hatten sich viele ihrer vermeintlich festgefügten Ansichten geändert. Zwei Ereignisse waren hauptsächlich daran schuld.
PLICK!
Ein Steinchen war fehlgegangen und draußen gegen die Mauer geprallt.
Neuneinhalb, dachte Gisela und wusste, dass sie sich selbst betrog. Sie schreckte vor der Kälte außerhalb ihres Betts zurück. Mehr noch schreckte sie vor dem Gedanken an den Tratsch zurück, der sich unweigerlich einstellen würde, wenn der Annäherungsversuch dieses Freiers von den Burgwachen beendet wurde. Erneut würde darüber getuschelt werden, dass Gisela d’Osoppo es sich eigentlich nicht leisten konnte, schon wieder einen Freier abzuweisen, nachdem ihr Verlobter sie im Stich gelassen hatte.
Verflucht seist du, Berengar de Cucagna, dachte sie, dass du mir das antust. Ich habe dich nicht geliebt, aber ich hätte dich genommen. Für die Familie. Für Osoppo.
Zugleich dachte sie, dass die Schmach, die mit der Lösung der Verlobung über ihr Haupt gekommen war, auch etwas Gutes gebracht hatte: nämlich die Erkenntnis, dass sie gar nicht willens war, für Tradition und Besitz ihr persönliches Glück zu opfern.
Den Mann, den ich in mein Leben lasse, werde ich ab sofort selbst bestimmen, dachte sie dann. Mit Berengar habe ich der Familienräson eine Chance gegeben. Beim nächsten Mal werde ich nur noch der Liebe eine Chance geben.
Zumal sie schon wusste, wer dieser Mann sein sollte. Sie sah ihn vor ihrem inneren Auge, hörte seine Stimme, sah sein Lächeln. Seinen Namen flüsterte sie, wenn sie allein war: Joseph.
Aber … wie erkläre ich das Vater? Und Mutter!?
Sie wusste, dass der Mann, dem innerhalb weniger Sekunden, nachdem sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte, ihr Herz gehört hatte, als Ehemann völlig undenkbar war.
PLONK!
Sie seufzte. Sie musste etwas unternehmen. Von alleine würde der Kerl dort unten nicht aufhören. Sie schwang die Beine aus dem Bett und stieß an etwas Kaltes, Hartes, das daneben auf dem Boden stand. Eine Idee kam ihr in den Sinn, wie sie den Sängerknaben loswerden konnte, ohne die Wachen zu alarmieren. Sie humpelte durch die Dunkelheit über die kalten Bodenbretter, nahm den Rahmen aus der Fensteröffnung und spähte nach unten. Der Sängerknabe warf sich sofort in Pose. Gisela winkte ihm zu, dass er gehen solle. Er schüttelte den Kopf und breitete die Arme aus wie jemand, dessen bloße Anwesenheit Überredung genug ist.
Na gut. Er hatte es nicht anders gewollt.
Gisela huschte zum Bett zurück, schnappte sich den vollen Nachttopf und leerte ihn mit Schwung nach unten aus. Dann lehnte sie sich nach draußen und machte sich auf einen jämmerlichen Anblick gefasst. Alles, was sie sah, waren ein dunkler, dampfender Fleck auf dem reifgepuderten Boden und die noch schwingenden Äste der Fichten, die das Wohngebäude vom Rest des Burghofs abgrenzten. Tristan de Gurize war wohl rechtzeitig geflohen. Auch gut. Sie zwängte den Rahmen wieder zurück in die Fensteröffnung und tastete sich zum Bett.
Natürlich würde sie diese impulsive Tat beichten müssen. Kaplan Grimoald würde sie sicher als Sünde bezeichnen. Für den Burgkaplan war so ziemlich alles Sünde, was ein Mensch zwischen Aufwachen und Einschlafen tat. Er würde sich die Lippen lecken und dann einen langen Sermon halten, der mit der Gehorsamspflicht gegenüber dem Herrn im Himmel, dem Heiligen Vater in Avignon und dem eigenen Vater zu tun hatte. Kaplan Grimoald leckte sich immer die Lippen, bevor er dazu ansetzte, und er beantwortete jede gebeichtete Missetat mit einer Abwandlung dieses Sermons. An den hohen kirchlichen Festtagen, wenn das ganze Gesinde am Vorabend bei ihm gebeichtet hatte, waren seine Lippen wund.
Aber war es denn eine Sünde, einen Mann abzuweisen, der so eindeutige – und so eindeutig schlechte! – Absichten hegte? Nein, war es nicht, doch es war eine Sünde, den Wünschen des eigenen Vaters zuwiderzuhandeln. Giselas Vater wollte seine Tochter nach der Auflösung der Verlobung mit Berengar de Cucagna so schnell wie möglich vermählen, um den Klatsch zum Verstummen zu bringen. Er hätte jeden genommen, der wenigstens halbwegs anständig war. Aber Gisela wollte bei diesem Spiel nicht mehr mitspielen. Das war ihre Sünde. Und Grimoald, der bei allem heiligen Eifer ein guter Kenner von Giselas Seele war, wusste es und verurteilte sie dafür.
Gisela rollte sich auf die Seite. Ihr Nachtschlaf war dahin. Würde es ihr im Himmel wohlwollend angerechnet werden, wenn sie endgültig aufstand und dem Gesinde half, obwohl sie es hasste, das warme Bett erneut zu verlassen? Während sie noch mit der Entscheidung kämpfte, spürte sie, wie das Bett plötzlich ruckte. Wahrscheinlich die Magd, die sich herumwarf. Doch die Magd lag ganz still.
Ein zweiter Ruck und dann ein Beben, das nicht mehr aufhörte. Es wurde immer stärker. Es erfasste das gesamte Bett. Gisela hörte die Bettpfosten auf dem Boden scharren. Sie hörte die Steine knirschen und die Balken an der Kammerdecke quietschen. Sie riss die Augen auf. Staub rieselte von oben herab. Von überall her klang plötzlich ein Rollen, lauter als Donner. Das Bett begann zu tanzen und rutschte seitwärts. Die Magd schoss keuchend in die Höhe. Der Fensterrahmen fiel heraus. Der Nachttopf hüpfte über den Boden. Giselas Magd kreischte auf.
Gisela spürte, wie sich ihr Magen hob. Sie hatte das Gefühl, dass die ganze Burg, dass das Land, auf dem sie stand, sich wand wie in Schmerzen. Die Sünde, dachte sie voller Panik. Die Sünde. Gott der Herr sieht alles und verzeiht vieles, aber meinen Ungehorsam verzeiht er nicht.
Das Mauerwerk der Burg stöhnte. Gisela hörte das Krachen, mit dem Balken aus den Verankerungen fielen und Wände zusammenstürzten. Die kleine Glocke in der Kapelle fing zu schlagen an, unrhythmisch und misstönend, bis ein noch lauteres Krachen ihrem Geklingel ein Ende machte.
Die Tür zur Kammer sprang auf, fiel aus den Angeln und knallte auf die Bretter. Feuerschein drang herein, und mit ihm ein Dämon mit leeren Augenhöhlen und gesträubtem Pelz. Die Magd sprang kreischend aus dem Bett und versuchte darunterzukriechen. Der Dämon stürzte in die Kammer und packte die Magd am Fuß. Er verwandelte sich in einen Mann, dem ein zweiter mit einer Fackel folgte. Erst jetzt erkannte sie Lothar d’Osoppo, ihren Vater, der seinen Helm trug und sich in einen Pelz gewickelt hatte. Er zerrte die Magd unter dem Bett hervor und wandte sich Gisela zu. Sie sah, wie sich sein Mund bewegte, aber das Dröhnen und Krachen und Bersten verschluckte seine Worte.
Gisela fand plötzlich ihre Stimme wieder.
»Ein Erdbeben, Vater!«, schrie sie. »Wir müssen hier raus!«
2
Joseph ben Kesher ging ohne sichtbare Eile durch die nachtdunklen Gassen Nürnbergs. Er hatte ein paar Minuten Vorsprung vor der Gruppe, die nach ihm kam, und das war genug. Den Weg, den er und die anderen zu nehmen hatten, kannte er im Schlaf, so oft hatte er ihn in den vergangenen zwei Tagen zurückgelegt. Er kannte jeden Hauseingang, jede Gassenöffnung, jede dunkle Ecke. Er wusste genau, wo der unvermeidliche Überfall stattfinden würde, und er war jetzt unterwegs zu dieser Stelle. Er fühlte Anspannung, aber auch vorauseilenden Triumph. Heute würden die Wölfe erleben, dass die Lämmer sich erhoben und ihnen die Zähne zeigten.
Der Geruch des Flusses stieg ihm in die Nase – Fäulnis, Nässe und toter Fisch. Unter seinen Stiefelsohlen knirschte der tagsüber zu Matsch getretene und in der Nacht wieder gefrorene Schnee. Vor dem vagen Grau des Himmels waren die dunklen Umrisse von Wasserturm und Henkerturm zu sehen. Die Morgendämmerung war noch mindestens drei Stunden entfernt.
Jede Stadt von der Größe Nürnbergs besaß zwei Bezirke, die nicht baulich voneinander abgetrennt und doch ganz unterschiedlich waren. Es gab das eigentliche Stadtinnere mit der relativen Sicherheit, die die regelmäßigen Nachtpatrouillen den Bürgern in ihren Häusern verliehen. Und es gab den Bereich unterhalb der Mauern und direkt bei den Toren, der das Stadtinnere wie ein Ring aus Gesetzlosigkeit umfasste. Hier gab es keine Patrouillen und keine Sicherheit. Man befand sich zwar innerhalb der Stadtmauern, aber man hätte genauso gut irgendwo draußen im Wald sein können, in der Welt, in der der Stärkere immer den Schwächeren fraß.
In Nürnberg gingen diese beiden Bezirke ineinander über. Vor zwanzig Jahren hatte die Stadt noch aus zwei separat umwallten Bereichen bestanden: der Sebalder und der Lorenzer Altstadt. Dann hatte man eine neue Mauer gebaut, die beide Bereiche umfasste und zur Stadt Nürnberg vereinte. Die alten wallnahen, schlechten Bezirke waren jedoch geblieben. Zwanzig Jahre reichten nicht aus, um eine Stadt so zu ändern, dass sich diese Bereiche auflösten. Und so zog sich mitten durch die Stadt Nürnberg entlang gewundener Gassen eine Zone, die die braven Bürger mieden und die die kürzlich entstandenen neuen schlechten Bezirke entlang der aktuellen Mauer verband.
In Zeiten wie diesen war der Unterschied zwischen dem guten und dem schlechten Teil der Stadt noch größer als sonst. Die Handwerker und die kleinen Leute betrauerten noch immer den Tod von Kaiser Ludwig dem Bayern und hassten die Patrizier und reichen Kaufleute, die ihrerseits rasch dem neuen König Karl die Treue geschworen hatten – und heimlich Gespräche mit dessen Rivalen Günther von Schwarzburg führten. Dass die beiden Anwärter auf die Kaiserkrone sich immer wieder in Nürnberg aufhielten, brachte den kleinen Leuten auch keine Vorteile. Das Geschäft mit den Mundschenken und Kammerherren der beiden Adligen machten die reichen Kaufleute.
Josephs Weg führte zwischen den Häusern entlang der Pegnitz, am ehemaligen Wall entlang. Die Gasse war ein Tunnel – sich neigende Wände, offen stehende Mäuler von türlosen Eingängen, tief heruntergezogene Dächer mit Lücken wie das Grinsen von Totenschädeln. An den Hauswänden fanden sich obszöne Malereien, unleserlich gewordene Sprüche, Schmähungen und Hasstiraden: die Helden der Kreide am Werk. In den Bruchbuden hier hausten der Bettlerkönig und sein Hofstaat. Die meisten von ihnen waren nicht zu Hause. Burggraf Johann von Hohenzollern, der kaiserliche Verwalter der Reichsstadt Nürnberg, hatte schon vor Wochen Anweisung gegeben, die Gesellschaft unter den Mauern nachts im jeweils nächstliegenden der Stadttürme einzusperren. Er fürchtete, die Besitzlosen könnten plötzlich ihre Solidarität mit den Handwerkern entdecken und diesen wiederum das Gefühl vermitteln, sie wären nun zahlreich genug, um einen Aufstand zu wagen.
Weiter voraus wusste Joseph die Mündung einer Quergasse, die seiner Meinung nach der einzig sinnvolle Ort für den zu erwartenden Überfall war. Die Gasse führte unter einem Gebäude hindurch, eine Straßenführung, die er aus seiner Heimatstadt Venedig als Sottoportego kannte.
Als er näher kam, sah er das Bündel Decken und Lumpen dort liegen. Es war ein Signal. Hätte es nicht hier gelegen, wäre der Überfall abgeblasen worden. Joseph drückte sich neben der Gassenmündung an die Mauer und lauschte.
Er hörte die Gruppe heranschleichen und Stellung beziehen, fast ebenso lautlos, wie er gewesen war, aber nicht ganz, weil die Männer es nicht gewohnt waren, leise aufzutreten. Joseph und die Männer waren jetzt nur durch die Hausecke getrennt – sie in dem finsteren Durchlass, er draußen an die Wand gepresst.
Er wartete.
Kurze Zeit später hörte er vom Anfang der Gasse, durch die er gekommen war, Schritte und Gemurmel: die Delegation, der er vorausgeeilt war und auf die es die Gruppe im Durchlass abgesehen hatte. Er lächelte, obwohl sein Herz heftig schlug. Das Warten hatte ein Ende. Er lauschte und hatte das Gefühl, dass die Männer dort hinter der Ecke sich bereitmachten.
Joseph trat ihnen in den Weg, als sie ihre Deckung verließen. Zwei von ihnen standen schon halb in der Gasse, zwei weitere duckten sich noch unter den Durchlass. Perfekt. Auf diese Weise behinderten sie sich gegenseitig.
»Nanu, wen haben wir denn hier?«, sagte er freundlich.
Die Männer stutzten. Joseph ahnte, dass sein italienischer Akzent die Überraschung noch vergrößerte. Er beherrschte die Sprache, die jenseits der Alpen gesprochen wurde, hinreichend, aber seinen Akzent hörte man trotzdem heraus.
»Verpiss dich«, sagte einer der Männer schließlich wenig geistreich. »Wir sind im Dienst.«
»Wenn ihr die Nachtwache seid, bin ich der Burggraf«, erwiderte Joseph.
»Ich hab gesagt, verpiss dich.«
»Was denn? Stadtluft macht frei – noch nie was davon gehört? Ich kann hier so gut sein wie ihr.«
»Kannst du nicht! Und jetzt hau ab.« Der Sprecher warf nervöse Blicke die Gasse hinauf, von wo sich die Delegation näherte.
Von den zweien, die sich noch in den Durchlass duckten, drängelte sich einer jetzt ins Freie. Er war offenbar der Anführer. Er gönnte Joseph einen kurzen, verächtlichen Blick.
»Was macht ihr Maulaffen hier?«, zischte er dann seinen Kumpanen zu. »Seht zu, dass der Kerl verschwindet, oder schlagt ihn tot!«
»Versucht’s doch«, sagte Joseph und hob die Fäuste wie die schlechte Parodie eines Faustkämpfers. Er wollte, dass die Männer ihn als Gegner nicht ernst nahmen.
Die Schritte der herankommenden Delegation waren jetzt so nah, dass man sie im nächsten Moment würde sehen können. Der schwache Lichtschein einer Laterne wanderte ihnen voraus.
»Gottverdammt«, sagte der Anführer. »Da kommen sie. Und wir stehen hier herum wie die Idioten. Los, zurück in Deckung. Den besoffenen Katzelmacher nehmen wir mit …«
Er packte Joseph am Wams. Josephs Rechte landete mit voller Wucht in seiner Magengegend. Als der Mann sich krümmte, schnappte Josephs Kopf nach vorn. Seine Stirn traf die Nasenwurzel seines Gegners. Der Mann sackte zusammen wie ein leerer Schlauch.
»Nie die Deckung vernachlässigen«, sagte Joseph. »Erste Lektion im Faustkampf.«
Die anderen Männer starrten ihn an. Dann fielen sie, mangels sinnvollerer Befehle und weil es das Naheliegende war, über ihn her.
Es dauerte nur ein paar Augenblicke, und es war weniger ein Kampf als vielmehr ein Tanz. Joseph wusste, wie man die Kraft des Gegners für sich und gegen ihn verwendete. Er wusste, wo man einen Gegner treffen musste, um ihn sofort kampfunfähig zu machen. Er wusste auch, wo man notfalls treffen musste, um den Gegner zu töten. Er trat einen Schritt zurück, als der letzte Angreifer sich stöhnend auf dem hartgefrorenen Boden ausstreckte und reglos liegen blieb, dann wandte er sich um und begegnete den Blicken der Ankömmlinge, die den Kampfplatz mittlerweile erreicht hatten. Es waren sechs alte Männer und eine junge Frau in der Mitte der Gruppe, die nun von den Männern nach hinten geschoben wurde. Sie trug die Laterne, deren Schein vorhin das Nähern der Gruppe angezeigt hatte. Sie hielt sie wie einen Schutzschild vor den Körper.
Einer der alten Männer trug eine runde, längliche Lederkapsel, wie man sie verwendete, um Dokumente vor Nässe zu schützen. Seine Hände krampften sich darum, als er flüsterte: »Was hast du getan, Joseph ben Kesher? Was hast du getan?«
»Friede sei auch mit dir, Jechiel HaCohen«, erwiderte Joseph ironisch.
»Was hat das zu bedeuten, Joseph?«, fragte einer der anderen alten Männer.
Joseph deutete auf die Lederrolle. »Diese Männer wollten Euch auflauern. Sie wollten Euch den Vertrag wieder abnehmen. Wie ich Euch prophezeit habe.«
»Aber … warum?«, stöhnte Jechiel HaCohen. »Ich verstehe das nicht. Der Burggraf hat uns doch eigens eingeladen, um den Vertrag zu ratifizieren.«
Die alten Männer waren die Seniores der jüdischen Gemeinde Nürnbergs. Jechiel HaCohen war der Parnass, der Vorsteher der Gruppe und damit die höchste geistliche und weltliche Autorität der Judengemeinde. Der Vertrag behandelte den geplanten Abriss aller Häuser im Judenviertel und den Austausch des jüdischen Grundbesitzes gegen anderen Grund und Boden außerhalb der Stadtmauern. Joseph, der den Vertragsverhandlungen seit mehreren Tagen als Berater beigewohnt hatte, hatte erreicht, dass die jüdische Gemeinde für das neue, zwangsweise zugewiesene Grundstück nur sechzehnhundert Gulden bezahlen musste – statt der ursprünglich geforderten dreifachen Summe. Er hatte des Weiteren eine Klausel in den Vertrag aufnehmen lassen, dass Burggraf Johann von Hohenzollern den Juden auch in Zukunft den Schutz der Stadt gewähren würde, selbst wenn sie außerhalb der Stadt lebten. Das letzte Massaker an der jüdischen Bevölkerung Nürnbergs war erst fünfzig Jahre her.
»Und jetzt wollte er Euch den Vertrag wieder wegnehmen«, sagte Joseph.
»Woher willst du das wissen, Joseph ben Kesher?«, fragte Jechiel HaCohen. »Du hast Gewalt angewandt, Joseph. Gewalt ist nicht unser Weg.« Jechiel deutete mit einem zitternden Daumen über seine Schulter auf die junge Frau. »Was wäre, wenn sie dich überwältigt hätten? Dann stünden sie jetzt hier vor uns und nicht du. Und sie wären wütend. Sie würden ihre Wut an Jutta auslassen. Du hast meine Tochter in Gefahr gebracht!«
»Nein, Reb Jechiel, Ihr habt sie selbst in Gefahr gebracht, indem Ihr sie mitgenommen habt. Ich hatte Euch gewarnt.«
»Meine Tochter geht stets voran und leuchtet mir, wenn ich nachts unterwegs bin«, sagte Jechiel. »So erfüllt sie ihre Pflicht gegenüber ihrem Vater.«
Joseph wandte sich ab. Er kauerte sich neben einem der Bewusstlosen nieder und drehte dessen Kopf herum. Der Mann stöhnte, erwachte aber nicht aus seiner Ohnmacht. »Zu gut rasiert für einen Straßenräuber«, sagte Joseph. »Zu wohl genährt.« Er riss die schmutzige Tunika des Mannes am Hals auf. »Und was sehen wir hier, unter den Lumpen? Eine Tunika in den Farben des Burggrafen. Das sind seine Soldaten. Selbst wenn die Tunika nicht wäre, wüsste ich es. Sie waren zu ungeschickt für Straßenräuber.«
»Wir sollten alle in die Falle gehen!«, rief einer der anderen alten Männer. »Sieh das doch endlich ein, Jechiel! Es war von Anfang an geplant.«
»Baruch hat recht«, sagte ein anderer. »Wir durften dem Burggrafen nicht vertrauen!«
»Ihr durftet König Karl nicht vertrauen«, sagte Joseph. »Der Burggraf tut nur, was man ihm sagt.«
»Ich halte das alles für ein Missverständnis«, sagte Jechiel. »Gewalt ist außerdem niemals unser Weg. Es ist nicht der Weg der Gerechten.«
Joseph antwortete nicht, weil Jechiels Hartnäckigkeit die alte, wohlbekannte Wut in ihm aufsteigen ließ. Manchmal versetzte ihn die Einstellung seiner Glaubensgenossen noch mehr in Zorn als die Hinterhältigkeit der Christen. Stattdessen begann er in den Kleidern des Mannes zu wühlen, der der Anführer der Soldaten gewesen war. Seine Hand kam mit einem gefalteten Papier zum Vorschein. Er faltete es auseinander, las es und grinste freudlos.
»Was hast du?«, fragte der Senior, der Baruch genannt worden war.
»Das, Reb Baruch, ist ein Erlaubnisschein, sich nachts trotz der Ausgangssperre in und außerhalb Nürnbergs aufzuhalten«, sagte Joseph. »Es heißt hier, dass seine Besitzer in keinem Fall aufgehalten oder für irgendetwas zur Rechenschaft gezogen werden sollen, weil das, was sie tun, zum Wohle der Stadt und des Reichs geschieht. Glaubt Ihr mir jetzt endlich, Reb Jechiel?« Er stand auf und reichte dem Parnass das Dokument. »Nehmt den Passierschein. Damit kommt Ihr unbehelligt durch, falls Euch die richtige Nachtwache begegnen sollte. Passt gut auf den Vertrag auf.«
Er wird euch im Ernstfall nichts nützen, fügte er im Stillen hinzu. Nichts nützt etwas, das ihr auf das Vertrauen baut, dass die Christen ihre Zusagen einhalten werden. Alles, was dieser Vertrag vermag, ist, euch Hoffnung zu geben, bis sie dann doch eure Türen eintreten und euch wegschleifen und euch und eure Frauen und Kinder auf der Straße erschlagen.
Uns, dachte er dann. Bis sie uns wegschleifen. Uns und unsere Frauen und unsere Kinder. Ich bin immer noch einer vom auserwählten Volk, auch wenn manche es sich anders wünschen. Zum Beispiel mein Vater.
Die Seniores drücken sich an Joseph vorbei. Bis auf Jechiel HaCohen murmelten sie ihm Abschiedsgrüße zu und segneten ihn. Jutta blickte weg, als sie ihn passierte. Die Gruppe verschwand in Richtung Judenviertel, und die Gasse war auf einmal wieder dunkel, weil das warme gelbe Laternenlicht jetzt fehlte.
Einer der besiegten Angreifer ächzte und versuchte sich aufzurichten. Joseph stellte ihm den Fuß auf die Schulter und stieß ihn um. Der Mann rollte aufs Gesicht und lag wieder still.
»Sie sind weg«, sagte er dann laut.
Das Bündel aus Lumpen und Decken, das Joseph als Signal gedient hatte, bewegte sich plötzlich, dann erhob sich ein Mann aus dem Wirrwarr und richtete sich auf. Er war einen halben Kopf größer als Joseph, hatte eine breite Brust und noch breitere Schultern und ein freundliches, bärtiges Gesicht unter einem Lockenkopf. Seine Miene war die eines Mannes, den man einfach beiseiteschubsen kann und der sich dann auch noch dafür entschuldigt, im Weg gestanden zu haben.
Man hätte keinen größeren Fehler begehen können, als Zacharias Phiselin tatsächlich für so einen Mann zu halten.
»Du hast mich überhaupt nicht gebraucht«, sagte Zacharias.
»Doch«, widersprach Joseph. »Ich kämpfe beruhigter, wenn ich weiß, dass du im Notfall eingreifst.«
»Wie bin ich froh, dass du meinetwegen beruhigt kämpfen kannst«, sagte Zacharias trocken.
»Und ich brauchte dich, damit ich wusste, dass sich die Kerle wirklich hier versteckten.«
»Dazu hätten die Decken alleine auch gereicht.«
»Und wie hätten die Decken sich wegbewegt, wenn der Hinterhalt woanders stattgefunden hätte?«
»Ich frage mich, ob ich mich im Ernstfall noch hätte wegbewegen können. Du hast mich reichlich lange hier herumliegen lassen, wenn ich das mal anmerken darf. Ich bin vor Kälte so steif wie Lots Weib.«
»Sei nicht so ein kleines Mädchen«, sagte Joseph lächelnd und schlug Zacharias gegen den Arm. »Und danke, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Es hat gutgetan, dich als Verbündeten in der Hinterhand zu wissen.«
»War mir ein Vergnügen«, erklärte Zacharias. »Und das mit dem kleinen Mädchen habe ich überhört.«
Joseph seufzte. »Machen wir, dass wir hier wegkommen. Ich habe genug von Schnee und Kälte; ich freue mich auf Zuh… auf Venedig.« Er bückte sich nach dem Deckenknäuel, unter dem Zacharias sich versteckt hatte, um es aufzuraffen.
»Ich nehm das schon …«, rief Zacharias hastig, aber es war zu spät. Joseph hob die Decken hoch. Ein Gesicht mit großen Augen, von wirrem, langem Haar umrahmt, blinzelte zu ihm hoch.
Joseph drehte sich um.
»Zacharias …«, begann er drohend.
»Ja, ja, ja!«, rief Zacharias. »Was sollte ich denn machen?«
»Du warst mit ihr hier unter der Decke?«
»Da war es wenigstens schön warm.«
»Du bist doch ein noch größerer Narr als Reb Jechiel …«, begann Joseph lautstark.
»Friede sei mit dir, Jossele«, piepste das Mädchen und verzog den Mund zu einem strahlenden Lächeln. »Ich hab dich vermisst.«
»Schrei mich nicht an in Gegenwart meiner Tochter«, sagte Zacharias mit verletzter Würde.
»Ich sollte dir in den Hintern treten in Gegenwart deiner Tochter«, sagte Joseph.
»Maria war nicht in Gefahr. Wofür hältst du mich?«
Joseph bückte sich und hob Maria samt den Decken hoch, in denen sie lag wie in einem Nest. Er küsste sie auf die Stirn. »Friede sei mit dir, meine kleine Suri«, sagte er. Maria kicherte.
»Nenn sie nicht Prinzessin«, brummte Zacharias. »Und sie kann alleine laufen. Lass dich nicht ständig von ihm rumtragen, Maria, du nutzt seine Gutmütigkeit schamlos aus.«
»Gehen wir, kleine Suri«, sagte Joseph, ohne das Kind abzusetzen. »Dein Vater hat jetzt eine Weile nicht das Recht, dir Sachen zu verbieten, nachdem er dich gegen mein ausdrückliches Verbot hierher mitgenommen hat. Stimmt’s?«
»Wo soll ich denn hin mit ihr?«, sagte Zacharias aufgebracht. »Hätte ich sie bei irgendwelchen Fremden lassen sollen? Mit sechs Jahren? Hätte ich sie beim Burggrafen abgeben sollen? Wie stellst du dir das vor, Jossele?«
»Du hättest sie in Venedig lassen sollen.«
»Bei wem? So einfach ist das nicht, wenn einem die Mutter des einzigen Kindes stirbt.«
»Deborah ist seit vier Jahren tot«, sagte Joseph sanft. Er sah aus dem Augenwinkel, wie Zacharias unglücklich mit den Schultern zuckte. Er hätte Zacharias das sagen können, was alle zu ihm sagten, die von seiner Lage hörten: Nimm dir doch wieder eine Frau. Es tut deiner Liebe für Deborah keinen Schaden. Und das Kind braucht eine Mutter.
Er sagte es nicht. Er und Zacharias waren enger miteinander verbunden als Brüder, und ein Bruder fügte dem anderen nicht unnötig Schmerz zu. Zudem war das Thema seit kurzem auch für Joseph mit Pein behaftet. So lange hatte er es geschafft, keine Frau in sein Herz zu lassen. Und dann war eine so schnell dort eingedrungen, dass das Aufschäumen seiner Gefühle ihn geradezu atemlos gemacht hatte. Es machte die Sache nicht besser, dass diese Liebe völlig unmöglich war. Von beiden Seiten. Eher kamen Feuer und Wasser zusammen als ein Jude und eine Christin.
Maria riss Joseph aus seinen Gedanken. »Du darfst Tatele nicht schimpfen«, sagte sie und musterte ihn mit ernster Miene. »Er ist der beste Tatele auf der Welt.«
»Das ist er«, sagte Joseph heiser und fühlte Schmerz in seiner Kehle. »Das ist er, bei allen Gerechten!«
Dann spürte er plötzlich, wie der Boden unter seinen Füßen bebte.
3
Gabriele de Mussis blinzelte, als er als Letzter der Delegation aus den Toren der Stadt Caffa ins Freie hinaustrat. Bis zur Morgendämmerung mochten es noch ein, zwei Stunden sein. Der Nieselregen ließ die Feuer im Lager der Tataren verwaschen durch die Dunkelheit leuchten.
Nach über einem Jahr Belagerung war man in Caffa an nächtliche Finsternis gewöhnt. Öl, Tran und Fett hatten längst den Eingang in den Speiseplan der Bewohner gefunden und waren zu wertvoll, um als Brandmittel für Laternen zu dienen. Wer nachts durch die Gassen von Caffa huschte – immer an den Wänden entlang, um den gelegentlichen Pfeilschauern der tatarischen Bogenschützen zu entgehen –, hatte sich längst mit Dunkelheit, Stolpern, angeschlagenen Zehen und Kopfnüssen von zu spät gesehenen Dachbalken abgefunden. So wie mit dem Beschuss. Die herunterkommenden Pfeile konnte man ebenso hören wie das Flattern der von den Schleudern abgeschossenen Steine und ihnen ausweichen – außer man saß zufällig in einem der Häuser, die den Steinen im Weg standen. Aber das eine oder andere beiläufige Opfer hatte man zu akzeptieren, wenn man belagert wurde; die überlebenden Nachbarn, die die Erschlagenen aus den Trümmern zogen, pflegten der Meinung zu sein, dass es auch schlimmer hätte kommen können.
Gabriele musterte den unregelmäßigen Ring aus trübe schimmernden Lagerfeuern, der sich im Nordosten der Stadt bis zum Meer hinunterzog und in der Gegenrichtung im unregelmäßigen Gelände verschwand. Die Fessel, die das Belagerungsheer Caffa angelegt hatte, ging dort bis zu den steilen Klippenhängen. Die Klippen schoben einen Sporn ins Meer hinaus und schützten den Hafen Caffas von Süden her. Diese Felsen und der Umstand, dass die Tataren sich nicht auf das Meer hinauswagten, waren der Grund dafür, dass der Hafen offen geblieben war. Natürlich beschossen die Belagerer jedes Schiff, das Caffa verließ oder dort anlegen wollte, und die Anzahl der am Strand angespülten oder die Hafenzufahrt unsicher machenden gesunkenen Wracks war beträchtlich – doch der Hafen war offen geblieben, und die Versorgung der eingeschlossenen Bürger funktionierte so weit, dass man halbwegs überleben konnte. Djanibek Khan, der Anführer der Tataren, würde Caffa niemals besiegen können, solange ihm der Hafen nicht gehörte.
Gabriele fühlte die Blicke der anderen Delegationsmitglieder auf sich. Er war das jüngste Mitglied der Abordnung und nicht einmal Bürger der Stadt, und doch betrachteten die anderen ihn als ihren Sprecher. Es war bekannt geworden, dass er bei früheren Reisen in die Gegenden östlich des Schwarzen Meers genügend Sprachkenntnisse aufgeschnappt hatte, um sich mit den Tataren unterhalten zu können. Ein Lob auf den reisenden Arzt, dachte er sarkastisch, er sammelt Wissen und Fertigkeiten – und zieht sich so ziemlich jede Krankheit zu, die man sich denken kann, und mit etwas Glück und Gottes Gnade überlebt er sie alle – und dann erhält er als Belohnung dafür den Auftrag, dem Löwen in den offenen Rachen zu spazieren. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, wie lange seine Courage noch vorhalten würde. Er war in der Stadt geblieben, obwohl viele Fremde die unregelmäßig verkehrenden Schiffe genutzt hatten, um zu fliehen. Er hatte sich vorgesagt, dass ein Arzt bei den Verwundeten und Kranken bleiben musste. Aber je länger sich sein Aufenthalt hinzog, desto mehr beneidete er diejenigen, die den Mut besessen hatten, sich als Feiglinge zu erkennen zu geben.
Und jetzt hatte er auch noch diesen Auftrag zu erfüllen. Die Aufgabe der Delegation lautete, Djanibek Khan dazu zu bewegen, endlich das von Caffa angebotene Lösegeld anzunehmen und die Belagerung aufzuheben, bevor das Patt zwischen beiden Parteien zu einem ewigen Stillstand kam. Es hatte schon mehrere derartige Versuche gegeben, allesamt vergeblich. Einmal hatte der Khan die Abgeordneten pfählen lassen. Die anderen Delegationen waren unverletzt zurückgekehrt. Man konnte nie wissen, wann es dem Khan wieder einfallen würde, die Botschafter zu Tode zu schinden.
Hinter ihnen schlossen sich die Torflügel. Matteo del Bosco, an dessen Seite sich Gabriele hielt, blickte auf. »Worauf warten wir, meine Herren?«, fragte er. Seine Stimme sollte vermutlich forsch klingen, aber in Gabrieles Ohren hörte sie sich dünn an. Während Gabriele der Sprecher der Gruppe war, galt Matteo als ihr Anführer.
Soldaten erwarteten sie an einem der Zugänge zum Heerlager und brachten sie schweigend tiefer hinein. Das Zelt des Khans stand auf einem freien Platz inmitten der anderen Zelte. Es war mit Goldfarbe überzogen. Der Überzug hatte gelitten in den langen Monaten der Belagerung und wies jetzt mehr schwarze als schimmernde Stellen auf. Feuer brannten um es herum. Neben einem der Feuer sah Gabriele etwas, das ihn mit Schrecken erfüllte. Auch die anderen Delegationsmitglieder sahen es und blieben stehen. Gabriele hörte Gemurmel. Matteo del Bosco zischte: »Schsch!«
Ein Mann kniete auf dem Boden, den Kopf gesenkt. Er war nicht gefesselt. Ein Tatar bewachte ihn. Der Gefangene schien nur halb bei Bewusstsein zu sein, denn sein Oberkörper schwankte hin und her. Neben ihm lag ein langer, abgeschälter, zugespitzter Pfahl. Gabriele sah das Fett schimmern, mit dem der Pfahl eingerieben worden war. Djanibek Khan schien zur Begrüßung der Delegation eine Pfählung vorbereitet zu haben.
Der Mann war kein Tatar, sondern ein Europäer.
Er trug die Kutte eines Mönchs, aber er hatte keine Tonsur. Um seinen Hals hing ein silbernes Kreuz an einer ebenfalls silbernen Kette, das die Tataren ihm gelassen hatten, damit die Delegation auch wirklich erkannte, was er war.
Er war ein Priester.
Gabriele blickte auf, als Djanibek Khan aus seinem Zelt trat. Er erkannte den Khan nur deshalb, weil die Wachen vor seinem Zelt strammstanden. Er hatte einen beeindruckenden Mann erwartet, aber der Khan sah nicht anders aus als seine Soldaten: eine untersetzte Gestalt, die aus genietetem Leder und einer Kettenrüstung zusammengesetzt schien, auf der ein quadratischer Kopf saß. Die Gesichtszüge der Tataren wirkten stets übelgelaunt und brutal, aber Gabriele war genügend herumgekommen, um zu wissen, dass dies ein Vorurteil war – man hatte ihm einmal in aller Freundschaft mitgeteilt, dass die Gesichter seines Volkes wegen ihrer Länge und der großen Augen auf die Tataren äußerst dümmlich wirkten. Er selbst, so hatte man ihn weiter ins Vertrauen gezogen, galt mit seinen blonden Haaren und den hellen Augen als außergewöhnlich hässlich.
Djanibek Khan hatte erst vier Jahre zuvor die Nachfolge seines Vaters als Anführer der Goldenen Horde angetreten; den guten Sitten seines Volkes folgend hatte er dabei seine beiden älteren Brüder beseitigt. Seitdem war er damit beschäftigt gewesen, die Moskauer Großfürsten zu terrorisieren, sich in die Angelegenheiten des Herzogtums Litauen einzumischen und in seinem Herrschaftsbereich den Islam als einzige Religion zu installieren. Bereits seit fünf Jahren plante er Caffa zu erobern, aber eine genuesische Flotte hatte seine Armee zerschlagen, und die Goldene Horde hatte fliehen müssen, fünfzehntausend Tote dabei zurücklassend. Vor über einem Jahr war sie wiedergekommen, Rache im Sinn.
Dem Khan folgte ein Unterführer, der hektisch auf ihn einredete. Djanibek grollte etwas. Der Unterführer redete weiter. Djanibek blieb stehen, wandte sich halb um und bellte etwas, so dass der Unterführer zusammenzuckte und einen Schritt zurückwich. Die Kiefer des Offiziers mahlten, aber er schloss jetzt den Mund und trat beiseite.
»Ihr alle«, sagte der Khan und deutete auf die Delegation, die sich verneigte, »ihr alle … auf euch wartet das Gras.« Er machte eine Kunstpause und grinste dann.
Gabriele drehte die Worte des Tatarenkhans hastig in seinem Kopf hin und her, versuchte sich daran zu erinnern, ob er etwas Ähnliches schon gehört hatte, bedachte die Herkunft der Goldenen Horde aus den asiatischen Steppen und übersetzte schließlich: »Er sagt, wir sind erledigt.«
»Fragt ihn, was diese unsägliche Zurschaustellung bedeutet«, sagte Matteo und deutete auf den gefesselten Priester.
»Angst«, erwiderte Gabriele. »Todesangst auf unserer Seite.«
»Ihr habt ihn noch gar nicht gefragt.«
»Ich brauche ihn nicht zu fragen, um das zu wissen. Der nächste Schritt wird sein, dass er den armen Kerl vor unseren Augen pfählen lässt.«
»Gütiger Himmel! Was für ein Monster! Wieso denkt er, uns Angst einjagen zu müssen?«
»Damit wir sie hinter die Mauern der Stadt tragen. Anders kann er uns nicht besiegen. Nur durch unsere Angst.«
»Ihr meint, er will gar nicht verhandeln?«
»Ich meine«, sagte Gabriele, »dass er das Gesprächsangebot wahrscheinlich gar nicht angenommen hätte, wenn ihm der Unglückliche nicht in die Hände gefallen wäre.«
»Gütiger Himmel!«
Djanibek Khan war der hastigen Unterhaltung interessiert gefolgt. Er hatte sie nicht unterbrochen oder sich darüber aufgeregt, dass man sich nicht mit ihm befasste. Gabriele glaubte nicht, dass er auch nur ein Wort verstanden hatte, aber er schien aus den Gesten und Mienen erraten zu haben, worum es gegangen war – und dass er sein Ziel erreicht hatte. Die Angst der Abgesandten war schon jetzt greifbar.
»Wie geht es jetzt weiter?«, fragte Matteo del Bosco unsicher.
»Ihr macht ihm das Angebot mit dem Lösegeld, er wird es ablehnen, dann wird er den Gefangenen umbringen, dann dürfen wir wieder gehen. Wenn wir Glück haben, vollzählig.« Gabriele versuchte es leichthin zu sagen, aber sein Herz hämmerte vor Angst so hart, dass es ihm wehtat.
»Wie meint Ihr das?«, hauchte Matteo.
Gabriele ging nicht darauf ein. Er beobachtete Djanibeks Miene. »Wir dürfen ihn nicht länger ignorieren. Macht ihm Euer Angebot. Jetzt.«
Matteo del Bosco raffte seinen Mut zusammen. »Sagt ihm als Allererstes, dass wir den Gefangenen mitnehmen wollen. Er ist Teil der Abmachung.«
Von den anderen Delegationsmitgliedern kamen überraschte Geräusche. »Seid Ihr verrückt geworden, Signor?«, stöhnte einer der Männer. »Wir können dem Mann nicht helfen.«
»Er ist totes Fleisch«, sagte ein zweiter. »Habt Ihr nicht gehört, was Messere de Mussis gesagt hat? Wir können froh sein, wenn der Khan uns alle wieder mit heiler Haut abziehen lässt!«
Matteo del Boscos Blicke ließen die Gabrieles nicht los. Der Mann war zwar ein zögerlicher Delegationsleiter, aber er hatte Mut. Gabriele fühlte sich durch ihn beschämt. Er hatte den gefangenen Priester genauso verloren gegeben wie die restlichen Delegationsmitglieder.
Er wandte sich an Djanibek und übersetzte die Forderung Matteos. Djanibek Khan musterte den Genueser. Dann knurrte er etwas.
»Er sagt Ja«, übersetzte Gabriele zu seinem eigenen Erstaunen. Djanibek sprach weiter. »Wir sollen ihm ins Zelt folgen.«
Der Khan machte eine barsche Kopfbewegung zu dem Unterführer, der vorhin auf ihn eingeredet hatte, dann stapfte er an seinen Leibwachen vorbei in sein Zelt. Der eine der beiden Wächter schien angeschlagen zu sein, denn er machte schmale Augen und schüttelte sich kurz wie jemand, der Kopfschmerzen hat. Aber er stand genauso stramm wie sein Kamerad. Die Delegation folgte Djanibek zögernd und zwischen zwei weiteren Wächtern hindurch, die breitbeinig vor dem Eingang zum Innenzelt standen.
Drin machte Djanibek es sich auf einem mit Teppichen und Kissen belegten Thronsessel bequem. Der Unterführer gehorchte einem Wink seines Herrn und stellte sich hinter ihn. Er schien sich in seiner Rüstung unwohl zu fühlen.
Djanibek begann zu reden und musterte dabei Matteo del Bosco.
»Mein Volk liebt den Tauschhandel«, sagte der Khan. »Wer etwas nimmt, muss etwas geben.«
»Euer Volk hat sich von unseren Leuten viel genommen, ohne zu geben«, wandte Matteo ein.
Djanibek sagte mit unbewegter Miene: »Das stimmt nicht. Wir haben ihnen den Tod gegeben.«
Matteo schluckte und blickte zur Seite. Gabriele wartete darauf, dass er etwas sagte, aber es kam nichts. Anscheinend fragte sich der Genueser, ob er auch nur mit irgendeiner seiner erlernten Verhandlungstaktiken weiterkommen würde.
»Du«, sagte der Khan zu Matteo, »verstehst das mit dem Tauschhandel, oder? Ich gebe dir den ungläubigen Priester. Was gibst du mir dafür?«
»Wir können uns über die Erhöhung des von uns angebotenen Lösegeldes sicher einigen«, begann Matteo.
Der Khan schüttelte den Kopf. »Kein Geld«, sagte er. »Der Pfahl ist gespitzt, er will verwendet werden. Gib mir den.« Er deutete auf eines der Delegationsmitglieder. Der Mann erbleichte und begann zu stottern, als Gabriele fertig übersetzt hatte.
»Oder den. Oder den dort? Der da ist zu dick, der Pfahl würde brechen. Wie wäre es mit dem?« Der Khan deutete nacheinander auf die Delegationsmitglieder.
Erregtes, panisches Stimmengewirr erhob sich. Matteo war totenblass geworden. »Ich kann nicht über das Leben der Delegationsmitglieder verfügen«, sagte er mit schriller Stimme.
»Na gut. Dann nehme ich – dich.«
Matteo stierte Gabriele, dann den Khan, dann wieder Gabriele an, als wollte er den Arzt auffordern, etwas anderes zu übersetzen. Gabriele hatte Mühe, sein Zittern zu unterdrücken. Er wusste, dass er den Khan richtig verstanden hatte. »Ich trete von meiner Bitte zurück«, sagte Matteo schließlich. »Der Priester ist in Eurer Gewalt. Gott wird sich seiner Seele erbarmen.«
Gabriele schloss die Augen. Damit war die Verhandlung vorüber. Der Khan hatte die Falle, in die sich Matteo mit seiner mitleidigen Forderung begeben hatte, zuschnappen lassen. Niemand, auch nicht Gabriele, hätte sich freiwillig an die Stelle des Priesters begeben und sich den Pfahl vom After her durch den Körper treiben lassen, bis er oben bei den Schulterblättern wieder austrat. Man starb nicht gleich daran. Man wäre es nur gern. Jedenfalls hatte Matteo nun jeden Respekt bei Djanibek Khan verloren, und auch die christliche Aufforderung zur Nächstenliebe war nun kompromittiert. Und genau diese Reaktion hatte der Khan von der Delegation erwartet. Er hatte gewusst, was er tat, als er die Abgesandten den Gefangenen hatte sehen lassen.
Matteo begann trotzdem, das Lösegeldangebot darzulegen. Er zählte auf, was alles gegen die Wahrscheinlichkeit sprach, dass die Belagerung jemals Erfolg haben würde. Seine Stimme verriet seine Demütigung und Hoffnungslosigkeit. Gabriele mühte sich durch die Übersetzung. Er fühlte sich mehr und mehr durch den Unterführer hinter Djanibeks Thron abgelenkt. Er wirkte zusehends nervöser, so als säße er mit dem Hintern auf einem Herd, der immer heißer wurde. Seine Hände wanderten immer wieder zu seinem Hals. Gabriele hatte bei seinen früheren Begegnungen mit Tataren Wutanfälle bei Besprechungen gesehen, demonstrativ zur Schau getragene Langeweile, albernes Gekicher und steinerne Mienen – aber niemals Nervosität oder Unruhe. Er fand es zusehends schwer, seine Aufmerksamkeit von dem zappeligen Offizier abzuwenden.
Dann ertönte eine Mischung aus einem dumpfen Aufprall, Metallgerassel und Röcheln vor dem Zelt, und Gabriele brach mitten im Satz ab. Der zappelige Offizier erstarrte in der Bewegung. Gabriele erkannte jetzt, dass der Mann schreckliche Angst hatte. Aber wovor?
»Seht nach, was da draußen los ist«, sagte Djanibek Khan und zog sein Schwert näher zu sich heran. Die Delegationsmitglieder wechselten rasche, besorgte Blicke.
Einer der beiden Leibwächter stapfte vor das Zelt. Die Blicke des Offiziers folgten ihm. Nach einem Augenblick kam der Krieger wieder herein und blickte noch finsterer als üblich.
»Ihr solltet es selbst sehen, Herr«, brummte er.
Djanibek Khan kniff die Augen zusammen. Dann sprang er auf und eilte durch die Delegation, deren Mitglieder hastig beiseitesprangen. Der zappelige Offizier gab sich einen Ruck und rannte ihm hinterher. Gabriele und Matteo del Bosco sahen sich an, dann drängten sie wie auf ein unsichtbares Zeichen ebenfalls zum Zelt hinaus. Die Delegation stolperte ihnen nach. Niemand hielt sie auf.
Einer der Wachposten lag inmitten seiner Waffen auf dem Boden. Der andere kniete neben ihm und sah ratlos aus. Djanibek Khan hatte die Hände in die Hüften gestemmt und holte Atem, um loszubrüllen. Der Offizier packte ihn am Arm. Die Beine des Wachpostens zuckten wie die eines Erstickenden.
Sein Kamerad fasste sich ein Herz und drehte ihn herum. Der Oberkörper des Gefallenen bäumte sich auf. Er gurgelte, dann brach sich ein mörderischer Hustenanfall Bahn. Schleim spritzte aus dem weit geöffneten Mund. Plötzlich folgten schwarze Blutbatzen, und dann hellrotes Blut, das heraussprühte wie aus einer durchtrennten Schlagader.
Djanibek Khan wich zurück. Der Wachposten auf dem Boden sperrte die Kiefer auf, seine Zunge streckte sich nach draußen, die Augen traten hervor, sämtliche Adern an seinem Hals standen vor. Seine Hände krallten sich in die Luft.
Djanibek Khan verschwand rückwärts in seinem Zelt, von seinem Offizier gezogen, der auf ihn einschrie. Der Kamerad des zuckenden Wachpostens sah mit blut- und schleimbespritztem Gesicht zu den Delegationsmitgliedern auf, so erschüttert und hilflos, dass es Gabriele wehtat. Aus dem goldenen Zelt ertönten wütendes Geschrei und Flüche.
Matteo del Bosco machte einen Schritt auf den gefallenen Mann zu. Gabriele ergriff seinen Oberarm und riss ihn zurück. Ihm war so kalt, als läge er tot unter der Erde.
»Gehen wir«, sagte er mit erzwungener Ruhe. »Gehen wir. Jetzt.«
»Wir müssen noch …«
»Wir müssen nur gehen. Jetzt. Bei der Jungfrau Maria und allen Heiligen, Signor! Lauft!«
Im gleichen Moment stolperte ein weiterer tatarischer Krieger in den Feuerschein. Sein Gesicht war rot. Sein Mund arbeitete. Seine Beine bewegten sich, als ginge der Mann auf Stelzen. Er riss sich den Helm vom Kopf. Seine Augen traten hervor. Er gurgelte. Gabriele wirbelte zu den Delegationsmitgliedern herum.
»Lauft!«, schrie er und rannte los.
Die Krieger auf der freien Fläche vor dem Zelt des Khans starrten ihren hilflosen Kameraden erschrocken an. Dieser torkelte im Kreis herum und versuchte den Halsausschnitt seiner Lederrüstung zu weiten. Gabriele bückte sich im Rennen und zerrte den Priester auf die Beine. Dieser stöhnte und schüttelte den Kopf. »Non!«, murmelte. »Non! Non!«
Gabriele stieß ihn vor sich her. Der Gefangene stolperte und wäre gefallen. Er schüttelte immer noch den Kopf. Gabriele packte seinen Arm und zerrte ihn mit sich. Er hatte die Sprache erkannt. Der Priester war Franzose.
»Wollt Ihr leben?«, schrie er ihm in dem bisschen Französisch ins Ohr, das er auf seinen Reisen gelernt hatte. »Kommt mit. Lauft.«
Der Gefangene stöhnte. Seine Beine begannen sich zu bewegen. Es war, als ob er sich bereits mit seinem Tod abgefunden hätte und jetzt nur schwer damit zurechtkam, dass er noch nicht stattfand. Aber er lief jetzt neben Gabriele her, der ihn nicht losließ, weil ein irrer Gedanke in seinem Kopf darauf beharrte, dass er aus dem Lager der Tataren lebend herauskäme, wenn er diese arme Seele dabei rettete. Eigentlich war es eine völlig unmögliche Flucht durch ein Heer von waffenstarrenden, jetzt aufgeschreckten Kriegern – aber wenn er es schaffte, den französischen Priester herauszubringen, würde Gott auch ihn, Gabriele de Mussis, herausbringen.
Zwischen den Zelten tauchten Soldaten auf und machten Anstalten, auf sie zuzulaufen und sie festzuhalten. Gabriele sah sich im Rennen nach der Delegation um und stellte fest, dass sie ihn gerade alle überholten. Matteo del Bosco lief vorneweg, sein langer Mantel flatterte hinter ihm her. Vom Zelt des Khans her ertönten plötzlich Hornsignale und Trommelschläge, und die auf sie zulaufenden Krieger änderten die Richtung und strebten nun auf den großen freien Platz zu. Der Weg aus dem Lager heraus war frei.
Gabriele und der Gefangene holten die anderen beim Tor ein. Der Priester sank zu Boden und krümmte sich dort. Er versuchte etwas zu sagen. Gabriele verstand Nein und Bei der Liebe Christi und Heiliger Vater, warum, warum! Er konnte sich keinen Reim darauf machen und stützte die Hände auf die Knie, um wieder zu Atem zu kommen. Der Gefangene wirkte, als ob er Fieber hätte. Einen schrecklichen Moment lang dachte Gabriele, er hätte auch die Krankheit wie die tatarischen Soldaten, doch er rang nicht nach Luft und spuckte auch kein Blut. Danke, Herr, dachte er und richtete den Blick nach oben, danke, dass Du mich gerettet hast.
Zwei der Delegationsmitglieder hämmerten mit den Fäusten an die Torflügel und schrien, dass man sie einlassen solle, bei der Jungfrau Maria und der Liebe ihres Sohnes Jesus Christus und macht-das-Tor-auf-ihr-Schweinehunde-und-lasst-uns-rein, während man von innen schon das Klackern und Rasseln des Mechanismus hörte, mit dem das Fallgitter hinter dem äußeren Tor hochgezogen wurde. Matteo del Bosco kam auf Gabriele zu.
»Was war das?«, stieß er hervor. »Was haben die Tataren?« Dann bemerkte er erst den Priester. Seine Augen weiteten sich. »Habt Ihr ihn mitgeschleift?«
»Ja.«
»Gütiger Himmel. Ihr seid ein mutiger Christ, Medicus.«
Es war ein Handel mit Gott, dachte Gabriele, aber er sagte nichts dazu.
»Also, schnell: Was, glaubt Ihr, war das im Lager der Tataren?«
Gabriele seufzte. Es war sinnlos, um den heißen Brei herumzureden. »Es ist die tödliche Seuche, die in den Ländern der Goldenen Horde herrscht.«
Matteo bekreuzigte sich. Er erbleichte trotz seines erhitzten Gesichts. »Jenseits des Chasarischen Meers? Ich habe das für ein Gerücht gehalten.«
»Ist es nicht. Ich habe die Gegenden bereist. Und ich kann Euch noch etwas verraten. Seid Ihr vertraut mit den Legenden über die Pest, die zu Zeiten von Kaiser Justinian geherrscht haben soll?«
»Gütiger Himmel! Wollt Ihr damit sagen …?«
Gabriele nickte. »Wenn ich die Anzeichen richtig deute, handelt es sich um dieselbe Krankheit.«
»Aber die ist vor siebenhundert Jahren aufgetreten und dann nie wieder!«
»Jetzt ist sie zurück.«
Matteo dachte mit weit aufgerissenen Augen nach. Schließlich fand er den Mut zu der naheliegendsten Frage: »Sind wir jetzt auch krank?«
»Ich glaube, nicht. Soweit ich weiß, wird die Krankheit durch Berührung übertragen.«
»Die Tataren …«
»Ja, ich weiß. Ich würde sagen, die Belagerung ist beendet, Signor. Die Krieger leben auf engstem Raum miteinander. Der Todesengel wird durch ihre Reihen schreiten wie damals, als der Herr ihn gegen die Ägypter sandte.«
»Gütiger Himmel, was für ein Vergleich. Glaubt Ihr, dass er es hat?« Matteo deutete auf den Priester.
Gabriele schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Die Anzeichen, die er zeigt, sind die eines Mannes, der ein paar Tage lang bei Wind und Regen draußen verharren musste. Vielleicht stirbt er an Unterkühlung oder Entkräftung, aber nicht an der Pest.«
Matteo nickte. Er blickte sich um, zum Lager der Tataren. Gabriele folgte seinem Blick. Die ersten Feuer loderten dort hoch, es waren immer noch Trommeln und Hornsignale zu hören.
Das Stadttor schwang auf. Soldaten kamen heraus und einige hochrangige Ratsmitglieder. Erschrockene Fragen wurden laut.
»Seid Ihr überfallen worden?«
»Haben sie Gefangene gemacht?«
»Was ist passiert?«
Matteo sah Gabriele drängend an. »Kein Wort über die Krankheit. Zu niemandem! Ich muss erst mit dem Konsul sprechen. Verstanden?«
Gabriele nickte. Er ließ es zu, dass er beiseitegestoßen wurde, als ein paar Männer sich um Matteo drängten. Die anderen Delegationsmitglieder betraten bereits die Stadt. Gabriele bückte sich und zerrte den französischen Priester auf die Beine. Er konnte sehen, dass der Mann fieberte und nur bruchstückhaft mitbekam, was um ihn herum vorging. Tränen liefen ihm über die Wangen. Gabriele konnte sich nicht vorstellen, wie man sich fühlen mochte, wenn einem der Tod durch Pfählung sicher gewesen war und man sich plötzlich gerettet sah. Er nahm an, dass er in diesem Fall auch fiebern, irr reden und weinen würde.
Er griff dem Priester unter die Arme und zog ihn mit sich. Anscheinend war der Mann jetzt seine Verantwortung. Nun, das war eine Verantwortung, die er gern auf sich nahm, und ein günstiger Preis für den Handel, den er mit Gott eingegangen war.
2. BUCH
DER TAG DER SÜNDEN
»Dieses Schiff bringt seine Ladung nach Genua, koste es, was es wolle.«
Kapitän Renzo
1
Hizyr Mahmud stolperte durch das Lager der Goldenen Horde. Tränen liefen über seine Wangen. Um ihn herum wälzte sich der Stolz seines Volkes sterbend im Schlamm.
Es konnte nicht anders sein, als dass Tenger Etseq, der zeitlose blaue Himmel, zornig über seine Kinder war. Wie hätte er es auch nicht sein sollen, da die alten Rituale, die Trankopfer, die Tänze seit Generationen zum Erliegen gekommen waren und Djanibek Khan, der derzeitige Herrscher der Goldenen Horde, dem alten Glauben durch seine bedingungslose Hinwendung zu Allah den Todesstoß versetzt hatte? Erschrocken ertappte Hizyr Mahmud sich bei diesen frevelhaften Gedanken.
»Möge der eine und wahre Gott meiner Seele gnädig sein«, flüsterte er und machte einen Bogen um einen Toten, der in einem Zelteingang auf dem Bauch lag und aus dessen Nase noch das Blut tropfte. Instinktiv hielt er sich die Hand vor den Mund und den Atem an.
Das Belagerungsheer der Goldenen Horde vor Caffa war am Ende, der Kriegszug verloren, die Vergeltung für die Niederlage vor drei Jahren sauer geworden und auf die Horde zurückgefallen. Jeder wusste es, von den Kriegern, die zu Dutzenden hustend, röchelnd und qualvoll in ihrem eigenen Blut ertrinkend starben, bis zu den Unterführern, die versuchten, am Leben zu bleiben, indem sie sich von ihren Scharen fernhielten. Hizyr Mahmud war einer der wenigen, die sich zu den Kriegern wagten, auch wenn dies bedeutete, dass er früher oder später ebenfalls krank werden würde und dass der Hin- und Rückweg zu den Zelten seines Kontingents ein Marsch durch einen Alptraum war. Der Khan hatte befohlen, die Toten zusammenzutragen und zu verbrennen, aber das Lager war riesig, und es starben zu viele. Zudem wurde es immer schwieriger, Männer dazu zu bringen, die Leichen einzusammeln – die Sterberate unter den Totengräbern war geradezu grotesk hoch.
Um das Zelt des Khans herum brannten hochlodernde Feuer. Die Vorräte an dicht belaubten Lorbeerästen, die sonst nur für das Entzünden der Feuer verwendet wurden, um ihren Duft zu verbreiten, waren fast zu nichts zusammengeschmolzen, und doch stank es vor dem Zelt des Khan wie überall im Lager nach dem verkohlten Fleisch ihrer toten Kameraden. Die beiden Wachen standen vor dem Eingang. Hizyr Mahmud sah die Ersatzmänner unweit davon vor einem weiteren Feuer, bereits in voller Rüstung und Waffen. Sie schwiegen, jeder Sinn für die üblichen schlechten Witze und Sticheleien längst vergangen. Die Wachen waren ebenso wenig vor dem im Lager rasenden Tod gefeit wie alle anderen; wenn einer fiel, sprang sofort ein Ersatzmann ein, während die Leiche weggeschafft wurde. Niemals war das Zelt des Khans länger als ein paar Augenblicke von weniger als zwei stattlichen Kriegern bewacht.
Die Wachen nickten Hizyr Mahmud zu, als er ins Zelt trat. Für einen Augenblick blitzte die Erinnerung an das hässliche bleiche Gesicht des Übersetzers der Genueser vor ihm auf, der einen einzigen Blick mit ihm, Hizyr Mahmud, gewechselt hatte. Hizyr war der Offizier, der beim Khan gewesen war, als die Delegation eingetroffen war. Er hatte Djanibek die schlimme Nachricht überbringen wollen, bevor das Gespräch mit den Bewohnern von Caffa begann. Mittlerweile schämte Hizyr sich dafür, dass er einen Feind seine Angst hatte erkennen lassen.
Im Zelt des Khans waren bereits weitere Unterführer versammelt. Hizyr war der letzte, der eintraf. Als er eintrat, bellte Djanibek Khan gerade: »Wir vernichten die Hunde, zur Ehre Allahs und unseres großen Volkes.« Anscheinend hatte einer der anderen Unterführer vorher leisen Zweifel am Sinn ihres weiteren Verbleibens vor der Stadt geäußert.
»Gott ist groß«, murmelten Hizyrs Kameraden.
»Ich werde Caffa in meiner Hand zerquetschen und die Ungläubigen darin abschlachten«, sagte der Khan. »Ich bin zu lange gnädig gewesen mit ihnen – nun zerdrücken wir sie.«
Die Unterführer wechselten Blicke und nickten dann mit schlecht gespielter Begeisterung. Hizyr Mahmud setzte sich zwischen sie. Sie rückten nicht mehr von ihm ab, wie sie es in den ersten Tagen getan hatten, nachdem der Khan ihn wegen seiner zur Schau gestellten Unruhe beim Besuch der Delegation öffentlich gemaßregelt hatte. Es gab mittlerweile weitaus Schlimmeres, als den Eindruck zu erwecken, man trage die ungnädigen Gefühle des Herrschers gegen einen seiner Offiziere nicht mit.
Als Hizyr Mahmud kurz vor dem Eintreffen der Delegation gesehen hatte, wie drei seiner Männer spuckend und um sich schlagend gestorben waren, und als, noch während er fassungslos vor seinem Zelt gestanden hatte, plötzlich zwei weitere Krieger, die den Sterbenden versucht hatten beizustehen, zusammengebrochen waren, war er in völliger Panik zum Zelt des Khans gerannt. Er hatte versucht, ihn dazu zu bewegen, die Delegation zurückzuschicken und zuerst einmal festzustellen, ob im Lager der Goldenen Horde die Pest ausgebrochen war. Doch er hatte seinen Auftritt zeitlich schlecht abgestimmt. Während er mit Händen und Füßen auf den Khan einredete, hatte die Delegation schon das Zelt betreten. Es war nicht so, dass Hizyr Mahmud grundlos in Panik verfallen wäre: Er war schon einmal Zeuge gewesen, wie diese Krankheit zwei Familien aus über hundert Menschen innerhalb von vierundzwanzig Stunden dahingerafft hatte, bevor sie wieder abgeklungen war. Die Kranken hatten Blut gehustet; manche hatten rot entflammte Beulen in den Leisten und unter den Achseln entwickelt. Er wusste, dass die Goldene Horde einen Feind in ihrer Mitte hatte, der noch gnadenloser war, als es die Goldene Horde selbst jemals gewesen war.
»Wir müssen endlich den Hafen in unsere Gewalt bringen. Die Panzerreiter sollen ihn erobern, koste es, was es wolle. Meinetwegen sollen sie über die Körper ihrer toten Kameraden reiten, wenn sie nur den Hafen sichern.«
»Gott ist groß«, murmelten alle Unterführer außer Hizyr Mahmud und dem Mann, der den Oberbefehl über die Panzerreiter hatte.
»Hundertfünfzig Mann werden reiten«, sagte der Kavallerieoffizier.
»Das reicht nie, du Narr!«, brüllte Djanibek Khan.
»Natürlich nicht, Herr. Aber das sind alle, die noch am Leben sind. Oder es gestern Abend waren.«
»Ich hatte fünfhundert Panzerreiter!«, zischte Djanibek Khan.
»Dreihundertfünfzig Pferde warten auf einen neuen Meister, Herr.«
»Verflucht sei der Hafen! Dann muss es so gehen. Wir stürmen die Wälle mit dem ganzen Heer.«
Keiner antwortete. Hizyr Mahmud seufzte. Sein Kontingent bestand ausschließlich aus Fußsoldaten, Plänklern und Pionieren, die ersten und die gefährdetsten in jeder Schlacht. Er fühlte, dass er ein Recht hatte zu sprechen, und er wusste, dass alle darauf warteten, dass er es tat.
»Herr, es ist unmöglich«, sagte er mit niedergeschlagenem Blick.
»Wieso!?«, brüllte Djanibek Khan.