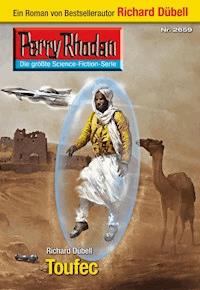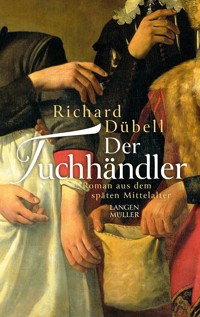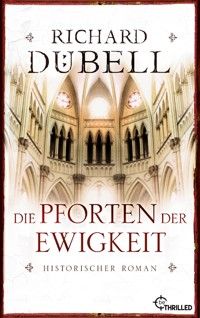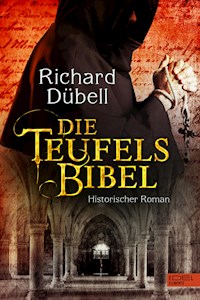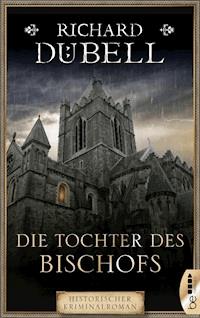4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Kampf um Leben, Tod und die große Liebe vor der Kulisse des mittelalterlichen Italiens
Florenz im 16. Jahrhundert. Lorenzo Ghirardi soll für einen wohlhabenden Kaufmann dessen zukünftige Schwiegertochter Clarice abholen. Doch seine Mission gerät zur Katastrophe: Am Treffpunkt findet er nur noch geplünderte Wagen, Tote und Verletzte. Sein Schützling wurde von einer Verbrecherbande entführt, dem berüchtigten "Wolfspack". Lorenzo weiß, dass er Clarice nur mit Hilfe einer List befreien kann. Er heuert als Söldner beim Wolfspack an und begibt sich damit in tödliche Gefahr ...
Weitere historische Romane von Bestsellerautor Richard Dübell bei beTHRILLED: Im Schatten des Klosters, Die Tochter des Bischofs und Krimis der Tuchhändler-Reihe.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungPrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51EpilogDanksagungÜber dieses Buch
Ein Kampf um Leben, Tod und die große Liebe vor der Kulisse des mittelalterlichen Italiens
Florenz im 16. Jahrhundert. Lorenzo Ghirardi soll für einen wohlhabenden Kaufmann dessen zukünftige Schwiegertochter Clarice abholen. Doch seine Mission gerät zur Katastrophe: Am Treffpunkt findet er nur noch geplünderte Wagen, Tote und Verletzte. Sein Schützling wurde von einer Verbrecherbande entführt, dem berüchtigten »Wolfspack«. Lorenzo weiß, dass er Clarice nur mit Hilfe einer List befreien kann. Er heuert als Söldner beim Wolfspack an und begibt sich damit in tödliche Gefahr …
Über den Autor
Richard Dübell, geboren 1962, lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Niederbayern und ist Träger des Kulturpreises der Stadt Landshut. Er zählt zu den beliebtesten deutschsprachigen Autoren historischer Romane. Seine Bücher standen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurden in 14 Sprachen übersetzt. Mehr Informationen über den Autor finden Sie auf seiner Homepage: www.duebell.de
Richard Dübell
Die Brautdes Florentiners
beTHRILLED
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2010/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Umschlaggestaltung: U1berlin / Patrizia di Stefano unter Verwendung von Motiven © shutterstock: photocell | Freedom_studio | DarkBird; © pixabay: 12019
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5402-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Walter Kurtz, Wolf Larsen und Mori Katsumoto,
und für jenen verzauberten Augenblick,
wenn die Morgensonne durch die Pappeln hindurch
die Nebelbahnen über den Dämmen vergoldet
und der Strom die Gedanken des Betrachters
mit sich nimmt bis zum Meer.
Prolog
Eine Botschaft, dachte der Abt. Aber nein … welche Botschaft könnte ich mir ausdenken, die wichtig genug ist, dass ich sie dem Heiligen Vater selbst überbringe? Wenn sie nicht plausibel ist, schickt er mich wieder zurück, und dann muss ich die verdammte Reise zweimal machen – wo es schon fraglich ist, sie auch nur einmal zu überleben … Vielleicht ein Geschenk?
»Man muss dem Heiligen Vater Bericht erstatten«, sagte die Äbtissin. »Vielleicht kann er das Leid unseres Landstrichs lindern.«
Ein Geschenk – aber was? Kirchenschmuck? Hier, Heiliger Vater, ich bin in eigener Person aus Parma angereist, um Euch diese schöne Monstranz zu bringen. Sie ist ein wenig angesengt, weil sie aus einer der vielen Kirchen stammt, die niedergebrannt worden sind … Der Abt schüttelte sich.
»In Rom hat man die schlimmen Gerüchte gehört«, sagte Bruder Girolamo.
Na klar, dachte der Abt. Papa Giulio Guerriero gehört ja auch zu denen, deren Armeen hier im Norden die Felder zertrampeln. Im gleichen Atemzug seufzte er in sich hinein: Ach, Rom!
»Deshalb hat man meine beiden Mitbrüder und mich hierhergeschickt, um uns umzusehen und Nachricht zurückzubringen«, sagte Bruder Girolamo. »Mit Ihrer Erlaubnis, ehrwürdiger Vater, ehrwürdige Mutter, möchte ich Ihnen gern berichten, was ich dem Heiligen Vater mitzuteilen habe.«
Rom, dachte der Abt. So weit weg von hier. So herrlich weit weg. War die letzte Armee, die Rom bedroht hat, die von Hannibal? Wie auch immer, das Beste, das man derzeit von Rom sagen kann, ist, dass die Stadt ein paar Tagesreisen von hier entfernt und ein ganzer Gebirgszug dazwischenliegt.
»Wir wissen, dass unsere Schäflein überall leiden«, sagte die Äbtissin. »Obwohl nur bruchstückhaft Neuigkeiten hinter diese Mauern dringen. Berichte uns, Bruder Girolamo.«
Ich muss irgendeinen Weg finden, nach Rom zu gelangen und so lange dort zu bleiben, bis der Wahnsinn sich hier gelegt hat, dachte der Abt. Nicht, dass ich damit rechne, in diesem Leben noch mal zurückzukommen. Dafür dauert der Wahnsinn schon viel zu lange.
»Vielleicht finden wir dann auch einen Weg, wie wir unserer Herde helfen können, was meinen Sie, ehrwürdiger Vater?«
Die Herde?, dachte der Abt. Die Herde ist nichts. Der Schäfer ist es, auf den es ankommt – Schafe gibt es überall. Wenn du willst, dann bleib hier, du alte Kogge, und behüte die verdammten Hungerleider, denen man das Dorf unterm Hintern weggebrannt hat. Lass dir von deinen dürren Weibern helfen, besonders von der Jungen da, die du zu unserem Gespräch mitgebracht hast und die mich schon die ganze Zeit anstarrt, als wollte sie mir in den Schädel gucken. Ich mache mich aus dem Staub, sobald ich einen guten Grund gefunden habe, nicht gleich wieder vom Heiligen Vater zurückgeschickt zu werden.
»Dem Schutz unserer Herde dient unser ganzes Trachten und unser Lebenszweck. Dafür sind wir auf der Welt«, sagte der Abt laut und nickte Bruder Girolamo gemessen zu. Dann schenkte er der jungen Klosterschwester ein väterliches Lächeln.
Er hatte keine Ahnung, dass Schwester Magdalena Caterina in seinen Gedanken lesen konnte wie in einem offenen Buch.
»Norditalien ist ein gesegnetes Land. Es heißt, dass Gottes Hand von jeher darauf liegt«, sagte die Äbtissin. »Wenn sie leicht darauf ruht, gibt es im richtigen Maß Sonne und Regen, Trockenheit und Überschwemmung, Anbauflächen und Wälder voll Niederwild, Straßen und schiffbare Flusswege, Gemüse und Kräuter im Frühling, Getreide im Sommer, Wein und Kastanien im Herbst.«
Und jenen mildsanften Nieselregen in blau verschwimmender Stille, die alles einhüllt und zur Ruhe bringt im Winter, dachte Schwester Magdalena. Die mein Herz aufschreien lässt, weil ich den Horizont nicht sehe und mich nur auf den Glauben verlassen kann, dass es jenseits des Nebels noch eine Welt gibt; weil das Leben im Winter noch zäher verläuft als sonst und ich jeden Tag Zeit habe, mir die Frage zu stellen: Wozu bin ich auf der Welt?
»Und wenn sie schwer darauf liegt«, fuhr die Äbtissin fort, »dann bringt sie Hitze und Kälte im Ungleichgewicht, verheerende Unwetter, Winterstürme, Überschwemmungen, Malaria und Ernteschädlinge und dann und wann einen Kaiser des Reichs, der entweder wie Friedrich Barbarossa die Städte niederbrennt oder wie Maximilian das Land als Exerzierplatz für seine Kriegstaktiken missbraucht.«
»Kriege kommen von den Menschen, nicht von Gott«, murmelte der Abt, der nur bruchstückhaft zum Gesprächsstoff fand und dessen andere Gedanken für Magdalenas besonderen Sinn durch die Luft wehten wie kleine panische Schreie: Rom! Ich muss hier weg! Rom! Es war nicht so, dass Magdalena tatsächlich Gedanken lesen konnte; aber die Wellen und Signale, die sie von manchen Menschen auffing, ließen sich deuten. Die Signale, die der Abt sendete, bedurften allerdings keinerlei Interpretation.
»Nicht von allen Menschen, ehrwürdiger Vater. Nur von denen, die sich auserwählt fühlen und Gottes Namen für ihr Werk missbrauchen«, sagte die Äbtissin. »Ob der deutsche Kaiser, der französische oder der spanische König – all die gesalbten Häupter, die ihre Armeen durch unser Land trampeln lassen!«
»Und doch sind das nur Schafe im Vergleich zu den Wölfen, die die Menschen aus purer Mordlust quälen«, erwiderte Bruder Girolamo mit seiner brüchigen, aggressiven Stimme und im toskanischen Dialekt.
»Welche Wölfe, Bruder Girolamo?«
»Die Söldner, ehrwürdige Mutter«, sagte Bruder Girolamo. »Die Mordhaufen. Die condottieri und ihre fleischgewordenen Monstren. Die Schwarze Schar!«
»Bruder Girolamo«, sagte der Abt, »berichte uns, was du erfahren hast, und lass nichts aus.«
Bruder Girolamo setzte sich zurecht. Er hatte ein blasses, nichtssagendes Gesicht, aber seine Gedanken waren eine Art weißer Flamme in Magdalenas besonderem Sinn; so wie die Signale, die sie vom Vater Abt spürte, kleine hektisch umherflatternde Vögel waren und die der Mutter Oberin ein unverständliches, unartikuliertes Geräusch, als würde jemand hinter einer dicken Mauer flüstern.
»Ich bin überzeugt, dass die Hand Gottes nicht schwer auf Norditalien ruht«, sagte Bruder Girolamo. »Sicher, die Menschen in diesem Land blicken zu Gott auf und fragen ihn: Warum folgt stets auf einen kurzen Sommer des Friedens ein langer Herbst des Mordens? Warum werden die Kinder, die die Fülle des einen Jahres ihnen geschenkt hat, in der Not des folgenden Jahres wieder abberufen? Es gibt zwei Antworten auf diese Fragen, ehrwürdige Mutter. Die eine ist theologischer Natur und könnte lauten, dass es vielleicht daran liegt, dass all die Gebete von den kleinen Flüssen zum Strom getragen und dort ins Meer geschwemmt werden, ohne Gott jemals zu erreichen.«
»Der Strom bringt den Segen, er nimmt ihn nicht mit sich fort«, hörte Magdalena jemanden sagen und stellte überrascht fest, dass sie es selbst gewesen war. Die Äbtissin warf ihr einen scharfen Seitenblick zu.
»Nun, so ist es hier«, sagte sie. »Wer auch immer festgestellt hat, dass Gottes Wege unergründlich sind, war vermutlich ein Piemonteser, ein Veneter, ein Lombarde … eben ein Norditaliener.«
»Ich komme aus den Bergen, Schwester«, sagte Bruder Girolamo. »Dort sind die Flüsse die, die unsere Felder unterhöhlen, unsere Brücken mit sich fortreißen, unsere Dörfer überschwemmen und die Frucht unserer Arbeit stehlen.«
»Der große Strom gibt uns mehr, als er nimmt.«
»Ja – Fieber, Schwüle, schwarze Gedanken …«
»Bruder Girolamo«, sagte die Äbtissin, »ich bitte dich, in deinem Bericht fortzufahren. Teile dein Wissen mit uns, die wir hinter diesen Mauern das Gefühl für die Weisheit derjenigen, die die Welt gesehen haben, zu verlieren drohen.«
»Die andere Antwort lautet … nun, ehrwürdige Mutter, Sie wissen, dass Norditalien von jeher den Neid all seiner Nachbarn erweckt hat. Sie zerren alle an diesem Land – sie halten sich für Jagdhunde, die einen geflohenen Hirsch aufgespürt haben, dabei sind sie schlimmer als Straßenköter, die sich um eine Ratte balgen. Und ich bitte um Verzeihung …«, Bruder Girolamo machte eine kleine Verbeugung in Magdalenas Richtung, die zwar nicht spöttisch aussah, aber die junge Nonne fühlte, wie sie gemeint war, »… wenn ich anmerke, dass die Ratte in diesem Fall halb verhungert ist. Die spanischen hidalgos und ihre Truppen sind verarmt, verblendet und allesamt syphilitisch, und sie liefern sich unwichtige, aber grausige Scharmützel mit den nur ein bißchen weniger verarmten, ein bißchen weniger verblendeten, aber mindestens genauso syphilisverseuchten französischen Generälen, wenn sich nicht beide Seiten ihrer Lieblingsbeschäftigung hingeben, nämlich ihre Krankheit emsig zu verbreiten.« Bruder Girolamos Gedanken loderten hell vor Zorn. In Friedenszeiten verbrennen in diesem Feuer Bücher, dachte Magdalena.
»Daneben geraten sich beide Seiten mit den deutsch-habsburgischen Landsknechtsheeren in die Haare, die noch ein bisschen verarmter, ein bisschen verrohter, ein bisschen skrupelloser sind.«
»Wenn auch nicht im gleichen Maß syphilitisch, was daran liegt, dass die deutschen Landsknechte ihre Huren aus der Heimat mitgebracht haben«, sagte die Äbtissin zornig. »So viel haben wir schon gehört!«
Aus dem Herzen des Abtes flog ein besorgter Vogel und trug die erschrockene Frage mit sich, ob die Magd, der der Abt letztens nach der Beichte Trost gespendet hatte, etwa von einem syphilitischen Spanier oder Franzosen geschändet worden war, sowie die Hoffnung, dass es ein deutscher Landsknecht gewesen sein mochte. »Fahr fort, Bruder Girolamo«, sagte die Äbtissin.
»Sie alle tragen ihre Schlachten auf den Feldern und in den Dörfern der Menschen in Norditalien aus«, sagte Bruder Girolamo. »Und wenn sich der Staub über dem Totenacker lichtet, kommen die Schlimmsten von ihnen heran, die Aasfresser, die struppigen, zerlumpten, hinterlistigen Wölfe – die Haufen der condottieri!«
In Magdalenas besonderem Sinn färbte sich die Flamme von Bruder Girolamos Gedanken dunkel. Das ist nicht wahr, dachte sie, während der Mönch ausholte und von Städten wie Venedig, Florenz oder Genua sprach, die zweihundert Jahre lang ihre Streitigkeiten mit käuflichen Söldnern ausgetragen hatten, damit ihre eigene Bevölkerung sich der lukrativeren Beschäftigung des Geldverdienens hingeben konnte. Nicht, dass die Laufbahn des condottiere selbst nicht auch lukrativ gewesen wäre … Sie erinnerte sich an die Geschichten, die ihr Großvater ihr in einer Ecke der streng nach Farbe riechenden Werkstatt erzählt hatte, wenn weder der Vater noch die großen Brüder Zeit hatten für das kleine Mädchen. Klingende Namen kamen ihr in den Sinn: Malatesta da Verrucchio, der spätere Herr von Rimini; Castruccio Castracane, Herr über Lucca; John Hawkwood, dem sie in Florenz ein Denkmal errichteten; Facino Cane de Casale, der eine byzantinische Prinzessin zur Frau gewann; Muzio Attendolo Sforza, dessen Söhne als Herzöge nach Mailand gingen – bis der französische König hundert Jahre später Mailand in seine Gewalt brachte –, und viele andere, die entweder Herzöge oder Bischöfe oder wenigstens reich wurden, indem sie nichts weiter taten, als mit ihrem Auftraggeber und dessen Feind gleichermaßen geschickt zu verhandeln, im Bedarfsfall die Seiten zu wechseln und im Übrigen dafür zu sorgen, dass die Schlachten, die ihre Männer gegeneinander führten, möglichst grandios und dramatisch aussahen, möglichst wenig Blut dabei vergossen wurde und vor allem möglichst wenig Besitz der Zerstörung anheimfiel. Der Schutz des Besitzes war es ja nicht zuletzt, der ihre Existenz begründete.
Und warum gibt es keine condottieri mehr?, fragte das kleine Mädchen in Magdalenas Erinnung, das die Antwort auf diese Frage längst kannte, aber den Redefluss des alten Mannes, auf dessen Knien es saß, nicht zum Versiegen bringen wollte. Sind sie alle gestorben?
Genau, pflegte Magdalenas Großvater zu sagen. Weil sie einen Ehrenkodex hatten. Weil sie ihm nicht untreu werden wollten. Und – unweigerlich und zu Magdalenas stillem Entzücken – glitten die Gedanken ihres Großvaters nach diesen Worten zuverlässig zurück in die Zeit, als die Werkstatt noch ihm gehört hatte. Als die condottieri, sobald sie den Franzosen, den Spaniern, den Deutschen, den Schweizern gegenüberstanden, ihre Champions vortreten ließen und den Gegner aufforderten, seine eigenen besten Kämpfer zum Duell heraustreten zu lassen, anstatt Tausende von Mann sich gegenseitig abschlachten zu lassen. Die condottieri handelten, wie es ihr Ehrenkodex vorgab – und sahen schockiert, wie ihre fähigsten Leute unter einem kurzen, brutalen Hagel von anonymen Pfeilen und Armbrustbolzen zusammenbrachen. Sie ließen ihre Reiterei und Fußsoldaten brüllend und singend und fahneschwenkend in die Reihen der Gegner hineinstürmen, die lediglich ihre Spieße auf dem Boden verankern, nach vorn senken und standhaft bleiben mussten, während die Angreifer sich selbst daran aufspießten. Sie ritten an der Spitze ihrer Männer in die Schlacht, und wenn sie röchelnd unter ihrem sterbenden Pferd lagen und ungläubig realisierten, dass sie von den langen Piken der Schweizer, den Pfeilen der Engländer, den Musketenkugeln der Franzosen und den Bolzen der Spanier zerfetzt worden waren und dass nicht ein gleichwertiger Anführer des Gegners sie besiegt hatte, sondern eine anonyme Gruppe von ungewaschenen Soldaten, die zufällig dort gestanden hatten, wohin sie galoppiert waren – wenn sie mit verlöschendem Blick zu dem Hügel hinübersahen, auf dem sich die Anführer des Gegners weit hinter den Kampfhandlungen aufhielten und ihr Sterben mitleidlos betrachteten, dann war es für das Eingeständnis zu spät, dass die Zeit irgendwie an ihnen vorbeigelaufen war.
»Malatesta da Verrucchio, Castruccio Castracane, John Hawkwood«, sagte Bruder Girolamo. »Verfluchte, mörderische Wölfe. Bartolomeo d’Alviano, Nicolo di Pitigliano – Raubtiere. Sie sind alle tot und jammern im neunten Kreis der Hölle um die Erlösung, die sie nie erhalten werden. Doch es gibt einen von ihnen, der immer noch sein Unwesen treibt – den schlimmsten von allen, den die anderen Todsünder nicht einmal in ihre Nähe gelassen hätten, wenn er dafür bezahlt hätte. Im Vergleich zu ihnen ist er nicht einmal ein Wolf, sondern ein Hund; aber ein entlaufener, streunender Hund, der zudem noch tollwütig ist. Er hat all die anderen streunenden, tollwütigen Hunde um sich gesammelt und zieht durch das Land: eine Bestie in Menschengestalt, ein Ungeheuer mit einem Herzen aus Hass, ein Teufel aus der Hölle, dessen Haufen um nichts weniger teuflisch ist als ihr Anführer.«
Magdalena spürte die Stille im Kapitelsaal. Die aufgescheuchten Gedanken des Abtes schienen plötzlich vor Schreck wie gelähmt zu sein. Im Herzen der Äbtissin hallte Schweigen wider, als hätten die hinter der undurchdringlichen Mauer gefangen gehaltenen Flüsterer erschrocken den Atem angehalten. Bruder Girolamo hatte hektische rote Flecken auf den Wangen und kleine weiße Schaumhalbmonde in den Mundwinkeln.
»Ich spreche von Konrad von Landau und seiner Schwarzen Schar. Man hat mir gesagt, dass, wenn man seinen Namen in einer Kirche ausspricht, die Glocken beben und das Weihwasser kocht. Im großen Dom von Piacenza hat der Herrgott am Kreuz blutige Tränen geweint, als die Gemeinde um Erlösung von diesem Teufel betete. Niemand weiß, wo er herkommt. Es heißt, die Hölle habe ihn ausgespuckt, weil er Luzifer selbst bedroht hat, und habe ihm so viele Dämonen zur Seite gestellt, wie er sich gewünscht hat, um die Christenheit zu terrorisieren. Es heißt, in ihm wohnt die verdammte Seele von Sulla dem Verräter, Julius Cäsar dem Eroberer, Theoderich dem Höllenreiter oder Attila der Gottesgeißel; er ist nicht menschlich oder hat vergessen, dass er einmal ein Mensch gewesen ist, er kann nicht in den Himmel gelangen und wird in die Hölle nicht eingelassen, eine wandernde Seele, ein Verdammter zwischen den Winden, schlimmer noch verflucht als der Mann, der den Herrn Jesus Christus auf dem Weg zur Schädelstätte nicht unter seinem Dach hatte rasten lassen, verlorener noch als Kain der Brudermörder. Wer ihn angreift, wird mit Blitz und Höllenfeuer zurückgeschlagen; wer ihm in den Weg kommt, wird zermalmt wie Ungeziefer unter den Klauen eines Drachen. Das ist Konrad von Landau und seine Schwarze Schar, ehrwürdige Mutter: eine Armee von Geistern, ein Heerwurm aus Hass – absolut mörderisch, absolut gnadenlos, absolut tödlich.«
Bruder Girolamo holte tief Atem.
»Dies ist die andere Antwort auf die Fragen der Menschen, warum sie leiden, ehrwürdige Mutter, und sie hat nichts Theologisches: Weil es die Schwarze Schar gibt. Und deshalb glaube ich auch, dass die Hand Gottes nicht schwer auf Norditalien lastet – denn wo Konrad von Landau und seine Armee sich nähern, zuckt selbst die Hand des Herrn zurück.«
Nach diesen Worten, die von den Wänden des Kapitelsaals zurückprallten und den Raum zwischend den Säulen füllten, dauerte das Schweigen lange. Die Äbtissin warf Magdalena einen Seitenblick zu, den diese nicht deuten konnte, aber nach der Zurechtweisung hatte sie ohnehin nicht vorgehabt, sich noch einmal in das Gespräch zu mischen.
»Es ist also nicht ratsam, die schützenden Mauern zum Beispiel des Klosters zu verlassen und über Land zu ziehen?«, fragte die Äbtissin zuletzt.
»Es ist lebensgefährlich.«
»Bruder Girolamo«, sagte die Äbtissin, »dich hat der Herr im rechten Augenblick zu uns geschickt. Ich weiß nun, wie ich mich verhalten muss, um meine Schäflein zu schützen.«
Sie lächelte Magdalena unerwartet an. Instinktiv horchte diese mit ihrem besonderen Sinn nach den Signalen der Äbtissin, aber wie gewöhnlich vernahm sie nur das unartikulierte Flüstern der eingesperrten Gedanken hinter ihren Festungsmauern.
Kapitel 1
Lorenzo setzte sich auf und überblickte das Lager. Seine Männer lagen wie formlose Deckenbündel im ersten Morgengrau. Das leise Schnarchkonzert war keinem Einzelnen zuzuordnen und schwebte über dem Platz wie die Rauchschwaden aus den glimmenden Resten des Feuers und der leise Dunsthauch. Lorenzo streifte seine eigenen Decken ab, stand auf und vollführte das übliche männliche Morgenritual: Gähnen, Strecken, Gliederschütteln, ausgiebiges Kratzen von Bauch, Gemächt, Gesäß und Gesicht (in dieser Reihenfolge), während die Verdauung sich bemühte, ihrer Pflicht mit melodischen Tönen nachzukommen; schließlich die Suche nach einem Platz abseits des Lagers, um die Gegend ein bisschen zu wässern. Erst nach Verrichtung all dieser Dinge fühlte man sich einem neuen Tag gewachsen.
Als Lorenzo zurückkam, waren die Ersten ebenfalls aufgewacht und saßen da, die Augen noch blicklos und die Münder weit aufgerissen. Lorenzo stapfte zu einem der unbeweglichen Deckenbündel hinüber und stupste es an, bis ein Gesicht zwischen den Falten zum Vorschein kam. Über Stirn, Nasenrücken und Kinn des Mannes zog sich eine frische Schürfwunde. Die Salbeiblätter, die Lorenzo gestern auf die Verletzung gedrückt hatte, sahen aus wie Schmutz unter dem über Nacht getrockneten Wundschorf. Lorenzo wusste, dass es kein Schmutz war; sie hatten die Besinnungslosigkeit Michèles genutzt und die Wunde sofort mit Wein und Urin ausgewaschen. Auf die spezielle Salbe, die sie für größere Verletzungen mit sich führten, hatten sie verzichtet – sie half, aber sie hätte selbst carrarischen Marmor blind geätzt.
»Alles klar, Michèle?« Lorenzo grinste.
»Der Schädel brummt noch, aber ich sehe nicht mehr doppelt«, sagte der Mann zwischen den Decken schwach.
»Ein Segen, wenn man bedenkt, dass du sonst Lorenzos holdes Antlitz zweifach sehen müsstest«, brummte der Mann, der neben Michèle hockte und gähnte. Er lächelte Lorenzo freundlich an. »Guten Morgen, capitano.«
»Das ist ganz allein Ihre Verantwortung, Ghirardi«, sagte Niccolò. »Wenn wir gestern weitergeritten wären, hätten wir unser Ziel noch erreicht. Ohne große Anstrengung.«
Lorenzo wandte sich zu seinem Truppführer um. Niccolòs Blick war unversöhnlich. Lorenzo hielt es für möglich, dass der Mann vor Ärger die ganze Nacht wachgelegen war.
»Wir hätten Michèle einfach liegen lassen können«, sagte Niccolò. »Wer nicht anständig reiten kann, ist selber schuld. Dann hätten wir den Treck gestern Abend noch erreicht.«
»So siehst du aus«, erklärte der Mann neben Michèle. »Einen Bewusstlosen, den sein Pferd abgeworfen hat, einfach neben der Straße liegen lassen, hilflose Beute für jeden Halunken.«
»So haben wir den Treck von monna Clarice hilflos am Treffpunkt auf uns warten lassen.«
»Hilflos, du meine Güte. Der holde Apfel ist mit mindestens genauso viel Mann Geleitschutz in Mailand aufgebrochen, wie wir hier sind, um sie nach Florenz zu bringen. Hilflos …«
Lorenzo, der inzwischen den Rest seiner Truppe geweckt hatte, hockte sich an die Feuerstelle und stocherte mit einem Ast hinein. Die Glut ließ sich leicht zum Feuer wiedererwecken. Er hängte den Kessel mit der dicken Mehlsuppe niedriger und spähte dann über ihn hinweg in die Weite. In Lorenzos Rücken erhoben sich die Hügel des Appenin, aber vor ihm und zu beiden Seiten war das Land flach wie eine Tischplatte. Dunst lag darüber und glänzte golden in den Strahlen der aufgehenden Sonne, der Himmel war eine weite, fliederfarbene Kuppel. Einzelne Kiefern standen wie die Masten von voll getakelten Schiffen, die über diese ebene Fläche eines zu Landschaft erstarrten gewaltigen Meeres trieben. So sehe ich dich wieder, dachte er. Und dabei hatte ich gehofft, es wäre damals ein Abschied ohne Rückkehr gewesen.
Er senkte den Blick und spähte in die erstarrten Schlieren der dicken Suppe, betrachtete den Ring aus Fettaugen, den das erkaltete Schmalz am Kesselrand entlanggezogen hatte, und wusste, dass er diesen Tag ohne warme Mahlzeit beginnen würde. Niccolò, der eifersüchtig auf Lorenzo und scharf auf dessen Posten als capitano des Hauses Bianchi war, ahnte nicht, dass Lorenzo es kaum weniger eilig hatte, zum Treffpunkt zu gelangen, die künftige Schwiegertochter ihres Herrn in Empfang zu nehmen und wieder nach Hause zu kommen. Es beschwerte die Seele eines Mannes, wenn er statt Brot und Suppe auf seinen Erinnerungen kaute.
»Etwas mehr Respekt vor der jungen Herrin, wenn ich bitten darf«, sagte Niccolò.
»Wenn sie erst mal die junge Herrin ist, werde ich ihr schon den nötigen Respekt erweisen. Bis dahin ist sie für mich ein holder Apfel wie die anderen Röcke auch, mit Kerngehäuse und allem.«
»Ich werde deine Bemerkungen Ser Domenico weitermelden, Pietro Trovatore!«
»O hab Erbarmen mit mir Armen«, sang Pietro und grinste über das ganze Gesicht.
Buonarotti tauchte neben Lorenzo auf und hängte den Kessel höher. »Du brennst alles an, capitano«, brummte er missmutig. »Das Zeug schmeckt ohnehin schon wie Pietros Leibhemd, da muss es nicht auch noch nach angebranntem Leibhemd schmecken.« Buonarotti begann mit einem geschälten Ast die Suppe umzurühren. Eigentlich hieß er Giuliano; seinen Spitznamen verdankte er seiner platt geschlagenen Nase, von der jemand vor langer Zeit behauptet hatte, sie sehe aus wie die Nase jenes schrulligen Bildhauers, dessen Zornesausbrüche ihn in ganz Florenz bekannt gemacht hatten, bevor er endlich nach Rom gegangen war. »Morgen, capitano«, sagte er. Buonarotti pflegte den Tag missmutig zu beginnen und ebenso zu beenden; dazwischen war er ungenießbar. Wenn Lorenzo seine Zuverlässigkeit in Gefahrensituationen nicht bekannt gewesen wäre und seine Kenntnisse in Wundheilung, hätte er sich gefragt, warum ihn die anderen Männer unter sich duldeten.
»Du musst es wissen, du hast es gekocht«, sagte Lorenzo und stützte sich auf Buonarottis Schulter, um aufzustehen. Er hätte die Stütze nicht gebraucht; Lorenzo Ghirardi war klein und sehnig und kannte die morgendliche Steifheit lediglich in ersten zarten Ansätzen; dennoch, die Zeit seiner Jugend lag hinter ihm. Definitiv, mein Held, dachte er und starrte wieder über die Ebene, durch die irgendwo weit entfernt im Norden der große Strom floss. Und hier ist der Ort, wo sie geblieben ist. Er klopfte Buonarotti auf den Rücken und trottete zu den Pferden hinüber. Er wusste es nicht, doch inmitten seiner Männer sah er aus wie ein magerer struppiger Wolf unter einer Horde von Wachhunden. Man sah sie an und wusste, sie konnten beißen; in Lorenzos Fall ahnte man, dass er beißen würde.
Nach der Morgenmahlzeit und nachdem sie das Feuer gelöscht und sich vergewissert hatten, dass keine Glut mehr darin war, stiegen sie auf ihre Pferde. Michèles Gaul zuckte beim ersten Schritt zusammen und lahmte dann gehorsam vorwärts. Lorenzo stieg ab und strich am Vorderbein des Pferds hinab; Pietro Trovatore gesellte sich zu ihm.
»Hat doch mehr abgekriegt, als es gestern den Anschein hatte«, brummte Lorenzo.
»Wird es gehen, capitano?«, fragte Michèle vom Pferderücken herunter. Er hing blass und krank darauf und versuchte, den Anschein zu erwecken, dass er sich auf die Fortsetzung ihrer Mission freute.
»Wenn er noch mal in ein Loch tritt, ist es sein Ende«, sagte Lorenzo.
»Und wenn du noch mal runter und auf deine Fresse fällst, deines auch«, sagte Pietro und zwinkerte Michèle fröhlich zu.
»Ihr seid alle meine Zeugen«, begann Niccolò. »Ich stelle ausdrücklich fest, dass Michèle unsere Mission gefährdet und Ghirardi, indem er sich meinem Rat, Michèle zurückzulassen, beständig und beharrlich widersetzt, obwohl ich ihn mit allem Respekt geäußert habe …« Er stellte fest, dass er den Faden verloren hatte, und endete: »Jedenfalls rufe ich euch alle zu Zeugen an.«
»Steck dir ’ne Rübe in den Mund, Niccolò«, sagte Pietro. »Am besten so tief, dass sie sich mit der Rübe in deinem Arsch trifft.«
»Ich lasse mir deine Frechheiten nicht gefallen, Pietro!«
»O hab Gnade, um mich wär’s schade«, sang Pietro.
Im Regelfall arbeiteten Lorenzo und sein Truppführer nicht zusammen; war Lorenzo als Geleitschutz für eine der Handelskarawanen unterwegs, sicherte Niccolò Haus und Hof ihres Herrn Domenico Bianchi in Florenz; im umgekehrten Fall hätte Lorenzo den Besitz seines Herrn bewacht, nur dass es den umgekehrten Fall nicht gab, weil Domenico Bianchi senior allen Menschen auf der Welt misstraute außer seiner vor fünf Jahren verstorbenen Mutter und Lorenzo Ghirardi. Niccolò hätte er nicht einmal im Traum mit der Sicherung einer seiner wertvollen Karawanen betraut. Dass Niccolò diesmal mit von der Partie war, lag an Domenico Bianchi junior, der darauf bestanden hatte, seiner zukünftigen Gattin jeden nur möglichen Schutz auf der Reise nach Florenz angedeihen zu lassen, und nicht davon zu überzeugen gewesen war, dass es in diesem Fall am besten gewesen wäre, Niccolò dort zu belassen, wo er sonst auch immer war, nämlich zu Hause.
Lorenzo schwang sich in den Sattel. »Langsamer Trab«, sagte er. »Wenn Michèles Gaul sich ein paar Meilen bewegt hat, wird die Schwellung zurückgehen. Der Treffpunkt liegt ein kleines Stück nordwestlich von Castelfranco. Länger als bis zum Mittag dürfte die Reise nicht mehr dauern.«
Er setzte sich an die Spitze seines Trupps und ritt in den beginnenden Morgen hinaus. Von Nordwesten bis Südosten hin erstreckte sich die Ebene des Po, begrenzt von der Horizont umspannenden Bergkette der Alpen: Reisfelder, auf die Ernte wartend, Obstbaumwiesen, vereinzelte Weinanbaugebiete, Gerste- und Haferinseln, baumbestandene Flächen, Wiesen … majestätisch durchzogen vom Po und seinen Nebenflüssen, akribisch durchkreuzt von Dämmen und Bewässerungskanälen, behütet von den fernen Kränzen der Alpenkette. Nach Süden erhoben sich die von Weitem harmlos scheinenden Hügel des nördlichen Appenin, durch deren Täler sie in den letzten zwei Tagen schweigend geritten und deren Kämme sie schwitzend erklommen hatten, ruhend auf einem Kissen aus Morgennebel und Dunst, vor allem aber ruhend in sich selbst. Die Vogelstimmen verkündeten schrill, dass es immer noch Sommer war, und verstummten nur kurz beim Vordringen der Männer. Aufgereiht auf und neben der Straße, die der alten Via Claudia folgte, lagen die Orte, die den letzten Teil ihrer Reise in übersichtliche Wegabschnitte eingeteilt hatten: Oberhalb von Bologna waren sie aus den Bergen gekommen, hatten sich nach Nordwesten gewandt, Zola Predosa nahe im Süden, Anzola fern im Norden.
Lorenzo versuchte vergeblich, die lässige Schönheit der Umgebung nicht auf sich wirken zu lassen. Florenz war herrlich, aber der Anblick der Natur in ihrer letzten Pracht vor dem Eintreffen des Herbstes war göttlich. Florenz war ein Wunder an Schönheit, das die Menschen geschaffen hatten, um die Natur auszuschließen. Die Landschaft, durch die er ritt, war ebenfalls von Menschen geschaffen worden, aber über Jahrhunderte und um mit den Früchten der Natur vereint zu leben. Selbst die ausgetretene Straße, die hindurchlief und deren Staub den Duft von trocknendem Gras, reifem Laub und verwehendem Dunst überdeckte, konnte daran nichts ändern. Daran nicht und nicht an den Bildern, die aus Lorenzos Geist emporstiegen, so unwillkommen sie auch waren. Er erinnerte sich an viele Morgende, die wie der heutige von den Sinneseindrücken des freien Landes um ihn herum und von den halb ernst, halb spöttisch gemeinten Sticheleien der Männer geprägt gewesen waren; sie waren vorbei, und wenn sie bisher – so wie jetzt – unerwartet in seine Seele zurückkehrten, dann hatte er stets gewusst, wie er sie wieder daraus verdrängen konnte. Sie gehörten zu einer anderen Zeit, zu einer anderen Person; zu einem anderen Leben. Anfangs, nach seiner Wiedergeburt, hatte er die Tage gezählt, dann die Wochen, schließlich die Monate: sechsunddreißig an der Zahl. Sechsunddreißig Monate in einem neuen Leben, die er gegen die ungezählten anderen aufrechnen konnte, die aus seiner Seele zu tilgen und für immer in sich abzutöten er sich vorgenommen hatte. Alles in allem war er schon recht weit damit gekommen. Namen verwehten, Gesichter verblassten, Geschehnisse verwirrten sich … die guten jedenfalls; die schlechten hatten eine Tendenz zum Überleben. Aber auch sie würde die Zeit ausradieren, jeder Tag, an dem er nicht an sie dachte, war ein Sieg, und es hatte doch den einen oder anderen solchen Tag gegeben in den letzten tausend. In der Tat, ich habe Glück gehabt, dachte Lorenzo und stellte im gleichen Augenblick fest, dass die Namen und Orte und Begebenheiten nur darauf gewartet hatten, bis er in die große Ebene zurückkehrte, um sich auf dem Pergament seiner Erinnerung wieder von selbst aufzufrischen.
Niccolò schloss auf.
»Die Männer reden«, sagte er mit einem Anstrich von mühsam errungener Vertraulichkeit. Lorenzo schwieg.
»Es geht um diese Ausgeburt der Hölle und seine Teufel«, fuhr Niccolò fort. Er spuckte aus und bekreuzigte sich dann. »Sie sollen hier in der Gegend gesichtet worden sein. Die Schwarze Schar. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was geschieht, wenn wir auf sie stoßen! Oder wenn sie monna Clarices Treck sichten. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns beeilen; nur deshalb. Wir sind erst wieder sicher, wenn wir zusammen mit der jungen Herrin zurück in den Bergen sind.« Er richtete sich im Sattel auf und gab sich den Anschein, besorgt in die Ferne zu spähen. »Die Schwarze Schar«, sagte er. »Niemand kann sie besiegen, niemand kann ihnen entrinnen. Wer ihnen in die Hände fällt, ist verloren. Sie nehmen den Zorn Gottes vorweg. Es heißt, ihr condottiere sei eine verdammte Seele und streife schon seit …«
»Mit mir haben die Männer noch nicht geredet«, erklärte Lorenzo.
Niccolò ließ sich im Sattel zurücksinken. Er presste die Lippen zusammen. Lorenzo betrachtete ihn aus dem Augenwinkel und empfand Widerwillen gegen Niccolòs weibische Mimik, mehr noch aber gegen seinen Versuch, seine eigene Furcht auf die Gruppe abzuwälzen. Niccolò wandte sich im Sattel um, auf der Suche nach einem anderen Thema, mit dem er Lorenzo beweisen konnte, dass dieser im Unrecht war.
»Michèle fällt zurück«, sagte er. »Nicht, dass ich deshalb Überraschung heucheln würde.«
»Weißt du, was den Menschen vom Tier unterscheidet?«, fragte Lorenzo. »Ein Tier kann nicht anders, als auf das zu reagieren, was es erlebt. Wird es angegriffen, flieht es. Wird es in die Enge getrieben, kämpft es. Läuft ihm eine saftige Beute vor die Fänge, frisst es. Ist es in der Brunft, pflanzt es sich fort. Ist seine Zeit gekommen, legt es sich hin und stirbt.«
»Mhm«, machte Niccolò, vergeblich bemüht, Lorenzos Ansprache zu folgen oder herauszufinden, ob sie als Angriff gegen ihn gemeint war.
»Der Mensch dagegen kann sich entscheiden. Er muss nicht fliehen, sondern kann verhandeln. Er muss nicht kämpfen, sondern kann seinen Gegner überlisten. Er muss nicht essen, sondern kann fasten, um seinen Geist zu klären. Er kann sogar über die Lust triumphieren.«
»Aber wenn seine Zeit gekommen ist, legt er sich hin und stirbt wie alle anderen«, sagte Niccolò, erfreut darüber, eine Lücke in Lorenzos Argumentation entdeckt zu haben.
»Nein«, sagte Lorenzo. »Er kann versuchen, seinem Tod einen Sinn zu geben.«
Niccolò schwieg beleidigt. »Warum erzählen Sie mir das Ganze, Ghirardi?«, fragte er schließlich.
»Weil ich möchte, dass du weißt, dass du dich stets entscheiden kannst.«
»Wofür? Umzukehren? Das würde Ihnen so passen!«
»Niccolò, mein Held«, sagte Lorenzo und lächelte seinen Truppführer an, »fürs Erste würde es schon reichen, wenn du dich dafür entscheiden könntest, zwei Meilen lang die Klappe zu halten.«
Er zügelte sein Pferd, wendete es und wartete neben der Straße darauf, dass Michèle aufschloss, um eine Strecke lang neben ihm zu reiten.
Kapitel 2
Votum stabilitas, dachte Schwester Magdalena. Eine Stimme in ihr drängte: Halte sie auf. Rette sie. Die Stimme war leise, doch es schien, als würde sie lauter werden, wenn man sie nur ließe.
Die Novizin kniete vor dem Altar der Klosterkirche auf dem Steinboden. Die Ordensschwestern standen in einem Halbkreis um sie herum: strenge Gesichter, beschattete Augen, grobe, abgearbeitete Hände, finstere Gestalten in den dunklen Kukullen, Trauervögel; Raben, die sich versammelten, weil sie das Aas witterten. Die Novizin war so blass wie der Tod und wagte die Augen weder zur Äbtissin noch zum Kruzifix zu heben, das mit groben Tauen an der Rückwand der Apsis befestigt war; ein krummes, knochenweißes Kreuz, das der Legende nach aus den beiden Hauptästen zweier Bäume bestand, die bei den Rodungsarbeiten während der Klostergründung genau an dieser Stelle entdeckt worden waren, an der Basis ineinander verschlungen zu einem Liebesknoten und in Schulterhöhe auseinanderstrebend, so die Form eines Gekreuzigten mit ausgebreiteten Armen nachahmend. Alle im Kloster außer Magdalena fanden das Kruzifix hässlich.
Die Liturgie näherte sich ihrem Höhepunkt – der zeitlichen Profess der jungen Novizin vor dem Altar.
Die Äbtissin stand vor der knienden jungen Frau wie ein vierschrötiger Racheengel in Schwarz, die Arme erhoben. Ihr Gesicht wirkte steinern. Die Lippen der Novizin bebten. Hinter der Äbtissin stand, klein und mager und zappelig wie immer, der ehrwürdige Vater Abt. Er war der Abt des benachbarten Mönchsklosters und eigentlich Vorsteher von San Paolo. Bei den Weihen der Novizinnen war er so überflüssig wie ein Hühnerauge, weil er die vorgeschriebenen Riten niemals zelebrierte, sondern stets der Äbtissin überließ – die jedoch die Jungfrauenweihe nicht selbst durchführen durfte, weil sie eine Frau war. Insofern war der Vergleich mit dem Hühnerauge nicht so weit hergeholt; seine Gegenwart schmerzte die Äbtissin, ohne dass sie etwas dagegen hätte unternehmen können. Die Signale der Panik, die er seit dem Gespräch am Vorabend aussandte, gingen in den Stimmen unter, die in Schwester Magdalenas Geist riefen.
»Sprich, Schwester Immaculata«, sagte die Äbtissin.
Natürlich hat die Kleine sich den Namen Immaculata ausgesucht, dachte Magdalena. Sie hatte um diese Namenswahl gewusst, kaum dass das Mädchen in ihre Obhut gegeben worden war. Manche Herzen waren nur zum Teil einsehbar, wie das Herz der Äbtissin; andere, wie das der Novizin – oder das des Abtes –, waren wie ein offenes Buch.
»Ich, Schwester Immaculata Veronica …«, begann die Novizin.
»Lauter, Schwester«, sagte die Äbtissin. »Jede in der Gemeinschaft soll dich hören.«
»Ich, Schwester Immaculata Veronica, lege zur Ehre Gottes und der Jungfrau Maria dieses Versprechen ab: Ich bin fest entschlossen, mich Gott zu weihen und zeit meines Lebens im Ordensstand der seligen Jungfrau und ihrem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, nachzufolgen.«
»Amen«, sagten die Schwestern. Die Äbtissin nickte. Zwei Schwestern, die erst vor kurzer Zeit die Profess abgelegt hatten, traten herbei und zogen Schwester Immaculata sanft die schwarze Kukulle über den Kopf, ordneten sie vorne und hinten und legten sie über der knienden Gestalt in elegante Falten – ein Detail, das Schwester Magdalena eingeführt hatte und von der Äbtissin mit einigem Grimm als unnütze Eitelkeit betrachtet wurde. Schwester Immaculatas Unterkiefer zitterte, doch es gelang ihr, die Tränen zurückzuhalten.
Anders als du bei deiner Profess, sagte die leise Stimme in Magdalenas Kopf. Aber das mag daran liegen, dass Schwester Immaculata Veronica, vormals Beatrice Casagrande aus Ferrara, Tränen der Freude zurückhält.
»Die selige Jungfrau und Gottesmutter Maria schütze und behüte dich«, sagte die Äbtissin.
Schwester Immaculata holte Atem.
Votum conversatio morum, dachte Magdalena.
»Ich gelobe den hier anwesenden Schwestern in ihre Hände und Schwester Giovanna Maria, meiner Mutter Äbtissin, für immer ein Leben in eheloser Keuschheit, Armut und Gehorsam, gemäß der Regel des heiligen Benedikt, dem Glauben des großen Bernhard von Clairvaux und der Lebensform des Ordens von Citeaux.«
Magdalena spürte eine leichte Berührung an der Hand und wandte den Kopf, während die beiden Schwestern den schwarzen Schleier brachten und gegen Schwester Immaculatas weißen Novizinnenschleier austauschten. Schwester Radegundis lächelte Magdalena verstohlen an. Ihre Augen glänzten, weniger aus Rührung denn aus Begeisterung dafür, dass auch sie bald Mittelpunkt dieser Feierlichkeit sein würde. Sie stand stolz aufrecht in der groben Novizinnenkutte, und Magdalena, deren Haltung sich ebenfalls deutlich von den runden Rücken der anderen Ordensschwestern unterschied, konnte nicht umhin zu bemerken, dass Radegundis selbst die unförmige Novizinnentracht wie eine Prinzessin trug. War nicht die heilige Radegundis Prinzessin gewesen, bevor sie sich für das Klosterleben entschieden hatte? Selten hatte ein Ordensname so gut gepasst. Mittelpunkt des Klosters zu sein, und sei es auch nur für die kurze Zeremonie der Profess – Magdalena konnte Radegundis’ Streben klar in ihrem strahlenden Gesicht sehen. Die Demut, die damit einhergehen sollte, die Bereitschaft zum Gehorsam und die Gewissheit, dass die Zeremonie nicht der Erhöhung diente, sondern den Eintritt in eine Welt aus Hingabe und Selbstverleugnung darstellte, konnte Magdalena nicht erkennen. Vielleicht verschloss Radegundis diesen Aspekt ihrer Begeisterung ja in einem Teil ihres Herzens, den Magdalena nicht sehen konnte.
»Der Herr Jesus Christus nehme dich an als seine Braut und fahre ein in dein Herz«, sagte die Äbtissin. Magdalena vernahm mit ihrem besonderen Sinn das leise Stöhnen der Verzückung, das Schwester Immaculata entschlüpfte. Plötzlich spürte sie, wie Übelkeit in ihr aufstieg. Sie musste den Blick von den weit aufgerissenen Augen Schwester Radegundis’ abwenden.
»Votum oboedientia«, flüsterte Schwester Radegundis.
»Ich stelle mich dieser Ordensgemeinschaft aus ganzem Herzen zur Verfügung, um durch die Gnade des Heiligen Geistes, im Vertrauen auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria und unseres seligen Vaters Bernhard von Clairvaux im Dienste Gottes und der Kirche zur vollkommenen Liebe zu gelangen«, stammelte Schwester Immaculata.
Die Äbtissin beugte sich vor. Magdalena beobachtete mit immer weiter aufsteigender Übelkeit, wie sie der jungen Schwester den Friedenskuss auf die Lippen drückte. Als die Äbtissin sich wieder aufrichtete, schwankte Schwester Immaculata.
»Was ist dein Streben, Schwester im Glauben?«, fragte die Äbtissin.
Der Welt zu entsagen und ein Leben in Demut und der Entsagung aller Lüste zu führen, dachte Magdalena. Sie hörte sich selbst vor wenigen Jahren die Formel sprechen und erinnerte sich, dass sie damals dieselbe Übelkeit verspürt hatte wie soeben. Das Gefühl verging nicht. Sie schluckte krampfhaft. Ihr Mund war sofort wieder voller Speichel, und ihr Magen hob sich. Warum jetzt?, dachte Magdalena panisch. Warum bei der ersten Profess, die einer ihrer Schützlinge ablegte? Warum so heftig?
»Der Welt zu entsagen und ein Leben in Demut und der Entsagung aller Lüste zu führen«, sagte Schwester Immaculata.
»Wer hat deine Liebe, Schwester im Glauben?«, fragte die Äbtissin.
»Die Ordensgemeinschaft und der Herr Jesus Christus, in dessen Bett ich eingestiegen bin.«
Etwas stieg brennend in Magdalenas Kehle auf; sie würgte es hinunter. Es schüttelte sie. Schwester Radegundis, die neben ihr stand, bemerkte nichts. Sie hatte die rechte Hand vor ihre Brust gehoben und die Finger ausgestreckt. Weiter vorn, unterhalb des Freskos im Kapitelsaal, vollführte Schwester Immaculata das Spiegelbild dieser Geste; die Äbtissin steckte ihr einen Ring auf den Ringfinger der rechten Hand. Magdalena hörte nicht, was die Äbtissin sagte. In ihren Ohren gellte ein Misston. Sie spürte kalten Schweiß auf Stirn und Oberlippe und wusste, dass sie es beim nächsten Mal nicht würde zurückhalten können. Und dann würde Schwester Immaculata sich an ihre Profess ständig als den Tag erinnern, an dem Schwester Magdalena Caterina, Ordensschwester seit dreizehn Jahren, Novizinnenmeisterin in San Paolo di Parma seit zwei Jahren und verantwortlich für ihren reibungslosen Übergang vom Noviziat zur Gemeinschaft, auf den Fliesenboden des Kapitelsaals gekotzt hatte.
Rette sie, hörte sie die Stimme in sich selbst rufen. Plötzlich verstand sie, dass sie die ganze Zeit über nicht richtig zugehört hatte. Die Stimme rief: Rette dich.
In ihrer Zelle kniete Magdalena auf dem Boden. Die Gebetsformeln waren längst in den Läufen ihrer Gedanken verloren gegangen, stattdessen hallten Fragen durch ihre Versenkung. Letzten Endes hatte sie weder den Fliesenboden verunreinigt noch Schwester Immaculatas Gelübde in sonst einer Weise gestört. In ihrem Herzen war sie dennoch erschüttert. Noch nie war ihr übel geworden, wenn sie Zeugin wurde, wie eine Mitschwester sich mit ihrem Gelübde an den Orden band – und heute … Es hatte auch nicht geholfen, dass sie sich vorgesagt hatte, es handle sich nur um die zeitliche Profess und Schwester Immaculata könne in den folgenden drei Jahren jederzeit in die Welt zurückkehren, bis sie sich mit der feierlichen Profess auf immer an die Gemeinschaft band: Sie hatte noch nie erlebt, dass eine Schwester während dieser Zeitspanne die Gemeinschaft verlassen hätte. Erst recht hatte es nichts geholfen, dass sie sich bewusst gewesen war, dass sie selbst, Schwester Magdalena Caterina, die neue Schwester Immaculata Veronica auf diesen Weg gebracht und ans Ziel geleitet hatte.
Als Beatrice Casagrande ins Kloster aufgenommen worden war, hatte Magdalena noch einmal einen Blick durch die kleine Klappe im Tor der Klosterpforte nach draußen geworfen. Mit der Erinnerung an das strahlende, verzückte Gesicht des jungen Mädchens hatte sie in das graue Antlitz eines Mannes geblickt, der die geschlossene Tür anstarrte. Eine ältere Frau stand neben ihm, verschlossen und mit stolzer Haltung. Die Casagrande waren erfolgreiche Kaufleute in Ferrara – die Äbtissin pflegte genaue Erkundigungen einzuziehen, bevor sie ein junges Mädchen als Postulantin aufnahm, und der Klostertratsch pflegte die Ergebnisse dieser Ermittlungen erfolgreich zu verbreiten. Beatrice war ihre einzige Tochter. Noch während Magdalena nach draußen gespäht hatte, hatte der Mann plötzlich die Fassung verloren, und er war in Tränen ausgebrochen. Sie hatte die Klappe leise geschlossen und gewusst, dass hier eine Tochter dem Vater das Herz gebrochen hatte.
Aber auch das war nicht der Grund für den Ansturm von Gefühlen, der sie im Kapitelsaal überwältigt und ihren Magen zum Rebellieren veranlasst hatte. Der Grund dafür lag ganz allein in ihr selbst.
Rette dich.
Sie versuchte, genügend Vernunft für ein sinnvolles Gebet zu sammeln: Herr, ich danke Dir, dass Du mir die Kraft gegeben hast, mich zum rechten Zeitpunkt selbst zu retten. Doch sie sprach es nicht aus. Wie konnte sie diese Worte zu ihrem Gatten senden, wenn sie bedeuteten, dass sie Ehebruch begehen wollte?
Wer hat deine Liebe?
… der Herr Jesus Christus …
Und wem hast du dein Gelübde gegeben?
… in dessen Bett ich eingestiegen bin.
Sie hörte das Räuspern vor der Tür. Als Magistra stand Magdalena eine eigene Zelle zu, um mit ihren Schülerinnen allein sein zu können, aber die Tür ließ sich nicht versperren. Magdalena versuchte, die verstörenden Gedanken in ihr wundes Herz zurückzudrängen. Eine Träne lief ihre Wange hinab; sie wischte sie mit einer wütenden Bewegung weg. Sie erwartete, dass Schwester Immaculata ihr für ihre Führung während der vergangenen zwölf Monate danken wollte, und mochte ihr ihren Tag nicht verderben.
»Wer ist da?«
»Isabella.«
Magdalena atmete ein. Sie kämpfte gegen die Versuchung, die junge Frau wegzuschicken, doch sie war ihr anvertraut, und ganz gleich wie sie sich fühlte, Schwester Magdalena Caterina würde einen ihr anvertrauten Schützling erst dann wegschicken, wenn sie dem Tod näher war als dem Leben.
»Schwester Radegundis Benedikta«, sagte Magdalena.
»Richtig«, sagte Schwester Radegundis Benedikta und trat ein. »Ich vergesse dauernd diesen neuen Namen.«
»Warum hast du ihn dir dann ausgesucht?«
Schwester Radegundis zuckte mit den Schultern. Magdalena seufzte.
»Man möchte eigentlich meinen, dass zehn Monate die Kraft hätten, alles Neue in Gewohntes zu verwandeln.«
»Ich darf mit«, sagte Schwester Radegundis. Ihre Wangen glühten noch stärker als während der Profess.
Magdalena wartete.
»Ich darf mit«, wiederholte die Novizin, und ihre Stimme überschlug sich vor Eifer.
»Wir wollen beten«, sagte Magdalena. »Knie hier an meiner Seite nieder. Gnädiger Herr Jesus Christus, wir danken Dir für Deine Güte, die Du uns auf allen Wegen erweist, für Deine Führung durch die Dunkelheit unseres Daseins und dafür, dass Du unsere Gebete erhörst. Heilige Maria Mutter Gottes, wir danken Dir für Deine Liebe und für Deine Fürsprache bei Deinem Sohn.« Und mit besonderer Betonung: »Heiliger Geist, wir danken Dir dafür, dass Du über die Menschen gekommen bist und ihnen die Macht verliehen hast, ihre Zungen in einer Weise zu steuern, die andere Menschen verstehen können. Amen.«
»Amen«, sagte Schwester Radegundis, ein wenig ruhiger, aber auch weniger beschämt, als Magdalena gehofft hatte.
»Wohin darfst du mit?«
»Wir geben Schwester Beatrice das Geleit nach Perugia.«
»Schwester Immaculata Veronica.«
»Ja, das habe ich ja gemeint.«
»Wohin?«
»Santa Giuliana di Perugia.«
»Und wir«, sagte Magdalena mit Betonung, »geben ihr das Geleit?«
»Novizinnen können doch nicht aus der Obhut der Magistra entlassen werden.«
»Es gibt derzeit nur eine einzige Novizin in diesem Gemäuer, und die kniet neben mir.«
»Ich!«, erklärte Schwester Radegundis strahlend.
»Lass den heiligen Geist in dein Herz, Schwester, und nutze seine Kraft, um deine Rede zu steuern.«
»Ich habe die Mutter Oberin gefragt, und sie hat gesagt …«
»Was hat sie gesagt?«
»Dass sie dich bitten lässt, sie im Kapitelsaal aufzusuchen, und dass ich dir nichts davon erzählen soll …«
»Wovon? Dass ich sie aufsuchen soll?«
»Nein!«, rief die junge Novizin und umarmte ihre Meisterin plötzlich so stürmisch, dass Magdalena vor Überraschung steif wurde. »Dass wir Abschied voneinander nehmen müssen! Ach, Schwester Magdalena, ich und die anderen hier im Kloster vermissen dich schon jetzt!«
Kapitel 3
Man konnte nicht behaupten, dass Clarice Tintori ihre Reise zu ihrem künftigen Bräutigam nicht mit angemessener Ausstattung angetreten hätte. Sie war in einem Hangelwagen mit schwingend aufgehängter Kabine gefahren. Das stämmige Fahrwerk und der Wagenkasten, dessen Rippen in einem schwungvollen Bogen von einer Längsseite zur anderen führten und genügend Raum darunter ließen, dass man sich im Inneren des Wagens aufrecht hinstellen konnte, ohne mit dem Kopf an das Planendach zu stoßen, waren durch ein kompliziertes Geflecht aus Ketten und Lederriemen verbunden, das die gröbsten Stöße abfing. Rippen und Flanken waren mit geschnitzten Ranken verziert, die sich rot von der dunkelgrünen Bemalung des Wagens abhoben und mit Goldfarbe erhöht waren. Selbst die Räder waren in der Mischung aus Grün, Rot und Gold bemalt. Die Plane, die den Fahrgastraum des Wagens verhüllte, war zart pastellfarben und schlug im leichten Wind wie ein ermatteter Vogel mit den Flügeln. Die Kissen, mit denen der Wagen ausgepolstert war, ähnelten der Ausstattung im Schlafgemach des Hauses Bianchi, und in Lorenzos Erinnerung stieg das Bild auf, wie monna Beatrice, die Herrin des Hauses, zwischen den Kissen gelegen und ihn aufgefordert hatte, sich danebenzulegen. Dass er der Aufforderung nicht gefolgt war, hielt Lorenzo für seine beste Tat der letzten Monate. Der Lohn für die gute Tat bestand in der eisigen Feindschaft Beatrice Bianchis.
Nicht nur die Ausrüstung des Brautzugs, auch der Geleitschutz war beeindruckend gewesen; mindestens sieben Männer in einheitlichen Farben, ausgerüstet mit Brustharnischen und Kesselhauben.
Lorenzo und sein Trupp betrachteten die Szene, die sich vor ihnen ausbreitete, mit unbewegten Gesichtern.
»Eine gute Stelle haben sie sich ausgesucht«, sagte Pietro. »Leicht zu verteidigen, mit dem Wäldchen und dem Landbruch im Rücken und der freien Ebene direkt vor sich. Da kann man gestern schon sehen, wer morgen kommen wird.«
»Was hat’s ihnen genützt?«, fragte Buonarotti.
Lorenzo richtete sich im Sattel auf und spähte zu der Stelle hinüber, an der Niccolò und ein weiterer seiner Männer standen, kleine Gestalten in der Ferne. Sie sahen das Lager des Brautzugs von einer anderen Perspektive ein; Lorenzo hielt es mit der Ansicht, dass zwei Paar Augen immer mehr sehen als eines. Einer der beiden, wahrscheinlich Niccolò, winkte mit wichtiger Geste zurück.
»Die Luft ist rein, wir können hinein«, sang Pietro Trovatore, weniger aus Überschwang denn aus Gewohnheit. Er schloss mit einem Misston und kratzte sich nachdenklich am Kinn.
Lorenzo winkte zurück und beobachtete, wie die beiden Männer in der Ferne sich in Bewegung setzten. Er nickte seinem Trupp zu. Der Brautwagen würde die Stelle sein, an der die Fährten beider Truppenteile zusammentreffen würden. Lorenzos Herzschlag war langsam und dumpf; es fiel ihm schwer, die unbewegte Miene aufrechtzuerhalten. Er spürte die Seitenblicke seiner Männer, aber er wusste, dass sie nichts sagen würden, solange er selbst keine Bemerkung zu der Situation vor ihnen machte – dazu hatten sie Niccolòs Sticheleien gestern Abend und heute zu deutlich vernommen.
Der Hangelwagen lag auf der Seite. Zwei der sechs Rippen über dem Wagenkasten waren gebrochen und reckten ihre zersplitterten Bruchstellen in die Luft. Das Fahrwerk, in seiner schwingenden Aufhängung aus Ketten und Gurten verrutscht, sah aus wie gebrochene Gliedmaßen unter einem zerschmetterten Körper. Die Kissen lagen um den Wagen herum, aus einigen von ihnen bluteten die Daunenfedern, die der Wind immer weiter verstreute. Federn tanzten über das Lager, punkteten das zusammengetrampelte Gras weiß, taumelten zwischen den reglosen Gestalten, die dicht nebeneinander in der Nähe des Wagens lagen, und wirbelten mit der Asche aus der erloschenen Feuerstelle um die Wette. In der Sonne blitzten die Rüstungsteile der Männer, als steckte noch Leben in den Körpern, aber Lorenzo bezweifelte, dass dies der Fall war.
»Wo ist der Trosswagen?«, brummte Buonarotti. Niemand antwortete. Die Frage würde sich entweder klären, wenn sie das Desaster vor ihren Augen genauer untersucht hatten, oder nie. Alle wussten, dass überdies eine andere Frage wichtiger war: Wo war Clarice Tintori? Die Gestalten auf dem Boden waren samt und sonders Männer in Harnischen – der Geleitschutz. Lorenzo spähte zu dem Wäldchen hinüber und fürchtete, dass er wusste, was sie dort vorfinden würden. Ihm war übel.
»Lange Reihe bilden«, befahl er. Der Trupp zog sich auseinander. Wer immer sie von der Ferne mit Pfeilen oder Armbrustbolzen angreifen wollte, hatte jetzt viele einzelne, sich bewegende Ziele. Keiner seiner Männer fragte ihn, wozu dieser Befehl nötig war, wo sie doch festgestellt hatten, dass sich im Lager nichts mehr regte. Sie dachten alle an das Wäldchen, das von außen uneinsehbar war. Wenn dort hundert Mann im Hinterhalt lägen, würden sie sie dennoch nicht sehen. Niccolò und sein Begleiter trabten eng nebeneinander heran. Lorenzo glaubte, Pietro Trovatore etwas singen zu hören, das die Wörter Idiot und tot enthielt, aber er ignorierte es. Alles, worauf er sich konzentrierte, lag vor ihm im freundlichen Licht der vormittäglichen Sonne.
Sie trafen vor dem umgestürzten Reisewagen zusammen. In Niccolòs Gesicht stritten Triumph darüber, dass seine Warnungen offenbar rechtmäßig gewesen waren, und Bestürzung über ihren Fund. Alle warteten schweigend, eine Hand am Zügel, die andere am Schwertknauf – bis auf Michèle, der seine Armbrust in der Rechten hielt und an seiner Seite herunterhängen ließ, von seinem Körper gedeckt. Er hielt einen Bolzen zwischen Zeige- und Mittelfinger und ließ ihn leise wippen. Lorenzo musterte ihn, und Michèle gab den Blick kurz zurück. Wenn es zu einem Angriff kam, würde Michèle wahrscheinlich nicht bei der Flucht mit den anderen Schritt halten können. Aber er würde mit seiner Armbrust Angreifer um Angreifer fällen, bis diese ihn erreicht hätten – oder bis Lorenzos Trupp in Sicherheit war. Lorenzo wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Wäldchen zu, versuchte das Blattwerk mit den Blicken zu durchdringen, versuchte festzustellen, ob sich etwas bewegte, und wenn, ob der Wind der Verursacher war oder ein Mann im Hinterhalt, der sich eine andere Position suchte. Die Vögel füllten die warme Luft mit Melodien, begleitet von den Grillen im Gras. Vom Wald her ertönte das beständige Sirren der Zikaden, dem nur der leichte Wind den Anschein von an- und abschwellender Lautstärke verlieh. Die Pferde von Lorenzos Trupp stampften, schnaubten oder versuchten, gegen die straffen Zügel anzugehen, um Gras zu rupfen. Die Stille, die sich hinter all diesen Geräuschen über die Szenerie wölbte und die bis zur tiefblauen Kuppel des Spätsommerhimmels hinaufreichte, schien sich langsam um die Männer herum zu drehen, als seien sie der Mittelpunkt eines gigantischen Musikmechanismus, dessen Musik darin bestand, ein vollkommenes Schweigen zu produzieren. Lorenzo lockerte den Sitz seines Schwertes. Er spürte, wie sich Pietro Trovatore und noch ein Mann – Franceschino der Barbier – neben ihn schoben. Das grelle Sirren der Zikaden setzte Lorenzos Schädelknochen in Schwingungen, bis es in seinem Kopf lauter schwirrte als in Wirklichkeit. Er war ziemlich sicher, was das Sirren bedeutete, aber er war auch sicher gewesen, dass eine Verspätung von einem Tag kein Problem darstellte.
Bei jeder Unternehmung gab es einen Moment der Wahrheit. Bei Geschäftsverhandlungen war es der Moment, in dem man ahnte, die Schliche des Verhandlungspartners durchschaut zu haben, es aber nicht genau wusste – und die Hand des Partners über dem Tisch in der Luft hing, darauf wartend, dass man einschlug. In Liebesdingen war es der Moment, an dem die kühle Schönheit, die die Gattin des Herrn war, einen einlud, zu ihr ins Bett zu kommen – und man sich dagegen oder dafür zu entscheiden hatte, wissend, dass jede Entscheidung einen in Schwierigkeiten bringen würde. Im Augenblick war es der Entschluss, abzusteigen und so zu tun, als seien alle Ankömmlinge völlig sorglos und man biete einem Bogen- oder Armbrustschützen gedankenlos seinen ganzen Körper zur Zielscheibe … und ihn damit herauszufordern, sein Hiersein preiszugeben. Lorenzos Rücken prickelte, während er ein paar lange Momente ohne Deckung herumstiefelte, ohne dass etwas passierte. Dann stieg Pietro ab, nach ihm Franceschino … dann Bernardo und Uberto … Buonarotti, mit dem Gesichtsausdruck äußerster Verdrossenheit … Das Gefühl, als liefe Ungeziefer über Lorenzos Rücken, verging. Dieses Mal hatte er recht gehabt: Wären Männer im Wald im Hinterhalt gelegen, hätten die Zikaden nicht gesungen.
»Niccolò, Maffeo, reitet einmal um den Treffpunkt herum – vielleicht hat sich jemand retten können und versteckt sich oder liegt verletzt irgendwo unter einem Busch. Versucht festzustellen, wie viele es waren, die den Treck überfallen haben, und wohin ihre Spuren führen.«
Maffeo zog am Zügel seines Pferdes – er und Niccolò waren die Einzigen, die noch im Sattel saßen –, doch Niccolò rührte sich nicht.
»Was ist mit dem Wagen?«, fragte er. »Wollen Sie nicht reinschauen, Ghirardi?«
»Alles zu seiner Zeit.«
»Ich warte, bis es so weit ist.«
Lorenzo spürte, wie die anderen darauf warteten, dass er Niccolòs Herausforderung annahm.
»Meinetwegen«, sagte er stattdessen. »Wir sehen zusammen nach. Steig ab. Maffeo, du und Buonarotti übernehmt die Patrouille.«
Als hätten sie es vorher miteinander abgestimmt, hatten sie sich dort versammelt, wo die Unterseite des Wagens aufragte. Das Holz war staubig und unbemalt, der Wagen breit genug, dass man nicht wirklich darüber hinweg- und ins Innere des Wagenkastens blicken konnte, wenn er so wie jetzt auf der Seite lag. Eine Bahn der Plane, mit der der Wind spielte, wehte über den Rand des senkrecht stehenden Wagenbodens, winkte ihnen, näher zu kommen.
»Das ist der Grund, warum der Wagen noch hier ist«, sagte Niccolò und deutete auf die gebrochene Vorderachse. Sie war lenkbar und hatte vermutlich nachgegeben, als der Kutscher zu fliehen versucht hatte. Lorenzo ging nicht davon aus, dass der Anführer des Trecks so unvorsichtig gewesen war, die Zugpferde auszuspannen. Die Ketten und Lederbänder, die die Tiere an der Deichsel gehalten hatten, pendelten träge herab. Eine der Ketten, die den Wagenkasten mit dem Fahrwerk verbunden hatten, war aus der Halterung gerutscht; sie schwang ebenfalls lose und klopfte von Zeit zu Zeit leise an die Unterseite des Wagens. Niccolò richtete sich auf und zögerte, um den Wagen herumzugehen. »Also haben sie nur die Pferde mitgenommen. Und den Trosswagen.« Er warf Lorenzo einen Blick zu.
»Nach dir«, sagte Lorenzo und wies mit einer scheinbar höflichen Geste um den Wagen herum.
Niccolò straffte sich und kletterte über die Deichsel. Lorenzo folgte ihm auf dem bequemeren Weg außen herum. Niccolò starrte den umgekippten Wagen an. Die Plane war an den Rippen festgehakt und nur dort über dem Innenraum zusammengefallen, wo die Rippen zerborsten waren. An den Stellen, an denen man ins Innere blicken konnte, waren weitere Kissen zu sehen und der blanke Boden des Wagenkastens. Etwas hatte den Boden an einer Stelle nass und dunkel gefärbt. Niccolò sah sich zu Lorenzo um und dann zu den anderen, die bei der Deichsel warteten, als hätte ihre Auseinandersetzung ausschließlich ihnen beiden das Recht verliehen, den Wagen zu untersuchen. Mit einem kleinen Winseln zog Niccolò die Plane beiseite. Der Wagen war bis auf die verstreuten Kissen leer.
Lorenzo fuhr mit dem Finger über die feuchte Stelle und schnupperte. »Wein«, erklärte er. Dann atmete er langsam aus. Er hatte nicht angenommen, dass sie im Wageninneren die Leiche von Clarice Tintori finden würden. Wenn überhaupt, würde sie im Wald sein … wenn überhaupt. Die Angreifer hatten nur das mitgenommen, was sich leicht transportieren ließ: Decken, aber nicht die Kissen; den unversehrten Trosswagen, aber nicht den ungleich wertvolleren, defekten Reisewagen. Lorenzo fragte sich, ob der Zweck des Überfalls das Beutemachen gewesen war oder etwas anderes.
»Sehen wir im Wald nach«, sagte er schließlich. »Niccolò, Pietro, stellt fest, ob die Männer dort jenseits aller Hilfe sind oder ob noch einer lebt – und wie kalt sie sind, damit wir eine Ahnung davon bekommen, wann der Überfall stattgefunden hat. Die anderen kommen mit mir.«
»Der Überfall geschah in der Nacht, capitano, denkst du nicht?«, sagte Pietro.
»Sieh dir das Feuer an. Es ist ordentlich gelöscht. Wenn sie nachts überfallen worden wären, hätte es unbeachtet weitergebrannt, bis nur noch Asche übrig gewesen wäre.«
Pietro stapfte hinüber und trat die halb verkohlten Äste und Holzstücke auseinander. Asche wallte auf und hüllte ihn ein. »Ein bisschen Glut ist noch da. Kann noch nicht allzu lange her sein.«
»Das ist alles Ihre Schuld, Ghirardi«, erklärte Niccolò. »Ser Bianchi wird Sie zur Rechenschaft ziehen.«
Ausnahmsweise fühlte Lorenzo sich mit seinem Truppführer einer Meinung. Er schwang sich aufs Pferd und galoppierte die wenigen Hundert Fuß zum Waldsaum hinüber, ohne darauf zu warten, dass sich ihm der Rest seiner Truppe anschloss.
Das Waldstück erwies sich als niedrig und verfilzt, das Spiel von Sonne und Schatten auf seinem Boden ein Albtraum für jeden, der etwas zu finden versuchte oder immer noch nicht völlig ausschließen konnte, dass Angreifer im Hinterhalt lagen. Es war warm und beinahe stickig unter den Bäumen, der Duft von Harz, Kiefernnadeln und trockenem Laub jenseits der Schwelle, an der er anregend wirkte. Den Landbruch weiter vorn verriet ein heller Streifen Himmel, in den die Wipfel der am Fuß des Abbruchs wachsenden Bäume ragten. Lorenzo hielt seine Männer zurück, als er die unterdrückten Stimmen vernahm, die von unten herauftrieben. Er legte sich auf den Bauch und kroch die restliche Strecke bis zur Kante des Abbruchs, schob seinen Kopf darüber und spähte nach unten. Sie hatten keine Spur von Clarice Tintori gefunden, noch nicht einmal einen Kleiderfetzen, der darauf hingewiesen hätte, dass sich Lorenzos anfängliche Befürchtung, die Angreifer hätten sie in den Wald gezerrt und sich an ihr vergangen, bewahrheiten könnte.
Was immer man monna Clarice angetan hatte, im Wald war es nicht geschehen.
Der Landbruch stellte sich als die scharfe Kante einer Art gewaltigen Erdrutschs dar, als hätte sich unter dem Boden eine weite Höhle befunden, die irgendwann eingestürzt war. Vom Fuß des Abbruchs zog der Boden sich sanft in die Höhe, bis er weit jenseits der Bruchkante das hiesige Niveau wieder erreichte. Die Bruchkante zog sich etliche Hundert Fuß links und rechts von Lorenzos Standort weiter, bis sie sich in völlig undurchdringlichem Unterholz verflachte. Sie ging senkrecht fünf oder sechs Mannslängen nach unten und endete in einem breiten Streifen schartiger Felsen und Gerölls, das sich dort aufgehäuft hatte und keinen Bewuchs zuließ außer Flechten und kleinem Gesträuch, das aus den Zwischenräumen wucherte. Zwei Männer waren dort unten damit beschäftigt, den reglosen Körper einer Frau an ein Tau zu binden, das von einem der Bäume an der Abbruchkante nach unten führte, nur knapp außerhalb der Reichweite Lorenzos. Lorenzo starrte nach unten und merkte erst, dass er den Atem anhielt, als das Blut in seinen Ohren zu rauschen begann.