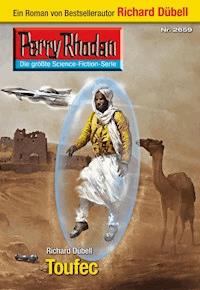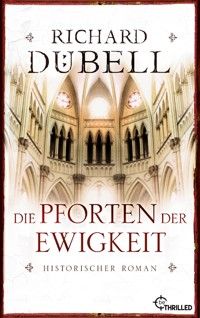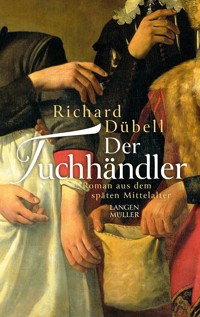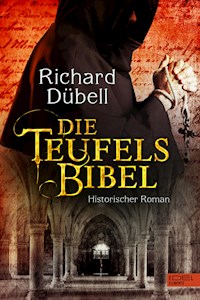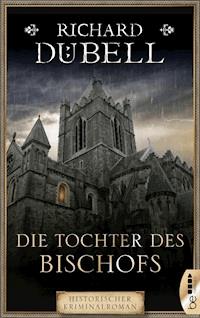4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter Bernward
- Sprache: Deutsch
Peter Bernward in seinem größten Abenteuer
Krakau, 1486. Der Tuchhändler Peter Bernward führt mit seiner Lebensgefährtin Jana Dlugosz in deren Heimatstadt ein beschauliches Familienleben. Doch die Ruhe währt nicht lange: Als Bernward versucht, einem befreundeten jüdischen Bankier zu helfen, sticht er in ein Wespennest. Die antijüdische Stimmung in Krakau heizt sich auf, und es kommt zu Ausschreitungen. Als auch Janas Adoptivsohn Paolo in Gefahr gerät und nur mit knapper Not entkommt, wird Bernward bewusst: Das Feuer leckt bereits an dem Pulverfass, auf dem sie alle sitzen ...
Weitere historische Romane von Bestsellerautor Richard Dübell bei beTHRILLED: Im Schatten des Klosters, Die Tochter des Bischofs und Die Braut des Florentiners.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Dramatis Personae
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Epilog
Ein neuer Anfang
Nachwort
Quellen
Über dieses Buch
Peter Bernward in seinem größten Abenteuer
Krakau, 1486. Der Tuchhändler Peter Bernward führt mit seiner Lebensgefährtin Jana Dlugosz in deren Heimatstadt ein beschauliches Familienleben. Doch die Ruhe währt nicht lange: Als Bernward versucht, einem befreundeten jüdischen Bankier zu helfen, sticht er in ein Wespennest. Die antijüdische Stimmung in Krakau heizt sich auf, und es kommt zu Ausschreitungen. Als auch Janas Adoptivsohn Paolo in Gefahr gerät und nur mit knapper Not entkommt, wird Bernward bewusst: Das Feuer leckt bereits an dem Pulverfass, auf dem sie alle sitzen …
Über den Autor
Richard Dübell, geboren 1962, lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Niederbayern und ist Träger des Kulturpreises der Stadt Landshut. Er zählt zu den beliebtesten deutschsprachigen Autoren historischer Romane. Seine Bücher standen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurden in 14 Sprachen übersetzt. Mehr Informationen über den Autor finden Sie auf seiner Homepage: www.duebell.de
RICHARD DÜBELL
DER SOHN DESTUCHHÄNDLERS
beTHRILLED
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schluck GmbH, 30827 Garbsen
© 2006/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: U1berlin / Patrizia di Stefano unter Verwendung von Motiven © shutterstock: photocell | LadyMary | blueeyes | PHET THAI
eBook-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-5399-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Michaela, die mich auf die Idee brachte,
für Schorsch, der mich drängte, sie weiterzuverfolgen,
und für Peter, der sie durchzustehen hatte.
Wir sehen durch einen Spiegel ein dunkles Bild.
1 Ko 13,12
Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel,
die sprach zu den sieben Engeln: »Geht hin und gießt die sieben
Schalen mit dem Zorn Gottes über die Erde!«
Offb. 16,1
DRAMATIS PERSONAE
PETER BERNWARD
Der Kaufmann versucht zu viele Bälle in der Luft zu halten
JANA DLUGOSZ
Peters Gefährtin sucht nach dem Geschäft ihres Lebens
PAOLO DLUGOSZ
Janas und Peters Adoptivsohn steht vor einem neuen
Lebensabschnitt
DANIEL BERNWARD
Peters Sohn hat seinen Kirchenbau zurückgelassen
und bereut es
SABINA HANGENOR
Peters älteste Tochter glaubt ihrem Vater kein Wort
MOJZESZ FISZEL(historisch)
Der Hofbankier des Königs hat ein Geschenk für seinen
Herrn
FRYDERYK MIECHOWITA
Der polnische Kaufmann fühlt sich bei Jana wie zu Hause
FRIEDRICH VON RECHBERG
Der Münzmeister des Landshuter Herzogs verzweifelt an seiner Mission
SAMUEL BEN LEMEL
Dem Schnitzergesellen ist sein Ruhm zu Kopf gestiegen
ZOFIA WEIGEL
Es wäre besser gewesen, sie und Samuel wären sich nie begegnet
JULIUS AVELLINO(angelehnt an die historische Figur des heiligen Johannes Capistrano)
Was immer alle anderen haben oder tun, Avellino missfällt es, und er predigt dagegen an
VEIT STOSS(historisch)
Der Bildschnitzer macht sich unsterblich
LAURENZ WEIGEL
Deutscher Kaufmann, christlicher Ratsherr und Zofias Vater
JOSEPH BEN LEMEL
Jüdischer Kaufmann, Judenrat und Samuels Vater
LEWKOBEN JORDAN
Ältester des Judenrates
REBECCA FISZEL
Mojzesz Fiszels Ehefrau
SALOMON SCHLOM
Pfandleiher, eigentlich Goldschmied
PROLOG
»… weißt so gut wie ich, dass es nicht mit mangelnder Liebe zu dir zu tun hatte, dass ich dich in all den Jahren nie um deine Hand gebeten habe; sondern einzig und allein mit meiner Angst davor, dich dann wieder zu verlieren, so wie ich Maria verloren habe. Ich habe diese Angst jetzt überwunden, Liebste, ich habe mir von König Kasimir die Erlaubnis geholt, und mit diesem Brief möchte ich dich jetzt bitten, meine …«
Einziger lesbarer Teil eines verbrannten Briefes, der in einer verkohlten Schatulle im Haus von Jana Dlugosz gefunden wurde.
»WIE VIELE?«, fragte der Zunftmeister.
»Vier«, sagte der Stadtknecht und spuckte aus. »Das ist eine Arbeit für den Totengräber, nicht für unsereinen. Ah!« Er wischte sich die Hände an seinem Wams ab, als er erkannte, dass sie von den Toten schmierig waren. »Schlimmer verbrannt als der Fraß, den meine Alte mir jeden Tag auftischt.«
Der Zunftmeister war geduldig. »Kennst du die Toten?«
»Ein alter Kerl, ein junger Kerl und zwei Weiber. Ansonsten – kannst du im Braten noch die Sau erkennen, die der Braten mal war? Du kannst sie dir gern selber anschauen, wir haben sie da drüben hingelegt.«
Der Zunftmeister seufzte. »Dann fragen wir mal in der Nachbarschaft herum. Oder gibt es irgendwelche Überlebenden, die hier herein gehören …?«
KAPITEL 1
25. Tag des Lenzmonats, 1486 A.D.
Verkündigung des Herrn
Judex crederis esse venturus
In te, Domine, speravi
Non confundar in aeternum
Salvum fac populum tuum
Judex crederis
»GOTT DER HERR BLICKT AUF DIESE STADT«, brüllte der Mönch. »Und Gott WEINT!«
Die Anzahl seiner Zuhörer war beträchtlich. Er stand in taktisch günstiger Position gleich außerhalb des Hauptportals der Sankt-Andreas-Kirche mitten in der Vorstadtgasse, und alles, was es gebraucht hatte, um die Zuhörermenge zu bannen, waren ein paar Dutzend Neugierige, die stehen blieben und die Eingänge der nächstgelegenen Gassen verstopften. Dafür, dass es Neugierige gab, hatte der Mönch gesorgt: Er stand auf einer schwankenden Staffelei, die von zwei Chorknaben aus dem Dom nur mangelhaft stabilisiert wurde; und als die ersten Messbesucher ins Freie gestrebt waren, hatte er sich die Kutte bis zum Bauchnabel aufgerissen und laut zu kreischen begonnen wie einer, der auf dem Scheiterhaufen steht und merkt, dass das Ganze kein Spaß mehr ist.
Die Leute blieben stehen und gafften. Die Nachfolgenden strömten aus der Kirche und drängten die Gaffer beiseite, aber da diese ihr Recht zu gaffen behaupteten und sich gegen den Andrang wehrten, wurde aus der Menge bald ein unentwirrbarer Knäuel Leiber, der Schimpfwörter und Flüche absonderte und ganz allgemein die Energie für eine baldige Prügelei ansammelte.
Friedrich von Rechberg und ich waren mittendrin.
»Das muss dieser Kapuzinermönch aus Italien sein«, schrie ich Rechberg ins Ohr. »Er hat sich durch das ganze Reich bis hierher gepredigt und soll seit einer oder zwei Wochen beim Kardinal leben. Fryderyk Jagiello hat scheinbar einen Narren an ihm gefressen.«
»Und was predigt er?«, schrie Rechberg zurück.
»Die frohe Botschaft der Christenheit …«
»Gott der Herr WEINT bittere TRÄNEN!«, donnerte der Mönch.
Die Gesichter der Menschen um uns herum wirkten in der Mehrzahl ungeduldig. Die meisten wandten die Köpfe, um nach einem Ausweg aus der Menge zu suchen; ein paar Glückspilze am Rand schafften es, sich abzusetzen. Sie hatten bis gerade eben eine Stunde lang den Rücken des Priesters der Sankt-Andreas-Kirche betrachtet, dessen Eigenart es war, die Messe flüsternd zu halten und selbst die Wandlung mit so sparsamen Bewegungen auszuführen, dass ein unaufmerksamer Beobachter ihn für eine lebensgroße Heiligenfigur halten konnte – sie hatten, selbst wenn sie mir in all den Jahren meines Hierseins gläubiger und ernsthafter erschienen waren als die Bewohner der Städte des Deutschen Reichs, für heute einfach genug von unverständlichen Predigten.
»Wieso spricht der Bursche in Latein?«, fragte Friedrich von Rechberg. »Ich dachte, hier spricht man entweder deutsch oder polnisch?«
»Auf Latein hört sich selbst Gegeifer edel an.«
»Der Herr SIEHT die gottesfürchtigen Menschen in dieser Stadt«, schrie der Mönch. »Er SIEHT die fleißigen Handwerker, von deren Tagwerk die Gassen widerhallen; er SIEHT die treuen Schreiber, die den Reichtum des Landes aufzeichnen; er sieht die kräftigen Baumeister, die den Ruhm der Stadt in Stein meißeln und in die Höhe bauen; er SIEHT die ehrlichen Dienstboten und die tapferen Scharwächter und die eifrigen Gesellen und die besorgten Betbrüder und die aufopferungsvollen Magister an der Universität und ihre klugen Studenten …«
»Komm zur Sache!«, rief jemand in der Menge, der den Prediger offenbar verstand. Spärliches Gelächter ertönte. Den meisten war nicht klar, worauf der Schreihals anspielte.
»Schmeißt ihn von der Leiter!« Jetzt kamen die Zwischenrufe auf Polnisch und ernteten bedeutend mehr Aufmerksamkeit im Publikum. Die deutschsprachige Oberschicht verschmähte die Sankt-Andreas-Kirche, wenn es darum ging, sich mit Gott in Verbindung zu setzen; sie hing der Ansicht an, dass Gott sie in der Marienkirche besser vernahm. Wer hierher zum Beten kam, gehörte zu den Handwerkszünften oder zum Dienstpersonal in den Häusern der ausländischen Gesandten im südlichen Teil der Vorstadtgasse und war von reiner polnischer Abstammung.
»Oder hängt ihn daran auf.«
»Dann hätten wir wenigstens eine Entschädigung!«
Noch lauteres Gelächter.
»Wenn du bis zum Mittag nicht fertig bist, tun wir’s!«
»Eine Entschädigung wofür?«, fragte Rechberg.
»Die Hinrichtung auf dem Marktplatz«, sagte ich.
»Ah ja … der Gesetzlose, der die Tochter des Kürschners geschändet und erschlagen hat …«
»Ein Bettler«, sagte ich. »Es war ein Bettler. Einer der Gesellen bot ihm etwas zu Essen an, wenn er für ihn eine Weile das Leder walken würde. Der Geselle hatte nämlich Sehnsucht nach seinem Liebchen in der Stadt und brauchte eine Ablösung. Der Bettler setzte sich also hin und bearbeitete das Leder; da kam eine der Mägde des Kürschners in die Werkstatt, sah den Fremden und begann ihn zu beschimpfen und nach der Wache zu rufen. Der Bettler versuchte sie zum Schweigen zu bringen, doch als er ihr den Mund zuhalten wollte, schlug sie ihn mit dem Steinguttopf über den Schädel, den sie bei sich trug. Er stieß sie von sich, und sie fiel mit dem Hintern ins Feuer und begann jetzt WIRKLICH zu brüllen. Die Nachbarn stürzten herein und sahen den Bettler, dem das Blut von der Stirn lief, über die Magd gebeugt, deren Hinterteil qualmte … wie hätten sie das wohl deuten sollen?«
»Meine Güte«, sagte Rechberg. »Das ist ihm zum Verhängnis geworden?«
»Nein, das noch nicht. Der arme Teufel gab Fersengeld. Auf die Straße hinaus konnte er nicht, da standen die Nachbarn. Da stürzte er die Treppe hinauf ins Obergeschoss, platzte blindlings durch die nächste Tür und erwischte die Weiberschlafkammer, wo die Frau des Handwerkers gerade ein Kleid anprobierte, um es zu ändern. Die Alte schrie sofort: »Vergewaltigung!« und ließ das Kleid fallen, um im Hemd auf den Bettler loszugehen und ihn mit der Elle zu verdreschen. Er versuchte zum Fenster rauszuspringen. Die Alte ließ nicht ab von ihm, und …«
»… da hat er die Tochter gepackt und auf sie eingeschlagen.«
Ich sah Friedrich von Rechberg an. »Nein, die war gar nicht im Zimmer. Er kriegte das Fenster nicht auf und raste wieder zur Tür hinaus, wo die Nachbarn gerade die Treppe heraufkamen und die kreischende Alte verstärkten. Jetzt suchte er sein Heil auf der Flucht ins Dachgeschoss, die Nachbarn und die Kürschnermeisterin immer hinterher. Im Dachgeschoss war die Ladeluke im Giebel geöffnet, und der Bettler rannte darauf zu und …«
»… die Tochter stellte sich ihm in den Weg, und er warf sie hinaus, und sie zerschmetterte unten in der Gasse.«
»Wollen Sie’s nun hören oder nicht?«
»Entschuldigung«, sagte Rechberg.
»… alles Betteln um VERGEBUNG wird nichts nützen, wenn der Zorn des Herrn die Gottlosen richtet. DIES IRAE, sage ich euch, DIES IRAE …!«
»Also, der Bettler sieht, dass eine Ladung am Galgen hängt. Er weiß nicht, wie groß sie ist oder wie sicher der Galgen, aber hinter ihm schreien sie schon nach seinem Blut. Er tut das, was er für seine einzige Überlebenschance hält – er springt ins Leere hinaus und greift nach dem Tau! Er sieht, dass eine Ladung Lederballen, auf eine Art hölzerne Palette gebunden, am Tauende baumelt … er kriegt es zu fassen …«
»Aaaah!«, seufzte Rechberg überrascht.
»Genau, das sagten alle anderen auch. Der Bettler hockt jetzt rittlings auf der Ladung, die weit ausschwingt, luftig und unbequem, aber fürs Erste gerettet.« Ich spähte Rechberg unter die Hutkrempe, aber er starrte mich nur mit großen Augen an und hing an meinen Lippen, fern einer weiteren Unterbrechung. »Dann rutschte der Splint, der die Seilrolle oben am Galgen fixierte, halb heraus, und nach einem Schreckmoment wurde der Bettler gemächlich abgewickelt, dem sicheren Boden entgegen.«
Rechberg blinzelte überrascht.
»… und wenn es auch scheint, dass die Gerechten leiden und die Sünder ihrer Strafe ENTGEHEN, so TÄUSCHT euch nicht, ihr Unchristen …!«
»Natürlich nur, bis die Knechte oben zupackten und verhinderten, dass er gänzlich in Sicherheit nach unten sank. Wieder schwebte der arme Teufel zwischen Himmel und Hölle. Sie können sich vorstellen, welche Beschimpfungen in der Zwischenzeit auf ihn herunterprasselten, vornehmlich von der Kürschnermeistersgattin.«
»Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie die Tochter des Meisters ins Bild kommt.«
»Sofort. Plötzlich schreit die Alte, man solle den Splint ganz herausreißen, dann würde der Hundsfott zu Tode stürzen … dem Leder könne ja nichts passieren, und um die Palette sei es sicher schade, aber sie ende für einen guten Zweck – und gesagt, getan: ein Ruck zurück, der Splint fliegt heraus, der Bettler klammert sich entsetzt an dem nutzlos gewordenen Tau fest, abwärts geht die Reise …«
Rechberg griff unwillkürlich eine Hand voll Luft und starrte mich an.
»Doch da trat unten die Tochter des Hauses vor die Tür, um nachzusehen, welcher Lärm da aus dem Obergeschoss tobte, und …«
»NEIN«, schrie der Mönch so laut, dass wir unwillkürlich zu ihm hinsahen. Er stampfte mit einem Fuß auf seine Staffelei, dass die Chorknaben an deren Basis durcheinander stolperten.
Ich zuckte mit den Schultern. »Doch. Der Aufprall brach dem Bettler ein Bein, aber für die Tochter kam jede Hilfe zu spät.«
»Aber da kann doch der arme Kerl gar nichts … ich meine, eigentlich ja schon, aber er wollte doch gar nicht, dass …«
»Na und?«, fragte ich. »Wo leben Sie denn, mein Freund? Die Tochter war seinetwegen zu Tode gekommen, oder nicht?«
»Ich hoffe, der Richter hat die Umstände berücksichtigt, als er die Hinrichtungsmethode festlegte.«
»Ja, hat er wohl. Sie hängen ihn. Zuerst wollten sie ihn in heißem Öl sotten, aber der Magistrat hielt es für zu gemein.«
»Meine Güte!«
»Ihr glaubt, ihr seid sicher, aber ich SAGE euch: Der Herr SIEHT jene Verirrten, und sein Auge blickt nicht wohlgefällig auf sie herab. Er SIEHT sie … er SIEHT ihnen ins Herz hinein und WEINT bittere TRÄNEN …«
Rechberg schüttelte den Kopf. »Worauf will dieser Dummkopf eigentlich hinaus?«
»… jene ANDEREN … jene vom Teufel verführten Seelen der Finsternis … jene ANDEREN … die statt vor dem Kruzifix vor dem Götzen Mammon niederknien … jene Diebe der ehrlichen Arbeit und jene Nutznießer der Not …«
»Wer kann hier unter den Leuten schon Latein? Das ist doch alles genauso in den Wind gesprochen wie jedes Wort, das man zur Verteidigung des vermaledeiten Bettlers im Kürschnerhaus vorbringen wollte.«
»Das Judenpack!«, schrie plötzlich eine Stimme in der Nähe.
Ich wandte mich um und sah den Sprecher an; dünn, langnasig, langgliedrig, wehendes Haar: Seine ganze Gestalt wirkte so ausgefranst wie der dunkelfarbene Mantel, der von seinen Schultern herabhing. Er sah aus, als hätte er seinen letzten Wertgegenstand schon vor Tagen zum Pfandleiher getragen und als hätte seine Finanzkraft seitdem keinen Aufschwung nach oben genommen. Sein dünner Aufschrei schnitt durch den Lärm in unserer Nähe hindurch wie eine Sense durch Grashalmgeraschel.
»Es gibt immer einen, der versteht«, sagte ich.
Der Mann hatte polnisch gesprochen. Die meisten um uns herum starrten ihn verwundert an; die in seiner Nähe versuchten von ihm abzurücken. Der Mönch oben auf seiner Staffelei schien nicht verstanden zu haben.
»… die das Blut der ehrlichen Arbeiter trinken und ihnen das Mark aus den Knochen SAUGEN … !«
»Sie haben mich ruiniert!«, rief der Langnasige.
»… und ich FRAGE euch: Warum duldet ihr sie unter euch?«
Um den Mann im dunklen Mantel hatte sich ein größerer Freiraum gebildet, der zu Lasten derer ging, die ein wenig weiter weg standen. Friedrich von Rechberg und ich wurden umhergestoßen und zurückgedrängt. Als ich über die Füße eines anderen stolperte, packte Rechberg meinen Arm und hielt mich fest, obwohl keineswegs genügend Raum zum Fallen gewesen wäre. Ein paar Leute in der Nähe des Langnasigen lachten, und einer streckte ihm die Zunge heraus und tippte sich gleichzeitig an die Stirn. Wer mitbekommen hatte, was vor sich ging, drehte sich um und versuchte, Zeuge des interessanteren Lamentos inmitten der Zuhörerschaft zu werden.
»Einst hatte ich ein Haus, Dienstboten, Kinder, eine Frau …«, schrie der Mann und schüttelte seine Fäuste gegen den Himmel.
»Einst hattest du Verstand«, brüllte einer der Umstehenden zurück. Ein großer Teil der Menge, der sich von dem Mönch abgewandt hatte, platzte mit einem lauten Lachen heraus. Der Mönch auf der Staffelei verstummte.
»Lassen Sie uns versuchen, hier herauszukommen«, sagte ich zu Rechberg.
»Warten Sie … ich möchte sehen, was passiert.«
»Was wird schon passieren? Der Mönch wird beleidigt den Mund halten, und den Kerl dort drüben werden sie, wenn er nicht aufhört zu jammern, vor die Stadtmauer tragen und in die Weichsel …«
»DIES IRAE!«, brüllte der Mönch. »Dies ist die Zeit des ZORNS! Und des HERRN ZORN wird nicht ablassen, bis er tut und ausrichtet, was er im Sinn hat, und er wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung, und sein Schall wird dringen BIS AN DIE ENDEN DER ERDE …!«
»Sie haben mir alles genommen!«, schrie der Langnasige.
»Es wird kommen der große Tag des Zorns, und es werden die Felsen und die Berge auf die Häupter der Übeltäter fallen, und sie werden rufen: Verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem ZORN DES LAMMES …!«
»Das Lamm!«, schrie eine dünne Stimme. Scheinbar fiel weiteren Zuhörern ein, dass sie doch Latein verstanden. Der Langnasige schwieg; er hatte die Hände erhoben und zu Fäusten geballt, und sein Mund arbeitete.
»Das Lamm!«, donnerte der Mönch. »Das Lamm, dessen Blut sie getrunken und dessen Fleisch sie gegessen haben, das Lamm, das für uns gestorben ist und das von ihnen gerichtet wurde …«
»Die Christusmörder!« Die dünne Stimme erneut.
»Seht mich an«, rief der Langnasige. »Ich stehe hier als Zeuge für ihre Unredlichkeit. Einst hatte ich ein Vermögen, einst hatte ich einen Namen …«
»Die verfluchten Juden!«
»… und GOTT zerstreute sie über die Länder der Erde zur Strafe dafür, dass sie seinen Sohn ans Kreuz geschlagen haben …!«
»Der sagte: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun«, brummte ich. Niemand hörte auf mich. Ich zerrte an Rechbergs Arm, doch er starrte wie fasziniert von dem Mönch zu den Männern, die so unverhofft seine Hetzpredigt aufgenommen hatten, und zurück. Der Mönch stand auf seiner wankenden Staffelei wie ein Kapitän auf dem Deck seines Schiffes; jede seiner pompösen Gebärden bezeugte, dass er genau erkannte, dass die Ersten ihm allen Umständen zum Trotz zu verfallen begannen. Ich versuchte, den Mann genauer zu betrachten, aber auf die Entfernung waren meine Augen zu schwach, als dass ich mehr erkannt hätte als ein schmales, dunkles Gesicht. Ich hatte ihn für einen der üblichen Schwätzer gehalten; ich hatte ihn unterschätzt.
»Der Herr sprach durch Joel zu den Verstockten: Mein Gold und mein Silber habt ihr mir genommen und in eure Tempel gebracht, ich aber will es euch HEIMZAHLEN auf euren Kopf!«
Kardinal Jagiello hatte sich einen passenden Gefährten gesucht. Der Bruder des Königs galt als einer der unerbittlichsten Feinde der jüdischen Bevölkerung Krakaus. Doch wenn er mit seiner hohen, monotonen Stimme sprach, fielen die Zuhörer reihenweise in Schlaf. Kardinal Jagiello hätte es nicht einmal vermocht, ein Heer von blutgierigen Landsknechten dazu zu überreden, in die geöffneten Tore einer belagerten Stadt zu rennen; er musste seinem Schöpfer auf den Knien danken, dass er ihm jemanden geschickt hatte, der die Menge in seinen Bann ziehen konnte. Was würde geschehen, wenn der Mönch erst die polnische Sprache erlernt hatte?
»Sie nehmen uns das Brot zum Essen und die Luft zum Atmen. Seht mich an – einst beeilten sich Fürsten, mir die Hand zu schütteln! Und als ich um Hilfe bat, es ihnen heimzuzahlen, spannten die Soldaten des Königs mich in den Block …«
Die Krakauer waren vor fast achtzig Jahren über ihre jüdischen Mitbürger hergefallen. Viele erinnerten sich mit Scham daran. Die meisten waren der Ansicht, dass so etwas nicht wieder vorkommen würde. Den Wenigsten war klar, dass nur der richtige Anführer erscheinen musste, damit es wieder vorkam. Die falschen Zitate aus der Bibel und die verzerrten Prophezeiungen taten bei mir keine Wirkung, und ich sah viele andere, die die Köpfe schüttelten oder die Hälse reckten, um nach einem Ausweg aus der Menge zu suchen, doch die dünne Stimme und das Gejammer des Langnasigen bewiesen, dass die Worte des Mönchs bei manchen auf fruchtbaren Boden fielen … und wenn diese nur genügend davon überzeugt waren, heute eine Offenbarung erlebt zu haben und darüber sprachen … wenn man auf das erste Feld eines Schachbretts nur ein einziges Reiskorn legte und nichts weiter tat, als dass man die Anzahl beim nächsten Feld verdoppelte und so fort …
»Du sprichst die Wahrheit, Bruder Avellino!«
»Seht mich an: Ich stehe hier und bezeuge, dass ich einst …«
»Avellino!«
»AVELLINO!«
Und dann – wie hatten sie sich so schnell gefunden? – im Chor: »Avellino-Avellino-Avellino …!«
»Ruft aus unter den Gerechten: BEREITET EUCH ZUM HEILIGEN KRIEG! Bietet die Starken auf! Lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute! Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße! Der Schwache spreche: ICH BIN STARK! Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif! Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß! Des Herrn Tag ist nahe im Tal der …«
Die Glocken der Marienkirche drüben am Marktplatz dröhnten plötzlich los, dass die Menge zusammenfuhr. Die Glocken der Michaels- und der Georgskirche auf dem Wawel folgten nur Augenblicke später. Bruder Avellino auf der Staffelei geriet ins Wackeln, dann ins Taumeln, seine Arme breiteten sich aus und begannen um Gleichgewicht zu rudern … die Chorknaben flatterten um ihn herum und machten mit ihren hektischen Bemühungen, ihn zu stützen, alles noch schlimmer … auf einmal schwang die eine Hälfte der Staffelei nach oben und beschrieb einen Bogen und knallte wieder zurück auf die Erde, und es sah aus, als habe sie einen großen Schritt getan und der Menge einfach den Rücken zugekehrt, und der Mönch, der jetzt in die falsche Richtung hinaussah, wirbelte mit den Armen und versuchte nicht herunterzufallen … die andere Hälfte der Staffelei hob sich … die ersten Zuhörer begannen zu kichern … und dann wurde ihnen allen plötzlich bewusst, welche Zeit die Kirchenglocken schlugen und dass sie eigentlich alle für die Mittagszeit etwas ganz anderes vorgehabt hatten, als einem Hetzprediger zu lauschen. Sie sahen sich betroffen an, dann kam Bewegung in die verkeilte Masse. Auf dem Marktplatz hatte der Bettler seine Verabredung mit dem Tod, und sie planten, ihm alle dabei zuzusehen.
Die Staffelei neigte sich bedenklich zur Seite, Bruder Avellino warf sich wie ein Reiter in die entgegengesetzte Richtung, sie knallte zurück … und stand wieder wie zuvor. Das Gesicht des Mönchs war so dunkelrot, dass es mir selbst von der Ferne auffiel. Er setzte an, etwas zu sagen, dann klappte er den Mund wieder zu und zog in einer Geste, die beredter war als all sein demagogisches Geplärr, die Kapuze über den Kopf, faltete die Hände und versenkte sich in die Position eines inbrünstigen Gebets. Seine ehemaligen Zuhörer drängelten und schubsten ungeduldig an ihm vorbei.
Friedrich von Rechberg schien wie aus einer Besinnungslosigkeit zu erwachen. Er schüttelte sich.
»Haben Sie das … haben Sie das mitbekommen? Er hatte die Menge mit einem Mal im Griff wie … wie … wenn er noch ein paar Augenblicke Zeit gehabt hätte, hätte er sie dazu gebracht, von jeder Kirchturmspitze zu springen … und dabei verstanden die meisten kein Wort von dem, was er sagte …«
»Ja«, sagte ich.
»Erschreckend. Der König sollte ihm das Handwerk legen.«
»Der König hat nicht viel zu sagen hier in der Stadt. Sie gehört den Bürgern.«
»Sie gehört den deutschen Kaufleuten und dem Magistrat.«
»Immerhin haben Sie das schon am zweiten Tag Ihres Hierseins begriffen. Wenn die Situation, die wir hier in der Stadt haben – diese tiefen Spalten, die durch die einzelnen Bevölkerungsgruppen gehen – irgendwo im Reich bestände und nicht hier, wo die Leute es gewöhnt sind, erst mal skeptisch abzuwarten, bevor sie irgendeinem Demagogen hinterherrennen … die eine Hälfte der Bürger würde der anderen Hälfte die Häuser anzünden, weil sie entweder jüdisch oder ausländisch oder einfach nur wohlhabender ist.«
»Ich wollte, ich wäre wieder zu Hause in Landshut«, sagte er und starrte zu dem betenden Mönch hinüber.
»Lassen Sie uns zu mir gehen. Ich werde Essen auftragen lassen und …«
»Nein, mein Freund, mir ist der Appetit vergangen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich seit gestern meiner so angenommen haben, aber ich will Ihre Gastfreundschaft nicht strapazieren.«
»Na gut«, sagte ich und klopfte ihm auf die Schulter, »Sie wissen, dass das Haus Dlugosz Ihnen jederzeit offen steht.«
Er nickte und machte einen Augenblick lang den Eindruck, als wolle er mich fragen, wann ich den Namen des Handelshauses meiner Gefährtin in meinen eigenen umzuwandeln trachtete (nie) oder wann ich endlich dafür sorgte, dass unser Zusammenleben auf eine christliche Basis gestellt wurde (das war eine andere Geschichte); dass er es nicht tat, bewies, dass er die kurze Zeit seit seiner Ankunft genutzt hatte, sich in Krakau über den Mann umzuhören, dem er ein halbes Pfund Korrespondenz mitgebracht hatte, mehr als jedem anderen deutschen Kaufmann in der Stadt. Ich nickte ihm zu und lächelte: Selbst wenn er mich nicht an meinen Freund Hanns Altdorfer erinnert hätte, hätte ich ihn seines Taktgefühls wegen gemocht.
Rechberg seufzte. Die gute Laune schien ihm wahrhaftig abhanden gekommen zu sein. Er wandte sich von der Richtung ab, in die die Anwärter auf einen Platz in der Zuschauerschar bei der Hinrichtung eilten.
»Gehen wir«, sagte er. »Auf mich wartet Arbeit.«
Das Läuten der Kirchenglocken verklang. Der Mönch auf seiner Staffelei war noch immer im Gebet versunken, die Kapuze über dem Kopf, eine leise schwankende Gestalt. Die Chorknaben knieten jetzt auf dem Boden, mit gesenkten Köpfen und vor dem Gesicht gefalteten Händen.
Ich erinnerte mich an die Gruppe, die laut den Namen des Mönchs skandiert hatte, als wäre er eine besondere Volksbelustigung.
Sie hatte mir keine Sorge bereitet.
Ich betrachtete das kleine Grüpplein, das vor der Staffelei stand und flüsternd diskutierte. Der langnasige Bursche mit dem ausgefransten Mantel war unter ihnen und redete mit Händen und Füßen. Alle trugen die Mienen von Leuten zur Schau, die sich auf einmal am Beginn einer Erkenntnis finden.
Aus dem einen Reiskorn waren zwei geworden.
Sie machten mir Sorgen.
»Worauf warten Sie, Herr Bernward?«
Ich riss mich vom Anblick des gestikulierenden Mannes los. In all ihrer plötzlichen Leere wirkte die Gasse vor dem Kirchenportal riesengroß und die Leute um den Mönch wie von einem Künstler dort aufgestellt. Sie sahen aus wie eine Kreuzigungsgruppe; wie die schockierten Apostel zu Füßen des Erlösers, bereit, sein Wort in die Welt zu tragen.
»Ich komme«, sagte ich.
Vom Marktplatz her trug der Wind das leise Echo des kollektiven Seufzers einer großen Menge. Der Henker hatte den Verurteilten von der Leiter gestoßen. Unmelodisch und kreischend setzte Musik aus Drehleiern, Hümmelchen und Schalmeien ein. Eine Gauklertruppe spielte für den Bettler auf, und dieser tanzte mit der Seilerstochter seinen letzten grässlichen Tanz.
KAPITEL 2
21. Tag im Brachmonat, 1486 A.D. Sommersonnwende
Libera me Domine de morte aeterna
In die illa tremenda
Quando caeli movendi sunt
Caeli et terra
Dum veneris judicare
ICH PLATZTE IN DEN GROSSEN SAAL im Obergeschoss, in dessen hellster Ecke Janas Schreibpult stand. Jana sah von den Papieren auf, die sich darauf türmten.
»Ist Paolo bei dir?«, fragte ich.
Jana sah mich an. »Wir sind pleite«, sagte sie dann.
Ich stieg über die schmalen Holzplatten, die ordentlich geschichtet quer durch den Raum lagen, stieß mir das Schienbein an der obersten Platte und humpelte stöhnend zu Jana hinüber. »Wieso liegen diese Dinger jetzt schon hier herum?«
»Ich bin hier, Herr Vater.« Paolo stand mit hängendem Kopf neben dem Schreibpult. Er sah aus, als wünschte er sich im nächsten Augenblick in eine Salzsäule zu verwandeln. Ich zog fragend die Augenbrauen hoch; sein Gesicht blieb blass und tragisch, aber er nickte knapp.
»Hast du gehört? Absolut und vollkommen pleite.« Jana sah auf den Brief in meiner Hand, und ich erkannte, dass ich seit meinem Hereinkommen damit herumwedelte wie ein päpstlicher Legat, der eine Bannbulle an den Mann bringen will. Ich ließ die Hand sinken.
»Endlich die erlösende Nachricht?« Jana lehnte mit einem Ellbogen auf den Unterlagen auf dem Schreibpult; die Schrift auf dem Papier (vielfach abgekratzt und öfter gebraucht als ein altes Hemd) war uneinheitlich, fiel in alle Richtungen zugleich um und war an den Stellen zerlaufen, an denen das Schabmesser die Oberfläche des Papiers zu sehr angegriffen hatte. Janas Lippen waren zusammengekniffen. Ich horchte ihrer bissigen Bemerkung hinterher.
»Du bist am schönsten, wenn du dich ärgerst«, erklärte ich.
»Wie wäre es mit einem Laut der Betroffenheit über das, was ich gesagt habe, anstatt nur darüber zu meckern, dass ich schon daran gedacht habe, die Sitzbänke hier heraufschaffen zu lassen?«
»Jana, ich hab’s eilig … und wir können nicht bankrott sein. Was ist mit den Einkünften meiner Firma in Landshut?«
Sie musste nicht einmal in die Unterlagen blicken. »Machst du Witze? Der Versuch, das Desaster mit diesen verdammten Schiffen durch eine riskante Geschichte mit Damaszener Stahl zu kompensieren, ist total danebengegangen … und wo noch dazu etliches durch Anleihen finanziert worden ist …«
»Das wird sich schon richten.«
»Das wäre schön … außerdem …«
»Außerdem was?«
Paolo gab einen kleinen Laut von sich wie ein Hündchen, das man am Genick packt und gerade in die Lache tunken will, die es schon wieder auf den sauber geputzten Küchenboden gemacht hat.
»… sind einige davon wiederum durch Kredite bei jüdischen Geldverleihern gedeckt, die Zinsen verlangen wie zu Zeiten der Kreuzzüge.«
»Du lieber Himmel«, sagte ich und schickte mich darein, meine eigenen Besorgungen noch ein wenig aufzuschieben. Der Brief brannte förmlich in meiner Hand, aber ich steckte ihn vorne in mein Wams und legte Jana eine Hand in den Nacken. Sie sträubte sich einen Moment, doch dann ließ sie sich zu mir heranziehen. Sie legte ihre Stirn gegen die meine. Paolo kaute auf seiner Unterlippe. Ich fuhr ihm über die Haare, und er seufzte tief.
»Und zu dieser ganzen Misere brauchte es nicht einmal zwei Stunden«, sagte Jana dumpf in Richtung Fußboden.
»Es sind ganze Weltreiche in zwei Stunden gefallen.«
»Verglichen damit sind dein und mein Haus kleine Fische, was?«
Ich küsste sie auf die Nasenspitze. »Es war aber auch eine sehr schwierige Aufgabe, die du ihm da gestellt hast.«
»Keine Aufgabe ist schwierig, wenn man sich auf sie konzentriert.«
»Wenn es so einfach wäre«, sagte ich und streichelte ihre Wange, »das Haus Dlugosz und das Unternehmen Bernward & Partner vom Schreibpult aus zur reichsten Firma der Welt zu machen, hättest du es bestimmt schon vollbracht, meinst du nicht?«
Jana raffte die Blätter vom Schreibpult auf und hielt sie anklagend in die Höhe. »Es hilft dem Jungen nicht, wenn du ständig seine Partei ergreifst, weißt du?«, sagte sie.
»Jana, lass ihm Zeit zum Verschnaufen. Er ist noch so ein kleiner Kerl …«
»Peter, es war eine ganz einfache Aufgabe – und die meisten Probleme, die zu bewältigen waren, entsprechen der Realität …« Sie verstummte und senkte den Blick; sie hielt dieses Terrain, das wusste ich von einigen anderen Diskussionen in der jüngsten Vergangenheit, für schlüpfriger als ich selbst.
»Es ist Sebastian Löw ja gelungen, die Anleihen zurückzuzahlen.«
»Aber zu welchem Preis!«
»Immerhin waren die Zinsen, anders als in deiner Aufgabe, nicht so hoch wie zu den Zeiten der Kreuzzüge.«
»Deine Ruhe möchte ich haben, was das Geschäft angeht.«
»Du weißt doch, dass ich im Augenblick an ganz andere Dinge denke. Wozu habe ich einen Partner wie Sebastian? Er hat bis jetzt immer eine gute Idee gehabt – meistens eine bessere als ich.«
»Mein Vater hat mich Dutzende solcher Exempel rechnen lassen, als ich so alt war wie Paolo. Ich hab’s ihm sogar noch leicht gemacht und nur schöne glatte Summen vorgegeben. Die Söhne der Adligen verlassen in seinem Alter ihre Heimat und gehen als Pagen in die Fremde, weißt du – und da setzt es Hiebe von ihrem neuen Herrn, wenn sie was verbocken, und ein paar Nächte im Pferdestall.«
Die Blätter, auf denen unser Sohn seine Eltern bankrott gerechnet hatte, schwebten noch immer empört über unseren Köpfen. Ich schielte zu ihnen hinauf.
»Na ja, dafür haben wir ja …«
»Ich bin schon ein großer Junge, Herr Vater«, sagte Paolo plötzlich reichlich kontraproduktiv.
»Genau, dafür haben wir ja …«, echote Jana.
Ich breitete die Arme aus und verdrehte die Augen. »Also gut. Statt der Pagenschaft bei einem adligen Raufbold geht unser Paolo beim besten Bankier in die Schule, den die Stadt aufbieten kann. Und weil dies eine Ehre ist, die nicht jedem zuteil wird …«
»… und weil du bestimmt nicht willst, dass es heißt, Paolos einzige Qualifikation dafür sei die Freundschaft zwischen seinem Vater und besagtem Bankier …«
»Mojzesz würde ihn nicht nehmen, wenn er nicht wüsste, dass er das Zeug dazu hat.«
»Mojzesz Fiszel ist der gewiefteste Bankier und Kaufmann landauf, landab; ist der Bankier von König Kasimir; und ist unser Freund. Das sind mindestens drei Gründe, warum Paolo sich bei ihm nicht blamieren sollte.«
»Ich bin wirklich schon ein großer Junge, Herr Vater«, meldete sich Paolo.
»Wozu bin ich heute überhaupt aus dem Bett aufgestanden?«, klagte ich. »Man kümmert sich nicht darum, dass ich eigentlich keine Zeit habe, man schlägt mich in der Diskussion mit meinen eigenen Argumenten, und mein Sohn, für den ich mich in die Bresche werfe, fällt mir in den Rücken.«
Jana sah mich von oben bis unten an. Plötzlich lächelte sie. Mit Befremden erkannte ich, dass das Lächeln ihre Augen müde erscheinen ließ. Sie spitzte die Lippen, wie sie es immer tat, wenn etwas sie belustigte. »Du bist doch hier hereingestolpert wie ein verwundeter Türke, hast den halben Bretterstapel umgestürzt und uns aus der Konzentration gerissen.«
»Ich glaube, du ahnst nicht, wozu ein verwundeter Türke fähig ist.«
Ich fasste endlich nach oben und packte den Blätterstapel in Janas Hand. Einen Moment leistete sie noch Widerstand, dann ließ sie es zu, dass ich Stapel, Hand und Arm nach unten zog und ihr schließlich die Papiere wegnahm. Ich warf sie auf das Schreibpult. Jana senkte den Blick. Als sie wieder aufsah, wirkte ihr Lächeln noch müder als zuvor, aber sie blinzelte mir zu.
»Verwundete Türken«, sagte sie, »werden einer echten Polin nur dann gefährlich, wenn sie es zulässt.«
»Herr Vater, sind Sie wirklich verwundet?«, fragte Paolo.
»Nein«, sagte ich und lachte. Ich rubbelte ihm über den Kopf. Ich musste weit dazu hinunterfassen: Paolo hatte die Zartheit seiner leiblichen Mutter übernommen, gemischt mit dem wilden Haar und dem dunklen Teint seines venezianischen Vaters. Wenn ich ihn manchmal betrachtete und in seiner Gestalt Fiuzetta und in seinem Aussehen Fabio Dandolo wiedererkannte, wartete ich jedes Mal auf den Stich der Eifersucht, dass dieses Kind, das wir nach seiner Geburt zu uns genommen hatten, nicht unser eigen Fleisch und Blut war. Es kam regelmäßig ein Stich, aber einer aus plötzlich emporschäumender Liebe und Zuneigung, die sich nicht nur auf Paolo, sondern auch auf seine Mutter erstreckte. Es schien, dass Jana meine Gedanken gelesen hatte.
»Paolo darf nicht vergessen, den Brief an Fiuzetta zu schreiben. Die Kaufleute, die nach Venedig reisen, wollen in ein paar Tagen aufbrechen.«
»Ich hoffe, es geht ihr immer noch gut.«
»Paolo Calendar und Michael Manfridus werden schon ein Auge auf sie haben.«
»Du weißt, wie leicht es ist, als Hebamme verleumdet zu werden.«
»Sie wird schon auf sich aufpassen, Peter.«
»Paolo Calendar ist jetzt im Zwölferrat, habe ich dir das mitgeteilt?«
»Mehrfach.«
»Ist das der Mann, dessen Namen ich trage?«, fragte Paolo.
»Du trägst eine ganze Reihe von Namen, mein Lieber«, lachte Jana.
»Paolo für einen aufrechten Mann in Venedig, Karol für meinen Großvater hier in Krakau, Peter für meinen Herrn Vater«, zählte Paolo sofort auf.
»… und für Bischof Peter von Schaumberg«, setzte ich leise hinzu. Jana lächelte mich an.
»Also gut, mein Junge«, sagte ich. »Da wir bankrott sind, wie es scheint, gibt es hier nichts mehr zu rechnen. Spring ins Kontor hinunter und sieh zu, ob du dich bei den Buchhaltern nützlich machen kannst.«
»Kann ich nicht in den Laden gehen, Herr Vater? All die Waren und Dinge aus den fremden Städten … ich könnte dem Ladenjungen doch beim Sortieren helfen und …«
»Verschwinde«, sagte ich und grinste. »Dass ich nachher nicht hören muss, du hättest den halben Laden durcheinander gebracht.«
Paolo warf Kusshände und schoss wie ein Bolzen an uns vorbei. Jana sah ihm nachdenklich hinterher.
»Womit haben wir diesen Engel verdient?«, fragte sie.
Ich legte die Arme um sie. Sie erwiderte meinen Blick, bis sie zu kichern anfing. »Was starrst du mich so an?«
»Wir sind eine ganze Strecke weit gegangen, wir beide, was?«
»Wenn das der Anfang einer Rede sein soll, die damit endet, wie alt und grau ich während dieser Zeit geworden bin, dann sieh dich vor!«
Ich beugte mich nach vorn und küsste sie sanft auf einen Augenwinkel. Natürlich waren dort mehr Krähenfüße als vor zehn Jahren, und natürlich wies ihr Haar an einigen Stellen weniger einen honig- als vielmehr einen aschblonden Stich auf; aber – wenn ich ehrlich sein wollte – ich liebte diese nichtigen Unzulänglichkeiten nur umso mehr, da ich Zeuge geworden war, wie sie über all die Jahre entstanden waren.
»Wenn etwas nicht in Ordnung wäre, würdest du es mir sagen, oder?«
»Was soll nicht in Ordnung sein?«
»Ich meine ja nur …«
Sie kniff mich in die Seite. »Es ist eine Weile her, seit du das letzte Mal Gespenster gesehen hast.«
»Die Gespenster holen einen immer wieder ein.«
Sie schmiegte sich an mich. Ich drückte sie heran und strich ihr über den Rücken. In meinen Armen fühlte sie sich immer noch wie die sehnige junge Frau an, die ich damals in Landshut kennen gelernt hatte.
»Die Situation erinnert mich …«, begann ich.
Sie versteifte sich in meinen Armen; kaum merklich, aber ich spürte es doch.
»Woran erinnert sie dich?«
»Als wir uns in Ulm wiedertrafen, nachdem wir uns in Landshut verabschiedet hatten«, sagte ich lahm. Ich wusste schon, bevor sie sich aus meinen Armen frei machte, dass der kurze Augenblick der Nähe, den wir in der Hektik der letzten Wochen gefunden hatten – und einem beginnenden Aneinander-Vorbei-Reden, in dem wir beide groß waren und das zwischen uns nie Raum gewinnen durfte, weil die Gefahr bestand, dass es in langes Schweigen ausartete –, dass dieser Augenblick schon wieder vorüber war.
»Wieso an Ulm?«, fragte sie.
»Da fielen wir uns auch in die Arme, und gleich darauf wusste keiner, was er dem anderen sagen sollte.«
Sie musterte mich. Sie wusste, dass ich gelogen hatte. Ich hatte mich nicht an Ulm erinnert. Die Lage zwischen uns hatte stattdessen die Erinnerung an Florenz wachgerufen, wo wir es auch zugelassen hatten, dass ein Schweigen zwischen uns so groß geworden war, dass wir es beinahe nicht mehr hätten überbrücken können – und das uns beide ums Haar das Leben gekostet hätte.
»War es so in Ulm?«, sagte Jana.
Ich zuckte mit den Schultern. Ich wusste, dass sie wusste, was ich zuerst hatte sagen wollen. Sie ging mit keinem Wort darauf ein. Irgendwann in den letzten Wochen musste ich, vertieft in meine eigenen kleinen Sorgen, den Zeitpunkt verpasst haben, an dem wir aufgehört hatten, aneinander vorbeizureden, und stattdessen überhaupt nichts mehr sagten.
Jana trat an das Schreibpult und schob Papiere hin und her. »Hast du es jetzt nicht mehr eilig?«
Ich fasste in mein Wams und zog den Brief heraus. »Ich warte wochenlang auf eine Botschaft meines nichtsnutzigen Sohnes Daniel, und was steht drin? Zwei verdammte Seiten über den Baufortschritt des Martinsdoms und dass sie dem Herzog oben auf der Burg jetzt wirklich bald in die Suppe sehen können, gewürzt mit Beschreibungen der Türmchen und Fialen und dem Stuckwerk und der Organisation der Bauhütte und der Halsweite jedes einzelnen seiner Gesellen und was weiß ich noch alles – und zwei Sätze über das, was ich eigentlich hören wollte: ob er für Paolos Feier nach Krakau kommen wird. Und dass Sabina sich dazu durchgerungen hat, auch zu kommen, musste ich von ihr erfahren, obwohl sie ihm aufgetragen hatte, es mir zu schreiben, weil Briefe aus Landshut schneller nach Krakau kommen als von anderswo!«
»Immerhin hat er zugesagt.«
»Und vergessen anzugeben, wann er kommen will.«
»Irgendwer von deinen Spionen in Landshut wird es dir schon rechtzeitig mitteilen«, lachte sie. »Erzähl mir nicht, dass du nicht Gott und die Welt angeschrieben hast, damit sie Daniel zur Not überreden, hierher zu kommen. Hanns Altdorfer zum Beispiel wird ihm jeden zweiten Tag damit lästig gefallen sein, da wette ich. Der arme Junge kann wahrscheinlich keinen Schritt tun, ohne dass seine Überwacher sich gegenseitig auf die Füße treten.«
»Es ist mir wichtig, Jana«, sagte ich.
Sie seufzte. »Ich wollte mich nicht lustig machen.«
»Schon gut.« Ich starrte unschlüssig auf ihren mir halb zugewandten Rücken, dann raffte ich mich auf und trat auf sie zu.
»Ich gehe nochmal los …«, begann ich. Sie drehte sich gleichzeitig um und sagte: »Peter, ich möchte dich …« Wir verstummten beide.
»Was wolltest du sagen?«, fragte ich.
»Wo willst du denn jetzt nochmal hin? Jeden Moment läuten die Glocken das Ende der Vespermesse.«
»Mir ist noch was eingefallen.«
»Wegen der Ankunft von Daniel und Sabina? Du musst doch nicht jeden zweiten Tag die Stadttore abklappern. Sie werden wohl so schlau sein, einen Boten zu uns zu schicken, sobald sie da sind, damit wir sie aus dem Zoll auslösen.«
»Ich überlasse die Dinge nicht gern dem Zufall«, sagte ich und spürte förmlich, wie falsch es schepperte.
»Was hat das denn mit dem Zufall zu tun?«
Was stört es dich denn, wenn ich noch was außer Haus zu tun habe?, hörte ich mich gereizt sagen. Stattdessen fragte ich: »Was wolltest du vorhin sagen? Was möchtest du mich …?«
Sie blinzelte. Plötzlich sah sie zu Boden. Zwischen ihren Brauen erschien eine steile Falte. Ich streckte die Hand aus und tat so, als würde ich die Falte mit dem Daumen wegreiben. »Was geht dir denn schon die ganze Zeit im Kopf herum?«, fragte ich und legte die Hand an ihre Wange.
Sie sah auf, doch da sprang die Tür auf, und Janas Magd platzte herein. Sie blieb gleich hinter der Tür stehen und kniff verlegen die Lippen zusammen. Ihre Blicke huschten von Jana zu mir.
»Was gibt es, Julia?«, fragte Jana.
Ich ließ die Hand sinken.
»Ein Kaufherr ist unten im Kontor und möchte mit Ihnen sprechen. Er heißt Mie … Miek …«
»Ist gut. Ich habe ihn erwartet. Sag Bescheid, dass ich hinunterkomme.« Jana trat einen Schritt zurück und strich sich über das Haar und danach das Kleid glatt. Ich sah ihr bei diesen tausendfach verrichteten Gesten zu und fühlte aus dem Nichts, wie ich diesmal dabei unsicher wurde.
»Siehst du, es passt ganz gut, dass ich noch was zu tun habe«, erklärte ich obenhin.
»Peter, sei nicht albern. Es dauert nur ein paar Momente.«
»Mein Geschäft auch. Ich sehe dich beim Vespermahl.«
Sie legte die Hand auf den Bauch. »Ich glaube nicht, dass ich allzu viel Hunger haben werde.«
»Bis später«, sagte ich und folgte Julia durch die offen gelassene Tür die Treppe hinunter.
Im Kontor stand ein aufwendig gekleideter Mann, den sein Putz älter erscheinen ließ, als er bei näherem Hinsehen war. Ich nickte ihm zu, und er nickte so knapp zurück, dass mir klar war, er hielt mich für einen der Bediensteten des Hauses. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich gleich darauf, wie er sich herumdrehte und mir nachsah, als ich durch Janas kleines Kontor schritt und von den Schreibern ehrerbietig begrüßt wurde. Ich war in Krakau ein bekannter Mann – weniger wegen eigener Leistung, sondern wegen des unerhörten Umstandes, dass ich in all den Jahren niemals versucht hatte, meiner Gefährtin die Führung des Geschäfts zu entreißen; und selbstverständlich der Tatsache wegen, dass wir bis heute noch keinen Priester aufgesucht hatten, um den kirchlichen Segen für unsere Verbindung zu erflehen (natürlich hatte es anfangs nicht nur Gerede gegeben, sondern auch das eine oder andere vermasselte Geschäft, wenn einem Handelspartner die Bigotterie über den Geschäftssinn ging). Mittlerweile hatte man sich daran gewöhnt; ein bunter Hund war ich dennoch.
Ich spürte eine närrische Genugtuung, als ich mir vorstellte, dass Janas hochmütiger Besucher sich vermutlich fragte, ob ich wohl der merkwürdige Kerl sei, mit dem die erfolgreiche Jana Dlugosz ihr Leben teilte – und dass er sich in den Hintern biss, es vor lauter Arroganz versäumt zu haben, mich in ein neugieriges Gespräch zu ziehen.
Der Laden, der zu Janas Handelshaus gehörte und in dem in schöner kaufmännischer Tradition all das für teures Geld verkauft wurde, was ihre Agenten und Handelsreisenden auf ihren Touren von den Geschäftspartnern geschenkt bekommen oder auf andere Weise günstig ergattert hatten, lag dem Eingang des Hauses Dlugosz schräg gegenüber. Jana hatte das Untergeschoss des Hauses angemietet; im Obergeschoss hausten der Eigentümer des Gebäudes und seine Familie und freuten sich täglich nach Kräften darüber, dass Janas Mietzins ihnen den größten Teil des Lebensunterhalts abnahm. Die weite, freie Fläche, die sich zwischen diesem Haus und dem nächsten die Gasse hinauf erstreckte, gehörte Jana ebenfalls; ihrem Vater war es gelungen, sie im Zuge der Umbauten, die mit der Universität in der Sankt-Anna-Gasse zu tun hatten, zu erstehen, und seitdem war die Rede, das Haus Dlugosz dort neuer, größer und schöner aufzubauen. Irgendwie hatte es wohl immer zu viel Arbeit gegeben, um diesen Plan umzusetzen; oder der Dlugosz’sche Pragmatismus hatte verhindert, Geld für ein neues Haus auszugeben, wenn das Dach des alten noch dicht war … der gleiche Pragmatismus im Übrigen, der bis jetzt auch verhindert hatte, mit Haus und Kontor gleich zum Marktplatz umzuziehen, wie es das heimliche Ziel der meisten erfolgreichen Kaufleute in Krakau war. Die Gasse, in der das Haus Dlugosz lag, war nur wenige hundert Schritte vom Marktplatz entfernt; doch vor knapp zwanzig Jahren waren die jüdischen Kaufleute, die in der Judengasse gelebt hatten, genötigt worden, ihre Grundstücke (und die Synagoge) für den Neubau der Universität herzugeben und in die parallel verlaufende Sankt-Thomas-Gasse umzusiedeln (und sorgten damit für die fällige Namensänderung, die bei den älteren Leuten noch heute zur Verwirrung beitrug: Die alte Judengasse wurde nun in Sankt-Anna-Gasse umbenannt, während die alte Sankt-Thomas-Gasse die neue Judengasse wurde – ein Ortsfremder wurde somit, je nachdem, wen er fragte, in der Regel in aller Unschuld in die Irre geschickt). Die Gasse, in der Janas Haus lag, verband die Sankt-Anna- mit der Judengasse und wurde über die Jahre hinweg selbst ein Teil davon – entsprechend wurde die Lage des Hauses Dlugosz herabgewertet. Wahrscheinlich trug Janas gelassene Ignoranz dieser Tatsache ebenso viel zum Klatsch ihrer Gildekollegen bei wie meine geschätzte Existenz.
Ich ließ die beiden teuer gekleideten Knüppelträger, die vor unserem Hauseingang herumstanden und dem Herrn den Tag stahlen, stehen. Offensichtlich waren sie die Begleitung des noch teurer gekleideten Herrn, den Jana erwartet hatte. Ihre Schuhe waren trotz des wegen der Enge unserer Gasse stets feuchten Straßenlehms sauber; Janas Besucher konnte keine weite Strecke zurückgelegt haben, um hierher zu gelangen. Paolos schmales Gesicht war hinter der Fensteröffnung des Ladens zu sehen; die Klappe davor war waagrecht gestellt und trug allen möglichen Tand, auf der einen Seite der Größe nach ausgerichtet, auf der anderen in fröhlichem Chaos durcheinander stehend. Offenbar hatte Paolo seinen eigenen Ordnungssinn auf die Auslage angewandt; das ordentliche Schema galt für die Seite, der er sich noch nicht gewidmet hatte. Ich nickte ihm zu und ging am Laden vorbei. Ich hoffte, dass alles so geklappt hatte, wie ich ihm aufgetragen hatte; mir lief die Zeit davon, und es gab noch so viel zu erledigen bis zu Daniels und Sabinas Ankunft und bis ich meine Pläne umgesetzt hatte, dass mir förmlich der Atem knapp wurde.
Ich hörte seine eiligen Schritte, mit denen er mir hinterherlief. Als er aufgeholt hatte, hielt er einen kleinen Lederbeutel hoch und sah mich drängend an.
»Zu früh«, sagte ich.
Er ließ die Hand sinken und stolperte betreten neben mir her. Wir umrundeten die Ecke des Gebäudes und betraten die Judengasse. Über die Dächer hinweg sah ich zur Rechten die Zwillingstürme der Marienkirche aus dem Gewirr der Firste und den anderen Kirchtürmen in die Höhe ragen. Die Glocken begannen zur Vesper zu schlagen, die Marienkirche wie üblich allen voran. Ich wandte mich nach links zur Stadtmauer. Paolo trabte neben mir her.
»Darf ich mitkommen, Herr Vater?«
Ich antwortete ihm nicht. Die Gasse lief geradewegs zur Stadtmauer. Einer der Wachtürme ragte mit seinem schlanken Turmhelm direkt vor uns auf; der schindelgedeckte Wehrgang der Mauer war eine dunkle Höhlung im schrägen Abendlicht. Unser Haus lag nun so weit zurück, dass selbst jemand, der wie wir um die Ecke gebogen und in die Judengasse hereingespäht hätte, uns im abendlichen Trubel kaum gesehen hätte. Die christlichen Messzeiten galten für die jüdische Bevölkerung nicht, und so nutzte man hier die letzte Stunde vor dem nächtlichen Ausgehverbot noch kräftig für ein paar Geschäfte.
Ich wandte mich um und streckte die Hand aus.
»Lass sehen, was du erwischt hast«, sagte ich.
Er überreichte mir den Lederbeutel. Ich nestelte ihn auf und schüttelte mir den Inhalt auf die Handfläche: ein goldener Ring mit einem Stein. Ich hielt ihn in die Höhe und musterte ihn.
»Bist du sicher, dass sie ihn nicht vermissen wird?«
»Ich habe so getan, als würde ich damit spielen wollen, und sie hat nicht gesagt: Leg ihn sofort wieder zurück!, sondern nur: Pass auf, dass du ihn nicht verlierst.«
»Hervorragend.«
»Darf ich mitkommen, Herr Vater?«
Ich steckte den Ring in den Lederbeutel zurück und ließ den Beutel in mein Wams gleiten.
»Was glaubst du denn, wohin ich gehe?«
Paolo strahlte mich an. »Zum Florianstor – Daniel und Sabina abholen.«
»Sie werden nicht ausgerechnet heute ankommen.«
»Das kann man nie so genau sagen«, erklärte er mit der vollen Weisheit seiner acht Jahre.
»Ich habe ein anderes Ziel«, sagte ich und klopfte auf das in meinem Wams versteckte Ledersäckchen. Paolo machte ein enttäuschtes Gesicht. »Und ich habe es schrecklich eilig. Lauf zurück in den Laden.«
»Bitte …«
»Das mit dem Ring hast du hervorragend gemacht. Nun lauf.«
»Bitte, bitte, bitte …«
Die ganze Tragik der enttäuschten Hoffnung lag in seinen Augen. Ich sah hinein und schmolz, während ich gleichzeitig dachte: Wie viel Zeit wird mich das wieder kosten?
»Ich kann mich aber nicht um dich kümmern. Du läufst neben mir her wie mein Schatten, verstanden?«
Seine Miene hellte sich auf. Ich machte eine einladende Geste, dass er vor mir gehen sollte, aber er streckte eine Hand aus und ergriff die meine. »Sie müssen auf mich Acht geben, ich bin noch ein kleiner Kerl«, sagte er ernsthaft.
»Kein großer Junge mehr?«
»Das bin ich außerdem.«
Ich lachte und setzte mich in Bewegung. Nach ein paar Schritten merkte ich, dass ich zu schnell für ihn war.
»Es tut mir Leid, dass ich die Aufgabe falsch gerechnet habe.«
»Kein Problem, Paolo«, sagte ich. »Bis es so weit ist, dass deine Rechnungen Einfluss auf die Wirklichkeit haben, vergeht noch ein Weilchen. Du kannst noch viel üben.«
Ich verlangsamte meinen Schritt, obwohl mir die Zeit auf den Nägeln brannte, so dass er bequem neben mir hermarschieren konnte. Der Lederbeutel mit Janas Ring war ein leichtes Gewicht in meinem Wams; noch leichter war die Hand Paolos in meiner, ein warmer, lebendiger Beweis von Vertrauen und Zuneigung, und ich verspürte in rascher Folge alle Gefühle von väterlicher Verantwortung bis zur Sorge, ob meine erwachsenen Kinder diesen kleinen Kerl an meiner Seite akzeptieren würden, und endete schließlich in einer heißen Aufwallung der Liebe. Paolo sah zu mir hoch und lächelte, und ich lächelte zurück.
»Muss ich viel üben?«
Ich nickte. Er nickte mit. »Die Frau Mutter sagt es jedenfalls«, erklärte er mit Grabesstimme.
»Deine Frau Mutter will nur das Beste für dich.«
Er seufzte; es wäre auch überraschend gewesen, wenn er meine Ansicht über Janas Enthusiasmus bezüglich diverser Übungsaufgaben zur Buchführung eines Handelsunternehmens geteilt hätte.
Wann würde Jana bemerken, dass der Ring fehlte? Sie war im Allgemeinen eher sorglos mit ihrem Schmuck, und meistens vergaß sie ohnehin, ihn anzulegen. Andererseits waren die Stücke, die sie besaß, in der Regel wertvoll. Schon ihr Vater hatte sein Geld nur für Qualität ausgegeben, und Jana war in dieser Hinsicht seine hundertprozentige Tochter. Ob sie ihn aus Angst vor Verlust oder aus schierem Pragmatismus in der Truhe ließ, war mir jedoch nicht ganz klar. Manchmal ertappte ich sie dabei, wie sie durch die Schatullen und Beutel forschte und das eine oder andere Stück mit einem Ausruf des Erstaunens in die Höhe hob: Sieh mal, das hab ich ja auch noch! Die Chancen standen gut, dass sie den Diebstahl nicht bemerkte.
»Haben wir immer noch unser Geheimnis, mein Sohn?«
Paolo legte zwei Finger an die Lippen, küsste die Fingerspitzen und wedelte dann mit todernstem Gesicht damit vor seinem Herzen herum. Die Geste war mir so vertraut, dass ich auflachte. Paolo starrte mir ins Gesicht und lachte dann auch.
»Heißt das: Ja?«
»So sicher wie der Sarg von Wladyslaw dem Ellenlangen, so fest wie die Stadtmauer von Krakau und so lang, bis dem Teufel der Arsch zufriert.«
»Was hab ich da gehört?«
»Ich habe … ich habe …«
»Wo hast du denn das aufgeschnappt, Paolo?«
»Nirgends, Herr Vater.«
»Nirgends, das ist: die Pferdeställe, hab ich Recht?«
Er ließ den Kopf hängen, aber der schiefe Blick, den ich empfing, verriet, dass seine Demut nicht ganz der Wahrheit entsprach und seine momentane Begeisterung über die drastische Ausdrucksweise der Stallknechte jedem möglichen Gewissensbiss darüber haushoch überlegen war.
»Du musst aufpassen, was du …«
»Wir gehen ja gar nicht zum Florianstor!«
»Nein, ich habe doch gesagt …«
»Wohin gehen wir dann, Herr Vater?«
Wir trabten über den Marktplatz, an der langen Nordwestflanke der Tuchhallen entlang, die mit ihren Flankenbauten und Seitenhallen über den Platz hingestreckt lagen wie eine flache, ungestalte Kathedrale des Gottes Mammon, am leeren Pranger vorbei, um das Rathaus herum. Der hohe Rathausturm warf seinen Abendschatten über die Tuchhallen; die Kirche des heiligen Adalbert am Südende des Platzes lag in einem goldenen Sonnenkeil. Den Blick auf die Kirche und die Große und Kleine Waage davor rahmte der Galgen ein, im Augenblick nicht mehr als ein Gerüst, wie für den gleich beginnenden Bau eines Tores, auf einem gemauerten Podest. Der Henker hatte die Leiter mitgenommen, die drei Stempel des Galgens waren leer, und allenfalls die Kerben am Querbalken, die die Seile eingesägt hatten, zeugten davon, dass dies kein Bauwerk ohne Funktion war. Krakau besaß einen weiteren, aufwendig gemauerten Galgen außerhalb der Stadtmauer auf einem Hügel für die schweren Verbrecher; sein kleinerer Vetter hinter dem Rathaus diente den kleineren Missetätern als Tor zur letzten Reise. Im Gegensatz zum großen Galgen nahm man die Erhängten vom kleinen Galgen nach kurzer Zeit ab und verscharrte sie; das tägliche Geschäft um die Tuchhallen herum vertrug sich schlecht mit dem Geruch.
Ich deutete an der Sankt-Adalbert-Kirche vorbei die lange Vorstadtgasse entlang. Der schroffe Wawelhügel blockte das Gassenende und ragte über dem Turm des Vorstadttors auf, violett und düster im Abendschatten.
»Wir gehen zum König?«, fragte Paolo voller Ehrfurcht.
»Mein Sohn, dein Vater hat den Hintern viel zu weit unten, um einfach so zu König Kasimir marschieren zu können.«
»Onkel Mojzesz kann es.«
»Onkel Mojzesz sorgt auch dafür, dass der König beim Weintrinken eine Goldvergiftung bekommen kann anstatt Tonbrösel zwischen die Zähne.« Ich hob die Hand wie mit einem unsichtbaren Becher darin zum Trunk.
»König Kasimir ist vergiftet?«, staunte Paolo.
»Nein, natürlich nicht. Allenfalls sein Vorkoster.«
»Onkel Mojzesz hat König Kasimirs Vorkoster vergiftet?«
»Wie wär’s«, sagte ich und zerdrückte den imaginären Becher in der Faust, »wenn du einfach ruhig bist und abwartest, wohin ich dich bringe?«
»Herr Vater?«
»Ja?«
»Warum hat Onkel Mojzesz König Kasimirs Vorkoster vergiftet?«
»Was ist das?«, fragte Paolo.
»Das«, sagte ich und wies auf ein hölzernes Schild mit einer in Goldfarbe ausgeführten Malerei einer Krone, »ist der beste Goldschmied der Stadt.« Ich deutete auf den Davidsstern, der unter der Krone aufgemalt war. »Und wahrscheinlich auch der beste der ganzen jüdischen Diaspora.«
Der Laden befand sich im südlichen Drittel der Vorstadtgasse, fast schon zwischen den Palästen der ausländischen Gesandten. Dass er dort lag, wo die Kanonikergasse eben begonnen hatte und parallel zur Vorstadtgasse verlief, sprach dafür, dass der Goldschmied einen einträglichen Umsatz machte. Gott braucht, wenn es nach den Klerikern geht, immer jede Menge Geschmeide für seine Kirchen – und für die Gewänder seiner Vertreter auf Erden.
Ein Mann stapfte die hölzernen Stufen hinauf. Er machte ein verbissenes Gesicht. An der obersten Stufe drehte er sich um und starrte in die Düsternis zurück, aus der er nach oben geklettert war. Er schien mit sich zu kämpfen, ob er wieder hinunterklettern sollte. Seine Hand fuhr in sein Wams und ertastete etwas. Dann warf er sich herum, rannte beinahe in Paolo und mich hinein, zog den Kopf zwischen die Schultern und stelzte mit hastigen Schritten an der Hausmauer entlang, bis er um die nächste Ecke bog. Paolo starrte ihm hinterher.
»Geh rein«, sagte ich und drängelte ihn sanft die Stufen hinunter. »Außerdem ist er ein Pfandleiher.«
»Ein schönes Stück«, sagte der Goldschmied. »Ein wirklich schönes Stück. Sehen Sie nur, hier …«, er schob die Tranfunzel näher heran, »… der Ring selbst ist wie ein Ast geformt, nein, eher wie verschlungene Wurzeln, und dabei so glatt und abgerundet, dass man sich nicht verletzt, und hier … das Blatt, das den Stein hält …«, er brachte sein Auge so nahe an das Schmuckstück heran, dass ich erwartete, die Tranfunzel würde jeden Moment sein Haar abzufackeln beginnen, »… es hat sogar Rippen, nein, eher wie Blattadern, und der Stein, wie eine rote Beere, nein, eher wie eine Kirsche …«
Ich streckte die Hand aus, und er ließ den Ring widerwillig hineinfallen.
»Ein sehr schönes Stück«, sagte er und musterte mich durch die Flamme seines kleinen Lichtes hindurch. »Ich kann natürlich nicht seinen gesamten Wert pfänden, nein, eher höchstens ein Zehntel …«
»Was können Sie anfertigen, das das hier übertrifft?«, fragte ich.
Die Augen hinter der Tranflamme blinzelten, und die Flamme zuckte einmal, als wäre sie ebenso überrascht wie mein Gesprächspartner. »Anfertigen?«
»Herr Vater?«, rief Paolo, der sich auf den Stufen herumtrieb und versuchte, auf einem Bein hüpfend die gesamte Länge hinauf- und herunterzukommen.
»Gleich, Paolo. Also?«
Der Goldschmied schob die Tranfunzel zögerlich beiseite. Er pflückte den Ring aus meiner Hand und wog ihn in der Handfläche. Er sah mich mit großen Augen an. »Anfertigen!?«
»Herr Vater, da kommt jemand!«
Ich schnaubte und beschloss, Paolo zu ignorieren.
»Sie sind nicht von hier, Herr?«
»Ich werde Sie nicht übervorteilen, keine Angst. Hier sind meine Bedingungen: Ich stelle Ihnen die nötige Menge Gold; die Steine, aus denen Sie diejenigen aussuchen können, die Sie brauchen, erhalten Sie ebenfalls von mir. Vor Beginn der Arbeiten erhalten Sie ein Drittel des vereinbarten Lohnes, ein weiteres Drittel, wenn wir uns über das Aussehen des Rings geeinigt haben, und den Rest bei Ablieferung.«
»Ein faires Angebot, nein, eher ein höchst anständiges Angebot, aber …«
»… aber natürlich hat die Sache einen Haken.« Ich lächelte ihn so freundlich wie möglich an. »Es ist nämlich so …«
»Herr Vater!«
»Paolo, so lass mich um Himmels willen mit dem Mann hier sprechen!« Der Goldschmied hob den Finger, um etwas zu sagen, aber ich schnitt ihm das Wort ab. »Der Haken ist, dass Sie für die Arbeit nur höchstens acht Wochen Zeit haben – bis zum Fest der heiligen Radegundis, Mitte des Erntemonats.«
Der Goldschmied breitete die Arme aus und machte eine halbe Körperdrehung, die seinen engen Laden umfasste. »Herr, Sie wissen doch, dass Sie sich hier bei einem jüdischen Goldschmied befinden?«
»Habe ich gegen eines Ihrer Gebote verstoßen? Tut mir Leid, es geschah nicht mit Absicht.«
»Die Seniores unserer Gemeinde haben im letzten Jahr einen Vertrag unterzeichnen müssen, der unsere Rechte in Krakau und der Umgebung schlimm beschnitten hat. Sehen Sie, die Wohlhabenden unter uns dürfen nur noch das Pfandleihgeschäft betreiben – und auch das nur an zwei Tagen in der Woche. Sie haben Glück, nein, eher richtigen massel, dass heute ausgerechnet einer der Tage ist, sonst hätten Sie mich gar nicht angetroffen. Die Armen unter uns dürfen noch ihre selbst hergestellten Mützen, Hauben und Kragen verkaufen.« Er seufzte. »Anfertigen, Herr? Nicht bei mir, so Leid es mir tut.«
Ich starrte ihn an. »Sie sind mir empfohlen worden«, sagte ich in Ermangelung von etwas Intelligentem.
»Von wem, wenn ich fragen darf?«