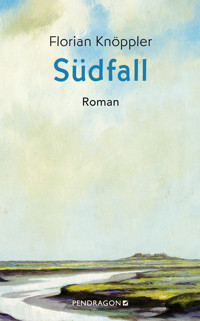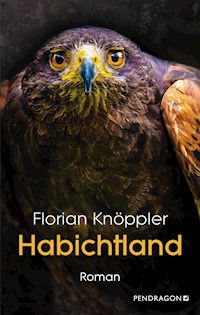Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein holsteinisches Dorf in den 20er Jahren: Das Dorf und der kleine elterliche Hof in der Elbmarsch sind seine ganze Welt: Der empfindsame Hannes leidet unter seinem gewalttätigen, unberechenbaren Vater und den Schikanen in der Schule. Zuflucht findet er allein in der Natur und in seinen Büchern. Doch Hannes beginnt, sich zu wehren, und unversehens gerät er dabei in die politischen Spannungen der Dorfgemeinschaft. Dabei will er doch eigentlich nur eines - die geheimnisvolle Mara für sich gewinnen, die so ganz anders ist als all die Mädchen im Dorf. Ein anderes Leben, denkt Hannes, ein anderes Leben muss doch möglich sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Florian Knöppler • Kronsnest
Florian Knöppler
Kronsnest
PENDRAGON
Meiner Mutter,
meinem Vater
1
Hannes befühlte die geschwollene Wange. Seit Stunden schon hockte er dort auf dem Hofpflaster und kratzte das Unkraut aus den Fugen. Vor ihm auf den Steinen lag Hermann, der Kater, und gähnte. Sein graues Fell schimmerte in der Sonne.
Es war einer der ersten heißen Tage in diesem Jahr. Man hörte nichts außer dem Schrei eines Bussards im Dunst hinter der Krückau. Bald ging es mit der Ernte los, die Gerste, die schon gelb wurde, das Heu, der Weizen. Den ganzen Tag mit dem Vater auf dem Feld. So war es meistens in den Ferien.
Hannes sah prüfend zur Sonne und erschrak. Er hatte kaum etwas geschafft. Der Vater würde gleich da sein. Er nahm das Messer wieder in die Rechte, schnitt, kratzte, pulte, schob sogar Hermann zur Seite.
Der Kater stand auf und ging gemächlich zur Scheune. Für ihn gab es kein Unkraut. Und keinen Vater. Der ließ ihn in Ruhe, solang er im Stall die Mäuse und Ratten wegfing. Nur einmal war es anders gewesen. Der Vater hatte sich geärgert und nach Hermann getreten. Mit einem Satz war der Kater im offenen Fenster, drehte sich um, fauchte und duckte sich, als wolle er dem Vater ins Gesicht springen. Der hielt ungläubig inne, bis Hermann nach draußen verschwand.
„Hannes! Kaffee!“
Schnell leerte Hannes den Unkrauteimer zwischen den Brennnesseln aus und lief nach drinnen.
„Komm. Vater ist gleich auf dem Hof.“ Die Mutter hatte gesehen, dass er mit dem Unkraut nicht fertig war. Eilig wusch er sich Hände und Gesicht im Bottich, setzte sich an den Tisch und wartete. Es war schummrig in der Küche. Es roch nach Kompott und ein bisschen nach Schimmel.
Der Vater ließ sich auf seinen Platz fallen und schenkte sich vom Gerstenkaffee ein. Gleich würde er vom Unkraut anfangen. Aber nichts geschah. Nicht einmal wütend sah er aus, wenn auch nicht zufrieden oder vergnügt, wie er es an guten Tagen sein konnte. Er wirkte bedrückt, die Stirn gerunzelt, die Augen unstet. Vielleicht war die Mutter der Grund, denn die saß mit reglosem Gesicht da und aß. Eine schöne Frau, sagten die Nachbarn, dickes rotblondes Haar und hohe Wangenknochen.
Der Vater schaute zu ihr hin.
„Mit der Deichsel war’s nicht so wild. Ging schnell.“
Die Mutter sah auf, sagte: „Gut“ und löffelte weiter ihr Apfelkompott. Sie ist ihm immer noch böse wegen heute Morgen, dachte Hannes. Das Essen schmeckte jetzt noch besser, er nahm nach. Immer wieder linste er zum Vater, er konnte sich nicht sattsehen an seinem Gesicht, seinem ruhelosen Blick.
Der Vater schob den Teller weg, dass es schepperte, und stand auf.
„Ich guck’ noch mal nach Resi.“ Kurz darauf war er wieder an der Tür. „Los, Hannes! Es muss raus.“
Im Kuhstall war es kühl und es roch nach Stroh und Fruchtwasser. Resi lag in einer Ecke, stöhnte und riss die Augen auf. Der Vater krempelte die Ärmel hoch, Hannes lief los, um Wasser und Seife zu holen. Er beeilte sich, aber auf dem Rückweg blieb er auf der Diele stehen. An einem Haken hing der Geburtshelfer, ein Stab mit Ösen und Schnüren, den man bei schwierigen Geburten brauchte. Hannes setzte den Eimer ab, nahm den Geburtshelfer vom Haken und schob ihn hastig unter eine Pferdedecke, die am Boden lag. Dann rannte er in den Stall.
„Gib schon her!“ Der Vater wusch sich und führte den Arm bis zur Schulter in die Kuh ein. Hannes sah ihm zu, die Hände hinterm Rücken zitterten. Mit geweiteten Augen schaute der Vater auf irgendeinen Punkt an der Bretterwand gegenüber und ertastete das Innere der Kuh. Es war wie immer. Aber je länger es dauerte, umso stärker wuchs die Hoffnung, der Vater würde diesmal die Vorderbeine des Kalbs nicht finden. Vielleicht lag es verkehrt herum oder quer. Der Vater schob und zog an etwas, ließ sich aber keine Unruhe anmerken. Wie oft hatte er ihn sagen hören: „So leicht stirbt mir kein Kalb bei der Geburt.“ Jetzt war es vielleicht so weit.
Hannes hielt Resi am Strick und stellte sich vor, wie der Vater sich immer weiter mühte und schließlich ein totes Kalb herauszog. Bisher hatte er, wenn es um die Tiere ging, immer mit dem Vater mitgefiebert, trotz allem. Aber jetzt war es anders, jetzt hoffte er nur, dass der Vater endlich eine Niederlage einstecken musste.
Der Vater zerrte und drückte.
„Scheiße. Alles durcheinander … sind zwei. Hol mal den Geburtshelfer.“
Er lief los und blieb vor der Pferdedecke stehen. Einen Moment lang wartete er, dann schrie er mit geschlossenen Augen: „Hier hängt nichts.“ Auf dem Weg zurück kam ihm der Vater entgegen. „Kann doch nicht sein, bist wohl wieder blind.“ Er starrte auf den Haken, rannte in die Werkstatt. Hannes wühlte in einem Regal herum und zwang sich, nicht auf die Pferdedecke zu sehen.
„Na ja, muss dann eben ohne gehen“, presste der Vater hervor und lief zurück in den Stall.
Hannes hielt wieder Resi. Der Vater versuchte, eine Seilschlinge um die Kälberbeine zu legen, aber sie rutschte immer wieder ab. Hannes dachte an die geflochtene Schnur in der Scheune, eine gute Schnur, aber sagte nichts. Seine Finger krallten sich um das Halfter der Kuh. Dem Vater lief immer mehr Schweiß über die Lippen, bis Hannes es nicht mehr aushielt.
„Ich hab ’ne gute Schnur.“
Mit dieser Schnur klappte es, sie legte sich fest um die Gelenke. Der Vater wand das Ende um sein Handgelenk und zog erst vorsichtig, dann mit Kraft. Zwei schmale Vorderbeine kamen zum Vorschein, ein Maul mit heraushängender Zunge, ein dampfender Körper. Das Kalb fiel ins Stroh. Es bewegte sich nicht, es war tot. Beim zweiten Kalb brauchte der Vater kaum zu ziehen. Es glitt zu Boden und blieb reglos liegen. Aber man hörte seinen Atem. Es röchelte unregelmäßig. Hannes wischte ihm den Schleim vom Maul, goss kaltes Wasser über den Körper und rieb ihn mit Stroh ab. Die ganze Zeit stand der Vater reglos hinter ihm.
„Das wird nichts mehr, kannst du vergessen.“
Einen Augenblick später hörte Hannes die Tür hinter sich zuschlagen und war allein.
Er rieb sich den Schleim von den Händen. Wenn er es doch schaffen würde! Er stellte sich den Vater vor, wie er das saufende Kalb sähe und nicht wüsste, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Er sah das Gesicht der Mutter, die Falten um ihre Augen, wenn sie strahlte.
Früher hatte er sie öfter so gesehen, am häufigsten, wenn der Vater wie ein zu groß geratener Junge aussah. Vor vielen Jahren hatte er für Hannes eine Baumhütte gebaut und der Mutter von oben eine Kusshand nach der anderen zugeworfen. Die Mutter hatte mit dem Kopf geschüttelt und gelacht.
Das Baumhaus. Ein Holzboden, ein Geländer, ein stabiles Dach. Sogar ein paar Querhölzer als Kletterhilfe hatte der Vater an den Stamm genagelt. Welcher andere Vater hatte sich Zeit für so etwas genommen? Ein wunderbarer Tag. Bis zu dem Moment, als alles fertig war. Zitternd war Hannes unten stehengeblieben. Es war zu hoch gewesen – und er zu ängstlich.
Das war lange her. Hannes zerriss einen Strohhalm und malte sich wieder aus, das Kalb würde auf die Beine kommen und er allein hätte es geschafft. Die Mutter würde hinter ihm stehen und sagen: ‚Mein guter Junge, mein tüchtiger Junge.‘ Später auf der Straße würde sie es zwei Nachbarn erzählen, die gerade zusammenstanden, Hein Ossenbrüggen und dem alten Jörn. ‚Ja, Clara, mit dem Jungen hast du Glück gehabt, erst 15, aber so ein Kerl‘, würde Jörn sagen und einen Strahl Kautabak ins Gras spucken. Hannes sah die Nachbarn vor sich, Jörns schiefe Zähne, sein Lächeln voller Anerkennung, Heins Nicken, das immer langsam war. Er hörte ihre Stimmen, roch ihren Atem. So war es immer. Wenn er allein war und träumte, erlebte er alles in zahllosen Einzelheiten, im Bett, auf dem Weg zur Schule, beim Hühnerfüttern. Und oft war es deutlicher, als ihm lieb war, verfolgte ihn, ließ ihn nicht los.
Das Kalb hustete, er nahm eine Schüssel vom Fenstersims und fing an die Biestmilch abzumelken. Resi leckte das Kalb. Es war nichts zu hören, außer dem Strahl der dicken gelben Milch in der Schüssel. Er tauchte den Finger ein und steckte ihn dem Kalb ins Maul, wieder und wieder, aber es schluckte nicht, auch nicht, als er ihm die Milch mit einem Löffel einflößte. Alles lief ihm aus den Winkeln wieder heraus.
Wenn die Schüssel leer war, molk er neu ab und begann von vorn. Die Hosenbeine waren nass und klebten von der verkleckerten Milch. Das Sonnenlicht auf der Bretterwand leuchtete schon gelb, es musste fast Abend sein. Warum hatten sie ihn nicht zum Melken gerufen?
Das Kalb hob den Kopf. Vielleicht war doch ein wenig Milch in seinen Magen gelangt. Er molk noch einmal ab, löffelte weiter und legte sanft den Finger an die Kehle. Das Kalb schluckte, zuletzt fast regelmäßig.
Später am Abend saßen Vater und Mutter beim Tee auf dem Sofa. Sie nähte Knöpfe an, er blätterte in alten Zeitungen. Hannes beobachtete die beiden von der Diele aus durchs Guckfenster. Er selbst hockte auf der Truhe und schnitzte an einem Pfeil für seinen Bogen. Aber er schaute mehr nach den Eltern als aufs Messer. Eine Überschrift auf der Zeitung war zu erkennen, irgendwas über Hindenburg, dann eine Tänzerin mit hauchdünnem Kleid und Zylinder auf dem Kopf. Seit wann hatten sie solche Frauen in den Zeitungen auf dem großen Stapel? Endlich öffnete sich die Tür und sie kamen heraus.
„Komm, Hannes, wir gucken noch mal, die Nachgeburt muss jetzt raus sein“, sagte die Mutter.
Er holte tief Luft und sprang von der Truhe.
Tatsächlich lag die Nachgeburt schon im Stroh. Das Kalb mühte sich hochzukommen, fiel in die Streu zurück und schaffte es schließlich, als der Vater ihm half. Das Kalb blieb stehen, es machte sogar einen kleinen Schritt. Da trat der Vater zurück und drehte sich langsam zu ihm um, sah ihm in die Augen, schob die Unterlippe vor und nickte. Hannes senkte den Blick und vergrub die Hände tiefer in den Taschen.
In der Nacht träumte er vom Vater: Er schlug mit dem Vorschlaghammer einen Zaunpfahl ein. Das Holz splitterte unter den Schlägen, aber der Vater kümmerte sich nicht darum, schlug weiter, bis nur noch ein paar zerfranste Reste aus der Erde ragten. Hannes schreckte hoch und rieb sich die Augen. Er hörte ein Geräusch. Es musste nebenan bei den Eltern sein. Er horchte und verstand. Ein Bettpfosten schlug gegen die Außenwand, der Vater atmete stoßweise, immer lauter. Von der Mutter war weniger zu hören.
Am Morgen noch war Hannes zum Dielentor hereingewankt und hatte das Entsetzen im Gesicht der Mutter gesehen. Der Vater hatte ihn geschlagen, weil ihm die Deichsel zerbrochen war. Immer wieder, völlig außer sich. Und jetzt lag sie dort drüben im Bett, nur ein paar Meter entfernt, und schlang die Arme um den Vater.
Hannes presste Lippen und Zähne aufeinander, seine Kehle wurde eng, Tränen brannten hinter den Augen. Leise stieg er aus dem Bett, griff sich Hose, Jacke und Schuhe und schlich hinaus bis ans Ende der Diele, wo Böltje auf seiner Decke lag. Der Hund hob den Kopf, sah ihm zu, wie er sich anzog, und wollte aufstehen.
„Nein, Böltje, geht nicht raus“, flüsterte Hannes, kniete sich hin und streichelte ihm über das Fell.
Im Kuhstall roch es scharf nach Mist und Urin. Resi und das Kalb lagen dicht beieinander in ihrer Ecke. Hannes setzte sich in den Strohhaufen gegenüber und sah zu, wie die Tiere, grau vom Mondlicht, dösten. Gleichmäßiger Wind war aufgekommen, über dem Dach rauschten die Bäume.
Es war hell, als ihn etwas an der Schulter berührte, die Sonne schien in den Stall, die Mutter setzte sich neben ihn und nahm einen Halm in die Hand.
„Es tut ihm leid“, sagte sie nach einer Weile. Dann sagte sie nichts mehr. Und er wusste nicht, was er hätte antworten können, die Gedanken fielen immer wieder auseinander.
Die Mutter war schon fast zur Tür heraus, als sie sich besann und zurückkam.
„Weißt du“, begann sie vor ihm stehend, „Vater kann … er redet nicht …“
Hannes wartete gespannt.
„Als Junge hat er … da hat er manchmal wochenlang nichts gesagt.“
Es war Sonntag, ein ganzer freier Tag. Das erste Melken war erledigt, der Vater hatte „Lass man!“ gesagt, als er sich Mistforke und Karre greifen wollte, und die Mutter hatte „Lauf rüber zu Thies“ gerufen, „und nimm dir Brote mit, fürs Mittag.“ Also lief er zur Scheune, wo er Angelrute und Reuse liegen hatte.
Der Hof von Thies lag verlassen da. Es war ein bescheidenes Gebäude mit rissigen Mauern und verfaultem Fachwerk, eingezwängt auf einem schmalen Stück zwischen Weg und Deich. Der Vater hätte solche Balken in der Wand längst ausgewechselt. Nicht einmal ein anständiges Plumpsklo hatten sie hier, nur einen Balken im Kuhstall.
Auf der Diele schärfte jemand eine Sense. Hannes machte das Tor auf und sah Thies’ Großvater, einen alten Mann mit knochigen Schultern und schwarzen Handflächen. Das kam vom Pech, mit dem ihm der Schuster die Risse in den Händen füllte. Thies sei schon länger weg, sagte der Alte, zum Angeln an der Krückau.
Hannes wusste, welchen Weg er nehmen musste, erst den Deich entlang fast bis Fleien und dann hinüber ins Vorland zwischen Deich und Fluss, dessen Nebenarme die Äcker und Weiden zerteilten. Er ging schnell, die Rute auf der Schulter wippte. Fast kam es ihm vor, als schwebe er. Die Sonne schien, das Kalb war über den Berg, die Mutter stolz, und der Vater hatte „Lass man!“ gesagt.
Auf den Feldern stand das Korn, bis zu den Höfen der Großbauern von Neuendorf. Inmitten der Ebene lag der Hof der von Heesens, der reichste in der Umgebung, ein mächtiger Giebel, halb verdeckt von den Bäumen. Haupthaus und Scheune standen dort zwischen den Getreidefeldern wie ein stolzer Mittelpunkt der Gegend und doch abseits. Vielleicht aber hatten die Erbauer gerade dies gewollt: genügend Abstand zu allen Nachbarn, ob reich oder arm.
Wahrscheinlich hielt das Wetter bis zur Ernte und das Korn blieb stehen. Wer auf diesem fruchtbaren Boden einen Acker besaß, konnte sich glücklich schätzen. Der Vater hatte im Dezember ein Stück gekauft. Eines zwar, auf dem noch im Frühjahr das Wasser zwischen den Binsen stand, aber immerhin eine Fläche binnendeichs, auf der nicht plötzlich eine der Sturmfluten, die immer wieder von der Elbe in die Krückau drückten, die Ernte verdarb. Was war da geredet worden, auch in der Schule: „Viel zu teuer, und so ein Sumpfloch.“ Zuerst hatte Hannes wieder tun wollen, als habe er nichts gehört, so wie sonst, wenn es gegen ihn ging, aber dann hatte er den Vater doch verteidigt. Auf den Bauern komme es an, auf den Bauern, nicht aufs Land. Sie würden schon sehen, die neuen Gräben waren längst gezogen, das Wasser floss schon ab. Immer mehr Höfe gingen kaputt, besonders die kleinen, aber ihrer würde nicht darunter sein. Das sagte auch der Vater manchmal und fügte fast immer wie eine Gebetsformel hinzu, entscheidend sei es, etwas zu tun, wenn man etwas wollte, egal worum es ging. Zu kämpfen.
Die Pappelreihe mit ihrem alles übertönenden Rauschen hatte er hinter sich gelassen und die ersten Schritte den Deich hinauf gemacht, da sah er oben Eggert und Albert sitzen, zwei Brüder, die in einer baufälligen Kate in Spiekerhörn wohnten. Die Mutter war Magd in Raa, einen Vater gab es nicht. Als die Jungen ihn entdeckten, standen sie auf und stemmten die Hände in die Hüften.
„Na, hat dein Alter dir auch mal frei gegeben?“, riefen sie ihm entgegen.
Er ließ sich Zeit mit der Antwort, bis er sie erreichte. „Ja.“
Eggert verzog das breite Gesicht zu einem Grinsen.
„Komm, wir fangen ein paar Frösche, für ein bisschen Froschschenkelmus, soll lecker sein“, sagte Eggert und küsste sich die dreckigen Fingerspitzen.
Kurz vor den Sommerferien hatte Hannes die beiden an der Fähre getroffen. Sie waren gerade dabei gewesen, Frösche in einen Eimer zu sammeln, ihnen ein Bein auszuzupfen und sie nebeneinander an eine Linie zu setzen. Froschrennen nannten sie das. Linksbein gegen Rechtsbein, Halbbein gegen Ganzbein. Die Frösche schleppten sich über das Pflaster, die Jungen johlten. Er hatte getan, als sähe er die Klassenkameraden nicht, und war weiter zur Fähre gegangen. Die anderen waren zwar fast zwei Jahre jünger, aber so groß wie er und im Raufen geübt. Doch nach ein paar Schritten war er mit einem Krampf in der Brust stehengeblieben, war zurückgegangen und hatte mit aller Wucht gegen den Eimer getreten. Er wusste, er war schnell, aber am Ende war es doch knapp geworden, als er zu Hause in die Scheune stürzte und den Riegel schloss.
„Na, was sagst du zu dem Vorschlag?“, fragte jetzt Albert, aber er antwortete nicht und drängte sich zwischen den beiden hindurch. Sie kamen hinter ihm her, gingen nun rechts und links von ihm, schubsten ihn, um zu sehen, was er tat, bis sie sich auf ihn warfen und mit dem Gesicht in den Dreck drückten.
Alles Wehren half nichts. Eggert hockte lachend auf seinem Rücken, schlug ihm auf den Hinterkopf, zog dicke Rotzflocken in der Nase hoch und ließ sie auf seinen Nacken fallen. Schließlich durchwühlte er seine Jackentaschen, bis er einen rostigen Nagel hervorzog.
„Ach, was haben wir denn hier?“, sagte er, nahm den Nagel und zog ihn fest über Hannes’ nackten Oberschenkel.
Es dauerte eine Weile, bis die Brüder genug hatten und ihn ziehen ließen.
Thies fand er gleich am ersten Seitenarm der Krückau. Schon von weitem sah er ihn dort sitzen, an eine Kopfweide gelehnt, die Mütze im Nacken. Als er Hannes bemerkte, sprang er auf.
„Wie hast du das denn gemacht?“, fragte Thies, wartete die Antwort aber nicht ab und hielt dem Freund eine verrostete Dose entgegen. Die berühmte Köderdose, mit den angeblich besten Würmern der ganzen Elbmarsch. Hannes nahm sich einen und legte die Angel aus.
Die Korkstücke, die ihnen als Schwimmer dienten, tanzten auf den Wellen, Böen strichen übers Wasser und verschwanden. Dies zu beobachten, wurde er sonst nie leid, heute sah er die Wasserfläche kaum. Er sah Thies, der den Deich hochstieg, hinter ihm das Rauschen der Pappeln, und oben Eggert und Albert, die auf ihn warteten.
„Na, hat dein Alter dir auch mal frei gegeben?“, riefen sie noch einmal.
Thies kam näher, die beiden Brüder versperrten ihm den Weg und grinsten. ‚Ja‘, sagte Thies und rammte seine Stirn auf Eggerts Nase. Eggert taumelte zu Boden, Albert wich zurück und Thies ging weiter. Die Angelrute wippte in seiner Hand.
Es war merkwürdig mit Thies. Ihn ließen viele Dinge kalt. Er war ein Kerl, der wusste, was er konnte. Die Jungen wollten seine Freunde sein, die Mädchen fanden ihn hübsch, aber er schien sich dafür nicht zu interessieren. Manchmal heckte er seltsame Streiche aus, doch er konnte auch stundenlang herumsitzen, etwas schnitzen oder vor sich hin starren. Alle hielten Abstand, wenn sie ihn so sahen.
„Dein Vater?“
Verständnislos sah Hannes den Freund an, bis der sich an die Wange tippte.
„Ja, gestern.“
„Und das da am Bein?
„Eggert und Albert“, sagte er und erzählte, wie ihm die Brüder zugesetzt hatten. Er wusste, was Thies dachte und gleich sagen würde. Eggert müsse man nur einmal was aufs Maul geben, dann sei Ruhe.
Aber Thies hörte nur zu.
In der Ferne sah man Frachter von der Elbe in die Krückau fahren, mit Gerste für die Mühle. Wie oft sie sich schon ausgemalt hatten, sie hätten ein solches Schiff und wären ihr eigener Herr. Oder besser noch, sie heuerten in Hamburg an und gingen auf große Fahrt, wie der alte Jörn, der als Steuermann die halbe Welt gesehen hatte, fremde Länder, wo die Menschen an weißen Stränden lebten, die Haut so dunkel wie nasses Eichenholz. Warum Thies von zu Hause weg wollte, konnte er nicht verstehen. Seine Eltern waren freundliche Leute.
„Komm, wir holen uns Kirschen“, sagte Thies, klappte sein Messer zusammen und sprang auf die Beine. Das ganze Schwemmland zwischen Deich und Fluss schien an diesem Sonntag menschenleer. Wiesen und Obstgärten, Felder und Reetflächen wechselten sich ab. Häuser konnte man hier nicht bauen, wegen der Sturmfluten, die von der Nordsee über die Elbe hereindrückten. Am Himmel zogen vereinzelt kleine Wolken. Schon als Kind hatte Hannes sich über solche Wolken gefreut, besonders, wenn er in seinem Versteck hinter dem Schuppen lag. Dann wurde es ruhiger im Kopf, die Geschichten, in die er sich hineinträumte, verliefen friedlicher, und wenn es doch mal Streit und Kampf gab, gewannen die Guten.
Die Kirschbäume, bei denen sie bald ankamen, hatten früher Jörn gehört, der immer großzügig war: „Pflückt euch man, ich hab’ genug.“ Aber vor zwei Jahren hatte der Sturm ihm das Dach weggerissen und der Obstgarten war an Lübben gegangen, einen Großbauern in Neuendorf, zu einem Spottpreis.
Hannes bog einen Ast herunter und steckte sich drei Früchte gleichzeitig in den Mund. „Hat er eigentlich noch Schulden bei Lübben?“
„Wer?“
„Jörn.“
Thies nickte.
„Ja, glaub schon. Der Obstgarten hat ja gerade mal für ein halbes Dach gereicht. Der Rest wurde dann ein schöner Kredit mit schönen Zinsen.“ Thies spuckte einen Kern ins Gras. „Eigentlich müsste man den ganzen Baum leermachen oder alle Bäume.“
Hannes kaute und dachte an Jörns Dach kurz nach dem Sturm. Das meiste Reet weg, der Rest kreuz und quer zwischen den Latten. Sein Vater hatte Jörn als erster geholfen, schon am nächsten Morgen, obwohl seine Rüben in der Erde zu verfaulen drohten und das Wetter für die Ernte gut war. In schier unglaublichem Tempo hatten Jörn und Vater die Reetreste heruntergerissen und alles fürs neue Dach vorbereitet. Auch Hannes hatte mitgeholfen, voller Stolz auf den Vater.
Mit ein paar Kirschen in den Taschen traten sie den Rückweg zu den Angeln an. Sie schwiegen, bis Thies plötzlich sagte, sie müssten mal wieder Jörn besuchen, er wolle noch mehr über Amerika hören, über dieses endlose Land, das niemandem so recht gehörte, wo man Höfe gründen konnte, die zwanzigmal größer waren als der von Lübben.
Immer wieder fing er von Amerika an, dachte Hannes. Wieso wollte Thies weg? Er hatte ihn noch nie gefragt, noch nie gewagt zu fragen, denn es war seit Jahren ausgemachte Sache, dass sie zusammen losziehen würden, sobald sie groß genug wären.
„Sag mal“, hörte er sich plötzlich sagen, „warum eigentlich? Warum willst du weg?“
Thies sah ihn von der Seite an und zuckte mit den Schultern.
„Ich glaub … na ja, irgendwann muss ich hier weg.“
„Wieso?“
Thies kniff die Augen zusammen. „Na ja, wenn man sich so umguckt: Die Großen teilen das Land unter sich auf, und die Hilfsgelder auch. Da haben sie schon recht, die Leute vom Stahlhelm oder Wehrwolf. Dieser Parteienstaat, der macht nichts für uns kleine Bauern. Wir müssen buckeln im Matsch und haben am Ende nicht mal genug Geld für ein bisschen Medizin.“
Hannes hörte auf zu atmen. Es war das erste Mal seit Langem, dass Thies auf seine kleine Schwester anspielte. Seit einem Jahr schon war Wiebke krank, manchmal musste sie wochenlang das Bett hüten. Anfangs hatte der Arzt gesagt, Wiebke gehöre eigentlich für eine Weile fortgeschickt, in ein besonderes Krankenhaus. Aber später war davon nicht mehr die Rede gewesen.
Sie waren bei den Angeln angekommen, die Korkstücke schwammen friedlich auf der gekräuselten Fläche. Hannes wollte seine Angel herausziehen, aber sie hing unter Wasser fest. Wahrscheinlich wieder mal irgendwo verhakt, dachte er, als es plötzlich an der Rute zog, so unerwartet, dass sie ihm fast entglitten wäre. Die Rute bog sich, der Fisch zog und zerrte, mal in die eine, dann in die andere Richtung. Er stemmte die Hacken ins Ufer und hoffte, dass die Schnur hielt. Sie hielt, der Fisch wurde schwächer, bis er ihn endlich ans Ufer ziehen konnte.
Es war ein Hecht, einen solchen hatten sie noch nie gefangen. Bald einen Meter groß, eine Kostbarkeit. Hechtklöße aß der Vater für sein Leben gern. Was wohl würde er sagen, wenn ein solches Tier plötzlich auf dem Küchentisch lag?
Die Sonne stand schon tief über den Bäumen. Thies sprang auf und suchte seine Sachen zusammen.
„Ich muss los.“
„Und wer nimmt ihn mit nach Hause?“
„Du, dann muss ich ihn nicht tragen.“
Die Mutter schob eine Karre über den Hof, als Hannes zu Hause ankam. Sie sah müde aus.
„Na, war’s gut?“
„Ja.“ Er achtete darauf, den Beutel mit dem Hecht vor dem Körper zu tragen, aber die Mutter hatte keinen Blick dafür.
„Lauf nach hinten. Vater ist schon beim Melken.“
Schnell brachte er den Beutel in die Küche und lief auf die Weide. Der Vater saß auf einem Schemel zwischen den Kühen, ein massiver Rücken in einer verblichenen Jacke. Er blickte nicht einmal auf. Es musste etwas passiert sein.
Vorsichtig horchte Hannes beim Melken nach hinten, wo der Vater saß, aber es blieb still, merkwürdig still. Keine Ermahnungen an ihn, kein Fluchen über eine Euterentzündung, keine Prügel für Kühe, die gegen den Eimer traten. Nichts.
Das Kalb lag zitternd im Stroh, als er nach dem Melken in den Stall kam. Fieber. Wieder molk er ab und flößte dem Kalb die Milch ein. Ein wenig schluckte es, der Rest floss daneben. Er biss die Zähne aufeinander, dass sie schmerzten. Das Kalb hatte die Augen geschlossen, Resi fraß von ihrem Heu. Wenn das Kalb starb, war alles umsonst und nichts würde sich ändern. Es würde sich ohnehin nie etwas ändern.
Das Prasseln dicker Tropfen weckte ihn. Es war noch fast dunkel, das kleine Quadrat des Himmels hob sich nur schwach gegen das Dunkel der Kammer ab. Das Wetter war umgeschlagen, scharfe Böen trieben Regen vor sich her. Das Bettzeug roch muffig wie im Herbst. Er lag da, die Arme hinter dem Kopf, und dachte an gestern, an den Morgen im Stall, den zufriedenen Vater, die Sonne über dem Vorland der Krückau. Jetzt ging auch dort der Regen nieder.
Müde schloss er noch einmal die Augen, aber sofort sah er das fiebernde Kalb und deutlich jeden Wirbel in dessen Fell. Jetzt lag es wohl schon leblos da. Warum konnte es nicht einfach dunkel bleiben, zu dunkel zum Melken, zu dunkel für alles?
Das erste Licht sickerte in die Kammer, als er sich beruhigte. Man musste was tun, wenn man was wollte. Was also stand heute an? Die Messer des Mähbalkens mussten geschärft werden, damit sie fertig waren, wenn Heuwetter kam. Genauso die Sicheln fürs Korn. Und der Boden fürs Heu war noch voller Kornsäcke und Harken, an denen Zinken fehlten.
Mit einem Ruck schlug er die Decke zurück, zog sich an, ging ohne zu zögern am Kuhstall vorbei nach draußen auf den Hof. Der Regen fiel dicht wie ein Vorhang, nur manchmal von Böen gelüftet. Er lief zur Scheune, stieg auf den Heuboden und räumte auf. Er würde es allen zeigen, besonders dem Vater. Also erst einmal Säcke stapeln, Harken zur Luke, Heureste nach unten. Er war beim Fegen, als die Mutter den Kopf durch die Luke steckte.
„Ameisen im Bett?“
Er grinste verschämt. „Ich komm.“
2
Hannes nahm seine Tasse vom Regal und setzte sich. Der Vater hockte schon auf seinem Platz und las Anzeigen in den Monatsheften: Buttermaschinen und Windfegen von der Carlshütte Rendsburg. Besonders die Abbildungen solcher Maschinen schaute der Vater sich genau an, um sie dann später, wenn es nötig wurde, nachbauen zu können. Maschinen ja, sagte er immer, aber ohne Schulden, denn dafür war nicht die richtige Zeit. Die Banken durften spekulieren, die Politiker taten nichts gegen das Billiggetreide aus dem Ausland, weil sie gerne mal ein paar Maschinchen exportieren wollten. Das war denen wichtiger. Das Geld blieb in den Städten, die Leute auf dem Land waren schon lange vergessen. Aber es half ja nichts. Man musste gucken, was man selber tun konnte. Das vergaßen sie oft, die sich jetzt so laut beklagten. Die Mutter löffelte Malzkaffee in die Kanne. Etwas besser als noch am Abend sah sie aus, auf ihrer Nase funkelte ein Regentropfen.
„Wo hast du den Hecht gefangen, so ein Riesentier?“
„Am Großen Ritt“, gab er zur Antwort und schaute aus den Augenwinkeln zum Vater. Ihm war nicht anzumerken, ob er zuhörte.
Stille trat ein. Hannes trank den Kaffee, der immer etwas faulig nach dem Graben schmeckte, aus dem sie ihr Wasser holten, horchte auf den Wind, schaute auf das Holz des Tisches. Eine seltsame Maserung. Die Linien bildeten einen Walfisch, der abtauchte in die Tiefe des Meeres, wild und frei.
„Das Kalb ist hin.“
Der Vater brummte den Satz mit fast geschlossenem Mund. Wieder klang es, als ob alles seine Schuld wäre. Hannes ballte die Fäuste.
„Einen Versuch war’s wert“, sagte er und erschrak über den Trotz in seiner Stimme.
Aber der Vater stieß nur belustigt Luft durch die Nase. Die Mutter ging zum Fenster. Es wollte an diesem Morgen nicht richtig hell werden, der Wind riss die Wolken nicht auseinander, es regnete immer noch.
Hannes sah auf die Schwanzflosse des Wals und wusste plötzlich, was er als nächstes sagen würde. Genau jetzt und hier würde er fragen, ob er in den Boxverein durfte. Seit einem Jahr schon sprachen Thies und er davon. In Elmshorn gab es einen Verein, in dem auch der Vater gekämpft hatte, aber bisher hatte er sich nie zu fragen getraut. Nun schob er seine Tasse so zurecht, dass sie zwischen zwei Linien der Maserung stand, und sagte lauter als nötig: „Ich will in den Boxverein, mit Thies.“
Schon vorher war es ruhig gewesen, aber jetzt schien keiner mehr zu atmen. Die Mutter machte eine vage Geste, der Vater betrachtete die Kaffeekanne, als ob etwas auf ihr zu entdecken wäre.
„Boxverein“, wiederholte er und schüttelte den Kopf, „das ist nichts für dich.“
Nicht mehr an das Kalb denken, nahm Hannes sich vor, nur an die Arbeit und die Vorbereitungen zur Ernte. Tagelang hörte der Regen nicht auf. Mal stürzte er in dichten Kaskaden vom Himmel, mal waren es feine Tropfen, die alles zu durchdringen schienen. Er arbeitete wie noch nie, molk mit dem Vater, half der Mutter bei den Schweinen, setzte die Sensen und Sicheln instand und nähte das Zaumzeug der Pferde, ohne dass es ihm jemand auftrug. Auch abends machte er noch weiter, wenn die Eltern schon in der Stube saßen, und stellte sich vor, wie sie über ihn sprachen.
Eines Morgens streifte er gerade eine Socke über, als er den Vater auf der Diele nach dem Hund rufen hörte.
„Böltje, hierher!“
Draußen auf dem Hof musste er sein, aber er kam nicht. Die Stimme des Vaters wurde schärfer. Böltje kroch – Hannes sah es vor sich — mit eingeklemmtem Schwanz über das Hofpflaster. ‚Böltje‘, dachte er, ‚los jetzt, lauf einfach los.‘ Der Vater brüllte noch einmal, außer sich vor Wut, und lief in schweren Stiefeln nach draußen. Dann war nichts mehr zu hören, bis zu einem dumpfen Schlag. Er steckte den Kopf aus der Kammer und sah Böltje. Er lag auf der Schwelle und versuchte hochzukommen. Dann blieb er reglos liegen, vielleicht hatte er die Besinnung verloren. Schließlich kam die Mutter und legte ihn auf sein Lager, eine zerschlissene Pferdedecke. Hannes schlich in die Milchkammer nahe dem Lager, ließ die Tür einen Spalt offen, wendete den Käse, bestrich ihn mit Lake. Der Vater tauchte auf, untersuchte den Hund und schiente ihm ein Bein. Eine blutende Wunde reinigte er mit Wasser und sogar mit Schnaps, den er sonst nur an Festtagen aus dem Schrank holte.
Die Eltern wechselten in den folgenden Tagen kein Wort, die Mutter schaute am Vater vorbei, wenn sie sich auf der Diele begegneten. Nicht wirklich wütend sah sie aus, wie sonst, wenn der Vater die Beherrschung verlor, nur abwesend, fern, als gingen sie die Dinge nichts an. Hannes fröstelte, wenn er sie so sah.
Abends saß die Mutter jetzt allein in der Küche, über ein Buch gebeugt. Sie hatte viele Bücher in ihrer Truhe, neben der Wäsche, geerbt von ihrem Vater, der Pastor gewesen war. Was hatte Hannes’ Vater schon gelästert, wenn er die Mutter lesen sah, über die muffigen Papierberge, die zu nichts gut waren, nur dazu, sich für was Besseres zu halten. Im Lauf der Jahre hatte sie immer seltener ein Buch hervorgeholt. Aber nun saß sie da und las, Stunde um Stunde.
Hannes beobachtete auch den Vater genau. Der drückte den Rücken durch und setzte eine entschiedene Miene auf. Aber was für ein schlechter Schauspieler! Das Gesicht spielte nicht mit, er wirkte traurig, hilflos, ähnlich wie damals, nachdem er sich zu Hannes gesetzt und ihm beim Spielen mit seinen Stöckchen zugesehen hatte, zum ersten und einzigen Mal.
Wieder einmal hatte Hannes eine ganze Landschaft entstehen lassen, schwarze Erde für die Äcker und wilde Schösslinge, die er irgendwo ausgegraben hatte, für die Alleen. Vater, Mutter, Kind – drei einfache Stöckchen – gingen darin spazieren, arbeiteten und unterhielten sich. Bis dahin hatte der Vater diese verträumten Spiele nie beachtet, nun aber, an diesem schönen Frühsommermorgen, hatte er sich daneben gesetzt, die Beine ausgestreckt und zugesehen, bis er plötzlich aufgesprungen und davongehastet war.
Hannes bereitete weiter die Ernte vor. Es ging gut voran, nur die Heuharken fehlten noch. Er schnitt Eschenzweige für die Zinken und legte in der Klüterkammer alle Werkzeuge zurecht. Hier arbeitete er gern. Es gab alles, was man brauchte, jeder noch so alte Stechbeitel war scharf, es roch nach Kirschholz und frischen Sägespänen. Bei Sonnenschein tanzte der Schleifstaub golden in der Luft.
Mit einem lückenhaften Zahnrad in der Hand kam der Vater herein und machte sich ohne ein Wort an die Arbeit. Das war ungewöhnlich. Sonst schickte er ihn mit einer Kopfbewegung hinaus, nun begnügte er sich mit dem Platz an der Hobelbank. Manchmal schaute der Vater sogar zu ihm herüber. Hannes tat, als bemerke er es nicht. Seine Gedanken taumelten wie aufgescheuchte Fledermäuse hin und her.
Eine Schönheit, ein Engel, ein Mädchen mit Krone auf den geflochtenen Haaren, direkt über dem Taufbecken. Von seinem Platz aus sah Hannes direkt in sein Gesicht. Er ging gern in die Kirche, hier war alles schöner, als es hätte sein müssen, nutzlos verziert, die Kanzel mit ihren Schnitzereien, der Altar in seinem Schwarz und Gold. Und die Geschichten aus der Bibel, die der Pastor mit Begeisterung vortrug, konnte er schon leise mitsprechen. Sie blieben wie von selbst im Gedächtnis.
Vorne saßen die Großbauern mit ihren Familien: Lübben, Bornholdt, Magens und natürlich von Heesen. Er staunte, wie unterschiedlich sie aussahen, obwohl alle gut angezogen waren. Bei Lübben und Bornholdt saß jede Falte an ihrem Platz, bei Harm von Heesen nicht, und doch sah gerade er vornehmer aus. Irgendetwas war anders an seiner Haltung, selbstbewusster und gelassener, als müsse er niemandem beweisen, dass seine Familie die edelste war.
Der Pastor hatte mit einem Gebet begonnen, als von Heesens Sohn Jakob mit seiner Schwester Mara zu tuscheln begann. Sein Vater überging es und legte dann, als Jakob nicht aufhörte, den Arm auf seinen Rücken. Kein böses Zischen, kein wütender Blick, nur dieser Arm auf dem Rücken, weniger Ermahnung als freundschaftliche Geste. Hannes konnte sich nicht erinnern, die Hand seines Vaters je auf der Schulter gespürt zu haben.
Jakob gab nicht lange Ruhe. Jetzt schnitt er seiner Schwester Grimassen. Von ihr sah man nur den Hinterkopf, dichtes rotbraunes Haar, das an beiden Seiten wie eine Krone nach hinten geflochten war. Die Zöpfe glänzten im hereinfallenden Licht.
Nur einmal hatte Hannes mit ihr gesprochen. Sie war so alt wie er und ging auf die Bismarckschule in Elmshorn, als einziges Neuendorfer Mädchen. Aber sie grüßte ihn jedes Mal, wenn sie sich begegneten. Noch eines wusste er von ihr, sie spielte Klavier. Das hatte er gehört, als er im l etzten Winter einen Eimer Honig von Jörns Bienen bei den von Heesens abgeliefert hatte. Mitten auf der Diele war er stehengeblieben und hatte gehorcht. Perlende Klänge, festlich und schön, wie erfunden für die Pracht dieses Hofes. Keine Diele in der Gegend war so riesig, sie mochte so breit sein, wie die Diele zu Hause lang war. Am Ende kam durch die geschliffenen Gläser einer Eingangstür die Sonne herein. Rechts streckten zehn Pferde ihre Hälse aus dem Stall. Ihr Fell glänzte im Zwielicht der Diele, man sah, wie gut sie gefüttert wurden. Der Anblick dieser prächtigen Tiere drang so tief in ihn ein, dass er sie auch Jahre später noch hätte beschreiben können. Den Pferden gegenüber standen hinter einer Bretterwand die angebundenen Kühe, man hörte das vielstimmige Klimpern der Ketten. Es eilten Mägde umher, zwei Knechte schütteten Hafer in die Tröge. Hannes ging zwischen ihnen hindurch zum Wohnteil des Hauses. Er sollte den Honig bei Gudrun in der Küche abgeben, einer Tante, die als Magd auf dem Hof arbeitete. Gudrun rührte mit dem Rücken zur Tür in einem Topf. Überall waren bemalte Kacheln an den Wänden, hoch bis zur Decke. Windmühlen, tanzende Mädchen, ein Mann mit zwei springenden Hunden. Und die Küche hatte alles, was die Arbeit bequem machte. Dreckiges Wasser konnte man durch einen Ausguss nach draußen schütten, eine Schwengelpumpe machte das Wasserholen überflüssig, durch einen Schacht fielen den Mägden die Torfsoden vor die Nase.
Gudrun kam ihm entgegen und nahm ihm den Eimer ab.
„Da staunst du, was?“
Er schaute hoch zur Decke. Die Musik kam von oben.
„Das ist Mara“, erklärte die Magd, „übt wieder.“
Hannes horchte und wünschte, Gudrun würde ihn allein lassen, ihn hier stehen lassen, inmitten dieser fremden Klänge, gespielt von unsichtbaren Mädchenhänden …
„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir …“
Hannes schreckte auf, der Pastor war schon beim Segen. Auf dem Weg nach draußen sah er zwischen den Menschen auch Eggert, wie er sich nach ihm umdrehte und grinste. Die meisten Kirchgänger waren zu Fuß gekommen, aber es standen auch ein paar Pferdewagen und eine offene, mit Blumen bemalte Kutsche da.
Sie waren noch nicht weit gekommen, als die Kutsche sie überholte. Die von Heesens. Auf dem Bock saß der Großknecht, dahinter mit dem Rücken zum Bock die Kinder und ihnen gegenüber von Heesen, der knapp grüßte. Auch Jakob und Mara grüßten, lachten sogar, als wäre Hannes ein Freund. Und schließlich – ihre Gesichter waren schon klein, der Hufschlag war kaum noch zu hören – da winkten sie noch einmal, besonders Mara.
Der Vater arbeitete verbissen an den Vorbereitungen zur Ernte. Der Wind hatte auf Süden gedreht, ein starker, trockener Wind, der sogar Äste abriss. Lange würde es bei solchem Wetter nicht mehr dauern, bis sie mähen konnten.
Die Pausen verbrachte Hannes auf der Pferdedecke bei Böltje, der sich nur für seine Geschäfte nach draußen quälte. Der Vater verlor darüber kein Wort, die Mutter schien es nicht zu sehen. Sie erledigte nur das Nötigste und las in der Küche. In der Kammer türmte sich die dreckige Wäsche.
„Was machst du da?“
Die Mutter stand im Türrahmen und schaute stirnrunzelnd auf den Seifenbrocken, von dem er dünne Schnitzel abschnitt.
„Ich wollte … ich dachte, wir können mal wieder Wäsche machen.“
Die Mutter zögerte, dann nickte sie.
„Ja, hast Recht. Holst du Wasser?“
Aus der Öffnung unter dem Kessel qualmte es, als er zurückkam. Die Mutter hatte beim Anfeuern wahllos Holzstücke aufgelegt. So etwas passierte ihr sonst nie.
Hannes schnitt weiter Seife ab.
„Böltje geht’s besser“, hörte er sich plötzlich sagen, „die Beine heilen schon, Vater hat sie wohl gut geschient.“ Die Worte hörten sich seltsam an, wie die eines Fremden.
Die Mutter sah ihn erstaunt an, dann nahm ihr Gesicht einen neuen Ausdruck an, eine Art Lächeln.
„Ja, gut.“
Er atmete auf. Man konnte wieder mit ihr sprechen. Das Wasser kochte fast, als er sich zu einer Frage durchrang, die seit Tagen in ihm rumorte, seit dem Morgen bei Resi im Stall.
„Er hat nicht geredet, damals?“
Sie nickte.
„Und warum?“
„Weiß nicht. Aber sein Vater, also Opa, der …“, sie suchte nach den richtigen Worten, „… der war kein guter Mensch.“
Immer häufiger verschwand der Vater in diesen Tagen, um nach den Weiden zu schauen, die sie mähen wollten. Seit der Sache mit Böltje hatte Hannes mit ihm kein Wort gesprochen, aber bei einem Mittagessen gab er sich einen Ruck.
„Sag mal, Vater, auf was guckst du eigentlich beim Wetter?“
Der Vater stutzte.
„Auf die Wolken, aufs Abendrot und die Schwalben, aber das weißt du ja. Und darauf, wie klar die Sicht ist.“
Aus den Augenwinkeln linste Hannes zur Mutter. Sie senkte den Kopf und schien ein Lächeln zu unterdrücken.
„Morgen geht’s los!“ Der Vater schaute der Mutter gerade ins Gesicht, sie wich dem Blick nicht aus.
In diesem Jahr, dachte Hannes, war alles anders, auch für ihn. Er hatte nicht auf Regen gehofft. Die Mutter schickte ihn zu Thies und zum alten Jörn. Die beiden halfen ihnen oft, Jörn sowieso, er brauchte immer Geld. Und Thies war dabei, wenn sein Vater nicht zur gleichen Zeit Heu machte.
Hannes’ Vater schätzte Thies, er war kräftig und zäh, genauso wie er aussah. Die Mutter mochte ihn sogar richtig. Früher hatte sie ihm oft über den Kopf gestrichen, heute gab sie ihm jedes Mal die Hand, wenn er auftauchte. Gerne hätte sie mehr Kinder gehabt, das wusste Hannes. Bei seiner Geburt musste etwas schiefgelaufen sein.
Auf dem Rückweg vom alten Jörn überlegte er, ob die anderen Bauern bald auch mähen würden. Der Vater hatte den Ruf, immer zur richtigen Zeit anzufangen. In einem Jahr hatte er zu mähen begonnen, als das Barometer noch im Keller war und sich tagelang nicht die Sonne gezeigt hatte. Die Nachbarn hatten nur den Kopf geschüttelt, aber am Ende war er der einzige gewesen, der Heu ohne Regen einfuhr. Manche hatten wochenlang ihre immer dunkler werdenden Schwaden gewendet.
Hannes lag wach, wälzte sich von einer Seite auf die andere, ging immer wieder den Balkenmäher durch. War alles in Ordnung? Es war ein Gerät, das leicht kaputtging, selbstgebaut, ein Einachser mit Pferd davor und einem Mähbalken, der über die Räder angetrieben wurde. Waren die Messer richtig gespannt, die Treibriemen intakt, alle Lager gefettet? Früher war ihm so was egal gewesen.
Er erwachte früh. Als er in die Küche kam, war der Vater schon da. Hannes setzte Wasser auf und holte die Tassen vom Regal. Sie setzten sich und warteten auf den Gerstenkaffee. Ab und an begegneten sich ihre Blicke und es war klar – er bemerkte dies mit einem Herzklopfen – dass sie beide an das Gleiche dachten, an die Ernte, die Geräte und ans Wetter.
Der Kaffee stand dampfend vor ihnen, als der Vater ihn nach den Heuharken fragte.
„Alle in Ordnung?“
„Ja, alle Zinken fest.“
Der Vater nickte.
„Konnt’ ich mir denken.“
Am Vormittag schickte der Vater ihn los, nach dem Gras zu sehen. Kaum zu glauben. Sonst hatte er immer selbst geprüft, ob das vom Morgentau noch feuchte Heugras schon so weit abgetrocknet war, dass man es mähen konnte.
„Schon unterwegs.“
Er zog los und musste sich zügeln, nicht zu hüpfen wie ein kleiner Junge.
Die Pferde zogen gleichmäßig, das Messer lief leicht durchs saftige Gras. Hannes harkte mit der Mutter die abgemähten Schwaden vom Grabenrand in die Mitte.
Die Arbeit fiel ihm leichter als in den Jahren zuvor. Damals hatte er oft Pausen gemacht, ans Angeln gedacht, Schmetterlingen hinterhergeschaut. Jetzt hatte er nur die Harke im Blick. Das Gras in die Mitte, die Binsen liegen lassen.
Es wurde warm, trotz des Windes. Schweiß lief über Bauch und Rücken. Ausholen, ranharken, Disteln liegen lassen, ausholen, ranharken. Bald nahm er die Harke in die linke Hand, die Schulter tat weh. Übertrieb er? Was, wenn er nicht bis zum Abend durchhielt? Und morgen mit Thies und Jörn?
Schon am Nachmittag wurden sie fertig. Der Vater fuhr den Balkenmäher zum Hof zurück, die Mutter und er gingen, die Harken geschultert, hinterher. „Es wollt ein Mägdlein früh aufstehn …“ Der Vater sang sein Lieblingslied, sah sich lachend nach ihnen um, winkte sogar. Das abgemähte Gras glatt am Boden, die Bäume im Wind, die strahlende Mutter. Endlich wieder die Lachfalten um ihre Augen.
Am nächsten Tag konnten sie früh beginnen, das Heu zu wenden. Thies und er nahmen den ersten Streifen der Weide, Jörn und die Mutter den zweiten, der Vater den dritten. An den Grabenrändern blühten die letzten Lilien, der Vater pfiff wieder, die Mutter wirkte gelöst. Thies stieß ihn mit der Schulter an.
„Darf so weitergehen, oder?“
Hannes nickte nur. Die Schulter tat weh, auch das Handgelenk, und er war langsamer geworden.
Mittagspause machten sie auf der Weide, Kartoffelsalat und Milchsuppe mit Mehlkluten, sein Leibgericht. Die Schwalben flogen hoch in der Luft, der Duft der Suppe vermischte sich mit dem des trocknenden Grases. Auch gekühlten Kaffee und Wasser mit Holundersirup gab es.
„Thies, warum machst du eigentlich meine Harken kaputt? Hab ich dir was getan?“
Der Vater hatte sich eine Pfeife angezündet und lag nun rücklings, auf die Ellbogen gestützt, im Stoppelgras. Thies kratzte sich an der Augenbraue.
„Tut mir leid, wirklich, dass ich deine Harke zum Harken benutzt hab.“ Am Vormittag waren ihm zwei Zinken abgebrochen.
Der Vater lachte auf.
Kurz darauf warf Thies eine Frage in die Runde: „Habt ihr gehört? Lübben hat auch das Stück Land neben den Kirschbäumen von Jörn gekauft. Und wieder hat er eine Notlage ausgenutzt. Claus Magens hatte doch das Bein gebrochen, vier Monate kein Arbeiten.“ Thies machte eine Pause und wandte sich wieder an den Vater: „Hast du nicht mal gesagt, Lübben ist gar nicht so schlimm wie sein Ruf ? Ausnahmsweise hast du mal nicht recht!“
Hannes hielt die Luft an. Aber der Vater lachte wieder nur.
„Ja, ein schlauer Hund, das ist er. Schulden machen, wenn die Inflation galoppiert, und die Hände reiben, wenn die neue Mark kommt. Aber er ist keiner von der hinterhältigen Sorte, das nicht. Und wer kann schon nein sagen, wenn er billig an ein Stück Land kommt? Und außerdem …“, nun ging der Vater zum Gegenangriff über, „… woher hast du diese roten Ideen? Aus Elmshorn? Wo sich die Arbeiter aufspielen wie die Retter der Welt?“
Der Vater steckte seine Pfeife in den Mundwinkel, wartete vergnügt auf Thies’ Erwiderung.
„Nee, von denen nicht, obwohl die noch dreimal besser sind als die Politiker und Schlotbarone. Die halten zusammen und haben alles in Marmor. Tagsüber pressen sie die Arbeiter und Bauern aus und abends trinken sie ihren Schampus, wahrscheinlich in einem dieser komischen Tanztheater.“
Der Vater zog die Brauen hoch, lachte und schaute zur Mutter. „Da ist was dran. Nicht gerade gerecht und auch nicht gut für Deutschland, auch nicht diese … diese neuen Bräuche.“
Nun warfen sich der Vater und Thies die Bälle zu, es ging um den ewigen Streit im Reichstag, um die Wut der Bauern und den Stahlhelm Westküste, der noch radikaler war als die meisten Frontkämpferbünde. Das war, fand Thies, endlich mal jemand, der sich nicht mit ein paar Versprechen einlullen ließ, der diesem Parteienstaat den Kampf angesagt hatte. Woher nur wusste Thies all diese Dinge? Und warum fragte der Vater nie Hannes nach seiner Meinung?
Den ganzen Tag über und in den folgenden Tagen kehrten die Gedanken zu Thies und dem Vater zurück, wie die Zunge zum schmerzenden Zahn. Thies und der Vater, wie sie lachten und stritten.
Jäh fuhr Hannes hoch, saß aufrecht im Bett, als hätte ihn jemand geweckt. Er horchte in die Stille. Da war es. Hundegebell, weit hinter dem Deich. Er warf die Decke zur Seite.
„Vater, schnell, Hunde, hinterm Deich.“
Er griff sich ein paar Seile, der Vater riss ihm die Seile aus der Hand und lief los, Hannes hinterher. Schnell war der Vater über den Deich verschwunden, ein dunkler Schatten gegen den Nachthimmel. Hannes blieb abrupt stehen, lief ins Haus zurück. Er holte Rüpel, ihren Wallach, und einen langen Strick. Das Pferd warf den Kopf, tänzelte, ließ sich zur Regentonne ziehen, von der er aufsteigen konnte.
Das panische Blöken hörte er schon von weitem. Dann sah er sie. Ein breiter Graben, weiß, voller Schafe, die auf der Flucht ins Wasser gerannt waren. Der Vater dazwischen, er zerrte hier und dort. Aber die Tiere waren zu schwer, der Vater sank nur selber tiefer ein.
Hannes sprang von Rüpels Rücken, legte ihm den langen Strick um die Brust und warf das Ende dem Vater zu, der es um ein Schaf wand. Es klappte. Rüpel zog das erste Tier heraus. Es wurde ein Kampf gegen die Zeit. Die Schafe sanken tiefer, blökten, der Vater wühlte im Wasser zwischen Schlamm und Wolle, machte Knoten. Hannes führte Rüpel und warf das Seil zurück. Alles ohne ein Wort, kein einziger Befehl des Vaters. Das fiel ihm erst viel später auf, als die Schafe wieder im Stall waren und er in seinem Bett lag.
Über die Schafe wurde in den Tagen danach kaum noch gesprochen, obwohl sie fast alle hatten retten können. Kein Lob für Hannes, kein Wort zu seiner Idee, Rüpel mitzubringen.
Thies’ Großvater kam am letzten Tag der Sommerferien herüber, um sich einen Flaschenzug zu leihen. Hannes hängte in der Scheune Kräuter auf und hörte ihn, wie er die Eltern fragte, ob sie etwas über die Hunde wüssten.
„Nee, hab sie nicht mal richtig gesehen“, erwiderte der Vater. Seine Stimme klang unwillig, als wenn er nicht gern über die Sache redete.
Aber Thies’ Opa sprach weiter. „Glück gehabt, Hinrich“, sagte er und klopfte dem Vater so kräftig auf die Schulter, dass man es hören konnte. „Ja, Glück gehabt, dass du so einen Sohn hast.“
Er hielt den Atem an. Der Vater sagte nichts, er nickte wohl nur, wie immer, wenn er nicht antworten wollte. Dann die Stimme der Mutter. „Ja, hast recht, nicht verkehrt, der Junge.“
Am Abend saßen sie in der Küche, schweigend über Bratkartoffeln gebeugt. Bei Thies nebenan hockten sie jetzt wohl Ellbogen an Ellbogen in ihrer winzigen Küche, redeten, lachten und aßen verschrumpelte Kartoffeln. Das Essen war dort nie besonders gut, aber es schmeckte besser als zu Hause.
„Sag mal“, der Vater riss ihn aus seinen Gedanken, „wann soll das eigentlich losgehen, mit Thies und dir?“
Verständnislos schaute er den Vater an. Der sah plötzlich erleichtert aus, als habe er sich gerade eine Last von den Schultern gewälzt. „Wollt ihr nicht bald mal anfangen mit dem Boxen, oder habt ihr es euch anders überlegt?“
3
Wie immer war Thies zu spät, auch am ersten Morgen nach den Ferien. Schuljahr ’27 / ’28, wie merkwürdig sich das anhörte, dachte Hannes, als Thies endlich angelaufen kam.
„Was? Ob wir noch wollen? Das hat dein Alter gesagt?“
„Ja“, antwortete Hannes.
Der Freund schüttelte den Kopf, lachte auf und hatte plötzlich blendende Laune. „Na dann auf die Räder, gleich nach der Schule, und einfach mal hin. Vielleicht erwischen wir jemanden. Und in ein paar Tagen geht’s los: Seilspringen, Sandsäcke verhauen, Mundschutz rein, boxen.“
Hannes lachte mit, während er neben Thies herging. Aber er konnte sich nicht wirklich freuen, er wusste selbst nicht warum. Die Bäume tropften, am Himmel stand schon die Sonne, eine Scheibe, die bald den Dunst durchbrechen würde. Alles nur Beginn und Vorfreude auf einen warmen Tag, wie er es sich manchmal im Winter ausmalte. Aber heute nichts davon. Er wollte nicht mehr zum Boxen, schon gar nicht mehr mit Thies, dem starken, dem großartigen Thies.
Bei der Hengststation hörten sie die Schulglocke. Sie liefen los, hasteten ins Gebäude, warfen die Jacken an die Haken, stürzten zu ihrer Bank. Aber nichts geschah, der neue Lehrer kam nicht, der alte Letje hatte immer schon mit dem Klingeln in der Tür gestanden, dürr und krumm wie ein Fragezeichen. Hannes sah sich um. Alles war wie immer, nur die Haselrute hinter der Tafel fehlte.
Dann hörten sie die Türklinke der Lehrerwohnung und Schritte auf dem Flur. Das Tuscheln erstarb. Seltsame Geräusche waren das, keine normalen Schritte. Der Lehrer erschien in der Türöffnung und ging durch die Reihen nach vorn. Das linke Bein zog er mit einem runden Schlenkern nach. Er war erstaunlich jung, hatte dunkles Haar, das ihm in Fransen in die Stirn hing, aber eine rote Narbe nicht verdecken konnte.
„Guten Morgen!“
„Guten Morgen, Herr Govinski!“ Schon dieser Name, dachte er, und dann auch noch ein Mann wie aus einer Gruselgeschichte. Richtig gefährlich, irgendwie wütend.
„Setzt euch!“
Sie nahmen Platz und warteten gespannt.
„Ich habe gehört“, begann der Lehrer und sah aus dem Fenster, „ihr seid ein bisschen schwierig. Aber ich bin sicher, wir werden keine Probleme kriegen.“
In der Pause standen alle in Gruppen zusammen und unterhielten sich über den Lehrer. Achim hatte gehört, dass er aus dem Osten kam, aus Königsberg. Im Krieg hatte eine Granate sein linkes Bein zerfetzt und ihm einen Splitter in die Stirn getrieben, 1918, ein paar Tage vor dem Ende. Kein schlechter Lehrer, bloß ein bisschen anstrengend.
Hannes hatte Achim noch nie so viel reden hören, aber heute waren alle aufgekratzt, durch diesen Lehrer, der so anders war als alle Männer, die man kannte.
Am Nachmittag fuhren sie zum Boxverein nach Elmshorn. Das Rad des Vaters lief leicht, Hannes fuhr es zum ersten Mal, aber große Freude hatte er nicht daran. In Gedanken war er beim Lehrer. Schon allein seine Art zu sprechen. Er rollte das R, dehnte manche Wörter, dass man sie kaum noch verstand. „Hää-iimlich“ sagte er, und „ää-iigentlich“. Und sein Blick heftete sich oft starr auf einen Punkt an der Wand, als wolle er den Stein durchbohren. Ähnlich sah der Vater aus, wenn ihn jemand nach dem Krieg fragte. Dann antwortete er immer: „Flandern, das Übliche.“ Athleten-Club Einigkeit. In großen schwarzen Lettern prangte der Name des Vereins an einer Fassade. Sie klingelten an der Tür, immer wieder, aber es regte sich nichts. Erst als sie enttäuscht auf ihre Räder stiegen, öffnete sich gegenüber ein Fenster. Eine Frau erschien. Die Boxer träfen sich am Freitag, glaube sie, so gegen sieben.
Thies war zufrieden, trat kräftig in die Pedale, aber Hannes musste an den Vater denken. „Boxen? Das ist nichts für dich.“ Bei Thies hätte er das nie gesagt.
In der Schule legte sich bald die Aufregung um den neuen Lehrer. Er ließ viel von der Tafel abschreiben und rechnen. Der Unterricht war anstrengender als beim alten Letje. Govinski schien immer zu wissen, wer gerade nicht aufpasste, und erteilte ihm besonders schwere Aufgaben. Aber er wurde nicht wütend, genauso wenig, wie er sich über richtige Antworten zu freuen schien. Hannes konnte nicht aufhören, sich Gedanken über ihn zu machen, über ihn und den Vater. Ob der Lehrer schon immer so war oder erst seit dem Krieg? Und der Vater, war der vor dem Krieg anders gewesen?
Nur beim Vorlesen kurz vor Schulschluss wurde Govinski lebhafter. Um viertel vor zwölf ließ er die Hefte zuklappen, öffnete die Schublade des Pultes und zog ein in Leder gebundenes Buch hervor: Die Schatzinsel. Sofort war da ein Beben in seiner Stimme und das letzte Getuschel erstarb. „In stürmischen Nächten, wenn der Wind die vier Ecken unseres Hauses schüttelte …“ So etwas hatte Hannes noch nicht erlebt. Er meinte den saufenden Kapitän mit seinen verfaulten Zähnen zu riechen, zu hören, zu sehen, wie er auf den Wirtshaustisch schlug und brüllte, den ängstlichen Jim, wie er ihm Branntwein brachte. Mit dem Klingeln schlug Govinski das Buch zu, egal wo sie gerade waren, und Hannes starrte ihn fassungslos an. Ein Tag, ein ganzer Tag, bis es weiterging.
Böltje hinkte in diesen Tagen immer noch stark und lag viel auf seiner Decke. Wenn der Vater vorbeikam, fing er an zu zittern. Hannes’ Aufgabe war es, den Hund zu versorgen.
Die Mutter saß jetzt abends wieder beim Vater in der Stube, aber immer noch über ihre Bücher gebeugt. Der Vater blätterte in Zeitschriften oder sah zum Fenster hinaus. Über die Bücher verlor er kein Wort.
Auch zu den vielen Blumen im Garten sagte er nun nichts mehr. Lupinen, Levkojen, Rittersporn, sogar Rosen hatten sie am Haus und in Reihen zwischen dem Gemüse. Der Vater hatte versucht, der Mutter die nutzlosen Blumen auszureden, hatte sich lustig gemacht und gedroht, sie eines Tages alle auszureißen. Nun sah man ihn dabei, wie er einen geknickten Rosentrieb säuberlich mit seinem Messer abschnitt.
Der Freitag, an dem sie zum Boxen wollten, war glutheiß. Ein typischer Gewittertag, aber Thies’ Vater hatte Heugras gemäht und nun harkten sie, auch Hannes. Mittagessen gab es zu Hause, denn die Weide lag direkt hinterm Deich. Immer wieder hielt Thies’ Mutter ihm die Schüsseln vor die Nase, Buchweizenknödel, Backobst, und freute sich, wenn er nahm.
„Ich war heut Morgen bei der Mühle“, erzählte sie, „Gesine, die älteste, die muss aufpassen. Da sind neue Wandergesellen, und einer ist ein schmucker Kerl. Der hat bestimmt schon ein Auge auf sie geworfen.“
Die Mutter malte die Gefahren für die bisher tugendhafte Gesine weiter aus, sah dunkle Ecken in der Mühle, in denen was passieren konnte. Die anderen schauten sich an und brachen in Gelächter aus, in das schließlich auch die Mutter einstimmte. Nur Hannes blieb starr sitzen und stocherte im Essen.
Auch am Nachmittag wollte es nicht kühler werden. Thies arbeitete wie ein Berserker, damit sie rechtzeitig zum Boxen fertig würden. Als sie aber mit den Harken über der Schulter auf den Hof kamen, lief er zum Misthaufen und erbrach sich. Er hatte sich übernommen, vielleicht ein Sonnenstich, jedenfalls war damit das Boxen erst mal gestorben. Ausgerechnet der immer starke Thies, der nie aufgab. Hannes ging nach Hause, plötzlich federnden Schrittes.
Am Abend stand noch Ausmisten an. Die Ferkel drängten sich an der Pforte. Hannes öffnete sie, schlug sie schnell wieder zu und hörte ein Schreien, als werde ein Tier abgestochen. Ein Bein war eingeklemmt. Schnell griff er sich das Ferkel und untersuchte es.
„Was ist denn hier los?“
Der Vater stand in der Tür.
„Ein Ferkel ist in die Pforte …“
Der Vater schob ihn grob beiseite, er stolperte nach hinten, fiel über eine Mistforke und schlug mit dem Ohr gegen die Wand.
Mit Mühe rappelte er sich auf, lief an der Mutter vorbei hinter die Scheune, wo es zwischen Brennnesseln und einem Haufen Zaunpfählen eine versteckte Stelle gab. Das Ohr war taub, ein Ellbogen schmerzte. Eine Weile saß er nur da, dann traten ihm Tränen in die Augen, liefen über die Wangen, blieben am Kinn hängen, tropften auf die nackten Knie.
Am Boden liefen ein paar Ameisen. Sie schleppten Gerstenkörner aus der Scheune, unermüdlich, sie selbst so klein, ihre Last so groß. Eine Ameise zog eine halbe Ähre hinter sich her.
An die Gerstenkörner dachte er noch, als er am nächsten Tag den Weg am Deich in Richtung Fleien entlangging. Bei einer umgestürzten Weide setzte er sich auf den Stamm und pulte lustlos mit einem Stück Draht das Mark aus einem Holunderast, wie früher, als Thies und er sich Pusterohre aus solchen Ästen gemacht hatten. Heute war er an Thies’ Haus vorbeigelaufen, froh, dass niemand zu sehen war.
Ein Klingeln ließ ihn zusammenfahren. Hinter ihm saß ein Mädchen auf dem Gepäckträger ihres Rads, die Arme über dem Sattel gekreuzt. Mara von Heesen. Ihr Gesicht war kaum zu erkennen, die Sonne stand direkt hinter ihr.
„Was machst du da, ein Pusterohr?“
Blut schoss ihm ins Gesicht. Er wusste, wie er dann aussah, die Wangen knallrot bis zum Kinn und mit merkwürdig scharfen Rändern.
„Nö, ich hab nur Langeweile.“
„Du bist ja taub. Hast du gar nicht gehört, wie ich gekommen bin?“
Er schüttelte den Kopf. Mara nahm ihre langen Arme vom Sattel und schob das Rad weiter, bis er nicht mehr gegen die Sonne zu blinzeln brauchte. Wie hübsch sie war, das weiche Gesicht, der Mund, die Nase, die glänzenden Haare. Nur die Augen waren seltsam. Eines blickte immer ein wenig an ihm vorbei.
„Der Schafretter von Kronsnest – wie findest du das?“ „Richtig lustig.“
Sie zog die Brauen zusammen.
„Kein Grund beleidigt zu sein. Hätte nicht jeder hingekriegt, mitten in der Nacht. Sagen jedenfalls unsere Knechte. Und ein bisschen Spaß schadet nie.“
Er nickte. Ein bisschen Spaß, ja, Mara schien bei allem unbeschwert. Er hatte sie gesehen, wie sie auf Schlittschuhen fuhr, vorwärts, rückwärts, als ob sie das Eis kaum berührte. Und wenn sie im Sommer beim Kinnergrön mit den Jungen der Großbauern tanzte, sah es aus, als ob für sie alles nur die Hälfte wog. Jetzt stand sie barfuß neben ihrem Rad, in einem dünnen Sommerkleid, das ihr der Wind eng um die Beine legte.