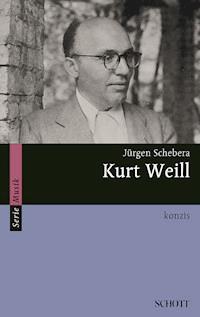
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schott Music
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kurt Weills Leben ist tief verflochten mit den kulturellen Höhepunkten und politischen Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Sohn des Kantors der Dessauer Synagoge wird Meisterschüler von Feruccio Busoni in Berlin, er steigt auf vom Schöpfer avancierter Orchester- und Kammermusik zum führenden Opernerneuerer der Weimarer Republik, begründet gemeinsam mit Bertolt Brecht einen revolutionierenden Songstil und wird schließlich nach seiner Emigration in den USA erfolgreicher Komponist von Musicals und «Broadway Opera» in der Nachfolge George Gershwins. Das vorliegende Buch wurde vom Autor Jürgen Schebera für diese Auflage vollständig aktualisiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Schebera
Kurt Weill
Jürgen Schebera
Kurt Weill
konzis
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Bestellnummer SDP 152
ISBN 978-3-7957-8576-5
© 2016 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Als Printausgabe erschienen unter der Bestellnummer SEM 8084
© 2016 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
www.schott-music.com
www.schott-buch.de
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung kopiert und in ein Netzwerk gestellt werden. Das gilt auch für Intranets von Schulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen.
Inhalt
Kindheit und Jugend in Dessau
Lehr- und Reifejahre in Berlin
Der Schritt auf die Opernbühne
Das neue Team: Weill / Brecht
Exkurs I: Songstil und epische Oper
Verteidigung der Oper – Vertreibung
Interludium in Paris
New York: Eroberung des Musicals
Exkurs II: Broadway Opera
Die letzten Jahre
Anmerkungen
Zeittafel
Zeugnisse
Werkverzeichnis
Bibliographie
Namenregister
Über den Autor
Dank
Quellennachweis der Abbildungen
Kindheit und Jugend in Dessau
Kurt Weill kam am 2. März 1900 in der – im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstörten – jüdischen »Sandvorstadt« von Dessau, in der Leipziger Straße 59, zur Welt. Der Vater, Albert Weill (1867–1950), aus einer Kippenheimer Rabbinerfamilie stammend, war Kantor und Religionslehrer an der Dessauer Synagoge, die Mutter, Emma geb. Ackermann (1872–1955), kam gleichfalls aus einer süddeutschen Familie von Rabbinern. Beide Eltern repräsentierten das alteingesessene deutsche Judentum: Ich stamme aus einer jüdischen Familie, die ihre deutsche Vergangenheit bis auf das Jahr 1340 zurückleiten kann.1 Dessau war zu dieser Zeit die Residenzstadt des Herzogtums Anhalt (1863 unter dem Askanier Herzog Leopold aus dem ehemaligen Fürstentum Anhalt, nach dessen mehrmaliger Teilung, wiedererstanden). Seit im Jahre 1621 Fürst Johann Casimir den ersten drei jüdischen Familien die Niederlassung in Dessau gestattet hatte, war hier – nicht zuletzt durch den aufklärerischen Einfluss des 1729 in ihrer Stadt geborenen Religionsphilosophen Moses Mendelssohn – eine der fortschrittlichsten jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland entstanden, zur Jahrhundertwende zählte Dessau unter seinen 15.000 Einwohnern 600 Bürger jüdischen Glaubens.
1898 hatte Kantor Albert Weill den Ruf nach Dessau erhalten, rasch hintereinander wurden hier die vier Weill-Kinder geboren: 1898 Nathan, 1899 Hans, 1900 Curt Julian (der zweite Vorname des Komponisten ist Stendhals Figur des Julien Sorel aus »Rot und Schwarz« geschuldet, die Mutter war eine Verehrerin der französischen Literatur), und schließlich 1901 das einzige Mädchen, Ruth.
Die ersten Lebensjahre des kleinen Kurt (wie er seinen Vornamen alsbald schrieb) waren von äußerst bescheidenen Lebensverhältnissen der sechsköpfigen Familie geprägt. Dies änderte sich zu Ostern 1907. Die Jüdische Gemeinde errichtete an der Steinstraße 14 dank einer großzügigen Stiftung der Baronin Cohn-Oppenheim eine neue Synagoge nebst Gemeindehaus. Dort bezogen die Weills nun die zuerst fertiggestellte geräumige Dienstwohnung. Am 18. Februar 1908 folgte schließlich die festliche Einweihung der imposanten, im romanisch-byzantinischen Stil erbauten Synagoge, die auch über eine große Orgel verfügte – ein weiterer Beleg für den in der Gemeinde herrschenden unorthodoxen Geist.
Der Knabe erhielt eine streng jüdische Erziehung und wurde von früher Kindheit an in Familie und Synagoge mit der hebräischen Musiktradition vertraut. Mein Vater, der Kantor und Komponist ist [schon 1893 war in Frankfurt a. M. eine Sammlung »Kol Avraham. Synagogen-Gesänge für Cantor und Männerchor« aus der Feder von Albert Weill erschienen], hatte stets großen Wert darauf gelegt, daß ich mir dieses Erbe zu eigen machte.2 Beim Vater erhielt der kleine Kurt, der 1909 in die Herzogliche Friedrichs-Oberrealschule eintrat und schon früh besondere musikalische Begabung erkennen ließ, ersten Klavierunterricht.
Schon bald sollte ihm neben Gemeindehaus und Schule ein weiteres Gebäude zur zweiten Heimat werden: das Herzogliche Hoftheater. Errichtet im Jahre 1798 direkt gegenüber dem Herzoglichen Palais in der Kavalierstraße, war hier seit dem ersten »Tannhäuser« von 1857, dem weitere Wagner-Pflege folgte, ein »norddeutsches Bayreuth« entstanden, das vom theaterbegeisterten Herzog Friedrich II. alle erdenkliche Förderung erfuhr. Ich beobachtete oft, wie der Herzog jeden Morgen zwischen zehn und elf aus dem Palasthof heraus und über den Platz fuhr, um den Proben im Theater beizuwohnen.3 Der musikbeflissene Sohn des Kantors war dem Herzog aufgefallen, seit dem Jahr 1910 erhielt Kurt Weill freien Eintritt zu den Aufführungen und konnte auch Proben besuchen. Ebenso wurde er öfter an den Hof gerufen, um der nahezu gleichaltrigen Prinzessin Antoinette Anna bei ihren Klavierübungen zu helfen.
Am 1. Oktober 1913 kam der Pfitzner-Schüler Albert Bing als Opernkapellmeister ans Hoftheater. Er nahm in den folgenden Jahren großen Einfluss auf die weitere musikalische wie geistige Formung des jungen Kurt Weill, der bei Bing ersten systematischen musikalischen Unterricht erhielt. So berichtet Weill zum Beispiel 1917:
Bei Bing arbeite ich jetzt wahnsinnig; jede Woche ein paarmal. Neben den üblichen klaviertechnischen und Schlüsselleseübungen machen wir jetzt folgendes: Wir nehmen irgendeine Opernpartitur und den Klavierauszug dazu, dann spielt zuerst Bing aus dem Auszug und ich dirigiere aus der Partitur, nachher umgekehrt.4
Synagogalmusik
Musik der jüdischen Liturgie, bis etwa 1850 streng nach dem Muster der alten orientalischen Grundformen (u. a. drei festgelegte Steiger [Tonarten]) verlaufend. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Westeuropa infolge starker, von Deutschland aus-gehender Reformbestrebungen stilistische Entfernung von der alten Tradition und Annäherung an die Musik der europäischen Kirche (auch Einbeziehung der Orgel) wie an das allgemeine klassisch-romantische Empfinden. Synthese von Tradition und Reform, wichtigste, auch Kantor Albert Weill beeinflussende Komponisten: Salomon Sulzer (1804–1891), Samuel Naumbourg (1815–1880), Louis Lewandowski (1821–1894).
Bings Ehefrau, eine Schwester des Dramatikers Carl Sternheim, führte den Jüngling in ihren musischen Zirkel ein, in dem man über neueste Literatur und Kunst diskutierte.
Durch Bing festigten sich die Beziehungen zum Hoftheater weiter, ab 1916 war Weill bereits des öfteren als »außerplanmäßiger« Korrepetitor tätig. Seine inzwischen erreichten pianistischen Fähigkeiten hatte er erstmals im Dezember 1915 öffentlich unter Beweis stellen können, als er im Festsaal des Herzoglichen Fridericianums bei einem Benefizabend Werke von Chopin und Liszt vortrug. Am 19. August 1917 durfte er die gefeierte Primadonna des Hoftheaters, Kammersängerin Emilie Feuge, bei einem Liederabend im nahegelegenen Köthen begleiten. Tags darauf berichtete er dem Bruder: Um ½ 2 ins Bett, um ¾ 5 raus, um ½ 6 mit dem ersten Zug weg, dann hier rasch umgezogen und um 7 mit gewaltigem Hochdruck in die Penne! Am Schluss des Briefes schildert er den Widerstreit in der Seele des Siebzehnjährigen, die erträumte Zukunft: Ach ich möchte jetzt so ein nettes kleines Zimmer haben, in Berlin, in Leipzig, in München; und ein Schrank voll Partituren und Büchern und Klavierauszügen und Notenpapier, und arbeiten daß die Schwarte knackt; und einmal ohne Hausvatersorgen, ohne Schulkram, ohne Einberufungssorgen hintereinander aufschreiben, was mir meinen Kopf manchmal fast bersten macht; und nur Musik hören und nur Musik sein!5
Hausvatersorgen – die Bezüge des Kantors waren im dritten Kriegsjahr drastisch gekürzt worden, Kurt hatte zum Familienunterhalt beizutragen – sollten ihm auch weiterhin auferlegt bleiben, er kam der Sohnespflicht stets ohne zu zögern nach. Die Einberufungssorgen (Bruder Nathan war bereits im Felde) waren zwar begründet, doch sollte Kurt Weill verschont bleiben. Und der Schulkram wurde achtbar absolviert, obwohl die Interessen längst eindeutig bei Musik und Oper lagen. So schreibt er nach dem Besuch einer von Bing dirigierten Verdi-Premiere:
Wir haben das Ereignis dann noch bei Tee und Schokolade zu dreien gefeiert, und Bing hat sehr schön erzählt von »Rigoletto«-Aufführungen mit Caruso und Baklanow. […] Du kannst dir denken, daß ich heute morgen zu allem anderen Lust hatte, als in die Schule zu gehen. Aber was hilft’s?6
Zu diesem Zeitpunkt, Herbst 1917, war in Dessau bereits eine beachtliche Zahl von Kompositionen entstanden. Die frühesten erhaltenen Werke sind ein Mi Addir – Jüdischer Trauungsgesang von 1913 sowie ein A-cappella-Chor Gebet (»Für Ruths Einsegnung«, nach einem Text von Emanuel Geibel) von 1915, beides für den Gebrauch in der Synagoge. Ab 1916 folgte dann eine ganze Reihe von Liedkompositionen (u. a. Im Volkston nach Arno Holz, Volkslied nach Anna Ritter, Sehnsucht nach Joseph Eichendorff, Die stille Stadt nach Richard Dehmel, zwei Duette nach Otto Julius Bierbaum und ein Zyklus Schilflieder nach Nikolaus Lenau), die zeigen, mit welcher Dichtung sich der junge Mann beschäftigte. Wichtigstes Werk dieser frühen Phase des Komponierens ist der Zyklus Ofrahs Lieder von Herbst 1916, fünf Stücke für Gesang und Klavier nach klassischen hebräischen Texten des Jehuda Halevi, die bereits beachtliches musikalisches Ausdrucksvermögen zeigen. 1917 entstand auch ein Intermezzo für Klavier.
Für einen Siebzehnjährigen eine außergewöhnliche Werkliste! Und: Dass er nur ein Jahrzehnt später die Opernentwicklung des 20. Jahrhunderts entscheidend mitbestimmen sollte, hier in Dessau lag eine der Wurzeln dafür: erste intensive Berührung mit dem Genre am Herzoglichen Hoftheater.
Längst stand in der Familie die Musik als Studienfach fest. Im März 1918 schloss Kurt Weill die Oberrealschule ab. Obwohl er gerade das Kriegsdienstalter erreicht hatte, ging der Kelch der Einberufung an ihm vorüber. Erleichterung spricht aus folgenden Worten an den Bruder: Lieber hungern als Soldat spielen, meinst du nicht auch?7 Statt in die Kaserne, wie viele seiner Altersgenossen, fuhr der junge Mann nun zur Aufnahmeprüfung an die Hochschule für Musik in Berlin. Er bestand sie und wurde Ende April immatrikuliert. Kindheit und frühe Jugend lagen hinter ihm, nun zog der gerade Achtzehnjährige aus, im geistigen Zentrum Deutschlands das Komponistenhandwerk endgültig zu erlernen.
Lehr- und Reifejahre in Berlin
Ende April 1918 begann das Studium an der Hochschule für Musik. Weills Lehrer waren Friedrich E. Koch (Kontrapunkt), Rudolf Krasselt, damals Erster Kapellmeister des Städtischen Opernhauses (Dirigieren) und Engelbert Humperdinck (Komposition). Durch einen bloßen Zufall bin ich zu Humperdinck gekommen. Man hatte mich nämlich mit einem anderen verwechselt, der nur einmal angefragt hatte, ob er bei Humperdinck Unterricht kriegen könnte.8 Außerdem belegte Weill Philosophievorlesungen an der Berliner Universität: Du könntest mich hier als stud. mus. (Kriegsmus!) et phil. bewundern. […] Auf der Universität habe ich schon zwei herrliche Vorlesungen gehört. In Dessoirs »Philosophie der Kunst« ist für mich jedes Wort eine Offenbarung, und auch Cassirers Abhandlung über die Philosophie der Griechen folge ich mit viel Freude und Interesse.9
Schon bald bildete sich der Student ein erstes Urteil über seine Lehrer an der Hochschule. So heißt es nach erst einmonatigem Studium: [Sie] sind gewiß nicht modern: Humperdinck höchstens in bezug auf kühne Rücksichtslosigkeit in der kontrapunktischen Stimmführung, Koch ist ein steifer Kontrapunktiker, als Komponist ein hypermoderner Viel-Lärm-um-nichts-Schreiber.10 Dennoch übersah Weill nicht, welche Fortschritte im Handwerklichen ihm vermittelt wurden. Als Anfang Juli die Sommerpause begann, schrieb er dem Bruder Hans:
Wenn ich die Ergebnisse des ersten Semesters überblicke, so glaube ich, […] daß ich überhaupt vom Komponieren eine Ahnung gekriegt habe, daß ich im Partiturspiel, Orgel- und auch Klavierspiel sehr viel profitiert habe. Und: Was ich außerdem fürs Leben gelernt habe, ist von unschätzbarem Wert: vom Grießbreikochen bis zum richtigen Umgang mit unverschämten Choristinnen.11
Aus der ruhigen und provinziellen Anhalter Residenzstadt in die pulsierende Metropole des Reiches, von der braven Oberrealschule ins aufregende Hochschulleben – Kurt Weill erlebte große Kontraste. Er besuchte eifrig Theater und Konzerte, las viel. Das Geld für die Eintrittskarten und Bücherkäufe verdiente er sich, da die Eltern ihn kaum unterstützen konnten, durch eine Tätigkeit als Chordirigent bei der Jüdischen Gemeinde in Berlin-Friedenau, die er von Mai bis Ende September 1918 ausübte. Das brachte immerhin 250 Mark im Monat ein, dafür aber hatte der junge Mann mit mancherlei Unbill zu kämpfen: Die Herren (10 an der Zahl) sind lauter Gojim und stellen sich mit dem Text scheußlich an. Aber mehr als zweimal wöchentlich wollen sie ja nicht proben. Und dazu muß man nun hier sitzen.12 Manchmal kam es noch schlimmer: Da ich gestern abend nach 2 Kompositionsstunden noch von ¼ 8 bis ¼ 12 Chorprobe gehabt und dabei immer zugleich dirigiert, Tenor gesungen, Orgel gespielt und die Weiber angebrüllt habe, bin ich jetzt ziemlich fertig. Nichts klappt, der Motor an der Orgel ist defekt und der Kantor singt im Kino.13 Doch dies alles, so lässt er den Bruder wissen, müsse man eben in Kauf nehmen, da ich mit Moneten so auf dem Hund bin, daß ich ohne meine Gage von Friedenau nicht heimfahren könnte oder mein Essen nicht bezahlen könnte.14
Die beiden Sommermonate verbrachte Kurt Weill bei den Eltern in Dessau. Von dort heißt es Anfang August:
So leicht ich in Berlin gearbeitet habe, so schwer geht es nun hier in dieser öden Umgebung. Da sieht man eben, wie sehr ich noch von der Anregung von Seiten des Lehrers, der Mitschüler, der Oper und Konzerte abhängig bin. Ob ich es wohl zu wahrer Kunst im Schaffen bringen kann, solange ich das nicht abstreife? Na, daß ich kein zweiter Schubert oder Beethoven werde, wissen wir ja, und die anderen haben, glaube ich, größtenteils auch an dieser »Krankheit« gelitten.15
Ab September ging das Studium weiter, unter Humperdincks Aufsicht (dem Weill in diesen Monaten bei der Orchestrierung seiner Oper »Gaudeamus« assistierte) entstand im Herbst 1918 das viersätzigeStreichquartett h-Moll. Das erste Kammermusikwerk des Achtzehnjährigen zeigt noch die natürlichen Tribute an verehrte musikalische Vorfahren (Mozart, Brahms, Reger). Ebenso sehr aber ist bereits eine neue chromatische Harmonie ausgeprägt, das Streichquartett trägt eindeutig alle Zeichen des Nach-Wagnerianismus. Erstmals verwendet Weill als harmonisches Modell das Fallen zusammengehöriger Quinten und Quarten (von David Drew als »Weillsches Ur-Motiv« bezeichnet), das später in vielen Werken wiederkehren wird. Auch bestimmte, später für ihn typische rhythmische Figuren, Ansätze eines Toccata-Stils, sind hier bereits ausgeprägt.
Es folgten mit dem Ende des Weltkriegs und der deutschen Novemberrevolution unruhige Wochen und Monate in Berlin, Weill beobachtete die Ereignisse wachen Auges. Am 12. November berichtete er dem Bruder Hans:
Am Sonnabend war ich den ganzen Tag am Reichstag, habe die Überrumpelung der Kasernen, die Bildung der A.- und S.-Räte, die Umzüge, die Reden Liebknechts, Hoffmanns, Ledebours u. a. und schließlich abends das schwere Gefecht am Marstall erlebt. Auch bei der regelrechten Schlacht gestern am Reichstag war ich dabei.16
Drei Tage später:
Die Revolution ist auch hier in ruhige Bahnen gelenkt worden. […] Alles wäre gut, wenn man nicht eines befürchten müßte: daß wir statt einer Diktatur der Aristokratie nun eine Diktatur des Proletariats kriegen könnten. Freilich ist das nur das Ziel der Spartakusgruppe.16Und weiter: Die Juden werden von jeder Partei, die bedrängt wird, als wirksames Ablenkungsmittel benutzt werden. Dagegen können wir natürlich arbeiten. […] Eine Politik aber, wie sie die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens treiben, die allem Geschehen unbeteiligt zuschauen wollen, ist unmöglich. […] Zum ersten Friedenssabbath herzlichst Maseltov!17
Auch an der Hochschule gingen die Ereignisse nicht spurlos vorüber. Im Dezember 1918 wurde ein »Revolutionärer Studentenrat« gebildet, zu den gewählten Mitgliedern gehörte auch Weill. Bemerkenswert dabei seine Motivation: Habe nur angenommen, um gegen Risches [jidd.: Antisemitismus] zu kämpfen.18 Zu den ersten Forderungen des Rates gehörte die Ablösung des siebzigjährigen konservativen Hochschulrektors Hermann Kretzschmar. Diese erfolgte auch Anfang 1919, es dauerte freilich mehr als ein Jahr, ehe dann mit Franz Schreker in Wien ein geeigneter Nachfolger für das Amt gefunden wurde. Ihn sollte Weill allerdings nicht mehr erleben.
Jetzt aber, im Frühjahr 1919, lief trotz aller Aufgeregtheit des Tages das Studium weiter. Am meisten profitierte Weill dabei von seinem Lehrer im Dirigieren, Rudolf Krasselt. Unter seinem Einfluss, so teilt er dem Bruder mit, sei er beinahe zu dem Entschluß gekommen, die Schreiberei aufzugeben und mich ganz in die Kapellmeisterei zu stürzen.19 Doch bei seinem – insbesondere mit der schon 1893 geschriebenen Märchenoper »Hänsel und Gretel« ungeahnte Erfolge feiernden – Kompositionslehrer gerät der »Beinahe-Entschluss« dann doch wieder ins Wanken:
Gestern hat Humperdinck mich zur Stunde in die Wohnung bestellt, ich mußte zum Tee bleiben und erfuhr von ihm und seinem Sohn manches neue. Der junge H. sagte wörtlich zu mir: »Wenn ich Ihre kompositorische Begabung hätte, würde ich ausschließlich Komponist werden, ob ich Weill oder Humperdinck hieße. Schreiben Sie eine Oper, und Sie sind ein gemachter Mann!«20
Prophetische Worte – doch soweit war es noch nicht.
Nach Fertigstellung einer siebensätzigen Orchestersuite in E-Dur (gewidmet »Meinem Vater in dankbarer Verehrung«) arbeitete Weill im Frühjahr 1919 an einem sinfonischen Poem nach Rainer Maria Rilkes »Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke« – Kulttext der damaligen jungen Generation. Hymnisch fast mutet der Bericht von der Arbeit an:
So weit will ich kommen – nur durch Schönberg könnte ich’s –, daß ich nur schreibe, wenn ich muß, wenn es mir ehrlich aus tiefstem Herzen kommt; sonst wird es Verstandesmusik, und die hasse ich. Die »Weise« kommt mir von Herzen, in dieser Musik lebe ich; aber – auch das beschämend! Eine Dichtung brauche ich, um meine Phantasie in Schwung zu bringen; meine Phantasie ist kein Vogel, sondern ein Flugzeug. […] Du mußt nun nicht denken, daß ich den ganzen Tag herumsitze und Trübsal blase. Nein, die Instrumentation macht mir viel Freude […], es kommen natürlich sicher sehr viel Fehler hinein, da ich sie mit der größten Frechheit ganz auf eigene Faust arbeite.21
Interessant ist hier der erstmalige Bezug auf Schönberg. Und: In Sachen Orchestration kündigt sich hier ein Arbeitsprinzip an, das Kurt Weill später lebenslang praktizieren sollte.
Da die Partitur als verloren gelten muss, vermittelt einzig ein 1927 erschienener, Weills bisheriges Schaffen retrospektiv betrachtender Artikel von Heinrich Strobel einen Eindruck von dem Werk: »Eine symphonische Dichtung zu Rilkes ›Weise von Liebe und Tod‹ sucht nach Art von Schönbergs ›Pelleas und Melisande‹ stärkere Konzentration des expressiv gespannten Melos. […] Hier spürt man zuerst Entwicklungswerte: vorsichtiges Abwenden vom äußerlichen Pathos des spätromantischen Epigonentums. Bezeichnend genug, dass der Glanz straussischer Instrumentation schon nicht mehr über diesen ersten Arbeiten liegt.«22
Zu dieser Zeit spricht Weill begeistert über Else Lasker-Schülers Schauspiel »Die Wupper«, bewundert den Komiker Max Pallenberg, ist ständiger Besucher der beiden Berliner Opernhäuser und immer wieder von Beethoven-Aufführungen. Emphatisch schreibt er dem Bruder:
Ich möchte mich einmal bis zum Rasendwerden verlieben, so, daß ich darüber alles andere vergessen würde, ich glaube, das wäre wohltuend. Es gibt nur noch eins, was eine ähnliche Wirkung auf mich ausübt, wie ich mir die Liebe denke: Beethoven. Eben hörte ich in der Hochschule die Kreutzer-Sonate; die könnte mich noch zum Weinen bringen, die allein könnte mich, wenn ich schlecht wäre, gut machen.23
Obwohl der junge Komponist nach der wohlwollenden Aufnahme seines Rilke-Poems durch Vermittlung Humperdincks ein Stiftungsstipendium von 300 Mark erhielt, stand für ihn bereits fest, dass er die Hochschule verlassen wollte, da sie ihm nichts Neues mehr vermitteln konnte. Doch wohin gehen? Weill suchte schließlich Rat bei einem der führenden Vertreter der musikalischen Avantgarde in Berlin, bei Hermann Scherchen. Am 20. Juni 1919 schreibt er dem Bruder:
Er riet mir, nach Wien zu gehen, allerdings kennt er Schreker wenig, meint aber, es gäbe eigentlich nur einen, bei dem ein begabter Mensch (er hatte mein Streichquartett flüchtig durchgesehen) noch etwas lernen könnte […]: Arnold Schönberg. […] Doch kostet dieses Privatstudium wahrscheinlich soviel Geld, daß bei mir garnicht daran zu denken ist, wenigstens vorläufig nicht. Jedenfalls schreibe ich heute noch an Schönberg.24
Eine Woche später, Weill hatte inzwischen Schönbergs »Gurrelieder« im Klavierauszug studiert, heißt es:
Warum bin ich nicht so stumpfsinnig wie die anderen, die ihr höchstes Glück darin sehen, 5 Jahre und länger die Hochschule zu besuchen, die gar nicht daran denken, daß es Musik gibt, die sie nicht kennen und die sie nie verstehen würden? Dank der Vorsehung, daß ich nicht so bin! Dank ihr, daß ich nach Neuem suche und das Neue verstehe. […] Wie es nun kommt, ist es mir recht, aber nach Wien muß ich – früher oder später. Es ist etwas so Neues, was dieser Schönberg mir bringt, daß ich ganz sprachlos war.25
Schönberg hatte auf die Anfrage offenbar rasch geantwortet, denn am 14. Juli 1919 schrieb Weill dem Bruder, dass er von Schönberg aus Wien eine überaus nette Karte hatte, in der er mir in vornehmster Weise Entgegenkommen in jeder Hinsicht ankündigt. […] Trotzdem werde ich vor dem nächsten Frühjahr kaum nach Wien können und habe auch schon in diesem Sinne an Schönberg geschrieben.26
Nur die prekäre finanzielle Situation hat also verhindert, dass Kurt Weill ab Herbst 1919 Schüler von Arnold Schönberg wurde. Stattdessen musste er Geld verdienen, denn die Familie brauchte dringend seine Unterstützung. Die Dessauer Jüdische Gemeinde hatte dem Vater infolge Finanznot kündigen müssen. (Bis er eine neue Stellung fand, ab Mai 1920 als Direktor eines jüdischen Waisenhauses in Leipzig, durften die Weills noch im Gemeindehaus wohnen bleiben.) Statt weiterem Studium musste sich Kurt Weill also eine bezahlte musikalische Stellung suchen. Er fand sie nach mehreren Absagen schließlich als Korrepetitor am Dessauer Friedrich-Theater, wie das Hoftheater nach Abschaffung der Monarchie nun hieß.
Dort trat er mit Beginn der Spielzeit 1919 /20 nun seine erste Stellung als Berufsmusiker an. Neuer Musikalischer Oberleiter war Hans Knappertsbusch; Weills Lehrer und väterlicher Freund Albert Bing blieb weiterhin als Kapellmeister tätig. Gleich zu Beginn seines Engagements konnte Weill einen Erfolg als Pianist – weniger als Komponist – verbuchen. Er war Begleiter bei einem Liederabend von Elisabeth Feuge, Tochter der gefeierten Kammersängerin Emilie Feuge, im Friedrich-Theater, auf dessen Programm auch zwei (nicht mehr zu identifizierende) Stücke Weills standen. Der Hofheatersaal war bis zum Brechen überfüllt mit allererstem Publikum […]. Besonders meine Lieder sang sie berückend schön, doch stießen sie durch ihre strenge Modernität auf blödes Mißverstehen bei der großen Menge. Und: Da auch das ganze Theater im Konzert war, habe ich mich in meiner neuen Stellung glänzend eingeführt.27
Doch schon nach kurzer Zeit wurden Weill die Aufgaben als Korrepetitor zu eng, außerdem kam es zu Spannungen zwischen Knappertsbusch und ihm. Was bei Bing in den Jahren bis 1918 üblich gewesen war, dass nämlich der junge Mann in allen musikalischen Fragen mitdiskutierte, seine Meinung einbrachte, entsprach nicht Knappertsbuschs Arbeitsweise. Er verwies den Mitarbeiter streng auf dessen alleiniges Feld, das hieß: die Rollenvorbereitung der Sänger. So kann es nicht verwundern, dass Weill das erste sich ergebende Angebot nutzte, um das Friedrich-Theater zu verlassen. Schon bald, nach nur drei Monaten »Fron« unter Knappertsbusch, bot sich dafür die Gelegenheit.
In der kleinen westfälischen Stadt Lüdenscheid hatte ein Herr Arthur Kistenmacher damals die Gründung eines Dreisparten-Stadttheaters beschlossen, unter anderem war auch die Position des Kapellmeisters zu besetzen. Mit einer Empfehlung Humperdincks bewarb sich der Dessauer Korrepetitor und wurde engagiert. Ende November 1919 verließ Kurt Weill die Vaterstadt endgültig. Nur noch zweimal, 1923 und 1928, sollte er gelegentlich von Aufführungen seiner Werke für wenige Tage nach Dessau zurückkehren.
Was er in Lüdenscheid vorfand, waren die typischen Verhältnisse einer »Schmiere«. Gespielt wurden im Saal eines Hotels Schauspiel, Oper und Operette; das Orchester war entsprechend, hinzu kamen enorm kurze Vorbereitungs- und Probenzeiten, da mangels ausreichenden Zuschauerpotentials für längere Aufführungsserien fast jede Woche eine Premiere stattfinden musste. Das Repertoire der musikalischen Sparte reichte von Wagner bis Kollo, wobei natürlich Operetten und Schwänke dominierten. Kurt Weill hatte nicht nur zu dirigieren, sondern darüber hinaus das ankommende Notenmaterial für die Lüdenscheider Gegebenheiten einzurichten, Stimmen um- und neuzuschreiben, die Sänger vorzubereiten und für die Kollegen vom Schauspiel allerlei musikalische Hilfsdienste zu leisten. Er stürzte sich mit Feuereifer in die Arbeit:
Du kannst dir denken, wie ich zu tun habe. Sonntag nachmittag »Fledermaus«, abends »Cavalleria Rusticana«, Montag nachmittag »Zigeunerbaron«, abends Premiere einer neuen Operette. Wie ich mit den Proben fertig werden soll, ist mir schleierhaft, es glaubt ja kein Mensch, was es heißt, mit diesem Orchester und Chor »Cavalleria« aufzuführen.28
Wie mag ihm erst am Dirigentenpult während des »Fliegenden Holländer« zumute gewesen sein? Besonders enervierend war die Beschäftigung mit Stücken unterhalb des Niveaus der Operette: Morgen habe ich wieder Premiere, eine furchtbar dreckige Gesangsposse »Im 6. Himmel«.29
Aber, und dies dick unterstrichen: Trotz dieser Arbeitsbedingungen, trotz so mancher Tiefpunkte – hier in Lüdenscheid lernte Kurt Weill die Musiktheater- und Orchesterpraxis von Grund auf, fortan konnte man ihm auf diesem Gebiet nichts mehr vormachen. Noch ein Vierteljahrhundert später, längst auf der Höhe seines Ruhms angelangt, wird er in den USA resümieren, er habe in Lüdenscheid endgültig erkannt, daß das Theater meine eigentliche Domäne werden würde.30
Für die eiserne Energie des gerade Zwanzigjährigen spricht, dass er neben der aufreibenden Theaterpraxis in Lüdenscheid auch noch Zeit zum Komponieren fand. Er begann mit der Arbeit an einem Operneinakter nach Ernst Hardt, Ninon de Laclos (das Material ist verschollen), und er schrieb eine Chorfantasie Sulamith nach Texten aus dem Hohelied Salomos (nur teilweise erhalten). Ob er sich damit von der äußerst säkularen Theaterwelt in die Gefilde seines Glaubens zurückziehen wollte? Heinrich Strobel kannte auch diese Komposition im Manuskript, er schrieb dazu: »Die musikalische Sphäre, in welcher der Zwanzigjährige lebt, breitet sich aus. Sie reicht bis zu Debussy, bis zum frühen Schönberg. Impressionistischer Klang und expansive Ausdrucksmelodik fließen in der Chorfantasie Sulamith zusammen.«31





























