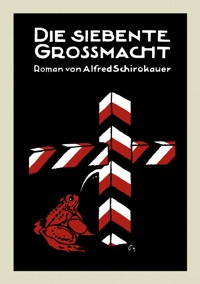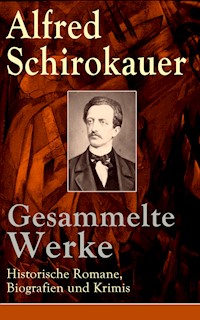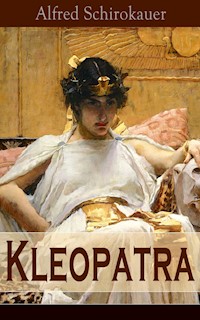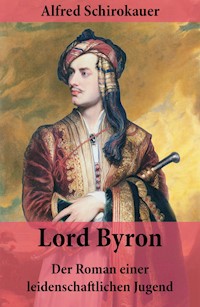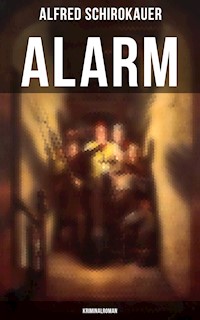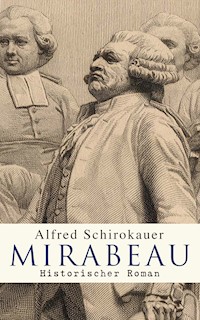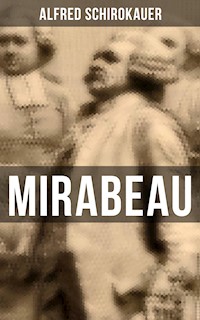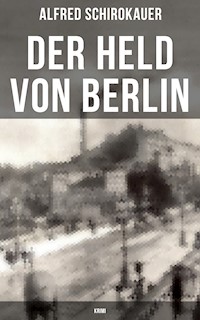Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alfred Schirokauers Buch 'Lassalle: Ein Leben für Freiheit und Liebe' ist eine fesselnde Darstellung des Lebens und der Leidenschaften des bedeutenden deutschen Revolutionärs Ferdinand Lassalle. Schirokauer beleuchtet einfühlsam Lassalles Kampf für soziale Gerechtigkeit und politische Veränderung im 19. Jahrhundert. Der Autor kombiniert historische Fakten mit literarischer Sensibilität, um ein umfassendes Bild von Lassalles Idealen und seiner Persönlichkeit zu zeichnen. Dieses Werk ist nicht nur eine Biografie, sondern auch eine Reflexion über die Kraft des Glaubens und der Liebe im Streben nach Freiheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lassalle: Ein Leben für Freiheit und Liebe
Inhaltsverzeichnis
I.
Die marmorne Standuhr auf dem Kamin tickte laut und geschäftig in die Stille. Sacht knisterte der eilende Gänsekiel.
Im gelben Schein der Moderateur-Lampe beugte sich der dunkle Kopf des Schreibenden über das Papier. Die blauen Augen sprühten, die feinen Nasenflügel bebten in Schaffensinbrunst.
Plötzlich schleuderte er den Kiel auf die Tischplatte, griff die Zigarre vom Aschenbecher, stieß den großen, bequemen Arbeitssessel zurück, erhob sich, reckte den schlanken Körper zu seiner biegsamen Stattlichkeit auf und schritt mit gedankenkrauser Stirn durchs Zimmer.
Er mußte die Szene noch einmal scharf durchdenken. Dieser Ulrich von Hutten sollte das Sprachrohr werden für sein geheimstes Planen und Sehnen, sollte all diesem einst nebelhaften, jetzt immer sonnenheller tagenden Ahnen Worte geben, das ihn bedrängte seit seinen jungen Tagen. Seit jener bitter-trotzigen Zeit, da er mit den Lehrern der Handelsschule zu Leipzig den täglichen Guerillakrieg geführt hatte.
Langsam ging der Mann durch das geräumige Gemach. Plötzlich wandte er sich einem der Regale zu, die mit Büchern, Broschüren, kostbaren Folianten, altertümlichen Papyros überladen, an drei Wänden des Zimmers zur Decke emporstrebten. Diese wuchtige Bibliothek gab dem ganzen Raume das strenge Gepräge ernster Wissenschaftlichkeit.
Er stöberte unter einem Pack wohlgeordneter loser Papiere und zog ein dickes Heft hervor.
Der frühe Februarabend blickte mit dämmermüden Augen durch das Fenster. Der Mann trat zurück in den Lichtschein der Tischlampe. Stehend schaute er auf das Heft nieder. Ein leises, halb wehmütiges, halb ironisches Lächeln spielte um den schönen Mund. »Mein Tagebuch«, las er auf dem Einband, »Breslau 1840.«
Er setzte sich wieder und blätterte in den schon an den Rändern leicht vergilbten Seiten. Der Rauch der Importen, in die sich die Zähne hart verbissen, stieg in zitternd blau-grauen Kringeln zur Höhe. Er wandte langsam suchend die Seiten. Da stand es. Das erste Bekennen des ahnungshaft aufdämmernden Lebenszieles. Als Fünfzehnjähriger hatte er mit sturmheißen Wangen diese Beichte hingestammelt. Oh, er erinnerte sich noch genau des heißen, gewitterbangen Sommertages oben in seiner kleinen Pensionsbude! – –
»Mittwoch, den 26. August 1840.
Es ist mir klar geworden, daß ich Schriftsteller werden will. Ja, ich will hintreten vor das deutsche Volk und vor alle Völker und mit glühenden Worten zum Kampf für die Freiheit auffordern. Ich will nicht erschrecken vor dem drohenden Augenzucken der Fürsten, ich will mich nicht bestechen lassen von Bändern und Titeln, um, ein zweiter Judas, die Sache der Freiheit zu verraten! – Nein, ich will nicht eher ruhen, als bis sie bleich werden vor Furcht.
Von Paris aus, dem Lande der Freiheit, will ich wie Börne das Wort zu allen Völkern der Erde schicken, und alle Fürsten sollen zähneklappern und einsehen, ihre Zeit ist gekommen.«
Mit fest zusammengekniffenen Lippen starrte der Mann nieder auf das Blatt. Das hatte er vor achtzehn Jahren geschrieben! Jung und keck und überschäumend! Und was hatte er bisher verwirklicht vom diesen Jünglingsphantastereien? Gewiß, ja doch! Er hatte im Sturmjahre 1848 nicht feig hinter dem Ofen gehockt. Er hatte seine Pflicht am Rheine getan. Und sein halbes Jahr Gefängnis dafür abgesessen.
Ja, ja. Aber! – Oh, es sollte noch anders kommen – – ganz anders! – Er lehnte sich weit im Sessel zurück, blies den Rauch in dicken Schwaden zur hohen Decke und faltete grübelnd die Hände. Da fühlte er den Ring an der Rechten. Er hob ihn dem Lichte entgegen, daß die Inschrift hell aufglänzte in dem matten Golde. »J’attends mon temps« – »Je maintiendrai«, las er laut. Die Züge, edel und scharf geschnitten wie die einer antiken Bronzebüste, belebten sich, die blauen Augen brannten hell wie Sankt Elmsfeuer.
»Ja,« sprach er vor sich hin, »ich erwarte meine Zeit, sie wird kommen.« Er schob das Heft zur Seite und griff wieder zum Kiel. Vorläufig galt es, in der Wissenschaft und in der Dichtung die Lava seiner Seelenglut ausströmen zu lassen. Einst kam die Zeit des Handelns. »J’attends mon temps!«
Und mit seiner kleinen klaren Schrift schrieb er die Szene herunter. Jetzt hatte er sie vor Augen. Diese Jugendworte sollte Hutten, seine eigene poetische Verklärung, aus tiefstem Gemüte sprechen.
Die marmorne Standuhr auf dem Kamin tickte wieder laut und geschäftig in die Stille. Emsig knisterte der eilende Gänsekiel auf dem Papier.
»Da lag auf einmal meines Lebens Zweck Mir licht vor meiner Seele ausgebreitet. Hell ward, was Ahnung bis dahin gewesen. Ich wußte jetzt, wozu ich ward geboren, Wozu so hart gehämmert in des Unglücks Esse! Wie sich ins Meer die Woge tosend stürzt, Die Brandung von dem Ufer widerschlägt, So stürzte ich mich flammensprüh’nden Auges, Zitternd vor Leidenschaft, vor Wollust rasend, Kopfüber in den ungeheuren Streit, Des Zornes Axt – – –«
Da pochte es leise an die Tür. Unwillig hob der Mann die hohe, prachtvoll gemeißelte Stirn. Sein Blick sprang hinüber zu der Uhr. Er konnte in der wachsenden Dunkelheit das Zifferblatt nicht mehr erkennen.
»Herein,« rief er mit hoher dünner Stimme. Der Diener trat ein.
»Was ist, Friedrich?« fragte der Mann barsch. »Es kann doch noch nicht vier sein.«
Ein diskretes Lächeln spielte um des jungen Dieners bartlosen Mund.
»Es ist noch nicht die Dame,« sagte er verstehend.
»Ein Herr wünscht den Herrn Doktor zu sprechen.«
Sofort klärte sich des Doktors Gesicht.
»Zünden Sie den Lüster an,« gebot er und stand auf. Er kannte diese Besucher, die in letzter Zeit, seit dem Erscheinen seines großen philosophischen Werkes, ihm ihre Aufwartung machten, um ihm ihre Bewunderung auszusprechen. So war Boeckh, der Altmeister der Philologie, so war Professor Michelet, Professor Stahr, so waren alle Koryphäen der Berliner Universität bei ihm erschienen.
Das Gas flammte in breiter fauchender Schmetterlingsflamme empor. Der Doktor warf einen schnellen Blick in den großen Spiegel über dem Kamin, zupfte die moderne samtene Weste über dem schlanken Leib straff und sagte: »Führen Sie den Herrn herein, Friedrich.«
Der Diener ging. Rasch streifte des Doktors Auge die Bilder der Revolutionsmänner an der rechten Stubenwand, fast unbewußt warf er den Cäsarenkopf zurück in die Pose, die Danton auf seinem Konterfei wies – – da klangen die Schritte des neuen Bewunderers seiner Philosophie an der Tür.
Herein trat ein kleiner feister Herr mit ergrauten Koteletten, dessen dürftiger Rock grell abstach von dem eleganten Redingote des Doktors. Der Kleine blieb dienernd an die Tür gebannt. Einen Augenblick verharrte der Doktor in seiner Danton-Pose, dann trat er eilig auf den Besucher zu.
»Mit wem habe ich die Ehre?« fragte er, ein wenig enttäuscht, doch sehr liebenswürdig. Und sich vorstellend, fügte er hinzu: »Lassalle.«
Der Gast dienerte abermals, hob dann beschwörend die behaarte Hand und beteuerte:
»Oh, ich kenne Sie, Herr Doktor. Wer wird den berühmten Herrn Doktor Ferdinand Lassalle nicht kennen!«
»Wollen Sie nicht näher treten,« lud Lassalle freundlich ein, ging voran zum Schreibtisch und schob dem Gast einen Sessel zu. Er selbst setzte sich wieder an das Schreibpult.
»Ich bin so frei,« entschuldigte sich der kleine Dicke und setzte sich breitbeinig nieder. Den altersrauhen Zylinder stellte er neben sich auf die Erde.
»Was führt Sie zu mir?« ermunterte Lassalle wieder.
Der Besucher schnellte hastig auf die Kante des Sessels und hob emsig an: »Verzeihen Sie, Herr Doktor, wenn ich Sie am Sonntag störe. Ich komme aber in einer delikaten Angelegenheit, Herr Doktor. In einer höchst delikaten Angelegenheit. Was soll ich vor Ihnen Faxen machen? Vor einem gescheiten Manne, wie Sie sind, macht man keine Faxen. Ich werd’ frei von der Leber reden. Mein Name ist übrigens Hirsch Mendelsohn.« Lassalle schwieg und spielte mit dem Federmesser.
»Der Name wird Ihnen nicht angenehm sein, Herr Doktor,« fuhr Mendelsohn bedauernd fort, »wegen der Erinnerung an Ihren unglücklichen Freund Dr. Mendelsohn, der nebbich in der Kassettengeschichte zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt worden ist. Tut mir aufrichtig leid, Herr Doktor. Sie müssen mir meinen Namen schon nicht verübeln. Ich bin ein anständiger stiller Mann, Herr Doktor. Ich könnte Ihnen sagen, ich bin ein Verwandter vom Komponisten Mendelsohn. Sie würden’s mir glauben. In fünfzig Jahren wird sowieso jeder Mendelsohn sagen, er stammt von Moses Mendelsohn ab. Sie können’s mir glauben. Ich hab’n Blick in die Zukunft.«
Lassalles helle Augen blitzten belustigt.
»Und was führt Sie zu mir, Herr Mendelsohn?« fragte er in seiner liebenswürdigen Höflichkeit.
»Ich habe mir schon erlaubt zu bemerken,« spann Herr Mendelsohn eifrig weiter, »daß ich komme in einer höchst delikaten Angelegenheit. Sie kennen doch den Großfabrikanten Anton Krafft?«
Jäh ruckte des Doktors Oberkörper zurück gegen die Lehne des Stuhles, daß er ganz steif dasaß. Die Augen wurden kalt und hart, das mächtige bartlose Kinn versteinte.
»Was ist mit ihm?« fragte er schroff. Auch der Kleine prallte vor dieser jähen Barschheit zurück. »Was is?« fragte er perplex. »Was sehen Sie mich so an! Haben Sie was gegen den Mann?«
»Was haben Sie mir von Herrn Krafft zu bestellen?« fragte Lassalle rauh. Unwillkürlich flog sein Blick zu der Uhr hinüber. Besorgt folgte Herr Mendelsohn den blauen Augen.
»Ich halt’ Sie nur fünf Minuten auf, Herr Doktor,« beschwichtigte er. »Ich weiß, die Minuten eines so gelehrten Mannes sind kostbar. Also, kurz und gut, was sollen die Umschweife? Sie kennen, doch Fräulein Marie?«
Lassalles Gesicht wurde noch abweisender. »Allerdings«, sagte er kurz.
»Sie haben sie durch ihren Klavierlehrer Herrn von Bülow kennen gelernt und sie bei Dunckers da vis-à-vis –« – Mendelsohn zeigte auf das Fenster – »getroffen und Sie sind in der Villa bei Herrn Krafft in der Bendlerstraße eingeladen gewesen. Sie sehen, Herr Doktor, ich bin informiert. Vor mir brauchen Sie sich nicht zu genieren.«
Lassalle schwieg starr.
»Die Sache ist nun die,« belehrte Herr Mendelsohn nach einer spärlichen Pause, »Herr Krafft möchte die Tochter verheiraten, und da – –« offenen Mundes hielt er inne. Eine überraschende Verwandlung war mit dem Doktor geschehen. Die abwehrende Gespanntheit war aus dem Gesichte gewichen, ein erlöstes Lächeln spielte in den tiefen Augenwinkeln.
»Wie denn?« machte Herr Mendelsohn wirr.
»Nichts, nichts,« hob Lassalle die Hand, »sprechen Sie nur weiter.«
»Sie sind wohl gar schon accord mit der Dame?« forschte der Kleine besorgt.
»Durchaus nicht,« tröstete Lassalle, »berichten Sie nur weiter.«
Herr Mendelsohn schüttelte ganz sacht den kahlen Schädel und dachte: »er ist wirklich ‘n komischer Mensch, dieser Lassalle. Die Leute haben ganz recht.« Und hoffnungsfreudig sprach er weiter: »Also wie ich Ihnen sage, Herr Doktor, Herr Krafft will die Tochter verheiraten. Sie wissen ja, sie ist das einzige Kind. Und das Malheur mit der Mutter – nu – was sollen wir erst davon reden? Am besten, man spricht nicht davon. Der Mann sagt sich mit Recht: wie lange kann ich’s noch machen? Dann steht die große Fabrik verwaist da. Er will die Marie also verheiraten, denn er will’n Schwiegersohn haben, der die Fabrik übernehmen kann. Sie verstehen doch?«
»Ich verstehe!«
»Da hat er nu gestern zu mir gesagt – ich bin nämlich ein guter Freund vom Hause –«
»Sie sind ein guter Freund vom Hause?« zweifelte Lassalle freundlich.
»Nu, ›guter Freund‹ is vielleicht ein bißchen viel gesagt,« stellte Herr Mendelsohn richtig. »Ich komme oft ins Haus.’ Ich handle nämlich mit Wein und Likör. Früher habe ich ein Geschäft gehabt, aber bei den ewig unruhigen Zeiten! Erst 48, dann die Reaktion! Sie wissen ja, Herr Doktor, wie das so geht. Man hat Pech. Nun hab’ ich nur noch Privatkunden, feine Leute! Sie verstehen!«
»Ich verstehe.«
»Nu war ich gestern bei Herrn Krafft. ‘n feines sechsundvierziger Rheinweinchen hab’ ich ihm gebracht! Wie wär’s, Herr Doktor, wenn Sie auch mal ein Probekistchen nähmen?«
»Danke, Herr Mendelsohn, ich bin vorläufig versehen. Meine Zeit drängt. Ich gebe heute abend ein kleines Souper, und vorher –«
»So – so – wieder ein kleines Souper! Die Soupers des Herrn Doktor Lassalle sind ja in ganz Berlin berühmt. Man weiß, daß sozusagen die geistige Elite Berlins hier zu Gast kommt. Dann brauchen Sie doch aber viel Wein, Herr Doktor.«
»Vielleicht später, Herr Mendelsohn.«
»Ich werde mir erlauben, später wieder einmal anzufragen.«
»Meinetwegen. Kommen Sie aber nun zu Ende. Ich habe wirklich nicht mehr viel Zeit.«
»Ich halt’ Sie nur noch fünf Minuten auf, Herr Doktor. Ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar.«
»Sagen Sie nun endlich, Herr Mendelsohn, was geht es mich an, ob Herr Krafft seine Tochter verheiraten will oder nicht.«
Da zwinkerte der kleine Herr vertraulich:
»Brauch’ ich das ‘nem so gescheiten Manne erst zu sagen!«
»Die Notwendigkeit erfordert es,« bedauerte Lassalle.
»Tun Sie nich so, Herr Doktor! Sie haben längst alles erraten.«
»Ich versichere Sie, Herr Mendelsohn – –«
»Nu, Sie wollen, ich soll’s sagen. – Auch gut. Also, wie ich gestern mit Herrn Krafft spreche, sagt er plötzlich:
»Mein lieber Mendelsohn, Sie kommen doch viel in guten Häusern herum, wissen Sie nicht irgendwelchen jungen Mann für meine Marie?«
»Vermitteln Sie Ehen?« fragte Lassalle plötzlich.
Entrüstet hob Herr Mendelsohn die fleischigen Hände. »Wo werd’ ich! Herr Doktor, nicht gewerbsmäßig! Niemals! Nur wenn sich gerade einmal die Gelegenheit bietet. Sie verstehen! –«
»Ich verstehe.«
Herr Mendelsohn lächelte billigend vor sich hin, als wolle er damit kundtun: »ein verständiger junger Mann, dieser Doktor Lassalle« und berichtete flugs weiter. »Ich sag: warum nicht, Herr Krafft? und nenn’ eine Menge Namen, Christen natürlich. Denn wer kann denken, daß Anton Krafft einen Juden zum Nachfolger in seiner Fabrik will.
Da sagt er: »›Kommen Sie auch zu Herrn Dr. Lassalle?‹ Nu, ich hab’ ja gesagt, denn warum soll ich nicht zu Ihnen kommen?« Er blinzelte vergnügt. Lassalle lachte herzhaft. »Und da sagte er: der Mann gefällt mir. Der weiß, was er will! Den möchte ich in der Fabrik haben.«
»Das hat er gesagt?« fragte Lassalle geschmeichelt.
»Ich will’n Schnorrer sein, Herr Doktor, wenn er nicht die Worte gebraucht hat,« beteuerte Herr Mendelsohn und pflasterte breit die Hand auf den Busen. »›Sie können ja mal ganz vorsichtig horchen, Herr Mendelsohn‹, hat er noch gesagt. ›Ich selbst möchte mir kein Refus holen‹. Nu, da bin ich hergekommen!–«
Lassalle schwieg einige Augenblicke. Dann lächelte er seltsam geheimnisvoll und sagte: »Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, Herr Mendelsohn, sich herzubemühen. Ich kann dem ehrenvollen Anerbieten des Herrn Krafft aber leider nicht entsprechen.«
Herr Mendelsohn fiel in den Polstersessel zurück. »Sie werden doch nicht!« hob er die Arme. »Sie werden doch nicht von sich weisen, die Fabrik Anton Krafft zu heiraten! Neben Borsig und Egels die größte Berliner Eisengießerei. Herr Doktor! Bedenken Sie doch nur, was das Grundstück in der Lietzower Wegstraße allein wert ist! Sie haben ja keine Ahnung. In fünfzig Jahren, was sage ich, fünfzig – in vierzig Jahren kostet dort die Quadratrute 6000 Taler. Sie können mir’s glauben. Ich hab’n Blick in die Zukunft.«
»Ich glaube es Ihnen, Herr Mendelsohn, die Entwicklung Berlins drängt nach dem Westen.«
»Na und?« schrie der kleine Dicke. »Sie wissen es. Und trotzdem wollen Sie – –!«
»Trotzdem, Herr Mendelsohn. Ich kann nicht heiraten.«
»Was heißt das? Sie können nicht heiraten? ‘n Mann in Ihrer Position kann nicht heiraten! Ein anerkannter Gelehrter! Daß Sie früher allerhand Narrischkeiten getrieben haben mit der Gräfin Hatzfeld,« – er blickte flüchtig zu dem kleinen guten Gemälde an der Wand hinüber, das die Gräfin als junge schöne Frau darstellte – »und dem Kassettendiebstahl und 1848 – – das ist doch längst vergessen. Und Sie sehen ja auch, Ihr Herr Schwiegerpapa stößt sich nicht daran.«
Da tönte draußen hell und durchdringend die Entreeglocke. Lassalle hob den Kopf. »Ich gehe sofort,« beeilte sich Herr Mendelsohn. »Sie sagen also ja!«
»Nein,« versicherte der Doktor.
»Gefällt Ihnen das Mädchen nicht?«
»Fräulein Krafft gefällt mir sehr gut,« gestand Lassalle mit demselben geheimnisvollen Lächeln.
»Na also. Oder stoßen Sie sich etwa an der Religion? Denken Sie an Herrn Varnhagen von Ense, der die Rahel geheiratet hat, und Herrn Professor Stahr, der die Lewald genommen hat, und ist Herr von Dönniges mit Fräulein Wolf etwa nicht glücklich geworden! Warum sollen Sie da nicht einmal umgekehrt Fräulein Krafft heiraten?«
»Weil ich nicht kann.«
»Was heißt das? Weil Sie nicht können! Stoßen Sie sich daran, daß Ihnen wegen der achtundvierziger Affaire der Aufenthalt in Berlin verboten wurde und nur widerruflich gestattet ist? Verlassen Sie sich auf mich, Herr Doktor, Sie werden nicht wieder ausgewiesen werden. Man weiß doch, wie Sie mit Herrn von Humboldt stehen. Nu, wenn Ihnen was zustößt, werden Sie eben ‘n paar Worte mit Herrn von Humboldt reden, und Herr von Humboldt wird ein paar Worte mit dem Prinzen Wilhelm reden und kein Polizeipräsident von Berlin wird wagen, Ihnen ‘n Härchen zu krümmen und wenn’s Herr von Zedlitz-Neukirch ist. Also sagen Sie ja, und nehmen Sie die Millionen und das Mädchen.«
Da stand Lassalle. »Meine Zeit ist nun wirklich erschöpft,« sagte er fest. »Ich danke Ihnen für Ihr liebenswürdiges Bemühen, Herr Mendelsohn. Ich kann aber wirklich nicht heiraten. Ich habe Pläne, die jede Ehe ausschließen.«
Da erhob sich auch der bekümmerte kleine Mann. »Sie werden schon noch mal heiraten wollen,« weissagte er betrübt, »und dann wird’s zu spät sein. Sie können mir’s glauben. Ich hab’ ‘nen Blick in die Zukunft.«
»Diesmal genügt der Blick in die Zukunft nicht,« scherzte Lassalle. »Sie müßten schon in den Himmel sehen können, denn dort werden die Ehen geschlossen.«
Da rief Herr Mendelsohn nervös: »Gehen Sie, Herr Doktor, reden Sie nicht gelehrt. Man weiß, daß Sie ein geistreicher Mann sind. Mir ist aber nicht geistreich zumut, wo Sie mir das beste Geschäft verderben wollen, das ich hab’ lange machen können. Kommen Sie, sein Sie kein Narr! Sagen Sie schon ja!« Er ergriff eindringlich des Doktors Hand.
»Nein,« Lassalle zog sie zurück und zwang den Gast sacht zur Tür.
»Ist das Ihr letztes Wort?« klagte Herr Mendelsohn.
»Mein allerletztes.«
»Nu,« meinte der kleine Feiste und stülpte im Entree den Zylinder auf den blanken Schädel, »dann werd’ ich mir erlauben, morgen noch einmal vorzusprechen.
II.
Kaum hatte der Diener im Korridor Herrn Hirsch Mendelsohn in Empfang genommen, so eilte Lassalle in das Arbeitszimmer zurück und öffnete die kleine Tapetentür im Hintergrunde. Mitten im Salon unter der strahlenden Krone stand – – Marie Krafft.
Sie hatte den Überwurf abgelegt und erwartete ihn mit weit gebreiteten Armen. Als er hereintrat, flog sie auf ihn zu, preßte die Hände um seinen Hinterkopf, schmiegte den schlanken Körper gegen seine Glieder und küßte wortlos seinen Mund, seine Augen, seine Stirn. Der Doktor streichelte sanft die Arme, die weiß und warm aus den kurzen Ärmeln der schwarzen Samtjacke hervorwuchsen.
Endlich entketteten sich ihre Finger von seinem Kopfe, sie trat ein wenig von ihm zurück, sah zu ihm auf mit ihren wundergroßen goldbraunen Augen, in die das Licht des Lüsters weiße Diamanten sprühte, und flüsterte: »Du – du – ich habe mich nach dir gesehnt!«
»Marie«, sagte er ganz weich, »wie bist du wieder schön heut abend. Nein, nein, bleib so stehen. Laß mich dein Sein einschlürfen!« Seine Nasenflügel flogen.
Das Mädchen stand in ihrem schwarzen Kleide still vor ihm, bebend befangen in einem Glücksbann.
Dann trat Lassalle an sie heran und fuhr mit der nervösen schönen Hand liebkosend durch das reiche, über der hohen klugen Stirn schlicht gescheitelte Haar, das sich an den Seiten dunkelblond aufbauschte. Um den schwellenden Haarknoten im Nacken schlang sich ein tiefrotes Samtband.
»Komm,« sagte er, legte den Arm um ihre Hüften, fühlte durch den feinen Seidenstoff des Rockes die jungen strebenden Glieder und führte sie in das Arbeitszimmer. Hier fragte er plötzlich schelmisch: »Kennst du Herrn Hirsch Mendelsohn?«
Erstaunt sah sie ihm ins Gesicht. »Mendelsohn? – Nein. Du meinst doch nicht den kleinen Alten, der mit Wein handelt?«
»Doch – den meine ich. Der war eben bei mir.«
Sie blickte ihn arglos an. »Ja und? Du sagst es so bedeutungsvoll, Ferdinand?«
»Weißt du, weshalb er zu mir gekommen ist?« Er lächelte noch immer so eigen.
»Nein, wie soll ich das wissen! Er wird dir eine Offerte gemacht haben.«
»Hat er, Marie. Aber nun rat’ einmal, worin?«
»In Wein doch natürlich.«
»Nein, mein Kind,« lachte er, und setzte sich rücklings auf die Ecke des großen einfachen Schreibtisches. »Keine Offerte in Wein, sondern in – Marie Krafft.«
Sie starrte ihn. verdutzt an. Dann sagte sie scheu: »Du scherzest.«
»Keineswegs, Marie. Er hat mir im Auftrage deines Vaters diese kleine feine Künstlerhand da angeboten.«
Purpurn siedete das Blut in ihre zarten bleichen Wangen. Sie würgte nach Worten.
Der Doktor zog die dunklen Brauen finster hoch.
»Ah – so – du wußtest darum!« Er kniff scharf die lebhaften Mundwinkel ein.
Da stand sie an seinen Knien. »Nein, nein«, flehte sie.
Er sah ihr prüfend ins Gesicht. Sie empfand, daß sie aufklären müsse. Und die Hände flach auf seine Schenkel pressend, sprudelte sie hervor: »Ich begreife es. Gestern nachmittag war Frau Fanny Lewald bei uns. Man sprach über deinen Heraklit. Frau Lewald hatte ihn nicht gelesen, aber ihr Mann, Professor Stahr, hatte ihr davon erzählt. Sie sagte, sie wundere sich, daß du dir just diesen fernliegenden griechischen Philosophen zur Bearbeitung erkoren hättest. Da konnte ich mich nicht zurückhalten und bekannte, daß ich das sehr wohl begriffe. Und ich sagte heraus, was mir klar geworden ist, damals, als du mir dein Werk erläutertest. Daß Heraklit dir so verwandt sei in seiner Ethik mit ihrer Lobpreisung des Staates und der Aufopferung für das Allgemeine, in seinem Stolze, seiner Menschenverachtung und – vergib, Liebster –« sie lächelte begütigend – »seinem Selbstbewußtsein. Und daß es dich gerade gereizt haben müsse, die Philosophie eines Denkers aufzuklären, den schon seine eigene Zeit nicht verstanden und daher ›den Dunklen‹ genannt habe.«
Lassalle nickte gönnerhaft. »Du bist ein sehr kluges Mädchen, kleine Maria.«
Sie hastete weiter, weiter. Er sollte nicht einen Augenblick glauben, daß sie ihm hinterrücks Fallen stellte.
»Ich hatte wohl etwas erregt gesprochen. Denn plötzlich spottete Frau Lewald: ›Schau, schau, flattert auch unsere liebe Marie um das magische Licht, das dieser Erleuchter des Dunklen in Berlin entzündet hat!‹ Ich wurde sehr verlegen. Und als sie gegangen war, fragte mich Papa geradeheraus, ob du mir nicht gleichgültig wärst. Ich sagte ehrlich: nein. Dann fragte er, ob ich meinte, daß ich dich lieben könnte. Da fühlte ich, wie ich eiskalt wurde, und in meiner Bestürzung sagte ich: vielleicht. Da lächelte Papa in sich hinein. Und dann kam das Mädchen und rief ihn hinaus. Herr Mendelsohn wünschte ihn zu sprechen.«
»Ach – daher!« lachte Lassalle. »Ich konnte mir auch nicht recht denken, daß du dahinter steckst.«
»Nein,« sagte sie beklommen, »ich weiß ja, daß du mich nicht heiraten wirst.«
Das kam so weh, daß Lassalle peinlich betroffen an ihr vorbei von dem Schreibtisch glitt und im Zimmer auf und nieder marschierte.
Sie stand mit dem Rücken gegen den Tisch, die Stirn gebeugt. Das Licht fiel hart nieder auf ihr Haupt, das Haar schimmerte im Scheitel ganz silberhell und hob sich scharf ab von dem glühroten Bande, das den Knoten im Nacken bändigte.
Die großen goldenen Ohrreifen schaukelten leise hin und her.
Er ging eine Weile stumm erbost auf und nieder.
Endlich sagte er: »Nein, ich werde dich nicht heiraten, Marie. Dich nicht und keine andere. Mein Weg muß einsam bleiben. Ich habe es dir gesagt an dem Tage, an dem du zum ersten Male zu mir gekommen bist.«
Sie schwieg und starrte auf den Teppich nieder.
»Ich habe dir damals die Gefahr vorgestellt, in die du dich begibst.«
»Ja, das hast du,« nickte sie. »Und ich habe dir erwidert, daß mir die Meinung der Leute über mich gleichgültig ist. Daß ich nur auf das Empfinden meines Vaters Rücksicht zu nehmen habe, und daß er seiner Tochter immer glauben wird, daß sie sich nichts vorzuwerfen hat, wenn sie dich auch in deiner Wohnung besucht.«
»Ich bedauere lebhaft die Berechtigung seines Vertrauens,« scherzte er vorwurfsvoll.
Sie kam zu ihm und legte ihm die Hand auf den Mund.
»Sprich nicht wieder davon! Ist unsere Liebe unser nicht würdiger, wenn ich stolz vor dir stehen kann?«
»Du solltest stolz darauf sein, ganz mein zu werden.«
»Ich bin dein, Liebster, ganz, ganz dein. Doch zum Weibe soll mich nur der Mann machen, der vor aller Welt der Vater meines Kindes heißen will.«
»Philisterlieschen,« spottete er.
»Wir wollen nicht wieder davon reden,« lenkte sie bittend ab. »Du sagst, du kannst mich nicht zu deinem Weibe machen. Ich habe mich darein gefunden.«
»Wirklich?« zweifelte er, ihre Hände streichelnd.
»Mit bitterem Weh. Ich bekenne es ehrlich.«
»Du weißt, ich kann nicht anders.«
»Ja, ja,« sagte sie mit ihrer klangvollen Altstimme, die etwas körperlich Wohltuendes hatte. Sie hob den Kopf, der Hals wuchs rührend-rein aus dem weißen Spitzenkragen des schwarzen Jacketts, Tränen glitzerten in den großen warmen Augen, der Mund zuckte weh. »Ich denke und sinne nur immer wieder darüber. Du sagst, du liebst mich, und ich muß es nach alledem, wie du zu mir bist, wie du mich in deine Welt und in die Welt der alten Dichter eingeführt hast, auch glauben. Ich glaube es so gern. Und wenn ich bei dir bin, begreife ich alles, dann scheint es mir so unabänderlich. Aber zu Hause, des Nachts – wenn ich darüber grüble, dann verflattern deine triftigsten Gründe – ich sehe nichts – nichts –.«
Sie schüttelte den blonden Kopf.
Flehend, hilflos sah sie zu ihm hinüber.
»Dann werde ich es dir noch einmal auseinandersetzen,« grollte er nervös. Er reckte seine hohe Gestalt, bohrte die Daumen in die Armlöcher der Weste und sprach eindringlich: »Marie, du weißt, daß ich ein Leben voll Kampf vor mir habe. Die da draußen, die über mein früheres Leben geheimnisvoll klatschen, und jene, die über meinen Heraklit jubeln, – was wissen die von meinen großen Plänen! Aber du, du weißt es. Dir habe ich es tausendmal gebeichtet. Ich bin nicht von jenen, die in den Niederungen bleiben. Ich will hinauf zu den Gipfeln der Menschheit. Ich werde hinaufklimmen Ich fühle es hier drinnen in der Brust, habe es in meinen Knabenträumen, in meinen Jünglingsstürmen gefühlt, fühle es heute als Mann stark und verheißend wie je. Weißt du das nicht, Marie?!«
Er blieb dicht vor ihr stehen, legte die Hand unter ihr Kinn und hob ihren Kopf dem Lichte zu.
»Ich weiß es,« sagte sie leise, »und deshalb liebe ich dich.«
»Wenn du das weißt,« sprach er weiter, »wirst du einsehen, daß das Leben eines solchen Mannes auf der Spitze eines Vulkans gebaut ist. Es wird ungeheure Kämpfe geben, wenn ich in die Arena hinabspringe. Meine Freiheit, mein Vermögen, mein Leben wird bedroht sein. Ein solcher Mann fesselt eines Weibes Schicksal nicht an sein ehernes Los.«
»Ein Weib, das diesen Mann liebt,« sagte sie fest, »wird stolz und selig sein, bei ihm zu stehen in seinem Kampfe.«
»Das sagst du heute,« schüttelte er den schwarzen Kopf, »so muß das Weib in dir heute sprechen. Der Verständige muß ich sein.«
Sie schüttelte den Kopf, daß die Ohrringe leise aufklangen. »Wir wollen nicht disputieren,« entgegnete sie traurig. Dann setzte sie sich auf den Schreibtischsessel, stützte die nackten Ellenbogen auf die Tischplatte und grub die geballten Fäuste in die Schläfen. Sinnend saß sie so da. Das gelbe Licht der Moderateurlampe zeichnete ihre weichen Züge plötzlich ganz scharf ab. Um den Mund lag ein alter, kummervoller Zug.
Lassalle ging erbittert auf und nieder.
Die Uhr schlug.
»Muß ich gehen?« fuhr Marie empor.
»Nein,« gewährte er, »du kannst noch eine halbe Stunde bleiben. Dann habe ich noch immer Zeit genug für meine Toilette. Übrigens war Ludmilla Assing vorhin hier, mir mitzuteilen, daß ihr Onkel heute nicht kommen kann.«
»Ist Herr Varnhagen von Ense krank?« fragte Marie teilnehmend.
»Ein bißchen erkältet. Gott, der Mann ist kein Jüngling mehr. Er ist übrigens auch ganz begeistert von meinem Heraklit. Und weißt du, was Boeckh mir vor ein paar Tagen geschrieben hat: das Werk zeige die umfassendste Gelehrsamkeit, die genaueste philosophische Erwägung, es sei einzig in seiner Art. Ich habe den Brief an meinen Vater nach Breslau geschickt, damit der alte Mann seine Freude hat. Und Humboldt ist geradezu begeistert, kann ich dir sagen, und Stahr und Michelet. Alle. Ich bin mit einem Schlage unter die ersten Gelehrten Deutschlands, ja Europas gerückt.«
Er warf den Kopf stolz und eitel zurück.
Da sagte Marie gut und ernst: »Du bist ein Kind, Ferdinand.«
Erstaunt fuhr er zu ihr herum. »Ein Kind! Wieso?«
»Weil alle Genies im Grunde ihres Gemütes Kinder sind. Deshalb. Aber es hat bei dir noch seine schlimme Seite. Niemand wird es dir sagen, wenn nicht deine beste Freundin. Du schadest dir, Liebster, mit dieser –« sie suchte nach einem Worte und sagte endlich mutig – »kindischen Eitelkeit.«
Eine flüchtige Röte strömte in sein scharfes bleiches Gesicht. Eine Weile war tiefe Stille in dem geräumigen Zimmer. Nur die Marmoruhr auf dem Kamin tickte dreist und beherrschend. Lassalle spielte mit dem Federmesser. Endlich sagte er, und mußte sich räuspern, denn die Stimme war rauh: »Ich weiß es.«
»Bist du mir böse?« fragte sie innig.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, Marie. Ich weiß es ja selbst. Ich suche dagegen zu kämpfen, vergeblich. Meine Erziehung ist daran schuld und mein Lebensgang. Daheim im Elternhause hat man mich mit vierzehn Jahren als Erwachsenen behandelt. Ich habe das ganze Haus beherrscht, die schwierigsten Familienangelegenheiten autoritativ entschieden. Und dann später. Wie hat Heine mein Selbstbewußtsein gekitzelt, als ich ihn 1844 in Paris besuchte! Ich könnte dir Briefe von ihm zeigen! Ich wünschte, du könntest einmal den Brief sehen, den er mir damals als Empfehlungsschreiben an Varnhagen mitgegeben hat. Weißt du, wie der kranke Dichter mich prophetisch genannt hat? Damals als ich 19 Jahre alt war? ›Den Messias des neunzehnten Jahrhunderts.‹ Und du weißt, wie abweisend und skeptisch der gebrochene große Mann in seinen Krankheitsjahren war. Und dann –« er sprach heftig rasch und stieß auffallender als sonst mit der Zunge an – »völlig unter meinen Schutz hat er sich gestellt, wie ein Kind. Ich habe ihm die Rente von seiner Familie erkämpft. Ich. Der Neunzehnjährige. ›Die Antilope sucht Schutz bei dem jungen Löwen‹, sagte er oft mit wehem Lächeln um den armen gelähmten Mund. Und weiter, Kind! Mußte mich mein Erfolg in dem Streit der Gräfin Hatzfeld nicht eitel machen? Bettelarm, brotlos, gehetzt, ihrer Kinder beraubt, lernte ich sie 1846 in Berlin kennen. Und ich, der einundzwanzigjährige Student, der keine Waffe hatte als seinen Kopf, habe den Kampf für sie gegen den allmächtigen Grafen mit seinen ungeheuren Millionen und seiner ganzen übermütigen Partei aufgenommen, ich, den er, als ich ihn damals in der ersten Empörung forderte, einen ›dummen Judenjungen‹ gehöhnt hat.
Na, der dumme Judenjunge hat ihm seine Dummheit bewiesen. Neun Jahre lang habe ich mit ihm gerungen, vor sechsunddreißig Gerichten habe ich mit ihm Prozesse geführt, ich, der am Anfang keine Ahnung von Jurisprudenz hatte, habe nach zwei Jahren mehr davon verstanden, als alle Rechtsanwälte zusammen. Und endlich habe ich ihn niedergetreten, ihn zu einer schimpflichen Unterwerfung auf die Knie gezwungen und der Gräfin die Scheidung und ein enormes Vermögen erkämpft. Und weiter, Marie, meine Verteidigungsreden in dem Kassettenprozeß und vor den Geschworenen im Mai 1849, als ich wegen meiner Revolutionstätigkeit am Rheine angeklagt war, haben sie nicht mit einem Schlage die Augen der ganzen Welt auf mich gelenkt! Und dann in Düsseldorf! Wie habe ich da den verfolgten Freiheitskämpfern mit Rat und Tat geholfen, ohne an meine und der Gräfin Sicherheit zu denken. Jeder, der der Gefangenschaft entsprang, jeder, der sonst fortgebracht werden sollte, wurde in mein Haus gebracht, dort mit größter Gefahr für mich und die Gräfin tagelang gehütet und mit Pferd und Wagen nach Holland gesandt. Und kaum hatte ich 1854 den Grafen niedergehetzt, da vollendete ich den Heraklit, den ich vor Eröffnung des Kampfes begonnen hatte, und Männer wie Boeckh und Humboldt umarmen mich als einen der Ihren. Darf ich da nicht stolz sein?«
Er hatte sich in Eifer geredet und blickte sie herausfordernd an. Sie saß noch immer in der alten Stellung. Der weiße breite Spitzenkragen leuchtete hell auf dem schwarzen Samtjackett.
Jetzt stützte sie die Arme auf das Pult, legte das feine ovale Kinn in die Hände, hob die großen Augen mit tausend knisternd sprühenden Lichtern darin zu ihm auf und sagte leise: »Ja, du darfst stolz sein auf alles, was deine zweiunddreißig Jahre erkämpft haben. Ich hielt es für meine Pflicht als deine Freundin, dich zu warnen, wegen der anderen. Ich liebe dich mit all deinen Eigenheiten und all deinen Fehlern. Vor mir brauchtest du dich nicht zu verteidigen. Ich weiß, du bist eine leidenschaftliche Flamme. Luzifer, der Lichtbringer, bist du. Prometheus, der sich gern selbst hell bestrahlt mit dem Feuer, das er der Menschheit bringt.«
Und auf sprang sie, warf sich zu seinen Füßen nieder, umklammerte seine Knie und flüsterte leidenschaftlich bacchantisch, zu ihm empor: »Ich liebe dich, du brausende Flamme, die mein Leben versengt.«
III.
Es ging auf sieben, als Lassalle seine langwierige Toilette beendete. Er stand vor dem hohen Wandspiegel, in dessen Glas das ruhig stehende Licht zweier Kerzendolden sich brach, die aus vielarmigen Bronzeleuchtern zu beiden Flanken des Spiegelrahmens emporwuchsen.
Der Doktor hatte soeben den neuen Frack angezogen und prüfte mit sachverständigen Augen den Sitz. Befriedigt strich er über den kleinen dunkelblonden Schnurrbart. Das feine schwarze Tuch des Rockes schloß sich schmiegsam seiner vornehmen Gestalt an. Er lächelte sacht, während er von der Konsole des Spiegels das seidene Taschentuch aufnahm, das Friedrich bereitgelegt hatte. Er sah sich in die zwingenden blauen Augen und dachte an die Antwort, die er vor einigen Tagen einer Dame gegeben, die ihn mit schmachtendem Liderschlag den geistreichsten und den schönsten Mann seiner Zeit genannt hatte. »Den Ruhm des ›Geistreichsten‹,« hatte er erwidert, »schlage ich nicht allzu hoch an, aber daß ich der schönste Mann meiner Zeit war, das soll man mir auf meinen Grabstein schreiben.« Was würde Marie gesagt haben, wenn sie diese Antwort gehört hätte! Sich nachsichtig belächelnd, schritt er zu dem marmorschimmernden Waschtisch hinüber, auf dessen Aufsatz eine wohlversorgte Batterie kristallener Flaschen und Fläschchen funkelte. Zögernd wählte er eines der Flakons und dachte trotzig: »Ist körperliche Schönheit nicht auch eine Gabe wie der Geist! Ist es keine frohe Schicksalsgüte, schon äußerlich so zu wirken, daß man in keinen lichter-strahlenden Salon eintreten kann, ohne alle Anwesenden zu verdunkeln und mit magnetischer Gewalt aller Augen zu bannen!«
Und während er das diskret duftende Parfüm auf das Taschentuch stäubte, sann er: »Alle Genies waren schöne Menschen: Alexander, Napoleon, Goethe, der junge Friedrich – –« Vor dem Spiegel barg er das Tuch malerisch in den Ausschnitt der seidenen lila Weste.
Und Friedrich, der just die Alltagskleider des Herrn in den Mahagonischrank einordnete, schmunzelte vor sich hin: »Er macht Toilette, als ginge er zum verliebtesten Rendezvous, dabei ist es nur ein Herrenabend.«
Lassalles scharfen Augen war der flüchtige Spott nicht entgangen. Sein durchdringender Verstand faßte sofort die Ursache. Im Hinausgehen blieb er vor dem jungen Diener stehen und sagte lehrhaft: »Merken Sie sich, Friedrich, ein kultivierter Geschmack schmückt sich nicht für die andern, sondern für sich.« Damit verließ er das Schlafzimmer. Verdutzt blickte der Diener ihm nach.
Der Doktor durchschritt das gemütliche kleine Wohnzimmer mit seinen schön geschwungenen rotplüschenen Polstermöbeln, dem hochlehnigen breiten Kanapee, den tiefen Sesseln, mit der Uhr im vergoldeten kunstvollen Rahmen, den Pastellbildern seiner Familie, und trat in den Salon. Er war ihm der Erinnerungstempel seiner Orientreise und eine kindlich stolze Genugtuung dadurch geworden, daß er in ganz Berlin nicht seinesgleichen hatte. Der Doktor betrachtete mit geheimnisvollem Lächeln diese orientalische Pracht. Welche drolligen Szenen würden heute diese hundertjährigen schwerglänzenden Gebetteppiche, diese kostbaren Fenstervorhänge, die niedrigen türkischen Divans mit ihren gestickten Seidendecken, all diese Etageren, Tische und Taburetts mit ihren kunstreichen Inkrustationen sehen! Und all dieser Krimskrams, der überall herumlag: Amuletts, Dolche, Bronzen, Schalen. Oh, das Berlin seiner Kreise erwartete nicht vergeblich stets irgendeine geistreiche oder burleske Überraschung von einem Lassalleschen Souper! Nun, Berlin würde zufrieden schmunzeln, wenn der heutige Herrenabend sich in allen Häusern der guten Gesellschaft herumsprach.
Sorgfältig prüfte der Hausherr das Rauchzeug: die feinen Nargilehs mit ihren bunt-kristallenen Gefäßen, die langen türkischen Pfeifenrohre mit ihren kostbaren Bernsteinspitzen, den Ebenholzkasten mit dem narkotisch-duftenden Tabak.
Befriedigt begab er sich in sein Arbeitszimmer.
Es fehlten noch fünf Minuten zu sieben. Lassalle trat an das breite Fenster, das auf die Potsdamer Straße hinausging. Die übrigen Zimmer der Wohnung lagen nach der vor wenigen Jahren bei dem Bau des Hauses durchgebrochenen Eichhornstraße.
Das Trottoir dort unten reckte die winterkahlen Äste seiner Bäume weißbepudert von frischem Schnee zu dem Manne am Fenster hinauf. Um die spärlichen Gaslaternen braute die Kälte blau und gelbrot. Der Fahrdamm war ganz vereinsamt. Auf dem Bürgersteig eilten Familien-und Freundesgruppen dahin, warm in mollige Pelze und flauschgefütterte Kapotten vermummt, dem Potsdamer Tore zu. Der Sonntag nachmittag hatte das Berliner Volk zu den zahlreichen Biergärten vor das Tor gelockt, in deren engen Zimmern man dicht und gemütlich beim Kaffee und Bier und Stadttratsch beisammen saß.
Lassalles Augen wanderten über die Straße hinüber zur Villa des Verlegers Franz Duncker. Aus einem schmalen hohen Fenster leuchtete Licht gegen die feucht beschlagenen Scheiben. Das war das gemütliche Kabinett der Hausfrau, in welchem Lina Duncker ihre Vertrauten zu traulichem Geplauder und stillem gemeinsamen Genuß einer guten Lektüre empfing.
Erst gestern nachmittag hatte Lassalle dort gesessen und der klugen feinen fixen Frau den »Rasenden Roland« gelesen.
Lange blickte der Mann am Fenster hinüber zu dem Hause, das dalag still und geborgen, umfriedet von dem Weiß des Vorder-und Hintergartens. Und plötzlich keimte in ihm ein dunkles Gefühl der Feindschaft auf, eine dumpfe Ahnung der Gegnerschaft gegen dieses geruhigte selbstsichere Bürgerheim dort drüben mit seinem heiter-hellen Fenster.
Der Mann horchte in sich hinein auf diese ahnungsvolle Stimme. Seine Züge strafften sich, unwillkürlich ballten sich die Hände. Er preßte die heiße Stirn gegen die kühlende Scheibe. Ja – ja, dachte er, wir werden sehen, wie Ihr alle dort drüben, Ihr guten Freunde, zu mir stehen werdet, wenn es in den Kampf um die Freiheit geht.
Da setzte die Marmoruhr mit geschwätzigem Schlage ein. Zugleich schnellte draußen im Korridor emsig die Glocke an ihrer hastenden Feder. »Das ist Korff,« nickte Lassalle, raffte sich gewaltsam aus seinem grollenden Brüten und trat in die Mitte des Zimmers.
Draußen rasselte hell ein Säbel, man hörte, wie er am Boden aufklirrte, als die Koppel gelöst wurde, und gleich darauf trat ein schöner schneidiger Prachtkerl in der blauen Uniform der zweiten Dragoner sporenklirrend ein.
»Guten Abend, mein lieber Baron,« schüttelte der Hausherr ihm herzlich die Hand. »Immer militärisch pünktlich.«
»Wenn Kleider Leute machen, so macht des Königs Kleid pünktliche Leute,« lachte der Rittmeister und zeigte eine Kolonne herrlicher Zähne unter dem blonden Schnurrbart. »Übrigens herzlichen Dank, lieber Doktor, für die freundliche Übersendung Ihres Heraklit und die famose Widmung.«
Während die Herren sich setzten, fragte Lassalle eifrig:
»Haben Sie hineingeguckt, lieber Baron?«
»Hineingeguckt! Wort für Wort habe ich das Buch gelesen. Und meine helle Freude an Ihnen gehabt. Sie sind ein Mordskerl, Doktor. Diese Schärfe der Dialektik! Wie eine blitzende Toledanerklinge, geschmiedet freilich in der guten alten Berliner Hegelschmiede.«
»Ja,« stimmte Lassalle bei, »ich bin stolz darauf, in der Geistesschmiede des alten Hegel Lehrbursche gewesen zu sein.«
»Ihr oller Grieche gefällt mir.« Der Baron streckte forsch die langen Beine von sich. »Das ist ein Ganzer. Übrigens Ihr Urahne, Doktor. Einiges habe ich mir wörtlich gemerkt. Der eine Satz klingt wie in Ihrem Brutofen geschmort: ›alle Menschen sind unvernünftig, nur ich allein weiß, während alle anderen wie im Schlafe handeln‹.«
»Nun – nun,« machte Lassalle. »Ganz so monopolsüchtig bin ich nicht. Wenn ich mein Selbstbewußtsein auch als mein Steckenpferd reite, bei der Gardekavallerie bleibe ich damit doch im Hintertreffen.«
»Feine Parade,« lachte der junge Offizier, »Sie sind –«
Da schnatterte die Glocke wieder.
»Der Garde folgt die Linie,« scherzte Lassalle und ging dem schnurgeraden hochragenden alten Manne, der eben eintrat, zur Tür entgegen. Es war der Hofrat Dr. Friedrich Foerster. Ihm folgten auf dem Fuße der Dichter Scherenberg und Ernst Dohm, der Redakteur des Kladderadatsch.
Als die Begrüßung beendet war und die Herren in den bequemen Polsterstühlen saßen, huschte noch der Maler Ludwig Pietsch herein.
Der alte Hofrat streichelte mit der zärtlich gepflegten Hand sein schwungvoll frisiertes volles silbergraues Haar und seufzte: »Gottlob, bei Ihnen ist’s warm. Draußen ist eine Hundekälte, trotz der heißen Begeisterung, die der überquellenden Volksseele entdampft.«
»Waren Sie in der Stadt, Herr Hofrat?« fragte Ludwig Pietsch artig interessiert. Seine lebensfrohen Augen funkelten die aufpeitschende Frische des eisigen Wintertages. Doch um die Nasenwinkel, oberhalb des dichten Vollbartes, verrieten einige tiefschürfende Sorgenfalten den bitter verzweifelten Kampf, den der mittellose junge Maler um das karge tägliche Brot für seine schöne Frau und seine Kinder gekämpft hatte und noch rang.
»Ja,« nickte der schöne Hofrat und wandte Pietsch die blauen Augen zu, »war Unter den Linden. Die Illumination brannte zur Probe, und die Volksbegeisterung desgleichen.«
»Aber Hofrat!« mimte Lassalle Entrüstung, »nun habe ich mich den ganzen Nachmittag auf ein bißchen echte schwarz-weiß lackierte Begeisterung gefreut! Von Ihnen als königlichem Beamten können wir Steuerzahler offizielle Begeisterung geradezu fordern.«
»Sonntags habe ich keinen Dienst,« belehrte mit altmodischer Zuvorkommenheit der Hofrat.
»Nanu!« Korffs Sessel wippte ordentlich auf.
»Ha,« lachte Lassalle und streckte die lebensvolle Hand ausgelassen von sich, »ein spannendes Farbenphänomen. Unserem Korff ›graut‹ vor der Schwärze dieser roten Gesinnung!«
Und ehe der Baron beruhigende Versicherungen über die Couleur seines Seelenzustandes abgeben konnte, funkelten Dohms blitzende Brillengläser dazwischen:
»Foerster hat doch unwiderleglich recht: Sonntag ist kein Dienstag.«
Mit einer zierlichen Bewegung, die eigenartig fein zu dem liebevoll frisierten grauen Haare paßte, reichte der Hofrat dem Redakteur die kleine weiße Hand: »Der Kladderadatsch hat, wie immer, recht.« Stumm, fest in seinen abgetragenen schwarzen Gehrock gewickelt, saß während des Gesprächs der Dichter Scherenberg in seinem tiefen Sessel.
Sein glattrasiertes knorriges Gesicht war unbewegt, die tiefliegenden grauen Augen unter der breiten edlen Stirn blickten nach innen, als sähen sie nicht die scherzende Herrengruppe ringsum. Der alternde berühmte Dichter von »Waterloo« und »Leuthen«, der Schilderer zahlloser glorreicher preußischer Schlachten, war kein Held im Wortscharmützel.
Aber er kam gern in diesen skeptischen witzfunkelnden Kreis, er, den die Reaktion als ihren Dichter beschlagnahmte, zu dem berüchtigten Revolutionär von 48, angezogen von dem seltsamen Reiz, den des Hausherrn Wesen übte auf Freund und Feind.
Als Pietsch jetzt den Dichter seinen Ruhm würdevoll in dem schäbigen alten Rocke bergen sah, öffnete er mutig die Knöpfe seines Kammgarn-Festkleides, dessen »glänzendes« Exterieur ihn ein wenig bedrückte, und dessen innere kunstvolle Mosaikarbeiten er sorgsam unter Verschluß gehalten hatte. – Ach, wie oft hatten Frau Pietschens kundige Hände das Futter in jenen Tagen geflickt, da sie anderes Futter manchmal tagelang kaum vor Augen bekam, damit er bei seinen Bittgängen um Arbeit honorig auftreten könne. – Pietsch öffnete den Rock und offerierte behaglich: »Lieber Lassalle, wenn Sie durchaus Begeisterung brauchen, stelle ich Ihnen die meine zur Verfügung. Ich bin begeistert. Nie war für mich wahrer das englische Wort: Zeit ist Geld. Diese Zeit des Jubels ist für mich bares Geld. Ich bin im Interesse des leeren Portemonnaies der deutschen Maler sehr für Ehebündnisse zwischen Preußen und England. Schade, daß wir nicht mehr Prinzen vorrätig haben. Na, vielleicht wird das mit der Zeit noch mal besser. Denn dann spitzt Frankreich plötzlich die Ohren. Und beauftragt einen armen Maler wie mich mit einer Kolossalzeichnung des morgigen Einzuges für die ›Illustration‹.«
»Für Sie ist die Hochzeit des Prinzen Friedrich Wilhelm also eine goldene Hochzeit,« lachte Dohm, daß sein rundliches Bäuchlein wippte.
Da sprach zierlich der Hofrat: »Verehrter Herr Pietsch, ich sehe, Sie betrachten diese eheliche Verbindung des Prinzen mit der Prinzessin Victoria als Realpolitiker. Ich auch. Und ich hoffe, daß durch den freiheitlichen englischen Einfluß die neue Ära nun ernsthaft einsetzen wird –« er wurde jäh grimmig – »und die Zeit dieser gottverdammten Reaktion –«
»Hofdemagoge!« entsetzte sich Lassalle drollig, »was reden Sie da für gefängnisschwangeres Zeug! Hat Sie Ihre Strafversetzung von der Königlichen Kunstkammer in die Königliche Bibliothek noch nicht kuriert!«
»Leider unheilbar veralteter Fall,« lachte der alte Herr, »gegen mich ist in der Königlichen Reaktionsapotheke kein Kraut gewachsen.«
»Von welchem Kraute ist die Rede?« fragte eifrig höflich Dr. Prietzel, der Botaniker und Kustos der Königlichen Bibliothek, der leise eingetreten war.
»Von dem Zauberkraut, mit dem der ›weiße Schrecken‹ des Herrn von Hinckeldey und seiner Nachfolger die Gegner bekehrt,« belehrte Lassalle.
»Ach so,« machte Prietzel, »Sie sprachen von blauen Bohnen!«
»Aber nicht doch!« kam es da aus Scherenbergs Stuhl, so laut und überzeugt kräftig, daß alle hell auflachten. Der Dichter von Waterloo blickte ganz erstaunt aus seinen grauen Lichtern.
Da schellte es durchdringend, als verübe jemand ein erfolgreiches Attentat auf den Drahtzug der Klingel. Unwillkürlich horchten alle hinaus. »Das ist Bülow,« prophezeite Korff, »so fortissimo animato singt nur ein Musiker das Lied von der Glocke.«
In wilder Hast sprang Dohms untersetzte proppere Leiblichkeit vom Stuhle, eilte spornstreichs zu dem Bechsteinflügel in der Ecke des Zimmers hinüber und begann mit gewaltiger Muskelkraft den Einzugsmarsch aus dem zweiten Akt des »Tannhäuser« zu pauken.
In die heimtückische erwartungsfrohe Spannung der Gesellschaft hinein platzte die Tür; im Hut und Mantel, einen Riesenschal um den Hais gewunden, stand der sechsundzwanzigjährige Hans von Bülow im Türrahmen, die kleine Gestalt vorgereckt, die scharfen Augen grimmfunkelnd, den charakteristischen Ziegenbart vor Wut gesträubt, und schrie: »Fis, Mann! Fis!! Sie spielen fortwährend F!«
Ein johlender Jubel erbrauste, hochgemut umrahmt von Dohms Wagnergetöse.
Inzwischen befreite Friedrich den quecksilbrig vor Ungeduld zappelnden Pianisten von seiner Umhüllung. Kaum war er den Ärmeln des Pelzes entronnen, stürmte er zu dem Flügel hinüber und schmetterte ohne Rücksicht auf Dohms tobsüchtige Hände den Deckel des Instrumentes nieder.
»Du läßt das!« herrschte er den Freund an. »Ihr, du und deinesgleichen, seid schuld, wenn der Meister nicht durchdringt. Wie kann einer ihn verstehen, wenn ein Pfuscher sich hinsetzt und immer F spielt statt Fis!«
Dohms lustige Augen lachten durch die Brillengläser: »Lieber, wenn mein F allein deinem Propheten im Wege stände!«
»Dein F ist typisch,« ereiferte sich Bülow. »Es zeigt –«
»Nun hören Sie bloß auf, junger Mann,« hob der alte Foerster abwehrend die Hände. »Bei dieser Musik –«
»Musik,« fing Prietzel auf, »das nennen Sie Musik! Hofrat! Diesen Bombast, diesen Phrasenschwulst, diesen Tataren-Radau-Tamtam!«
Bülow schnaubte vernehmlich, seine kleine kampfbrünstige Gestalt reckte sich. Doch ehe er erwidern konnte, rief Lassalle: »Aber Prietzel, Junge, hast du kein Ohr für dieses hinreißende Pathos Wagners, für diese gewaltige Deklamation, für diese deutsche Wucht und Zartheit und urwüchsige Kraft!« Er stand da, vor Begeisterung sprühend.
»Bravo,« sekundierte Pietsch enthusiastisch.
Jetzt stand alles und rief durcheinander.
»Entsetzlich,« schüttelte sich der Hofrat.
»Paris hat ihm die Antwort Europas auf seine Zumutung erteilt,« frohlockte Dr. Prietzel.
»Wenn er sich rechte Mühe gibt und noch etliches zulernt,« gönnerte Korff, »kann er vielleicht einmal einen brauchbaren Regimentsmarsch zusammenschreiben.«
Scherenberg, der allein sitzen geblieben war, flüsterte mit versunkenen Augen: »Meyerbeer.« Es klang wie ein erlösendes Zauberwort.
Bülows Bart zitterte. Er fuchtelte mit seinen aderreichen genialen Händen und sprach wild auf Dohm ein: »Ich sage dir, Wagner ist der deutscheste Musiker, der je gelebt hat. 1849, als Liszt den Lohengrin in Weimar –«
»Paris – Paris!« hißte Prietzel sieghaft seine Fahne.
»Paris!« spießte Bülow die Herausforderung wie auf der Spitze eines Floretts auf, »wollen Sie etwa behaupten, daß dieser Tobsuchtsanfall gegen Wagner in Paris –«
»Allerdings,« betonte der Hofrat. Und jeder sprach wieder heftig auf seinen Spezialgegner ein.
Zwei Parteien klafften jäh auseinander.
Da stand plötzlich mitten unter den Fehdenden eine aufrechte hohe Gestalt mit langem, schlohweißem vollen Haar, das seltsam gegen das militärisch straffe Gesicht abstach. General von Pfuel, der Siebenundachtzigjährige, der ewig junge Ungebrochene blickte mit seinen klaren blauen Augen belustigt in den wogenden Streit.
Man bemerkte ihn erst, als er mit kräftiger Kommandostimme dazwischenwetterte:
»Alcibiades, ist das Ihre heurige Überraschung, daß Sie uns uns gegenseitig zum Schmause vorwerfen? Herr von Bülow ist gerade dabei, Dr. Prietzel menschenfresserlich zu behandeln.« Damit reichte er dem Hausherrn die eisenfeste Hand.
Da verstummte alles zur Begrüßung. Dohm aber rief wie ein Heerrufer: »Exzellenz, Sie kommen als Retter in der Not. Ein 48 der Musik! Dort, Herr Hofrat Foerster und Genossen bilden den vormärzlichen Musikstaat, hier Bülow, Lassalle, Pietsch und ich schwingen die rote Fahne der Revolution. Wir erwarten von Ihnen, der Sie einst für den Antrag gestimmt haben, dem revolutionären Wien zu Hilfe zu ziehen, daß Sie jetzt auch uns zur Hilfe eilen. Ich verpfände mich und meinen Namensvetter, den Kölner Dom, für ein lorbeerumrahmtes Bild im Kladderadatsch.«
Da drohte Prietzel mit seiner schönen guten Stimme und einem feinen Lächeln: »Ich sag’s der Kreuzzeitung!«
Alles lachte und dachte daran, daß die Kreuzzeitung das achtundvierziger Ministerium des Generals »das Ministerium der Schande« genannt hatte.
Der aufrechte junge Greis besah sich der Reihe nach die kampferhitzten Gesichter.
»Kinder,« schmunzelte er, »habe heute früh wie jeden Tag in der Spree gebadet. Loch ins Eis hacken lassen. Scheint mir ausgezeichnetes Lokal für ‘ne Wagnerdebatte, so’n Eisloch. Empfehle ich euch dringend.«
Da rief Lassalle: »Ausgezeichnete Idee, Exzellenz. Dann werden die Herren dort drüben doch nicht so unverfroren auftreten.«
»Bravo,« erkannte Korff ritterlich an. »Aber jetzt geben Sie uns unser abendlich Brot, Lassalle. Ich befinde mich nämlich in der oktroyierten Verfassung des Verhungerns.«
Man lachte, sofort umgestimmt, und Lassalle überzählte seine Gäste. »Duncker fehlt noch,« stellte er fest.
»Natürlich,« rief Foerster, »der lange Weg entschuldigt –«
»Frau Lina!« hob Dr. Prietzel den Zeigefinger.
»Pst, pst, lästern Sie nicht,« dämpfte Lassalle drollig, »es ist mein Verleger.«
»Meiner auch,« beteuerte Pietsch.
Doch Dohm hatte schon das Fenster geöffnet, eine eisige Luft schnitt in das warme Zimmer, und mit mächtiger Stimme rief der Mann des Kladderadatsch durch die zum Schallrohr gerundeten Hände über die jetzt ganz einsame Potsdamerstraße:
»He, Duncker – Du-uncker!«
Alle traten zum Fenster und blickten hinüber zu der stillen Villa. Da sprang Duncker schon die Treppen zum Vordergarten hinab. Eine schmächtige Gestalt eilte vor ihm her. Er winkte hinauf und verabschiedete sich von seinem Begleiter.
»Beeilen Sie sich,« rief Korff hinunter, »wir schreien nach Brot wie die schlesischen Weber.«
Die schlanke Gestalt eilte über den Fahrdamm.
»Empfangen wir ihn mit der Jubelouverture,« schlug Förster vor. Und während Webers jauchzende Klänge unter Bülows Meisterhänden hervorrauschten, trat der Verleger ein.
Stumm blieb er in der Tür stehen, den unverhältnismäßig großen haarumwallten Kopf mit dem üppigen braunen Vollbart verklärt lauschend vorgebeugt. Als Bülow mit einem selbstherrlichen Akkord schloß, beugte er scherzhaft demütig das packende Gesicht und sagte: »Verzeihen Sie, meine Herren, daß ich Sie dem Hungertode ausgesetzt habe. Vielleicht kann Sie das aber trösten, daß meine Verzögerung höchstwahrscheinlich einen talentvollen jungen Dichter vom Hungertode errettet hat.« Und während ein feines Lächeln um die gewaltige kühne Nase zuckte, begrüßte er einzeln die Herren.
Dann trat Lassalle in die Mitte des Zimmers und sagte mit harmloser Miene: »Meine Herren, darf ich Sie in den Rauchsalon bitten.« Und öffnete die kleine Tapetentür.
»Nanu,« scheute Korff, der der Tür am nächsten stand, zur allgemeinen Belustigung entsetzt zurück.
»Erst Schall, jetzt Rauch. Und Essen?!«
»Bitte,« lud Lassalle mit steifen Zügen ein. Nur die blauen Augen flackerten vielverkündend.
»Ihr, die Ihr hier eintretet, laßt alle Hoffnung hinter euch,« murmelte Dr. Prietzel und durchschritt die Pforte.
»Hören Sie, Alcibiades,« runzelte der General die durchfurchte Stirn, »daß Sie Gesellschaftsumstürzler sind, wissen wir. Das ist nicht schlimm. Wenn Sie aber die Speisenfolge umstürzen und mit der Zigarre anfangen wollen, dann sind Sie ein Mensch, mit dem ein königstreuer Mann nicht mehr verkehren kann.«
Geheimnisvoll trat Lassalle als letzter ein und schloß hinter sich die Tür. Dann stellte er sich in den Kreis der gespannt forschenden Augen und sprach: »Meine Herren, das Volk draußen hat heute seinen Rausch. Es träumt von Freiheit und Hohenzollernliebe. Wir Skeptischeren, die wir nicht glauben, daß die Heirat eines Prinzen uns allen den Himmel auf Erden bescheren wird, wir würden ohne Rausch ausgehen, wenn es nicht außer königlichen Familienfesten noch andere Mittel gäbe, auch uns einmal aus dem Elend unserer Alltagsmisere in lichtere Höhen zu erheben.«
»Was mag nur wieder dahinterstecken?« kribbelte Bülow.
»Auch für uns, meine lieben Gäste, gibt es ein Mittel, uns zu berauschen, wenn wir es auch freilich noch weiter herholen müssen, als das Volk da draußen seine britische Königstochter.«
»Hm,« summte Dohm, »etwas Gutes kann es also nicht sein, denn das Gute liegt ja nah.«
»Psch, psch,« rief erwartungserregt der Chorus.
»Wir wollen uns berauschen, meine Herren. Unser Freund Heinrich Brugsch, der berühmte Archäologe, der leider ebenso wie unser allverehrter Herr Geheimrat Varnhagen von Ense heute am Erscheinen in unserer Mitte verhindert ist, hat uns das Mittel aus dem fernen Orient verschafft.«
»Doch nicht etwa eine Odaliske oder Bajadere!« rief Pietsch mit lüstern funkelnden Augen.
Alles lachte, und Korff neckte: »Unser lieber Pietsch schwelgt schon auf dem west-östlichen Divan.«
Und prompt zitierte Foerster vor sich hin:
»Und zu des Lagers vergnüglicher Feier Bereiten den dunklen behaglichen Schleier Die nächtlichen Stunden das schöne Gespinst.
»Nein,« fuhr Lassalle fort, schalkumwittert, »es ist zwar eine Art Götterrausch, den ich Ihnen bereiten will. Sie sollen hinaufgeführt werden über die Schranken Ihres Lebens. Aber, mein lieber Pietsch, den Gott und die Bajadere wollen wir hier doch lieber nicht als lebendes Bild stellen.«
»Spanne uns nicht auf die Folter,« flüsterte Prietzel ganz erregt. In allen Augen glitzerte die Neugier.
»Brugsch hat mir aus Persien –« Wieder machte Lassalle eine wohlberechnete Kunstpause. Es bereitete ihm ein satanisches Vergnügen, die Geduld der Gäste auf das Prokrustesbett zu schnallen.
»Nun los – los!« drängte Korff.
»Protzen Sie endlich ab!« kommandierte der General.
»Gemach, meine Herren, gemach, ich bin ja schon dabei, es Ihnen zu sagen, so schnell ich nur kann,« hielt Lassalle sie behaglich schäkernd hin und weidete sich an der aufgewühlten Neugier, die ihn unverhüllt aus acht Augenpaaren anstarrte. Jeder wußte, es mußte etwas Unerhörtes sein, wenn Lassalle solches Wesen davon machte.
»Brugsch hat mir aus Persien – « er blickte in eitlem Triumph jedem einzelnen langsam ins Gesicht – »Haschisch besorgt.«
Hellauf züngelte die lang zurückgedämmte Erregung. Alle riefen durcheinander. Was? Haschisch? Wir sollen Haschisch rauchen? Herrlich! Göttlich! Scheußlich! Ich bin doch in keine chinesische Opiumhöhle geraten!
Lassalle stand unbeweglich mit imperatorisch gekreuzten Armen, ein rocher de bronce in dem Aufruhr.
»Ist es nicht gefährlich?« erkundete endlich Foerster.
»Unsinn,« ereiferte sich Bülow. »Ein genialer Einfall, Lassalle. Schade, schade, daß ich vor wenigen Stunden etwas gegessen habe. Man müßte ganz nüchtern sein, um den vollen Genuß zu haben. Macht aber nichts. Los, los. Wo haben Sie das Zeug?«
Auch Dunckers Augen glänzten. »Das nenne ich mir eine Überraschung,« freute er sich in seinem behaglichen Phlegma. »Haschischrausch! Kinder, paßt auf, ich werde mich in einen Harun Al Raschid hineinträumen und Tausende beglücken.«
»Ich werde Napoleon und leite Austerlitz.« beschloß Korff.
»Ich möchte träumen, ich wäre zwanzig,« sagte der General, und sein herbes Gesicht löste sich auf, weich und lind.
Einige waren bleich geworden. Doch sie scheuten sich, ihre Furcht zu verraten. Nur Scherenberg lehnte ab: »Ich danke Ihnen herzlich, verehrter Herr Doktor, für Ihre außerordentliche Aufmerksamkeit. Ich möchte aber bitten, mich ausschließen zu dürfen.«
Die Beherztesten protestierten heftig: »Nicht desertieren – mitgefangen – mitgehangen! Sie, der Dichter des preußischen Heldentums, werden doch nicht kneifen!« Und Lassalle erwog: »Herr Scherenberg, gerade Sie als Dichter müßte es doch reizen. Denken Sie an die mühelose Inspiration.«
Doch Scherenberg entgegnete fest und schlicht: »Mich inspirieren preußische Trommeln und klingendes Spiel, das den stürmenden Kolonnen voranschreitet, und flatternde Fahnen. Orientalischer Sinnenrausch ist meiner Kunst fremd.«
Da schwiegen alle, und Lassalle bat liebenswürdig: »So nehmen Sie dort in dem Stuhle Platz und erzählen Sie uns, wie wir uns aufgeführt haben. Und noch eins, meine Herren! Jeder von uns verpflichtet sich, nachher wahrheitsgemäß seine Traumerlebnisse zu berichten. Sie wissen wohl, daß der Rausch sehr schnell verfliegt, ohne jede katzenjämmerliche Nachwirkung.«
»Ja doch – ja doch!« trieb Bülow. »Geben Sie das Götterzeug nur endlich heraus!«
»Erst Platz nehmen,« gebot Lassalle.