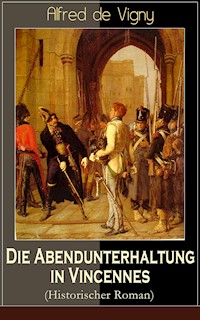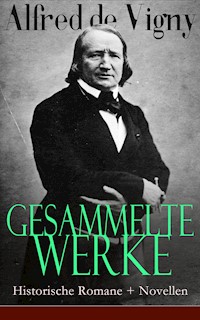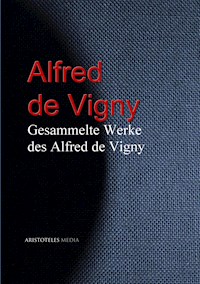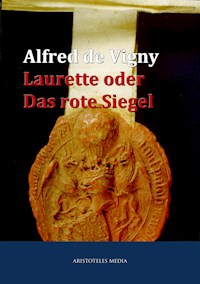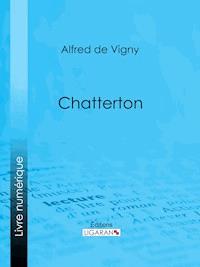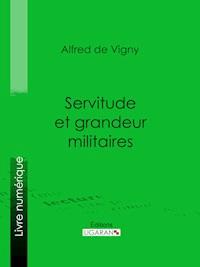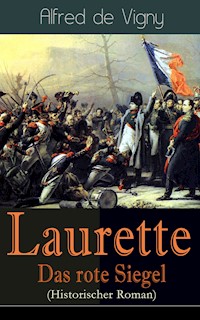
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Laurette - Das rote Siegel (Historischer Roman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Alfred de Vigny (1797-1863) war ein französischer Schriftsteller. Vigny wird heute zwar kaum mehr gelesen, zählt aber zu den bedeutenderen der französischen Romantiker. Aus dem Buch: "Die große Landstraße von Artois und Flandern ist lang und öde. Ohne Bäume und Gräben verläuft sie schnurgerade zwischen Feldern, die bei jedem Wetter mit einer gelben Schmutzschicht bedeckt sind. Auf dieser Straße befand ich mich im März 1815, und die Begegnung, die ich dortselbst hatte, ist mir seither unvergessen geblieben. Ich war allein und zu Pferde; ich trug einen guten weißen Mantel, roten Rock, schwarzen Helm, Pistolen und einen großen Säbel. Seit vier Marschtagen und -nächten hatte es in Strömen geregnet; ich erinnere mich jedoch, daß ich aus voller Kehle das Lied des Giocondo sang. Ich war ja so jung!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 51
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laurette - Das rote Siegel (Historischer Roman)
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Von meiner Begegnung auf der Landstraße
Die große Landstraße von Artois und Flandern ist lang und öde. Ohne Bäume und Gräben verläuft sie schnurgerade zwischen Feldern, die bei jedem Wetter mit einer gelben Schmutzschicht bedeckt sind. Auf dieser Straße befand ich mich im März 1815, und die Begegnung, die ich dortselbst hatte, ist mir seither unvergessen geblieben.
Ich war allein und zu Pferde; ich trug einen guten weißen Mantel, roten Rock, schwarzen Helm, Pistolen und einen großen Säbel. Seit vier Marschtagen und -nächten hatte es in Strömen geregnet; ich erinnere mich jedoch, daß ich aus voller Kehle das Lied des Giocondo sang. Ich war ja so jung! – Der König hatte im Jahre 1814 nur Knaben und Greise um sich gesammelt; wie es schien, waren alle Männer vom Kaiser verschleppt und aufgeopfert worden.
Als Gefolge König Ludwigs XVIII. waren meine Kameraden auf der Straße weit voraus, und ich sah am nördlichen Horizont ihre weißen Mäntel und roten Röcke schimmern. Die Lanzenreiter Bonapartes, die unseren Rückzug bewachten und uns Schritt für Schritt folgten, ließen am entgegengesetzten Horizont die dreifarbigen Wimpel ihrer Lanzen flattern. Mein Pferd war wegen eines verlorenen Eisens zurückgeblieben. Es war ein junges, starkes Tier, und ich gab ihm die Sporen, um meine Schwadron zu erreichen; so fiel es in Trab. Ich legte die Hand auf meinen dick mit Gold gepolsterten Gürtel; die Eisenscheide meines Säbels stieß scheppernd an meinen Steigbügel: Mein Stolz und mein Glück kannten keine Grenzen!
Es regnete immerfort, und immerfort sang ich. Bald wurde mir dies jedoch langweilig, und ich verfiel in Schweigen. Außer dem Regen und dem klatschenden Geräusch, das die Hufe meines Pferdes in den Fahrgeleisen hervorbrachten, war nichts zu hören. Die Straße war nicht gepflastert, und so versank ich im Schlamm und mußte wieder Schritt reiten. Meine Reitstiefel waren mit einer dicken, ockerfarbenen Schmutzkruste überzogen, und ihr Inneres füllte sich mit Regenwasser. Meine schönen, neuen goldenen Achselstücke, die mein Glück und meinen Trost ausmachten, waren von der Nässe aufgeweicht: Das betrübte mich.
Mein Pferd ließ den Kopf hängen, und ich tat desgleichen. Ich begann zu sinnen und legte mir erstmalig die Frage vor, wohin mich mein Weg führe. Mir war dies völlig unbekannt. Indessen hing ich solchen Betrachtungen nicht lange nach, weil ich ja davon überzeugt war, daß meine Pflicht bei meiner Schwadron liege. Die tiefe, unerschütterliche Ruhe, die ich im Herzen spürte, verdankte ich jenem unaussprechlichen Gefühl der Pflicht; ich versuchte mir dies zu erklären. Freudig ertrugen blonde und weiße Köpfe ungewohnte Mühsal, und so viele Männer, die in der bürgerlichen Welt ein glückliches Leben geführt hatten, setzten ihre gesicherte Zukunft ohne Bedenken aufs Spiel. Auch mir selbst hatte sich jene wunderbare Befriedigung mitgeteilt, die durch das Bewußtsein, daß man sich den Anforderungen der Ehre durchaus nicht entziehen könne, hervorgebracht wird. Wenn ich dies alles bedachte, so begriff ich leicht, daß die Selbstverleugnung eine viel einfachere und gewöhnlichere Sache ist, als man gemeinhin annimmt.
Ich fragte mich, ob die Selbstverleugnung uns möglicherweise angeboren sei. Was hatte es mit dem Bedürfnis auf sich, gehorchen zu müssen und den eigenen Willen wie ein drückendes Gewicht fremden Händen zu überantworten? Woher rührte das heimliche Glücksgefühl, dieser Bürde entledigt zu sein, und wieso hatte sich der menschliche Stolz nie dagegen empört? Ich sah zwar, wie dieser dunkle Trieb die Völker allenthalben zu starken Gemeinschaften verband; nirgends schien mir jedoch der Verzicht auf eigenes Handeln, eigene Worte, eigene Wünsche, fast sogar auf eigene Gedanken so unbedingt und furchteinflößend zu sein wie in der Armee. Ich erkannte, daß überall die Möglichkeit, Widerstand zu leisten, gegeben war, weil der Gehorsam des Staatsbürgers immer auf der Hut ist, steter Prüfung unterliegt und jederzeit aufgekündigt werden kann. Selbst die sanfte Ergebenheit der Frau kann ein Ende finden, wenn ihr ein Unrecht zugemutet wird; dann tritt sogar das Gesetz auf ihre Seite. Der Gehorsam des Soldaten dagegen, handelnd und leidend zugleich, den Befehl empfangend und ausführend, schlägt blind zu wie das antike Schicksal! Dieser Selbstverleugnung des Soldaten ging ich bis in ihre letzten Folgerungen nach: Sie kennt kein Wenn und Aber und kann bisweilen sogar zu verhängnisvollen Handlungen führen.
So sinnierte ich, während ich, von Zeit zu Zeit auf die Uhr schauend, meines Weges dahinritt. Ich nahm wahr, daß die Landstraße, die sich in gerader Linie ohne einen Baum oder ein Haus immer weiter dahinzog, die Ebene wie ein gelber Strich auf grauer Leinwand bis an den Horizont durchschnitt. Manchmal vermischte sich der wässerige Streifen mit dem ihn umrahmenden wässerigen Erdreich; wenn dann ein etwas hellerer Lichtstrahl über die öde Weite zuckte, bildete ich mir ein, auf einer lehmfarbenen Strömung inmitten eines schlammigen Meeres zu treiben.
Als ich den gelben Strich der Straße aufmerksamer prüfte, fiel mir in einer Entfernung von ungefähr einer Viertelmeile ein kleiner, dunkler Punkt auf, der sich bewegte. Dies erheiterte mich; es befand sich also jemand in meiner Nähe! Ich konnte den Blick nicht davon abwenden. Ich sah, daß sich der schwarze Punkt wie ich selbst in Richtung der Stadt Lille bewegte; der Umstand, daß er im Zickzack ging, zeigte mir an, daß er sich nur mühsam vorwärts arbeitete. Ich spornte mein Pferd und verringerte bald den Abstand zwischen mir und jenem Gegenstande, der vor meinen Augen in die Länge und Breite wuchs. Da der Boden hier etwas fester war, konnte ich den Trab wieder aufnehmen; bald meinte ich, ein schwarzes Wägelchen unterscheiden zu können. Da mich hungerte, hoffte ich, daß es ein Marketenderwagen sei. Meine Einbildungskraft verwandelte mein Pferd in eine Schaluppe, die nach vielen Ruderschlägen durch ein Meer, in welchem sie manchmal tief einsank, eine verheißende Insel anlaufen müsse.