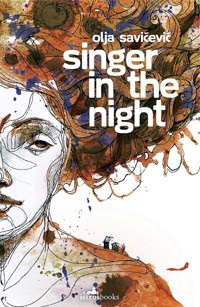8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dada kehrt in ihren Heimatort zurück, um herauszufinden, warum sich ihr Bruder Daniel umgebracht hat. Von der Familie sind nur ihre Mutter und ältere Schwester übrig, die seinen Tod nie überwunden haben. Mit ihren Nachforschungen weckt Dada Erinnerungen an die Kindheit, an die Westernfilme, deren Helden Daniel und sie verehrten, an die Kämpfe zwischen Indianern und Cowboys, die sie sich mit den Kindern von der anderen Seite der Bahngleise lieferten. Daniels Selbstmord erscheint ihr wie ein Verrat, und mit den Bildern der Vergangenheit im Kopf macht sie sich auf die schmerzhafte Suche nach einer Erklärung. Olja Savicevics Roman "Lebt wohl, Cowboys" ist eine geistreiche und poetische Auseinandersetzung mit den allmächtigen Helden der Kindheit und der Frage nach Schuld und Rache. In der Reihe Sonar veröffentlicht Voland & Quist die Stimmen des jungen, urbanen Süd-Osteuropas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Aus dem Kroatischen von Blazena Radas
Sonar 8
Originaltitel: Adio kauboju, erschienen bei Algoritam, Zagreb 2010
Verlag Voland & Quist, Dresden und Leipzig, 2011
© der deutschen Ausgabe by Verlag Voland & Quist – Greinus und Wolter GbR
Lektorat: Dagmar Schruf, Bornheim
Korrektorat: Stephan Ditschke, Hamburg
Umschlaggestaltung: HawaiiF3, Leipzig
E-Book-Erstellung: nimatypografik
ISBN 978-3-938424-88-9
www.voland-quist.de
Olja Savicevic, 1974 in Split geboren, veröffentlichte mehrere Gedichtbände und arbeitet als Kolumnistin, Literaturkritikerin und Herausgeberin. Für ihre Erzählungen in »Augustschnee« (Voland & Quist, 2008) erhielt sie diverse Literaturpreise. »Lebt wohl, Cowboys«
Dada kehrt in ihren Heimatort an der dalmatinischen Küste zurück, um herauszufinden, warum sich ihr Bruder Daniel umgebracht hat. Von der Familie sind nur ihre Mutter und ihre ältere Schwester übrig, die seinen Tod nie überwunden haben. Mit ihren Nachforschungen weckt Dada Erinnerungen an die Kindheit, an die Westernfilme, deren Helden Daniel und sie verehrten, an die Kämpfe zwischen Indianern und Cowboys, die sie sich mit den Kindern von der anderen Seite der Bahngleise lieferten. Daniels Selbstmord erscheint ihr wie ein Verrat, und mit den Bildern der Vergangenheit im Kopf macht sie sich auf die schmerzhafte Suche nach einer Erklärung.
»Lebt wohl, Cowboys« ist eine poetische, geistreiche Auseinandersetzung mit den allmächtigen Helden der Kindheit und der Frage nach Schuld und Rache.
Die Herausgabe dieses Werks wurde gefördert durch TRADUKI, ein gemeinsames Programm des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland, des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, Goethe-Institut und S. Fischer Stiftung.
Die Reihe Sonar wird herausgegeben von Christine Koschmieder.
Eastern
Fremder, hier schützt dich kein Gesetz
(Graffiti, große Mole)
Inhalt
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
WESTERN
THE END
LEB WOHL
1.
Der Sommer 200X kam früher als sonst. Das bedeutete eine elende Hitze, die sich seit Anfang Mai angesammelt hatte: In den Parks und Blumenkübeln seufzten die Mairosen.
Ende Juli packte ich alle meine Sachen zusammen, verließ die fremde Wohnung, in der ich einige verlorene Jahre verbracht hatte, und fuhr nach Hause.
Meine Schwester erwartete mich in der Küche unseres alten Hauses mit einem fertig gepackten Koffer. In den eineinhalb Stunden, die unser Treffen dauerte, erhob sie sich viermal vom Tisch, einmal um mir Milch nachzuschenken und dreimal, um auf die Toilette zu gehen. Schließlich kam sie mit grell rosa geschminkten Lippen zurück, was mich wunderte, auch wenn ich nichts sagte. Eine solche Lippenstiftfarbe hatte sie früher nicht benutzt. Sie verschickte einige SMS und redete nebenher mit mir. Dann stand sie endlich auf, strich ihren Rock glatt und stieg die lange Treppe im Hausflur hinab. Ma lag ein Stockwerk tiefer in ihrem Zimmer und zappte sich durchs Fernsehprogramm.
Sie verabschiedeten sich kurz in der Haustür, ich hörte ihre Stimmen und sah vom Balkon, wie meine Schwester an der Straßenecke hinter dem Haus des Bäckers verschwand. Für einen Augenblick war sie eine unwirkliche Erscheinung in einer wirklichen Szene, eine Simulation. Ich schlürfte den kalten Kaffee aus ihrer Tasse mit dem grell rosa Lippenstiftabdruck.
Bevor sie fortging, hatte sie mir von ihrem Zusammenleben mit Ma in den letzten Monaten erzählt.
Das tägliche Ritual war präzise und einfach: Sie standen sehr früh auf, immer zur selben Zeit, und tranken mindestens zwanzig Minuten lang Kaffee. Dann machten sie sich, bevor die Sonne zu stark brannte, zu Fuß auf den Weg, eine hinter der anderen her, an der Küstenstraße entlang zum Friedhof. Der schmale Erdstreifen am Straßenrand, gerade breit genug für zwei kleine Füße, verwandelte sich an Sommertagen in Puder. Zwischen der Straße auf der einen und den Brombeersträuchern, dem Greiskraut und den unverputzten Häusern auf der anderen Seite dieses imaginären Bürgersteigs wirbelte der Staub auf und drang in die Augen, den Hals und zwischen die Zehen in den Sandalen.
»Hast du gewusst, dass manche Menschen Erde essen?«, fragte meine Schwester die Mutter, als sie durch den Straßenstaub auf der Küstenstraße gingen. »Geophagie nennt man das.«
Und Ma schoss zurück: »Staub zu Staub, es ist besser in der Erde vergraben zu werden, als in Beton eingemauert.«
»Der Tod ist mir egal«, fuhr meine Schwester dazwischen. »Scheiß auf den Tod. An den kann man sich auch gewöhnen, da bin ich mir sicher.«
»Natürlich ist er dir egal.« Ma war verletzt, sie schüttelte den Staub aus ihren Holzpantoffeln und ging erhobenen Hauptes weiter, mit der Würde einer zukünftigen Verstorbenen, einen Schritt vor der Schwester.
Nachdem sie unser Grab gesäubert und die verwelkten Blumenblätter abgezupft hatten, liefen sie beschwingt zum Strand hinunter.
»Still und dumpf wie in einer Mikrowelle«, bemerkte die Schwester, als sie durch fremde Höfe und vertrocknete Obstgärten gingen, das erzählte sie mir später.
Am Strand holte Ma die angestoßenen Birnen und Bananen aus einer Papiertüte, die in einer Plastiktüte steckte, die in einer Tupperdose lag, die in der Tasche verstaut war, und bot sie mit ihrem berühmten Hollywoodlächeln an, bei dem sich jeder normale Mensch besser fühlen müsste, stellte meine Schwester fest.
Aber ihr kam es so vor, als zöge Ma diesen Gesichtsausdruck aus einer Datei oder aus der großen Basttasche, die sie werk- und feiertags mit sich herumschleppte. Manchmal zieht sie dieses Lächeln, das As unter ihren vorgefertigten Gesichtsausdrücken, einfach im falschen Moment aus dem Ärmel, dachte sie.
Ihre Zweisamkeit endete jeweils mit der Rückkehr nach Hause, nach dem Mittagessen, wenn sich meine Schwester bis zum Abendessen in ihr Zimmer im ersten Stock zurückzog und versuchte zu arbeiten, obwohl sie Urlaub hatte – sie war Lehrerin an einer Schule. Ma fütterte die gelbe Jill, machte es sich vor dem Fernseher bequem und verkündete: »Meine Serie fängt an.«
Minerva, Aaron und Isidora hatten beschlossen, Vasiona Morales’ wahre Identität aufzudecken. Sie war eine sehr gefährliche Frau, die man von Juan trennen musste.
Für Ma waren alle Serien gleich wichtig.
Sie schlief gewöhnlich vor dem Fernseher ein, das Bettlaken über den Kopf gezogen, obwohl an diesen Tagen die Temperatur auch nachts nicht unter 30 Grad fiel.
Meine Schwester hatte Panik, dass Ma es mit den Schlaftabletten übertrieb – sie bewegte sich nicht unter dem Laken, atmete nicht, nur manchmal furzte sie im Schlaf.
»Sie ist schrecklich«, sagte Ma über die Schwester, als diese weg war. »Sie sagt so furchtbare Sachen. Ich verstehe das einfach nicht, Dada.« So heiße ich – Dada, diesen Namen haben mir meine Eltern gegeben.
Während ich Ma bis zur Küstenstraße begleite, steigt die Hitze aus der Erde nach oben: Um sieben reicht sie bis zu den Knöcheln. Montags beginnt es nach trockenen Vormittagen gleich mittags vom Himmel zu brennen. Gegen fünf ist es in der Stadt am schlimmsten, die salzige Luft schwitzt, und alles, was sich bewegt, watet träge durch die nachmittägliche Melasse, und das Lied aus Millionen Klängen verwandelt sich in einen flachen elektrischen Ton, der betäubt.
Obwohl Ma vollkommen aufrecht sitzt und steht, beim Gehen am Straßenrand wankt sie. Einige Zentimeter neben ihrer Schulter jagen Tankwagen und Tiefkühlfisch-Transporter vorbei. Vielleicht ist für Nicht-Fahrer kein Platz mehr im Verkehr, denke ich.
»Man sollte sie in Fußgänger-Gulags sperren, diese lebensmüden Idioten«, sagte meine Schwester einmal, ich glaube, als wir im Geländewagen ihres Exmanns zu Daniels Beerdigung fuhren und ein paar Jungs die Straße überquerten.
»Fußgänger soll man lieben. Fußgänger haben die Welt erschaffen. Und als alles vollendet war, kamen die Autos«, sagte ich. Alle sahen mich an, als sei ich nicht bei Trost. »Das ist aus einem Buch«, sagte ich.
Ich saß hinten auf dem klebrigen Kunstleder, zwischen Kränzen aus Palmzweigen, die mich in die nackten Arme pieksten, zwischen Chrysanthemen-Gebinden und Sträußen aus aufgeblühten Rosen mit großen schwarzen Bändern. Die Kränze hatten violette Bänder mit in Goldfarbe aufgedruckten Namen.
»Damit auch jeder weiß, wer da trauert«, bemerkte die Schwester, was allgemein als unangebracht empfunden wurde.
»Wie primitiv wir sind«, sagte sie, während sie das Fenster schloss, durch das sie eine blutrote, noch glühende Kippe geschnippt hatte, »sieht man an solchen Dingen. Jede Liebe wird gewogen, verstehst du, je größer die Todesanzeige, der Marmorstein, das goldene Kreuz, je mehr Geld, desto größer die Liebe. Rausgeschmissenes Geld. Je luxuriöser der Staubsauger für das Brautpaar, desto größer die Bruderliebe, immer dasselbe. Arme Verwandte gibt es nicht, das sind dann geizige Schotten, die dich nicht lieben«, sagte sie und drehte sich zu mir um.
Ich saß steif zwischen den pieksenden Kränzen, achtete darauf, die Blumen nicht zu zerquetschen und beobachtete die Menschen, die neben dem Zementwerk Kirschen pflückten. Sie hatten Leitern, Mützen und blaue Schürzen. Sie sahen zufrieden aus, digitale Arbeitsbienen. Ich fragte mich, ob wohl Zementstaub auf sie fiel, wenn sie mit Haken die Äste nach unten zogen. Diesen Staub hatte ich als weichen Teppich in Erinnerung, eine angenehme Erinnerung.
Ich antwortete der Schwester nicht, und das nahm sie zum Anlass, weiterzureden, Sätze, die wie Projektile über meine Abwesenheit schossen. Ihr Exmann, ein friedliebender und unscheinbarer Typ, weich und stoisch, sagte zu ihr: »Lass endlich gut sein.«
Mutter hat sich aus einem bestimmten Blickwinkel in einen Maulwurf neben dem Plakat des Gemeindezentrums verwandelt, auf dem Jesus liebt dich stand, dann in eine erloschene Wunderkerze neben Kuna.komerc und schließlich in ein Minuszeichen, das unter dem vergilbten General Gotovina in Überlebensgröße durch den Staub an der Straße vor der Tankstelle ging, auf einem Weg, der breit genug war für zwei kleine Füße. Sechzig ist hier die Höchstgeschwindigkeit, aber die meisten fahren mindestens achtzig, etwas weiter vorne endet die vierspurige Schnellstraße, und die Autofahrer verlieren das Gefühl für Geschwindigkeit. Und dann fädeln sich aus nicht asphaltierten kleinen Nebenstraßen Landwirte auf Traktoren in den Verkehr ein und verlangsamen ihn vollends.
Bis vor Kurzem lag auf der Landstraße auch noch Pferdemist, aber jetzt nicht mehr, es ist zu gefährlich geworden, mit dem Pferdekarren zu fahren. Und ich glaube, dass nur noch ein Mann in der ganzen Stadt ein Pferd besitzt. Es ist zwar illegal, Pferde in der Stadt zu halten, doch er war früher Schmied, und wenn es stimmt, was Ma sagt, gehen alle davon aus, dass er bald stirbt. Was wird wohl aus dem Pferd, wenn der Schmied stirbt?, überlegte ich. Früher gab es im Alten Ort eine Schmiede, die dieser Alte betrieb, im dem Hof, wo sich heute das Restaurant La vida loca befindet. Doch die Schmiede wurde in dem Jahr geschlossen, als Daniel zur Welt kam. Das Geräusch des Hufbeschlagens, das Schnauben der Pferde in der Dunkelheit und das Feuer hatten sich mir eingeprägt. Ich war damals noch sehr klein und beobachtete diese Dinge aus der Entfernung, sah aus der sommerlichen Helligkeit, von der die Augen schmerzen, in die offene Dunkelheit des Hauses. In der Straße, in der wir wohnten, hörte man Pferdegetrappel auf dem abgenutzten Steinpflaster, ein unwirkliches Geräusch, so unwirklich wie die Melodie des Ledo-Wagens, der zur Zeit der Mittagsruhe zum Eisessen ruft. Willy Wonka ist in Ihre Stadt gekommen!
Jedenfalls liegen keine frischen Pferdeäpfel mehr in den Gassen. Hunde kacken dorthin und niemand sammelt es auf, so wie früher die Pferdeäpfel nicht aufgesammelt wurden. Doch mit Hundescheiße wird niemand nach dir werfen, da kannst du sicher sein. Das würde mich wundern.
Als die Gestalt in der Ferne zu einem Strich geworden war – wegen der Gluthitze auf der Straße war es ein waagerechter Strich, ein Minus, kein senkrechter, wie man vielleicht erwartet hätte – drehte ich mich um und rannte nach Hause, am betonierten Bachbett bei den Neubauten für Kriegsinvalide entlang. Früher konnte man dort allerlei Schrott und Schätze finden, im Frühjahr schwappte der Bach über einen Damm aus Müll ins Meer. Seit er gesäubert und das Bett betoniert wurde, ist mir aufgefallen, dass auf dem Grund eine Schleimspur sickert, die sich im Sommer zu grünem Matsch verdickt.
»Du könntest morgen allein zum Friedhof«, hatte ich gestern, am zweiten Tag nach meiner Ankunft, zu ihr gesagt. »Ich muss etwas in der Stadt erledigen, etwas Wichtiges«, log ich.
Ma hatte gelächelt, genau so, wie meine Schwester gesagt hatte, sie holte ihr Hollywood-Lächeln im falschen Moment hervor. Sie hatte schöne Zähne, einen goldenen Schneidezahn in der unteren Reihe. Manchmal klopfte sie mit dem Fingernagel auf die Zähne, um ihre Festigkeit und Gesundheit zu beweisen.
»Mama sieht aus wie ein Smiley auf Droge«, sagte ich meiner Schwester am Telefon.
»Meine Rede«, antwortete die Schwester und blies Rauch in den Telefonhörer am anderen Ende.
* * *
Ich fand jede Menge Schlafmittel auf dem Boden unter dem Küchenschrank: Xanax, ein bisschen Prozac, Normabel, Praxiten, Portal und Apaurin, alles in einer Schachtel mit der Zahl 505 und einem Strich, zusammen mit Pflastern, Schmerztabletten und Halspastillen. Sie hatte sie nicht einmal versteckt, wie meine Schwester vermutete – oder aber Ma wusste, dass offenkundige Verstecke die besten waren. Letzten Winter hatte sie alles in den Müll geworfen, das hatte ich beobachtet.
»Wie kommt sie bloß da dran?!«, schnaubte die Schwester wütend.
Das ist kein Problem, dachte ich. Das halbe Studentenwohnheim war auf Wodka oder Wein in Kombination mit Valium, Beruhigungsmitteln und anderen Sachen, die man angeblich nur auf Rezept bekam. Sie waren billiger als Bonbons. Ein Rasta aus dem ersten Stock hatte immer eine Tüte voll dabei, nach dem Prinzip: »Greif rein, und was du in der Hand hast, gehört dir«, hatte mir eine Mitbewohnerin erzählt.
»Das Problem ist, dass jeder Gaul, der keine Lust hat, sich die Haare zu waschen, meint, ein Rasta zu sein«, erinnere ich mich gesagt zu haben.
»Lass ihr das Lorisan zum Schlafen«, ermahnte mich meine Schwester. »Den Rest, den du findest, kannst du in die Toilette schütten.« Ich zog mehrmals die Spülung, eine hartnäckige blaue Prozac-Tablette kam immer wieder hoch. Dann war auch die weg.
Ich sitze auf der Schaukel auf dem Balkon und sehe über die Dächer hinweg. Von der Straße grüßen mich Nachbarn und ich winke ihnen zu.
Als sie auftaucht – zuerst ein Minus, dann ein Maulwurf – von Westen, hinter dem Haus des Bäckers, winke ich ihr ebenso zu. Schon in der Tür sage ich: »Ma, ich habe beschlossen, eine Zeit lang zu bleiben. Kannst du Daniels Sachen aus meinem Schrank räumen?«
Sie steht in der Toilette vor dem Waschbecken und seift sich unter dem heißen Wasserstrahl lange die Hände ein.
»Ja«, antwortet sie, dreht den Wasserhahn zu und trocknet die Hände mit einem rauen Frotteehandtuch.
»Es hat keinen Sinn, im Sommer Blumen hinzubringen, das vertrocknet alles, nach einem Tag ist schon alles vertrocknet«, sagt sie nachdenklich.
Mein Zimmer ist eine Schachtel in einem Schachtelhaus.
Zu einer Zeit, an die ich mich nicht erinnere, war hier ein Weinkeller mit Fässern, dann eine Speisekammer, weshalb es im Zimmer kein Fenster gibt. Nur eine schmale Tür, einen schmalen Tisch, einen riesigen Schrank, darauf eine große Puppe, dann ein Bett, über dem Bett einige uralte Filmplakate, hauptsächlich von Western. An einem Poster war ein trockener Olivenzweig befestigt, eine Huldigung an John Wayne.
In dieser Katakombe im Erdgeschoss, tief im Inneren des Hauses, hatte Mutters Großmutter gelebt, hilflos, blind, Diabetikerin. Fünf Jahre in Dunkelheit, unbeweglich bei vollem Bewusstsein.
»Santa Subita«, sagten Tanten und andere Frauen, an deren Gesichter unter den ondulierten Frisuren ich mich nicht erinnere. Die Blinde beschwerte sich nie, sie klagte nicht übertrieben, was eine solide Referenz für eine Heiligsprechung war. Sie leierte ihre Gebete mit dünnen Lippen herunter, die auf Fotografien voll gewesen waren, wie ich bemerkte. »Blaslippen«, hatte die Schwester über die Urgroßmutter auf einem der Fotos aus jungen Tagen gesagt und gegrinst.
Es gab nichts, worüber diese uralte Frau lieber sprach, als über die Liebe, mit vielen Ausschmückungen. Urgroßmutters Jugend wurde, während wir heranwuchsen und sie verschwand, immer ungezügelter, bis sie zum Schluss – in unserer Erinnerung ihrer Vergangenheit – als die Große Unersättliche kanonisiert wurde.
Sie hatte drei Ehemänner beerdigt, fünf Kinder geboren und in ihren besten Jahren konnte sie ein Feld mit Brombeeren, Fenchel und Spargel mähen, dann zum Mittagessen zwei Kilo Muscheln essen und mit drei Gläsern Rotwein hinunterspülen. Sie fluchte laut und oft und betete mit demselben Eifer.
Ich erinnere mich, dass Mama das Zimmer sorgfältig desinfizierte. In allen Schränken lag Naphthalin, in den Ecken roch es nach Lavendel und Kampfer.
»Die hat Angst, dass die Alte am lebendigen Leib in Stücke zerfällt, fehlt bloß noch, dass sie sie in Formalin einlegt«, sagte die Schwester. »Oder in Japon«, fügte sie hinzu.
Die einbalsamierte Alte, schon erheblich geschrumpft, war nicht viel größer als Daniel oder ich damals. Sie wurde vor unseren Augen weniger, von Tag zu Tag, in den dicken Daunen auf dem hohen Bett, von dem aus sie wisperte: »Kinder! Ah, Kinder!«
Wir Schwestern taten manchmal so, als hörten wir sie nicht, erinnere ich mich, aber Daniel war anders, er fand das nicht langweilig.
Es gab ein Lied aus dieser Zeit, das Ma häufig sang:
Du bist eine Paradiesblume
Dich liebt die ganze Welt
Dich liebe ich
Und sonst niemanden
Und ohne Mutters Wissen
Pflückte sie Rosen für ihren Liebsten …
Später sang ich dieses Lied für Daniel und Daniel für die Urgroßmutter, die mit offenen wässrigen Augen in der ewigen Dunkelheit lag.
»Oma, ist für dich wirklich alles ganz schwarz, wie in der Hölle?«
»Die Hölle ist nicht schwarz, die Hölle ist grün, wie das Meeresleuchten. Auch in mir ist alles grün wie ein Marsmenschenarsch.«
Mit den Händen drückte sich Daniel die Augen tief in die Höhlen, erinnere ich mich.
»Dann dreht sich das Auge um und du siehst das Innere, in dir drin«, sagte er.
Er drückte auf seine Augen, bis ihm schlecht wurde, aber die gelbgrüne Helligkeit erblickte er nicht, soviel ich weiß. Er sah sie erst später, in einem Sommer, als das Meer vor Algen in vollem Phosphor erblühte. Tagsüber glich es einer Jauchegrube, mare sporco, doch nachts zerstäubte jede unserer Bewegungen in fluoreszierende Tropfen.
»Und der Himmel?«
»Welcher Himmel? Es gibt keinen Himmel. Nein. Nur die Hölle und zwar hier auf der schwarzen Erde!«, die Alte stöhnte vor Schmerzen auf. Und fügte hinzu: »Oh, santo dio benedetto, du Sau du verhurte … Komm, mein Täubchen, sing für mich Du bist eine Paradiesblume …«
* * *
Ein paar Tage vor dem Tod der Urgroßmutter schlich sich ein kleiner Affe ins Haus, der damals im Hof unseres Nachbarn, des Tierarztes, lebte. Reiche Touristen hatten ihn dort zurückgelassen, als sie genug von ihm hatten, erzählte man sich. Er richtete eine große Unordnung im Haus an, dieser Affe. Wir brauchten lange, um ihn zu finden, er hatte sich unter Uromas viel zu großes Nachthemd verkrochen. Gemeines Biest, sagten wir. Bald darauf entkam er dem Tierarzt für immer, erst in den Park und später wer weiß wohin.
»Habt ihr zwei die Uroma lieb?«, fragte die Schwester.
Daniel und ich nickten. Die Alte war unser Holzreptil – sie berührte unsere Wangen mit trockenen geruchlosen Fühlern. Unsere Kellerpuppe vom Dachboden.
»Dann müssen wir ihr helfen«, sagte die Schwester und ihre grünen Augen blickten direkt aus der Hölle.
»Die arme Uroma hat es schwer«, sagte sie »und wir werden ihr helfen, dass sie in den Himmel kommt.«
Das wollte sie wirklich, erinnere ich mich. Dass wir der Alten ein Kissen auf das Gesicht legen. Ein Kind, das mit Waffen spielt, ist schrecklich, denn alles ist eine Waffe. Es ist ein wahres Wunder, dass so viele von uns die eigene Kindheit und die anderer überlebt haben.
»Den Himmel gibt es nicht«, sagte Daniel schnell. »Kannst die Uroma fragen.«
Mit Daniel war es einfacher. Damit war die Sache erledigt.
»Pass auf, dass Ma dich nicht hört«, flüsterte ich.
»Ich habe ja nicht gesagt, dass es Gott überhaupt nicht gibt.«
»Ihr seid Dummköpfe! Ganz gewöhnliche Dummköpfe. Und Feiglinge«, sagte die Schwester. Ihr Hass war grausam, erinnere ich mich. Er ist es übrigens heute noch.
»Feigling«, woher hatte sie bloß dieses Wort? Aus einem Film glaube ich.
Und die Alte – »die Arme, die Arme«, sagten alle – jammerte wirklich grauenvoll und verfluchte Gott und Teufel.
Ich glaube, dass meine Schwester diese Urgroßmutter liebte, auch wenn man bei der Schwester nie genau weiß.
Sie betete inbrünstig, dass die Urgroßmutter sterben möge, sogar beim Essen, wofür sie sich Ohrfeigen einfing.
Und schließlich fruchtete ihre schreckliche spirituelle Euthanasie.
Uroma starb wie ein Fisch, mit aufgerissenem Mund.
Das war unser erster Tod – er sah gar nicht so schrecklich aus.
Sie lag auf dem Bett, endlich mit geschlossenen Augen, und Daniel hob ihr weites Nachthemd an, das aus der Zeit, als sie die Große Unersättliche war. Wir suchten den Touristenaffen, doch unter dem Nachthemd war nichts. Alles an der Uroma war schon seit Jahren tot, blaue und braune von Schuppen bedeckte haarlose Beine. Nur der Muff zwischen den Beinen war lebendig, buschiges schimmerndes Fell, glänzend schwarz, das von der Mitte der Schenkel bis zu den Schamleisten kletterte und in dünner Winde bis zum Bauchnabel.
»Ist das der Affe?«, fragte ich.
»Eine Katze«, sagte Daniel überrascht und senkte das Nachthemd.
An diesem Abend entdeckte ich unter meinem Höschen ein Haar. Ein einzelnes, aber es ließ sich nicht herausreißen. Ich war beinahe ein Junge, wie mein Bruder, der »wie ein Mädchen« war, wie die Tanten immer sagten.
Doch das stimmte nicht, denn Daniel war genauso sehr ein Junge wie die geschnitzten Schutzengel oder wie die gotischen Engel mit den fröhlichen Gesichtern, die wie Jungs aussehen, nicht wie ein Mädchen. Sie sind frei von männlichen und weiblichen Makeln, die einzigen heiteren Vollblutwesen auf Kirchenfresken oder im freien Flug über den anorektischen Heiligen, Hysterikern und Jungfrauen in den Seitenflügeln. Vielleicht kommt es daher, dass sie interessante Aufgaben erledigen, profane Arbeiten zwischen Demiurgen und Menschen.
Hinter dem Altar der Kirche Sveti Fjoko, über der Pietà, lächelt und saugt ein vergoldeter pausbackiger Engel an seinen Zehen oder bohrt in der Nase. Alle Gottesanbeterinnen träumen davon, ihm in die Wange zu beißen.
Er war vielleicht ein verwahrloster Engel, aber kein Porzellantassenengel und kein Mädchen, unser Daniel.