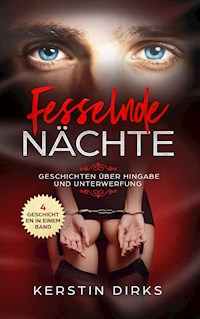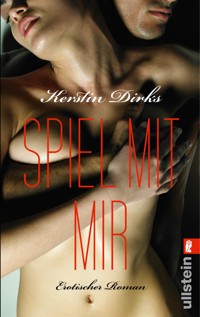3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Schottland im 17. Jahrhundert: Nach dem Tod ihres Vaters übernimmt die junge Avery McBain die Leitung des Clans. Doch durch eine Intrige ihres Vetters gerät sie bei einer Schlacht in die Hände der verfeindeten McCallens. Der Chief des Clans, der grausame Ewan McCallen, ist beeindruckt von dem Mut und der Kampfkunst seiner Gefangenen. Avery soll ihm als Trainingsgegnerin dienen. Je öfter sie gegeneinander kämpfen, umso stärker fühlen sie sich zueinander hingezogen. Bald schlagen nicht nur ihre Schwerter Funken …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Ähnliche
Das Buch
Schottland im 17. Jahrhundert: Nach dem Tod ihres Vaters übernimmt die junge Avery McBain die Leitung des Clans. Doch durch eine Intrige ihres Vetters gerät sie bei einer Schlacht in die Hände der verfeindeten McCallens. Der Chief des Clans, der grausame Ewan McCallen, ist beeindruckt von dem Mut und der Kampfkunst seiner Gefangenen. Avery soll ihm als Trainingsgegnerin dienen. Je öfter sie gegeneinander kämpfen, umso stärker fühlen sie sich zueinander hingezogen. Bald schlagen nicht nur ihre Schwerter Funken …
Die Autorin
Kerstin Dirks, 1977 in Berlin geboren, hat eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert und Sozialarbeit studiert. Sie schreibt seit mehreren Jahren historische Liebesromane, erotische Romane und Fantasy.
Kerstin Dirks
Leidenschaft inden Highlands
Roman
Ullstein
Neuausgabe bei Refinery
Refinery ist ein Digitalverlag
der Ullstein Buchverlage GmbH,
Berlin Juli 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009
Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-203-1
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
PROLOG
Worauf hatte sich Avery MacBaine bloß eingelassen? Sie stand am Ufer des Sees und beobachtete ihre jüngeren Schwestern Anola und Ann, die im kühlen Nass badeten. Sie spritzten sich gegenseitig nass und kicherten dabei vergnügt wie kleine Mädchen, denen man die Fußsohlen kitzelte. Avery betrachtete die zierlichen Frauenkörper, die bis zu den Hüften aus dem Wasser ragten, und blickte dann ein wenig unzufrieden an sich hinunter.
Anola war erst 17 Jahre alt, doch eine Schönheit, wie man sie in dieser Gegend selten sah. Ihre Figur war sinnlich, die Taille schlank, und die Brüste waren so wohlgeformt wie zwei saftige Äpfel. Sie besaß ein feines Gesicht, das noch immer kindliche Züge aufwies, und die strahlendsten Augen, die Avery je gesehen hatte. Kein Wunder, dass Anola die Blicke der Männer auf sich zog!
Ann sah mit ihrer auffällig blassen Haut und natürlichen Eleganz wie eine Edelfrau aus. Ihr Hals war schwanengleich, und sie trug ihr Haupt stets aufrecht und erhaben.
Die Männer ihres Clans schwärmten regelrecht für die beiden Frauen. Sie lächelten ihnen zu, wann immer sie ihnen begegneten, und machten ihnen nicht selten großzügige Geschenke.
Näher an sie heran wagten sie sich jedoch nicht. Und das lag nicht nur daran, dass es sich um die Töchter des Chiefs handelte.
»Avery passt auf ihre Schwestern auf wie ein Wachhund«, hieß es. Sie seufzte, denn es ärgerte sie, dass man in ihr nie mehr als eine Anstandsdame sah.
Wenigstens ein Mal wollte auch sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, nicht vom schimmernden Glanz der beiden jungen Frauen überstrahlt werden. Ob das je geschehen würde?
Resigniert grub Avery die Spitze ihres Schuhs in den feuchten Sand, während Ann und Anola langsam zum Ufer zurückschwammen. Das Wasser schimmerte rot im Licht der Sommersonne, und eine kühle Brise trieb die Wellen ans Ufer. Es war immer noch hell an diesem Abend.
Anola spritzte Ann ein letztes Mal nass und lachte. Ann schien das nicht zu gefallen. Sie verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf.
Aye, sie und ihre Schwestern waren völlig unterschiedlich – nicht nur, was ihre Erscheinung betraf.
Anola, das Nesthäkchen, galt als kleiner Dickschädel. Sie rühmte diesen Umstand gern mit den Worten: »Selbstverständlich bin ich stur. Das gehört sich für eine Schottin.« Ann sagte man nach, sie sei die Vernünftigste und Besonnenste unter ihnen. Es mangelte ihr weder an Erfahrung wie Anola, noch war sie ein Heißsporn wie sie selbst.
Avery wusste, wie sie sich Gehör verschaffte: notfalls auch, indem sie mit der Faust auf den Tisch schlug. Ein Verhalten, das bei einer Frau beileibe nicht gern gesehen wurde. Als Tochter des Chiefs, die noch dazu von ihm persönlich im Schwertkampf ausgebildet wurde, genoss sie allerdings einige Privilegien.
Die Männer brachten ihr Respekt entgegen. Sie behandelten sie wie eine von ihnen, was jedoch zwangsläufig zur Folge hatte, dass die Frau in ihr von den meisten Kriegern übersehen wurde. Nicht weil es ihr an der Körpergröße mangelte, ganz im Gegenteil. Wie leicht konnte sie einen Mann mittlerer Größe verunsichern, nur weil sie ihm in die Augen sah, ohne sich dabei auf die Zehenspitzen stellen zu müssen! Es lag vielmehr an ihrer kräftigen Statur, den herben Zügen und den krausen rotgoldenen Locken, die stets zerzaust aussahen. Es gelang Avery einfach nicht, sie zu bändigen, und deshalb band sie ihre Haare stets zu einem Zopf. Das war bequemer, als sie unter einem Tuch zu tragen, wie es die anderen Frauen taten. Auch gab sie ihrem Plaid jedem Kleid, und sei es noch so edel, den Vorzug.
»Vielen Dank, dass du Wache gehalten hast, Ave. Aber jetzt bist du dran.« Anns Worte holten Avery jäh in die Wirklichkeit zurück. Die mittlere Schwester griff nach einem ordentlich zusammengelegten Tuch, das im Gras für sie bereitlag, und schlang es um ihren nasskalten Körper.
Avery wusste nicht recht, was Ann meinte, und musste ihre Schwestern wohl sehr ratlos angesehen haben, denn die lachten plötzlich erneut los.
»Ab ins Wasser mit dir. Dein Training heute Nachmittag war doch sehr anstrengend. Du hast es bitter nötig«, sagte Anola auch prompt und hielt sich die Nase zu, um anzudeuten, wie nötig Avery ein ausgiebiges Bad ihrer Ansicht nach hatte. Dann schnappte sie sich das Tuch von Ann, die heftig protestierte, und trocknete sich ab. Anschließend schüttelte sie ihr Haar wie ein Hündchen, das in den Regen gekommen war, seinen Pelz, so dass unzählige perlenförmige Tropfen durch die Luft flogen und zielsicher in Averys Gesicht landeten.
»Zier dich nicht, Ave.«
Sie waren den langen Weg hinausgeritten, weil ihre beiden Schwestern so versessen darauf gewesen waren, den See zu erforschen, von dem ihr Vetter Amus ihnen erzählt hatte. Lochan Lor lag nur wenige Meilen vor der Grenze zwischen den Gebieten der MacBaines und der MacCallens.
Avery hatte sich den beiden Frauen angeschlossen, um wie gewohnt ein Auge auf sie zu haben, ganz wie es normalerweise ein großer Bruder getan hätte. Da Kenlynn MacBaine ihrem Mann allerdings keinen Sohn geschenkt hatte, war es nun an Avery, diese Pflichten zu übernehmen.
Gegen einen Ausflug hatte sie nichts einzuwenden gehabt, wohl aber sträubten sich ihre Nackenhaare bei dem Gedanken, sich ins kalte Nass zu stürzen. Zumal an einem Abend wie diesem, an dem die Temperatur im Vergleich zum Mittag so stark gesunken war, dass sie, auch ohne nass zu werden, leicht fröstelte. Insgeheim beeindruckte es sie, wie Anola und Ann der Kälte ohne Murren standgehalten hatten. Sie waren härter im Nehmen, als man ihnen ansah.
»Mein letztes Bad liegt nicht lange zurück«, konterte Avery und hob ihren Arm, um zum Beweis an ihrer Achselhöhle zu riechen. Als ihr dann ein unerwartet starker Geruch entgegenstieg, musste sie einen Moment lang die Luft anhalten, worauf Anola in Gelächter ausbrach. »Na bitte. Was habe ich dir gesagt?«
Avery knirschte mit den Zähnen. »Das kommt vom harten Training.« Sie hatte sich zuvor im Übungskampf gegen ihren Vater verausgabt. Er war nun einmal einer der stärksten Männer des Clans.
»Ich habe nichts anderes behauptet.« Anola hob beschwichtigend beide Hände.
»Schon gut«, knurrte Avery und zog ihr Schwert aus der Scheide, um es, mit der Spitze voran, in einem einzigen Stoß in den Grund zu rammen, so dass es in der Erde stecken blieb. Dann legte sie den Plaid ab, bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr sie fror. Sie wollte sich nicht erneut dem Spott ihrer Schwestern aussetzen.
Mit einem lauten inbrünstigen Schrei stürmte sie die Böschung hinunter, um sich mit einem Hechtsprung in die Schwärze des Wassers zu stürzen.
Die Wellen schwappten kraftvoll über sie hinweg, während sie in einer geraden Linie zur Mitte des Sees tauchte. Lieber Gott, das Wasser war eisig! Die Kälte lähmte ihren Herzschlag für einen Augenblick. Sie glaubte beinahe zu erfrieren. Doch dann setzte er wieder ein und beschleunigte sich rasch, während Avery schnaufend an die Wasseroberfläche zurückkehrte.
Ungeschickt mit den Armen paddelnd, drehte sie sich zu ihren Schwestern um. Wie hatten die beiden es bloß in diesem eiskalten Gewässer aushalten können?
Ann, deren braune offene Haare wie ein dunkler Schleier in ihr Gesicht wehten, winkte ihr mit hochgestrecktem Arm zu, während Anola ihr dabei half, sich anzukleiden, und Avery gleichzeitig etwas zurief, das die nicht verstand, weil sich das Wasser in ihren Ohren gesammelt hatte.
»Ich verstehe kein Wort. Du musst lauter sprechen!« Avery neigte den Kopf zur Seite, damit das Wasser aus ihrem Ohr laufen konnte. Mit strampelnden Beinen kämpfte sie darum, an der Oberfläche zu bleiben.
»Hinter dir«, drang schließlich die dumpf klingende Stimme Anolas, die mit einem energischen Fingerzeig hinter sie deutete, zu ihr vor. Avery drehte sich blitzschnell und änderte die Richtung.
Wachsam sah sie sich um, bis sie auf der schimmernden Wasseroberfläche eine verdächtige Bewegung entdeckte. War es ein Hecht, der das Gewässer unsicher machte?
Während Avery noch nach einer Erklärung für die zunehmende Wellenbewegung suchte, tauchte plötzlich statt eines Fisches nur wenige Schwimmzüge entfernt der Kopf eines Mannes aus dem Wasser auf. Der Fremde schnappte nach Luft, wischte sich mit beiden Händen über die Augen und schüttelte sein nachtschwarzes Haar, ehe er zum Ufer schwamm und im Schilf verschwand.
Er hatte sie nicht gesehen, weil sie rechtzeitig untergetaucht war. Avery erlaubte sich einen kurzen Atemzug, ehe sie erneut Deckung im Wasser suchte. Woher kam der Fremde so plötzlich? Und wieso hatte sie ihn nicht früher bemerkt?
Wahrscheinlich war er von der anderen Seite des Sees gekommen. Eine Welle trug ein eigenartig geformtes Holzstück zu ihr herüber. Avery wartete einen Moment, ehe sie an die Wasseroberfläche zurückkehrte, griff nach dem schmalen Stück Holz und musterte es verwundert. Es war mit einem Messer bearbeitet worden und von innen ausgehöhlt. Vermutlich gehörte es dem Fremden. Aber wozu hatte er es gebraucht?
Avery betrachtete es nachdenklich von allen Seiten. Plötzlich wurde ihr klar, warum sie den Kerl nicht vorher bemerkt hatte: Er musste sich unter Wasser fortbewegt haben. Durch den Halm hatte er Luft bekommen.
Doch warum dieses Versteckspiel? Avery ging in Gedanken einige Möglichkeiten durch. Sie kam zu dem unweigerlichen Schluss, dass es nur einen Grund gab, warum er sich in ihrer Nähe aufgehalten, sich ihnen aber nicht gezeigt hatte. Er war ein Wüstling, der ihre Schwestern beim Baden beobachtet hatte!
Denn wenn er ein Mann der Ehre gewesen wäre, hätte er sich längst stillschweigend verzogen. Stattdessen trieb er sich noch immer hier herum. Vielleicht hoffte er auf weitere interessante Ausblicke?
Ein derartiges Verhalten konnte Avery nicht dulden. Es ging um die Ehre ihrer Schwestern!
Entschlossen, diesem Schuft eine Lektion zu erteilen, folgte sie ihm ins Schilf. Sie würde ihn zur Rede stellen. Und sobald er sein Verbrechen gestanden hatte, würde er zur Strafe ihre Fäuste zu spüren bekommen. Er war nicht der erste Mann, dem sie ihren Handabdruck auf der Wange als Andenken hinterlassen würde, weil er sich ihren Schwestern gegenüber unziemlich verhalten hatte. Einen kecken Blick und ein heimliches Augenzwinkern ließ sie den Kerlen durchgehen. Dieser Schuft aber war deutlich zu weit gegangen.
Vorsichtig schob sie das Schilf zur Seite und lugte durch die entstandene Lücke. Der Mann lief einige Schritte am Ufer entlang, sah sich um, als suchte er nach etwas, und blieb schließlich im Gras stehen, um sich nach einem Tuch zu bücken. Damit trocknete er seinen muskulösen Po ab. Er war klein, augenscheinlich recht fest und ungewöhnlich braun gebrannt. Die meisten Menschen im Hochland waren eher blass. Eins musste sie ihm zugestehen: Ihm stand die dunkle Farbe.
Avery ertappte sich dabei, dass sie ihn schon unerhört lange anstarrte. Vielleicht sollte sie besser wegsehen, bis der Fremde sich angekleidet hatte. Doch aus irgendeinem Grund konnte sie die Augen nicht von seinem wohlgeformten Körper lassen. Es ärgerte sie, dass sein Anblick sie derart faszinierte, dass sie einen Moment lang ihre eigenen Prinzipien über Bord warf. Und dass er die Unverschämtheit besaß, sich ihr auf diese Weise zu präsentieren. Auch wenn das in Anbetracht der Umstände einen gewissen Sinn machte. Immerhin war er gerade erst aus dem Wasser gestiegen.
Avery folgte ihm heimlich durch das Schilf, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Alle Heimlichkeit ging allerdings verloren, als die Halme begannen, durch ihre Bewegung zu rascheln.
Der Fremde fuhr prompt herum und suchte das Schilf mit seinem eindringlichen Blick ab. Avery hielt erschrocken inne und hoffte, er würde annehmen, dass ein Tier für das Rascheln verantwortlich sei.
Tatsächlich kam ihm wohl dieser oder ein ähnlicher Gedanke, denn er wandte sich schon nach einem kurzen Augenblick wieder ab. So hatte sie wieder seinen ansehnlichen Rücken im Blick.
Avery atmete erleichtert auf. Es war wohl ratsamer, an dieser Stelle zu verharren, wenigstens so lange, bis er sich endlich angekleidet hatte. Dann würde sie aus ihrem Versteck kommen und ihm eine Lektion erteilen, die er ganz sicher nicht so schnell wieder vergaß.
Seine Kleidung hatte er auf einem Baumstumpf abgelegt. Daneben entdeckte sie ein Claymore, das im Gras lag und im Licht der Sonne schimmerte wie die Wasseroberfläche des Sees.
Er hob es hoch und ließ es elegant durch die Luft gleiten, gleich einem Raubvogel, der mit ausgebreiteten Schwingen über die Glens flog. Gefährlich, präzise und doch voller Anmut.
Für einen Schwertkämpfer bewegte er sich außerordentlich grazil. Das deutete darauf hin, dass er viel Erfahrung im Umgang mit der Waffe hatte. In Averys Welt war dies der vollendetste aller Tänze, geprägt durch Kraft und Schönheit.
Sie sah, wie sich seine Muskeln mit jeder Drehung, jedem Schritt und jedem vollführten Hieb anspannten, während er mit einem unsichtbaren Gegner zu kämpfen schien.
Ihr wurde warm. Von ihrem Versteck aus hatte sie den besten Blick auf seine breiten Schultern, die muskulösen Arme und Oberschenkel, die ebenso beeindruckend wie wohlgeformt waren.
In nassen, dunklen Wellen flossen seine offenen Haare über seinen Rücken bis zu dessen Mitte. Wenn er sich drehte, sausten sie durch die Luft und zogen eine Spur aus Wasserperlen hinter sich her.
Seine Bewegungen erinnerten an die eines Raubtieres, als er sich ein zweites Mal langsam, beinahe lauernd umdrehte, so dass Avery sein markantes Gesicht, die dunklen Augen und die auffällige Narbe an seiner Wange im rötlichen Schein der Sonne sehen konnte. Sie fragte sich, wer sie ihm zugefügt hatte.
Narben erzählten die interessantesten Geschichten. Avery trug jede ihrer Narben, von denen sie nicht wenige besaß, mit Stolz. Und jedem, der es wissen wollte, erzählte sie gern die dazugehörige Geschichte. Ob es sich nun um einen Trainings- oder gar einen Wettkampf handelte oder ob sie in eine Kneipenschlägerei eingegriffen hatte, sie hatte unzählige Gelegenheiten gehabt, sich eine zuzuziehen.
Die Geschichte seiner Narbe würde sie jedoch nicht erfahren, was sie seltsamerweise bedauerte. Doch sie hatte nicht vor, mit dem Lüstling zu schwatzen, sondern wollte ihm bestenfalls eine weitere Narbe verpassen, die ihn an eine weniger ruhmreiche Tat erinnern sollte.
Ihr Blick glitt über seinen Brustkorb, den Bauch und tiefer hinab, hin zu seinem mächtigen – sie schluckte. Nie zuvor hatte sie einen solch intimen Blick auf den männlichen Körper werfen dürfen. Sie war nicht naiv. Aus Erzählungen der anderen Frauen wusste sie, wie in etwa der Lendenbereich aussah. Ihn aber nun selbst zu sehen, dazu noch aus ihrem Versteck heraus, ohne dass der Fremde auch nur ahnte, dass sie hier war und ihn beobachtete, machte die Sache äußerst aufregend.
Eine unerklärliche Hitzewelle stieg in ihr hoch. Sie war derart aufgewühlt, dass sie mehrere Wimpernschläge lang fürchtete, sich zu verraten, weil diese Hitze das Wasser zum Kochen brachte.
Oh, es ziemte sich ganz und gar nicht, ihn in dieser Situation zu beobachten. Doch sie war einfach nicht stark genug, sich ihrer Neugierde zu widersetzen. Er sah so perfekt aus. So wunderschön.
Rasch versuchte sie, ihre Gedanken auf etwas anderes zu lenken. Auf die Schandtat, die dieser Unhold begangen hatte. Er würde seine gerechte Strafe bekommen, sobald sie sich wieder unter Kontrolle hatte. Vielleicht sollte sie besser untertauchen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen?
»Seid Ihr in Not?«, drang plötzlich eine tiefe männliche Stimme an ihr Ohr.
Erschrocken wich Avery zurück, so dass sich die Schilfhalme wie ein Vorhang vor ihrem Gesicht schlossen. Nay! Er konnte nicht sie gemeint haben. Er hatte sie nicht entdeckt, das konnte einfach nicht sein. Sie hatte doch aufgepasst. Er musste jemand anderen meinen.
»Soll ich Euch aus dem Wasser helfen? Habt Ihr einen Krampf bekommen?« Er rammte sein Claymore in den Sandboden und kam einige Schritte auf sie zu.
Himmel, nun gab es keinen Zweifel mehr. Er sprach tatsächlich mit ihr. Sie hätte sich für ihre Unachtsamkeit am liebsten eine Ohrfeige gegeben. Sie hätte besser aufpassen müssen, war zu unvorsichtig gewesen.
Avery spielte mit dem Gedanken, nun doch unterzutauchen, und blickte dabei an sich hinab. Der Anblick ihrer blanken Brüste erinnerte sie daran, dass nicht nur er ohne Kleidung war. Ihre Wangen wurden mit einem Mal heiß.
Das Schilf schützte sie vor lästigen Blicken. Das war allerdings nur so lange der Fall, wie sie im Wasser und er an Land blieb. Panik stieg in ihr hoch, als seine Füße das kühle Nass berührten. Nur noch wenige Schritte trennten sie voneinander!
»Wagt es nicht«, zischte sie und tauchte bis zum Hals ins Wasser, um zu verhindern, dass er mehr sah, als sich ziemte. Sie verabschiedete sich von der Idee, ihm eine Ohrfeige zu geben. Sie konnte froh sein, wenn sie aus dieser Sache herauskam, ohne das Gesicht zu verlieren.
»Was treibt Ihr denn dort unten?« Es war ihm anzuhören, dass er sich über ihre Situation amüsierte. »Wollt Ihr nicht mit mir sprechen?« Er reckte den Kopf in die Höhe, um über das Schilf hinwegzusehen. »Traut Euch nur. Ich beiße Euch nicht.«
Glaubte er etwa, sie hätte Angst vor ihm? Die Vorstellung kränkte sie als tapfere Kriegerin, die sie war. »Ihr solltet Euch schämen«, knurrte sie.
»Sollte ich das?« Er stemmte die Hände in die Seiten und lachte.
Avery wünschte, er hätte zumindest genügend Anstand, sich seinen Plaid anzulegen.
»Aye!«
»Und wofür sollte ich mich schämen?«
»Dafür, dass Ihr meine Schwestern beim Baden beobachtet habt. Ein ehrbarer Mann tut so etwas nicht.«
Verwirrung spiegelte sich in seinem Gesicht. Entweder besaß er ein außergewöhnliches schauspielerisches Talent, oder er wusste tatsächlich nicht, wovon sie sprach. Eine dicke Furche, die an eine Narbe erinnerte, bildete sich auf seiner Stirn. Dann lachte er mit einem Mal schallend auf. »Ihr beliebt wohl zu scherzen!«
Sein spöttisches Gelächter heizte Averys Wut an. Noch aber konnte sie sich zurückhalten.
»Verzeiht, Lady, aber ich habe weder Euch noch Eure Schwestern beobachtet. Ich kam früher oft an diesen Ort, um nachzudenken, die Ruhe zu genießen oder meinen Körper durch das Schwimmen zu stählen und durch das Tauchen gegen die Kälte abzuhärten. Des Vergehens, das Ihr mir vorwerft, habt Ihr Euch allerdings selbst schuldig gemacht.«
Avery schnappte ärgerlich nach Luft. Nun machte er ihr also auch noch einen Vorwurf? »Ich habe mich keines Vergehens schuldig gemacht.«
»Das sehe ich anders. Wollt Ihr etwa leugnen, dass Ihr mich in dieser wahrlich intimen Situation beobachtet habt? Selbst jetzt habt Ihr mir gegenüber den Vorteil, dass Ihr mich vom Kopf bis zu den Zehen sehen könnt, während ich nur erahne, wo sich Euer Haupt über dem Wasser befindet.«
Verflucht, der Fremde hatte recht. Nicht er war der Schuft, sondern sie! Ihre Wangen brannten wie Feuer. Es kribbelte unerträglich. Wäre sie nicht ohnehin größtenteils unter Wasser gewesen, sie wäre am liebsten vor Scham im Erdboden versunken.
»Ich werte Euer Schweigen als Zustimmung. Nun, da wir das geklärt haben, erwarte ich, dass Ihr Euch schämt.«
»Ich soll mich …?« Sie verstummte. Mit ihren haltlosen Anschuldigungen hatte sie sich tatsächlich reichlich blamiert.
»Schämen«, vollendete er ihren Satz und kratzte sich das Kinn, auf dem sich kurze, dunkle Stoppeln abzeichneten. »Vielleicht sollte ich mich besser davon überzeugen. Ich möchte doch nicht, dass Ihr mich hinters Licht führt.«
Meinte er das ernst, oder wollte er sie necken? Als er einen Schritt in ihre Richtung machte, keimte erneut Panik in Avery auf.
Sie fürchtete, er könnte verrückt genug sein, um seine Worte tatsächlich wahr zu machen. Und wenn er es tat, würde er sie sehen! Auch wenn er nicht jedes Detail erkennen würde, das sich unter der Wasseroberfläche verbarg, so würden ihm doch ihre kleinen Brüste und die knabenhafte Figur nicht entgehen.
Tatsächlich störte sie weniger der Gedanke, dass er etwas sah, das ihm gar nicht zustand, als vielmehr, dass ihm nicht gefiel, was er sah. Avery fragte sich, woher diese wirren Gedanken kamen. Normalerweise wusste sie sehr wohl, was sich gehörte.
Als er weiter auf sie zuging, konnte sie nicht länger an sich halten. »Nay!«, stieß sie in einem hohen, schrillen Ton aus.
»Ihr schämt Euch nicht?«, fragte er trocken.
»Kommt nicht näher. Bitte.« Nach einer kurzen Atempause fügte sie kleinlaut hinzu: »Ihr müsst nichts überprüfen. Verzeiht, dass ich Euch Vorwürfe machte.«
Der Fremde hob überrascht eine Augenbraue. Dann nickte er zufrieden. »Ihr gebt rasch nach«, sagte er mehr zu sich selbst als an sie gewandt. »Vielleicht sollte ich besser doch nachsehen?«
»Nay!« Avery machte einen verhängnisvollen Schritt nach hinten und trat dabei mit ihrem rechten Fuß auf einen kleinen kantigen Stein, der am Grund lag und unter normalen Umständen niemandem weh getan hätte.
Die Spitze des Steins bohrte sich schmerzhaft in ihr Fleisch. Avery erschrak. Sie konnte nicht verhindern, dass sich ein lauter Aufschrei ihrer Kehle entrang.
Als hätte er nur auf diesen Signalton gewartet, stürmte der Fremde ins Wasser, schob die Schilfhalme mit beiden Armen zur Seite und hechtete auf sie zu. Eine hohe Welle schwappte ihr entgegen.
»Nicht! Ich brauche keine Hilfe«, rief sie.
Da war er aber schon bei ihr und hob sie aus dem Wasser. Es blieb ihr keine Zeit, noch heftiger zu protestieren. Schon drückte er ihren nackten, vor Kälte zitternden Körper an seine Brust, die erstaunlich warm war. Himmel – er fühlte sich gut an!
»Ihr habt geschrien«, verteidigte er sich und schleppte sie ans Ufer.
»Es war doch nur ein Stein«, sagte sie, aber er schien den Einwand zu überhören.
Am Ufer angekommen, setzte er sie nicht etwa ab, sondern hielt sie in seinen Armen und sah sie voller Sorge an. Sie glaubte, in zwei tiefe, dunkle Seen zu blicken. Seine Augen waren dunkelblau, ja schon beinahe schwarz.
»Das klang eher, als hätte jemand versucht, Euch hinterrücks zu meucheln.«
Ihre Wangen röteten sich erneut. »So laut habe ich nun auch wieder nicht geschrien«, sagte sie leise.
»Doch, das habt Ihr.«
»Das ist nicht wahr!« Eine Kriegerin schrie nicht wegen eines spitzen Steins. Sie schrie nur, wenn sie in die Schlacht zog. Und dann war es kein Schmerzens-, sondern ein Kriegsschrei.
Ihr Atem wurde schneller. Nicht aus Wut auf sich selbst. Nein, seine warme Haut, seine verwirrende Nähe machten etwas Unheimliches, Unbekanntes mit ihr.
Sie spürte ein sinnliches Prickeln zwischen den Beinen und hoffte, dass er es nicht bemerkte. Das wäre wahrlich die Krönung aller Peinlichkeiten des heutigen Tages gewesen. Sie versuchte, es zu unterdrücken, doch dadurch wurde es nur noch stärker.
»Setzt mich bitte ab«, sagte sie schließlich heiser und bedauerte es im nächsten Augenblick, denn eigentlich hatte es sich sehr gut angefühlt, von ihm gehalten zu werden. Noch nie zuvor hatte ein Mann sie als schützenswert erachtet oder gar gerettet. Seine Sorge um sie berührte sie tief. Sie konnte nicht umhin, ihn zu mögen.
Der Fremde tat, was sie verlangte, und lächelte, während er sie von oben bis unten musterte. Plötzlich wurde Avery sich wieder dessen bewusst, dass sie nackt voreinander standen. Sie bedeckte ihre Brüste rasch mit einem Arm und streckte den anderen in seine Richtung aus. Er musterte verwirrt ihren Zeigefinger, der beinahe seine Brust berührte. Fragend hob er eine Augenbraue.
»Könnte ich wohl Euer Tuch benutzen?«, fragte sie leise.
»Ah. Sicher.« Er nickte, hob es auf und reichte es ihr. Dann drehte er sich um. Rasch wickelte sie sich ein. Er war anders als die Männer, mit denen sie sonst zu tun hatte. Auch wenn er augenscheinlich ebenfalls ein Krieger war, so war er doch weder roh noch ungehobelt, sondern freundlich und respektvoll. Trotz ihrer Anschuldigung war er nicht wütend oder ausfallend geworden. Aye, er hatte sogar Humor bewiesen. Sie ertappte sich dabei, dass sie seine Nähe zusehends genoss.
»Verzeiht, ich wollte Euch nicht anstarren«, sagte er. »Ihr seid hübsch, aber das gibt mir nicht das Recht, Euch auf diese Weise in Verlegenheit zu bringen.«
Avery glaubte, sich verhört zu haben. Er nannte sie hübsch! Wahrscheinlich war es einfach seine Art, die Situation zu entschärfen. Oder er ging mit allen Frauen auf diese Weise um. Andererseits klangen seine Worte so ehrlich, dass sie nicht daran zweifeln mochte.
»Ihr könnt Euch wieder umdrehen.«
Endlich konnte sie ihn aus der Nähe mustern. Was sie zuvor nur geahnt hatte, bestätigte sich nun. Er hatte wahrhaftig die tiefgründigsten Augen, die sie je gesehen hatte. Und sein zartes Lächeln löste ein eigenartiges Flattern in ihrer Brust aus.
»Ihr müsst mir glauben, auch Eure Schwestern habe ich nicht belästigt. Ich war hier, um zu tauchen und zu trainieren. Darauf gebe ich Euch mein Wort.«
Es tat ihr plötzlich leid, dass sie ihn verdächtigt hatte. Er schien ein anständiger Kerl zu sein.
»Ich muss mich auch entschuldigen …« Sie verstummte, weil sie am Ufer zwei Gestalten bemerkt hatte, die sich ihnen näherten: Anola und Ann. Panik stieg in ihr auf. Was sollten die beiden von ihr denken, wenn sie Avery in Gegenwart dieses entkleideten Mannes fanden? Anola würde sich gewiss wieder über sie lustig machen, und es war nur eine Frage der Zeit, bis der ganze Clan über diesen Vorfall sprach. Schnell verbarg sie sich hinter einem Gebüsch.
»Was habt Ihr denn jetzt vor?«
»Meine Schwestern dürfen mich nicht so sehen«, erwiderte sie aufgeregt.
Er sah zu den beiden Frauen auf der anderen Seite des Sees hinüber. »Verstehe. Das wäre wohl sehr schlimm für Euch?«
»Aye, das wäre es.«
Er zuckte die Schultern und drehte sich um. »Dann lasst mich Euch zumindest diesen Dienst erweisen.«
Avery wusste nicht, was er damit meinte, und beobachtete, wie er zum Baumstumpf ging. Dort griff er nach seinem Plaid, faltete ihn und legte ihn um seinen männlichen Körper, dessen Anblick sie nach wie vor durcheinanderbrachte. Er warf das eine Ende der Decke über seine linke Schulter, schlang den warmen Stoff um seinen Oberkörper und befestigte ihn mit einer Spange. Dann legte er einen Gürtel an, schlüpfte in seine Strümpfe und stieg in seine Stiefel.
Plötzlich bedauerte sie, dass er seinen Körper verhüllt hatte. Obwohl er auch in seinem Plaid sehr prachtvoll aussah. In der Hoffnung, dass der Schmerz ihre wirren Gedanken verscheuchen würde, biss sie sich kräftig auf die Unterlippe. Aber sie hatte keinen Erfolg. Das lästige Prickeln wollte einfach nicht nachlassen.
»Ave? Wo steckst du?«
»Sag doch etwas! Wir machen uns Sorgen um dich!«
Das waren die Stimmen ihrer Schwestern. Durch die Zweige sah sie die beiden Frauen, die mit gerafften Röcken und wehenden Gewändern am Ufer entlangrannten und sich dabei suchend nach allen Seiten umsahen. Anola, die sich Averys Hemd und Plaid unter den Arm geklemmt hatte, legte ein rasantes Tempo vor, so dass sich der Abstand zwischen Ann und ihr immer mehr vergrößerte.
»Ave?«
Wenn der Fremde sich nicht beeilte, war ein Zusammentreffen unvermeidbar. Er formte mit Daumen und Mittelfinger ein O, steckte die Finger in den Mund und pfiff den schrillsten, lautesten Ton, den Avery jemals gehört hatte. Dann ging er zu seinem Schwert, zog es aus dem festen Sand und befestigte es auf seinem Rücken.
»Ich werde jetzt verschwinden, Lady. Zieht Euch bald etwas Warmes an, sonst erkältet Ihr Euch noch«, sagte er in die Stille hinein. Avery antwortete nicht, doch sein Lächeln wärmte sie so sehr, dass sie eine Erkältung kaum fürchten musste.
»Lebt wohl. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages wieder.«
Nur wenige Augenblicke später trabte ein schwarzes Pferd die Böschung hinunter und blieb vor seinem Herrn stehen. Der schwang sich gewandt auf den Rücken des Tieres, warf einen letzten Blick zum Busch hinüber, hinter dem Avery mit pochendem Herzen kauerte, und gab seinem Tier sanft die Sporen. Als sie zusah, wie er davongaloppierte, verspürte sie weniger Erleichterung als Enttäuschung. Überrascht wurde sie dessen gewahr, dass es ihr lieber gewesen wäre, wenn der faszinierende Fremde geblieben wäre. Aber wenigstens würden ihr nun die lästigen Fragen ihrer Schwestern erspart bleiben.
In dem Moment, in dem Anola die Uferstelle erreichte, erhob sie sich aus ihrem Versteck und winkte ihr zu.
»Ave!«, kreischte ihre Schwester, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Oder eher eine Moorleiche? Avery fand selbst, dass sie einfach schrecklich aussah: Algen klebten an ihren Schultern, ihre Haare, in die sich Algen eingenistet hatten, hingen ihr in feuchten Strähnen ins Gesicht, und ihre Haut war so bleich wie die einer kürzlich Verstorbenen. Wahrscheinlich hatte der Fremde nur gescherzt, als er ihr gesagt hatte, sie sei hübsch.
»Wir dachten, du wärst ertrunken! Jag uns nie wieder so einen Schrecken ein, hörst du?«
»Keine Sorge, das habe ich nicht vor. Aber sei so lieb, und wirf mir das Tuch herüber. Meins ist bereits völlig durchnässt.«
»Welches Tuch?«
»Das zum Abtrocknen natürlich.«
Avery beeilte sich, hinter dem Gebüsch vorzukommen. Die Sonne würde bald untergehen. Ein kühler Wind strich über ihre nasse Haut. Sie kämpfte gegen das Zittern an, konnte es aber nicht vollkommen unterdrücken.
»Ehrlich gesagt waren wir so in Eile, dass wir es vergessen haben.« Mit diesen Worten reichte Anola ihrer Schwester den Plaid.
In dem Moment erreichte auch Ann die beiden Schwestern. Sie hatte auf dem Weg eine Ruhepause eingelegt. Trotzdem war ihr Gesicht puterrot, und sie ließ erschöpft die Arme hängen.
»Du solltest mehr trainieren«, sagte Avery ernst und griff nach ihrem Hemd, streifte es über den Kopf und legte anschließend den Plaid an. Dann wrang sie ihre Haare aus und wickelte sie zu einem Knoten.
Ann schüttelte nur atemlos den Kopf. »Wer war der Mann?«
Anolas Frage versetzte Avery einen imaginären Schlag in die Magengrube. »Von wem sprichst du?« Sie versuchte, überrascht zu klingen.
»Wir haben ihn vom Ufer aus beobachtet. Als du ihm gefolgt bist und wir dich nicht mehr sehen konnten, haben wir uns schreckliche Sorgen um dich gemacht. Dann haben wir plötzlich einen grässlichen Schrei gehört. Ave, wir dachten, er wäre ein gefährlicher Mädchenmörder, der dich ertränken wollte!«
Avery lachte leise. Anola besaß wahrlich eine lebhafte Fantasie. »Du kennst mich wirklich schlecht, Anola. Denkst du ernsthaft, ich würde mich von einem dahergelaufenen Strolch ertränken lassen? Aber um deine Frage zu beantworten: Ich habe keine Ahnung, wer er war. Ich weiß nicht, wie er heißt. Er hat sich mir nämlich nicht vorgestellt.«
»Also hat sie mit ihm gesprochen«, sagte Ann, die endlich wieder zu Atem gekommen war.
»Natürlich hat sie das, von ihm hat sie auch etwas zum Abtrocknen bekommen.«
Avery fühlte sich ertappt und spürte, wie das Blut sich in ihren Wangen staute. Sie warf das nasse Tuch, das sie verraten hatte, ins Gebüsch.
»Aye, ich habe mit ihm geredet, weil ich dachte, der Schuft hätte euch beobachtet«, rechtfertigte sie sich.
»Und hat er es?« Anns Brustkorb bewegte sich noch immer im raschen Takt ihrer Atmung.
»Nay.«
»Was macht dich so sicher?«, bohrte Anola nach.
»Ich weiß es eben.« Dieser Mann hatte sie nicht angelogen, davon war sie überzeugt. Er war eine ehrliche Haut.
»Dann bin ich aber erleichtert.« Ann legte die Hand auf ihre bebende Brust und atmete tief durch.
»Vielleicht sah er ganz anständig aus?« Anola grinste von einem Ohr bis zum anderen.
»Oh, hässlich war er nicht«, sagte Avery, ohne zu ahnen, dass sie damit eine kleine Lawine lostrat.
»Ich habe in letzter Zeit so viele dickleibige, Ale saufende Kerle gesehen, dass ich schon dachte, die ansehnlichen Männer wären ausgestorben. Erzähle, wie sah er aus?«
Avery seufzte lange und gedehnt. »Welche Rolle spielt das? Er ist fort.« Er, ihr Retter. Bei dem Gedanken an seine Aktion musste sie lächeln. Was so ein kleiner, spitzer Stein bewirken konnte! Es war schön gewesen, ein Mal keine Stärke zeigen zu müssen. Noch immer glaubte sie, seine warme Brust an ihrem Körper zu spüren.
»Warum so grantig? Man weiß nie. Es gibt nicht viele attraktive Männer in der Gegend. Er dürfte also auffallen. Ich wette, er ist ein Herzensbrecher.«
»Wie kommst du denn darauf?«, fragte Avery ein wenig zu hastig. Wenn sie sich weiterhin so auffällig verhielt, könnte Anola noch auf den Gedanken kommen, dass sie sich zu dem Fremden hingezogen fühlte!
»Ave, du bist zu oft allein. Du hast keine Ahnung davon, wie es in der Welt zugeht. Selbstverständlich hat ein attraktiver Mann viele Verehrerinnen. Das ist ein Naturgesetz. Kannst du mir so weit folgen?«
»Aye.« Sie war genervt von Anolas ewiger Besserwisserei, aber auch ein wenig traurig, weil sie sich sehr gut vorstellen konnte, dass der Fremde eine große weibliche Anhängerschaft sein Eigen nannte.
»Vielleicht ist er auch verheiratet. Habt ihr daran schon gedacht?«, sagte Ann.
Avery musste scharf nachdenken. Aye, sie meinte, einen Ring an seinem Finger gesehen zu haben. Aber an welchem und auf welcher Hand wusste sie nicht mehr.
»Manche Männer hält auch das nicht davon ab, sich weiter umzuschauen«, erwiderte Anola in einem altklugen Tonfall.
»Man fragt sich direkt, woher du so viel über die männlichen Gepflogenheiten weißt«, bot Avery ihr Einhalt.
»Ich weiß das alles nur aus zweiter Hand.«
»Soso. Wie dem auch sei. Lasst uns meine Schuhe und mein Schwert holen und die Pferde losbinden. Wir sind viel zu spät dran. Das wird Athair gar nicht gefallen«, sagte Avery und ging voran. Die beiden Schwestern folgten ihr. Unter ihren nackten Füßen spürte Avery jeden Grashalm und jedes kleine Steinchen. Die Erde war feucht, und der Geruch von Seggen und Binsen lag in der Luft. Über ihnen breitete sich ein Meer aus funkelnden Sternen aus – eine ruhige, friedliche Nacht. Avery hoffte, den Fremden eines Tages wiederzusehen.
FÜNF JAHRE SPÄTER
Das ohrenbetäubende Kreischen der Krähen, die bedrohlich ihre Kreise über einem nahe gelegenen Feld am Wegesrand zogen, weckte Averys Aufmerksamkeit. Die schwarzen Aasfresser glichen unheilvollen Schatten, die den strahlend blauen Sommerhimmel verdunkelten.
Sie trieb ihre Fuchsstute an und lenkte sie auf das freie Feld. In ihrem Magen rumorte es. Zum einen, weil sie an diesem Morgen nichts gegessen hatte, zum anderen, weil sich beim Anblick des Krähenschwarms ein ungutes Gefühl in ihr breitmachte.
Bereits aus der Ferne erkannte sie einen reglosen Körper, der wie ein unbeweglicher Stein im Gras lag und auf dessen Rücken zwei Krähen hockten, die ihre Schnäbel gierig in sein Fleisch stießen.
»Bitte, lieber Gott, lass es nicht Athair sein«, betete sie, während die Stute sie im Galopp zu der Stelle trug, von der einige Krähen nun aufstoben.
Eilig sprang sie von ihrem Ross und rannte die letzten Schritte auf den Mann zu. Ihr Herz raste vor Angst. »Bitte lass Athair in einem Gasthaus oder bei einer Dirne übernachtet haben. Alles andere, solange er nur nicht der ist, der hier liegt.«
Sie rannte auf ihn zu, verjagte die Krähen, die hartnäckig geblieben waren, mit kreisenden Armbewegungen, musste sich dann jedoch überwinden, dem Reglosen ins Gesicht zu blicken. Er lag auf dem Bauch, den Kopf seitlich geneigt. Der dunkle Vollbart mit den krausen Locken, die Stirnglatze und die markanten Augenbrauenwülste ließen keinen Zweifel offen: Es war William MacBaine.
Seine Augen waren weit aufgerissen, und sein Mund war zu einem stummen Schrei geöffnet. Eine Fliege setzte sich auf seine Oberlippe. Avery hockte sich fassungslos neben ihn, scheuchte das Insekt fort und legte zitternd eine Hand auf seine Stirn. Oh Gott, er fühlte sich so schrecklich kalt an!
Hastig tastete sie nach dem Puls an seinem Hals. Es konnte einfach nicht sein. Es durfte nicht sein. William MacBaine musste noch leben.
Kein Herzschlag!
»Nay!« Sie stieß einen gellenden Schrei aus.
Ihre Hände bebten, und ihr Atem ging so rasch, dass sie fürchtete, in Ohnmacht zu fallen. Ein undurchdringlicher Schleier legte sich über ihre Augen.
Heiß rannen die Tränen über ihre Wangen. Der Strom wollte nicht abbrechen, und sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Nur den einen, der sich langsam und schmerzvoll in ihr formte: MacBaine war tot, unwiederbringlich.
Sie wischte sich über die Augen, versuchte, tief durchzuatmen, aber es half nichts. Ein starkes Zittern erfasste ihren Körper. Sie wollte schreien und konnte es nicht. Das musste ein Alptraum sein. Sie würde aufwachen. In Wirklichkeit war ihr Vater zu Hause und saß mit ihrer Mutter beim Frühstück in der Halle.
Ihr Blick glitt über seinen Leib. Ein riesiger Blutfleck, der seinen gesamten Rücken bedeckte, hatte sich auf dem Stoff gebildet. Doch der Stoff des Plaids war nicht zerrissen. Es war also kein Angriff mit einer Klingenwaffe gewesen.
Sie nahm all ihre Kraft zusammen und sah ihn noch näher an, beugte sich über ihn. Da entdeckte sie ein Loch in dem Material. Es gab den Blick auf eine kreisförmige Wunde frei. Jemand hatte ihn von hinten erschossen.
»Oh, Athair«, schluchzte sie und verbarg ihr Gesicht in beiden Händen. Wie sollte sie das ihrer Mutter erklären? Wie Anola und Ann?
Allmählich ließ das Zittern nach, die Tränen wurden weniger, und ihr Atem beruhigte sich.
Er war ein guter Mann gewesen, der stets den Weg der Diplomatie gewählt hatte. Er hatte keine Feinde gehabt und gute Beziehungen zu seinen Nachbarn gepflegt. Selbst zu den MacCallens, denen in der Region nicht gerade viele zugetan waren, weil sie eine ruchlose und machtgierige Sippe waren.
Wer also hatte einen Grund, ihn zu töten?
Sie sah auf. War da eine Bewegung in der Luft, direkt über ihnen? Tatsächlich, eine dreiste Krähe setzte zum Sturzflug auf ihren Vater an! Sie holte mit dem rechten Arm aus und traf das Tier mit voller Wucht, noch bevor