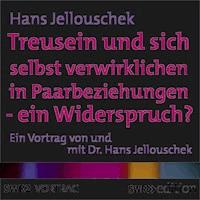6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kreuz Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Eine erfüllte, dauerhafte Partnerschaft muss kein Wunschtraum bleiben. Der bekannte Paartherapeut zeigt auf dem Hintergrund seiner 30jährigen therapeutischen Erfahrung, wie Partner ihre Beziehung so gestalten können, dass beide aus freien Stücken dauerhaft beieinander bleiben. Beständigkeit der Zuneigung und Liebe kann gelingen auch in Zeiten, in denen Scheidungen fast etwas Normales sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Hans Jellouschek
Liebe auf Dauer
Was Partnerschaft lebendig hält
Kreuz
Für meine Frau Bettina,
die die Entstehung dieses Buches
liebevoll, kritisch und kompetent begleitet hat
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
Überarbeitete Neuausgabe des erstmals 2004 erschienenen Titels
© 2008 Verlag Kreuz GmbH, Freiburg
www.kreuzverlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagfoto: © plainpicture/bilderlounge
Datenkonvertierung eBook: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-7831-8028-2
ISBN (Buch) 978-3-7831-3208-3
Einleitung
Für wen ist dieses Buch geschrieben?
Ganz allgemein gesprochen: für alle, die beides möchten, eine Partnerbeziehung, in der die Liebe lebendig ist und die dabei stabil bleibt. Das können Paare sein, die – ob jung oder schon in fortgeschrittenerem Alter – erst kurz zusammen sind, die verliebt sind ineinander und die Intensität ihrer Beziehung nicht verlieren wollen; oder auch Paare, die schon lange ein gemeinsames Leben führen und dabei das Gefühl haben, dass ihre Liebe einer Erneuerung bedürfte, weil ihre Glut unter der Ascheschicht der Jahre zu verglimmen droht; oder auch Frauen und Männer, die eine Trennung hinter sich haben und reflektieren wollen, woran es gelegen haben könnte und was sie in einer künftigen Beziehung besser machen könnten.
Eine Paarbeziehung, in der die Liebe lebendig ist und die trotzdem stabil bleibt: Ist dies aber nicht ein Widerspruch in sich? Die Stabilität von Beziehungen wurde in früheren Jahrzehnten dadurch garantiert, dass sich Paare kaum trennen konnten: entweder weil das den wirtschaftlichen Ruin bedeutet hätte, oder weil sie die Kirche und die Gesellschaft verurteilt hätte, oder weil es ihnen ihr Gewissen nicht erlaubt hätte und die Frauen, die heute in der Mehrzahl die Scheidungen einreichen, damals gar keine Möglichkeit dazu hatten. Wie die Qualität der Beziehung war, das spielte für die große Mehrzahl der Menschen jahrhundertelang eine vollkommen untergeordnete Rolle.
Heute ist dies dagegen vollkommen anders geworden. Natürlich spielen weltanschauliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Gründe auch noch eine Rolle. Aber das Einzige, was die Stabilität von Paarbeziehungen heute garantiert, ist deren Qualität, also die Beantwortung der Frage, ob Frau und Mann diese Beziehung noch als befriedigend erleben, ob einer den anderen noch spürbar liebt und sich vom anderen geliebt fühlt. Wenn einer den anderen zum Beispiel durch eine Affäre verletzt hat, wenn der Sex miteinander nicht mehr gut ist, wenn der Mann nur noch seinen Beruf kennt und die Frau nur noch die Kinder versorgt, und überhaupt: wenn einer oder beide erleben, dass die Liebe erkaltet, die Beziehung langweilig und öde geworden ist. In all diesen Fällen ist der Gedanke an Trennung nicht mehr fern. Und oft muss dann nur noch ein äußerer Anlass dazukommen – zum Beispiel die Liebe zu einem Dritten – und es ist passiert. Seit vielen Jahren bewegen sich die Scheidungszahlen hierzulande zwischen 30 und 50 Prozent, nicht mitgerechnet die nichtehelichen Lebensgemeinschaften, bei denen der Prozentsatz vermutlich noch höher liegt.
Mit anderen Worten heißt das: Die Stabilität einer Paarbeziehung über Jahre hin hat heute immer weniger Chancen, wenn es den Partnern nicht gelingt, auch ihre Liebe lebendig zu halten. Aber muss denn eine Beziehung von solcher Dauer sein? Ist »Liebe auf Dauer« nicht überhaupt eine illusorische Vorstellung? Wird nicht heute der »Lebensabschnitts-Partner« das neue und gültige Modell? Nicht nur viele »Normalbürger« sind heute dieser Meinung, auch Fachleute suchen nach solchen neuen Modellen, die angeblich leichter lebbar wären (Mary 2002).
Ich schließe mich solchen Überlegungen nicht an. Natürlich meine auch ich – auch aus der Erfahrung meines eigenen Beziehungslebens heraus –, dass wir es nicht einfach in der Hand haben; dass trotz allen Bemühens eine Trennung unvermeidlich, ja sogar manchmal die bessere Lösung sein kann. Dem steht aber andererseits entgegen: Wenn Menschen die Erfahrung tiefer Liebe machen, wollen sie immer, dass diese Liebe von Dauer sei. Natürlich haben wir das Bedürfnis nach Freiheit, das Bedürfnis, die »Flügel auszubreiten« und losfliegen zu können, wohin wir wollen. Aber noch tiefer sitzt das Bedürfnis nach »Wurzeln«, nach einem sicheren Platz im Leben, das Bedürfnis nach einer festen Bindung. In einer erst kürzlich durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchung in einer deutschen Großstadt zeigte sich, dass 83 Prozent der befragten Dreißigjährigen, die mit einem Partner in fester Beziehung lebten, wünschten, mit diesem Partner »ein Leben lang zusammenzubleiben« (Schmidt u. von Stritzky 2004, S. 98). An einem Ort in unserem Leben wollen wir erleben: Hier bin ich geliebt, hier kann ich lieben. Das bedeutet der Tendenz nach Ausschließlichkeit. Und wenn es tatsächlich gelingt, bedeutet es, wie vielfache Erfahrung zeigt, Reichtum und tiefes Glück.
Aber wie gesagt: Gesellschaft und Arbeitswelt schaffen heutzutage keine Bedingungen mehr dafür, dass dies gelingt. Es kommt immer mehr auf das Wissen und Können der Partner an, die Liebe auf Dauer lebendig zu halten. Davon sind viele Menschen jedoch überfordert. Immer noch gilt der Satz aus einem Gedicht von Rilke: »Nicht ist die Liebe gelernt« (1984, S. 743). Denn wie man Beziehungen nach der Verliebtheitsphase gestaltet, das war früher kein Thema. Wir haben keine lebendige Tradition, die uns vermittelt, was einer Paarbeziehung zuträglich ist und was ihr schadet.
Damit bin ich beim zentralen Anliegen dieses Buches. Was in meinen früheren Veröffentlichungen (Jellouschek 2001, 2002a, 2003, 2004) immer schon anklang, möchte ich hier zum tragenden Leitthema machen: Wie kann die Liebe in einer Paarbeziehung lebendig und damit dauerhaft bleiben? Ich schöpfe in meinen Ausführungen hauptsächlich aus meinen Erfahrungen, die ich in nunmehr fast dreißig Jahren therapeutischer Arbeit mit Paaren gewonnen habe. Ich werde daraus zehn »Grundsätze« formulieren, denen ich jeweils ganz praktische »Hinweise« folgen lasse, die aber niemals als Patentrezepte »für alle Fälle« verstanden werden dürfen. Der einzelne Fall kann immer noch so sein, dass alles, was ich hier sagen werde, weder zutrifft noch zuträglich ist. Kein Ratschlag ohne berechtigten Einwand, keine Regel ohne mögliche Ausnahme! Dies bitte ich die Leserinnen und Leser immer mitzubedenken, und dies möchte ich dadurch auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass ich nach jedem Kapitel auf »Einwände« eingehe, die ich nach Vorträgen und in Kursen von Teilnehmern häufig gehört habe.
Außerdem bin ich sicher, dass sich auch bei Beachtung aller folgenden Hinweise und bei bestem Willen aller Beteiligten Trennungen oftmals weiterhin nicht verhindern lassen werden. Trennungen müssen manchmal sein, etwa weil sich die beiden anfangs wirklich ineinander getäuscht haben, oder weil sich Entwicklungen ergeben haben, welche die beiden unausweichlich in verschiedene Richtungen führen, oder weil die Beziehung bis hierher gut war, nun aber ein neuer Abschnitt beginnt, den die beiden ohne einander gehen »müssen«, und dergleichen mehr. Trennungen sind manchmal unausweichlich, auch sogar im Interesse der Kinder, die besser mit getrennten Eltern leben, die gut kooperieren, als mit vereinten, die sich hassen und gegenseitig boykottieren. Dies will ich mit meinen Ausführungen keineswegs bestreiten. Allerdings ist mir auch bewusst, dass viele Trennungen nicht sein müssten, wenn beide Partner rechtzeitig die Weichen anders stellen würden und wüssten, was zu tun ist, sobald sie sehen, dass der Kurs, den sie eingeschlagen haben, in eine problematische Richtung führt. Dafür Hilfestellungen zu geben, das ist das Anliegen dieses Buches.
1Definieren Sie Ihre BeziehungDie Kunst, verbindlich zu werden
Wer bin ich für den anderen?
Was mit diesem ersten Grundsatz oder dieser ersten Regel gemeint ist, möchte ich an einer häufig gemachten Erfahrung deutlich machen: Immer wieder habe ich mit Paaren zu tun, die schon jahrelang zusammenleben, die aber nicht sagen können, wer oder was sie eigentlich sind: ein Liebespaar, ein Freundespaar, ein Ehepaar …? Irgendwann haben sie sich zusammengetan oder sind sogar zusammengezogen. Das war ein bedeutsamer Schritt, aber dabei ist es geblieben, weiter wurde nichts mehr geklärt. Wenn einer den anderen vorstellt, druckst er ein wenig herum, sagt »Mein Partner« oder »Meine Lebensgefährtin«, und obwohl diesen Begriffen heutzutage im Unterschied zu früher immer weniger etwas moralisch Anrüchiges anhaftet, hat es trotzdem etwas Peinliches, über das alle am Gespräch Beteiligten gerne schnell hinweggehen wollen …
Dies ist oft ein Zeichen dafür, dass den beiden nicht wirklich klar ist, wer sie füreinander sind. In der Regel bekommt ihnen, oder mindestens einem der beiden, das nicht gut. Er oder sie fragt sich: Wer bin ich eigentlich für den anderen? Will er mich wirklich? Steht er auch im Ernstfall zu mir? Kann ich mich wirklich auf ihn verlassen? Gibt es echte Verbindlichkeit zwischen uns? Es bleiben immer ein gewisser Vorbehalt, ein Misstrauen, eine Unsicherheit. Um hier Klarheit zu schaffen, braucht es eine eindeutige Beziehungsdefinition: Ich bin dein Mann, du bist meine Frau. Wir sind ein Paar. Diese Definition verspricht Verbindlichkeit. Ist sie nicht gegeben, sind wir eben etwas anderes füreinander: Freunde oder Kollegen oder gute Bekannte oder …
Liebe braucht Verbindlichkeit
Natürlich kann es solche Verbindlichkeit nicht gleich von Anfang an geben. In der Phase des Jugendalters haben gegengeschlechtliche Beziehungen auch die wichtige Funktion, die Ablösung von den Eltern zu ermöglichen. Die starken emotionalen Liebeserlebnisse der Heranwachsenden untereinander lockern die Bindungen zu Vater und Mutter. Außerdem sollen sie den jungen Erwachsenen unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit dem anderen Geschlecht vermitteln. Dabei fällt auf, dass es Heranwachsenden trotzdem auch in dieser »Probierphase« wichtig ist, ihre Beziehungen genau zu definieren. Sie unterscheiden sehr klar zwischen »befreundet« und »mein Freund/meine Freundin«: »Mit diesen Jungs bin ich befreundet, und der Steffen ist mein Freund.« »Mein Freund«, »Meine Freundin« oder »Wir sind zusammen«: Solche Beziehungsdefinitionen werden durchaus als sehr verbindlich verstanden. Dennoch bleibt diese Verbindlichkeit in einer Art Vorläufigkeit, ist eine Art von Ausprobieren von Verbindlichkeit. Die Beziehung kann sehr schnell zu Ende sein, und ein anderer, eine andere tritt an die Stelle der Freundin/des Freundes. Das ist in dieser Phase auch durchaus in Ordnung. Zu frühe Festlegung kann notwendige Entwicklungen blockieren. In dieser Phase ist es wichtig, sich als Mann, als Frau in Beziehungen zum anderen Geschlecht auszuprobieren und kennen zu lernen, und das geschieht gerade auch durch die Vielfalt der Erfahrungen und auch durch die Schmerzen von vollzogenen und erlittenen Trennungen.
In unserer Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren zudem eine Phase der menschlichen Entwicklung herausgebildet, die es so im Lebenszyklus früherer Generationen nicht gab, die so genannte »Zweite Adoleszenz«. Das ist die Zeit, in der die jungen Erwachsenen bereits definitiv von zuhause ausgezogen, in Ausbildung oder bereits berufstätig und damit wirtschaftlich, jedenfalls teilweise, selbstständig sind, aber noch keine »eigene Existenz« gegründet haben. Es ist eine Art Zwischenphase zwischen der Jugendzeit im Elternhaus und dem eigentlichen Erwachsenenalter. In dieser Zeit werden so genannte »Probeehen« immer häufiger. Man zieht mit dem Freund, der Freundin zusammen und lebt wie ein Ehepaar, ohne sich als solches zu definieren. Auch dies kann ein durchaus angemessenes, nützliches oder sogar notwendiges Stadium sein, um die eigenen Fähigkeiten zu erproben und in Beziehungen, im Lebensstil und im Beruf jene Ausrichtung zu finden, die zur eigenen Person passt. Die Zeiten, da eine solche Lebensform als »Konkubinat« oder »wilde Ehe« diffamiert und moralisch abgewertet wurde, sind weitgehend vorbei, sogar bei aktiven Mitgliedern der katholischen Kirche, die dies offiziell immer noch ablehnt.
Hier droht allerdings eine Gefahr: Dass die beiden den Zeitpunkt übersehen, an dem ein nächster Schritt in ihrer Beziehung fällig wird. In gewissem Sinn ist die Situation jetzt unklarer, als sie vor dem Zusammenziehen war. Da war sie seine Geliebte, und er war ihr Geliebter, und die beiden waren ein Liebespaar. Was sind sie jetzt? Sie leben wie ein Ehepaar, sind aber keines. Oft »dient« diese Situation beiden oder einem von beiden, eine geheime Angst, sich zu binden, zu kaschieren. Oft aber spürt wenigstens einer von beiden, und häufiger sind das die Frauen als die Männer, dass jetzt noch etwas ansteht: eben der Schritt in die Verbindlichkeit. Manchmal zeigt sich das darin, dass sie den Wunsch verspüren und ihn – hinter vorgehaltener Hand – ganz vertrauten Menschen gegenüber sogar äußern: »Ich fände es so schön, wenn er mir einen Heiratsantrag machen würde!«
Hinter diesem, manchem vielleicht altmodisch und in alten Rollenklischees verhaftet anmutenden Wunsch äußert sich ein tiefes Bedürfnis: das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis für den anderen, der/die Wichtigste, in diesem Sinn »Einzige« zu sein. Mindestens als Frage äußert es sich in jeder länger dauernden Beziehung: Ist der andere der, für den ich der/die Wichtigste, der/die Einzige bin?
Diese Frage will beantwortet sein, sonst wird sie sich immer wieder melden, es sei denn, ich schiebe sie, weil sie mir nicht oder immer nur negativ beantwortbar scheint, resigniert in den unbewussten Untergrund meiner Seele. Viele Paare spüren den Zeitpunkt, da sie sich unabweisbar stellt. Und dann sagt einer von beiden: »Sag, wollen wir nicht heiraten?« Oder: »Du, ich spüre, eigentlich möchte ich dich heiraten!« Und wenn der andere dann spontan oder nach einer gewissen Bedenkzeit zu demselben Ergebnis kommt, erleben beide: Dieser Schritt war jetzt fällig, und er initiiert und erschließt eine neue Qualität des Zusammenlebens, die es bisher zwischen uns nicht gegeben hat.
So unwahrscheinlich es klingen mag, weil äußerlich oft nicht viel anders wird: Es beginnt jetzt wirklich etwas Neues, und nicht nur deshalb, weil die Heirat auch vermögens- und erbrechtliche Folgen hat. Es beginnt auch psychologisch etwas Neues. Das spüren sogar Paare, die jahrelang »nur so« zusammengelebt haben und aus irgendeinem Grund dann doch noch die Entscheidung fällen, ihre Beziehung »zu legalisieren«. Dieser Schritt des ausdrücklichen Ja zueinander, die Aussagen »Du bist mein Mann, ich bin deine Frau« beziehungsweise »Du bist meine Frau, ich bin dein Mann« bewirken in der Seele eine Klarheit und Verbindlichkeit, die es vorher nicht gab. In der Regel erfüllt das beide mit einem tiefen Glück, bei allen Unsicherheiten und Ängsten, die vielleicht auch noch damit verbunden sind. Damit wird dieser Schritt nicht eine Garantie, aber eine gute Grundlage für eine »Liebe auf Dauer«.
Warum ist das so? Das Bedürfnis nach verbindlicher Bindung ist nicht nur ein kindliches, das erfüllt werden muss, damit ein gutes Aufwachsen möglich wird. Dieses Bedürfnis begleitet uns ein Leben lang. Wir haben in den letzten Jahrzehnten das Erwachsen-Werden vielleicht zu sehr mit einem allzu individualistisch verstandenen Begriff von Autonomie identifiziert. Autonomie, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit gehören freilich unverzichtbar zum Erwachsen-Sein. Aber menschliche Autonomie ist immer eine relative. Autonom sein heißt nicht autark sein. Wir sind zutiefst aufeinander angewiesen, um als Menschen leben und auch autonom sein zu können. Wir brauchen es, eingebunden zu sein, um uns als wichtig und liebenswert zu erleben. Und wir brauchen es, für jemanden »einzig«, am wichtigsten zu sein, um zu uns selber Ja sagen zu können. Das suchen wir in der Paarbeziehung, und dazu braucht es diesen ausdrücklichen Akt: »Du – mein Mann, ich – deine Frau«, »Du – meine Frau, ich – dein Mann«.
Wenn das so ist, wenn dieser Schritt einem tiefen menschlichen Bedürfnis entspricht, warum wird er dann trotzdem von vielen Menschen vermieden? Den Willen zur Verbindlichkeit auszudrücken, diesem »Akt«, ob er nun in der Kirche, im Standesamt oder privat vollzogen wird, haftet immer eine gewisse Feierlichkeit an. Viele schrecken vor solcher Feierlichkeit zurück. Sie ist ihnen peinlich. Warum? Trauen sie sich nicht zu, etwas so »Schwerwiegendes« zum Ausdruck zu bringen? Warum trauen sie es sich nicht zu? Die Gründe können unterschiedlich sein.
Angst vor Bindung
Das tiefe Bedürfnis nach Bindung ist bei vielen Menschen in der Kindheit nicht ausreichend erfüllt worden. Die moderne Säuglingsforschung hat herausgefunden, dass sich zwischen Kindern und Eltern bestimmte Bindungsmuster einspielen (Endres u.a. 2000). Man unterscheidet hier die sicher gebundenen Kinder von den unsicher gebundenen. Sicher gebundene Kinder, also Kinder, die die frühen Bezugspersonen verlässlich und in ihrer Verfügbarkeit sensibel und kontinuierlich erlebt haben, haben auch als Erwachsene keine Schwierigkeiten, ein eindeutiges Ja zum Partner, den sie lieben, zu sagen und sich auf dessen Wunsch nach Verbindlichkeit einzulassen. Bei unsicher gebundenen Kindern ist das jedoch anders. Sie haben von ihren wichtigen Bezugspersonen entweder überhaupt zu wenig Bindung erlebt oder ein Hin und Her zwischen manchmal übermäßiger Bindung und dann wieder abruptem Rückzug. Sie gehen mit einer großen Sehnsucht nach echter tiefer Bindung ins Leben hinein, zugleich aber auch mit einer großen Angst davor. Ihr Blick bleibt sozusagen rückwärts gewandt in die Kindheit. Hier suchen sie immer noch das, was sie nicht bekommen haben. Sie sind nicht wirklich frei für einen Partner, und wenn ihnen dieser ein intensives Bindungsbedürfnis entgegenbringt, bekommen sie Angst, wieder dieselbe Enttäuschung zu erleben wie damals. So werden sie hin- und hergerissen zwischen Bindungssehnsucht und Bindungsangst.
Wenn sie ihre Partnerbeziehung »undefiniert« lassen, kommt das dieser Problemlage in gewissem Sinn entgegen, stellt sogar eine Art Problemlösung dar: Sie haben eine kontinuierliche Beziehung, aber Verbindlichkeit vermeiden sie. Freilich ist das keine wirkliche Lösung. Denn das Bedürfnis in ihrer Seele nach echter tiefer Bindung bleibt dabei trotzdem unbefriedigt, und oft enttäuschen sie mit ihrer Nichtentscheidung den Partner, der den Schritt in die Verbindlichkeit machen möchte, so tief, dass die Beziehung immer mehr in die Gefahrenzone der Auflösung gerät.
Wenn ein Paar spürt, dass es den Schritt in die Verbindlichkeit nicht schafft, ist es also nützlich, sich zu fragen: Hat einer oder haben beide Partner vielleicht eine tief sitzende Angst vor Bindung, weil sie vielleicht unsicher gebundene Kinder waren und in ihrer Seele immer noch sind? Es ginge dann darum, miteinander oder auch einzeln in einer Therapie den Weg der Heilung zu suchen. Sonst werden ihre erwachsenen Beziehungen immer wieder an diesen schwierigen Bindungserfahrungen scheitern. Vermeidung von Bindung und Verbindlichkeit kann aber auch noch eine andere Ursache haben:
Angst vor Trennung
Es kann sein, dass ein Paar oder einer der Partner die Frage nach einer klaren Beziehungsdefinition deshalb vermeidet, weil die Antwort lauten müsste: Ein Paar fürs Leben sind wir nicht! Wir sind vielleicht eine Notgemeinschaft oder ein geschwisterlich befreundetes Paar. Aber wenn wir die Frage nach der Verbindlichkeit ernstlich stellen würden, müssten wir uns trennen. Dieser Trennungsgedanke macht Angst. Allein dazustehen ist womöglich noch schlimmer, als diese unbefriedigende Beziehung weiter aufrechtzuerhalten. Also lässt man es lieber so weiterplätschern.
Oft legt sich dann allerdings ein dunkler Schatten von untergründiger Traurigkeit auf solche Beziehungen oder der Mehltau tödlicher Langeweile, und die Beziehung wird in höchstem Maße krisenanfällig. Wenn einer der beiden sich dann plötzlich heftig in einen Dritten verliebt, sind solche Beziehungen oft abrupt zu Ende, begleitet von vielen Verletzungen und Enttäuschungen, und je länger man in dem undefinierten Zustand der alten Beziehung verharrte, desto zerstörerischer für die Betroffenen kann dann eine solche Trennung werden.
Auch hier wieder die Frage: Was steckt möglicherweise dahinter, wenn die Angst vor Trennung so groß ist, dass man sie so lange hinauszögert? Frauen und Männer, die dieses Problem haben, leben mit ihren Partnern wie Geschwister oder wie Kinder mit ihren Eltern. Man ist sich oft sehr nah, man ist sehr vertraut miteinander, aber es fehlt die Spannung zwischen Mann und Frau. Der Partner bekommt väterliche Züge, die Frau töchterliche. Oder die Frau wird quasi zur Mutter des Mannes. Oder sie fühlen sich wie Bruder und Schwester: tief verbunden, aber nicht als männliches/weibliches Gegenüber. Die innerfamiliären Beziehungen Eltern-Kind und Bruder-Schwester aus ihren Herkunftsfamilien werden hier auf die Mann-Frau-Beziehung übertragen. Er oder sie oder beide sind nicht abgelöst von diesen Familien, sie setzen deren Muster miteinander einfach fort. Eine bewusst vollzogene Trennung voneinander wäre hier deshalb so wichtig, weil damit zugleich auch – endlich! – die Ablösung von den eigenen Herkunftsfamilien vollzogen und zu Ende geführt würde, sodass sie freier und erwachsener in eine nächste Beziehung gehen könnten. Auch hier kann es nötig sein, Therapie in Anspruch zu nehmen, um den Mut zur Trennung zu entwickeln. Diese muss unter Umständen gar nicht endgültig sein. Es kann sein, dass eine kräftige Distanzierung voneinander genügt, um die nötigen Schritte ins Erwachsen-Werden zu ermöglichen, sodass die beiden sich wieder neu begegnen können und dann fähig sind, den Schritt in die Verbindlichkeit miteinander zu wagen.
Heiraten, weil ein Kind unterwegs ist?
Es gibt übrigens eine sehr versteckte und immer beliebter werdende Möglichkeit, den Schritt in die Verbindlichkeit zu vermeiden: Man heiratet, weil ein Kind unterwegs ist. Damit vollzieht man zwar eine klare Beziehungsdefinition, aber diese wird »wegen des Kindes« vorgenommen und nicht, »weil ich Mann mich dir als Frau geben« und »ich Frau mich dir als Mann geben will«. Es sollen hier keine generellen Unterstellungen gemacht werden. Es muss sicher nicht immer so sein. Oft ist das Kind, das sich anmeldet, der Anlass, den bereits vorher als fällig gefühlten Schritt in die Verbindlichkeit endlich zu tun. Das Kind hilft dem oder den Zögerlichen, seine/ihre Ängste zu überwinden. Dennoch scheint mir die kritische Anfrage berechtigt, ob der Heiratsentschluss erst angesichts der Schwangerschaft nicht doch auch ein Herummogeln um die Entscheidung füreinander darstellt. Denn es geht hier um eine Entscheidung auf der Paarebene, die eine Elternschaft erst begründet – und nicht umgekehrt. Gar nicht so selten bleibt die Frage offen: »Hat sie mich wirklich als Mann gewollt? Oder etwa nur als Vater ihres Kindes?« – »Hat er mich wirklich als Frau gewollt oder nur deshalb, weil er keine uneheliche Vaterschaft wollte?« Ohne puristisch sein und Maximalforderungen aufstellen zu wollen, möchte ich doch sagen: Paare haben für ihre Zukunft eine festere Grundlage, wenn sie sicher sind, dass die Entscheidung füreinander aufgrund ihrer Beziehung als Frau und Mann und unabhängig von einem gemeinsamen Kind oder gemeinsamen Kindern gefallen ist.
Einwände
Heißt das bisher Gesagte nicht, dass hier wieder für die lebenslange Ehe plädiert wird – nicht mehr mit weltanschaulich-moralischen Argumenten, aber mit psychologischen? Wird hier nicht wieder eine Festlegung verlangt, die uns Menschen gar nicht möglich ist, und läuft das nicht doch wieder auf die Zwänge hinaus, eine Beziehung aufrechterhalten zu müssen, die unter Umständen schon längst tot ist?
Ja, ich plädiere in gewisser Weise für die lebenslange Partnerbeziehung, und zwar in folgendem Sinn: Das Ja zum Partner, wie ich es oben beschrieben habe, will ein unbedingtes sein: »Bei Tag und bei Nacht, bei Gesundheit und Krankheit, in guten wie in schlechten Tagen …«. Was wäre ein Ja zum anderen wert, das ich an Bedingungen knüpfen und im Vorhinein mit möglichen Ausnahmen versehen würde? Es wäre ein Ja mit Vorbehalt und es würde das, was wir wünschen und wollen, nicht erfüllen. Es wäre nicht dieses Ja zu mir, das ich in der Tiefe meiner Seele suche und brauche. Die Verbindlichkeit ist in dem Moment, wo sie eingegangen wird, un-bedingt. Sie wäre sonst gar keine Verbindlichkeit. In diesem Sinn finde ich es auch höchst angemessen, wenn Paare sich, wie es in den Hochzeitsritualen beider christlichen Kirchen vorgesehen ist, diese Verbindlichkeit zusagen: »Bis der Tod uns scheidet«. Darin kommt ihre Unbedingtheit am prägnantesten zum Ausdruck.
Das heißt allerdings nicht, dass damit das Gelingen der Beziehung bereits vorweggenommen wäre oder das Zusammenbleiben unter irgendeinen Zwang gestellt wird. Natürlich kann auch eine Beziehung, die mit dieser Verbindlichkeit eingegangen wurde, scheitern, durch die unterschiedlichsten Ursachen und Entwicklungen. Zudem bin ich der Überzeugung, dass eine Beziehung gar nicht immer »gescheitert« sein muss, wenn die beiden sich trennen. Es kann sein, dass sie eine Zeit lang gut und wichtig war, dann aber ihren Zweck erfüllt hat und somit zu Ende ist, weil die Wege der beiden in verschiedene Richtung führten. Eine Beziehung, auch wenn wir sie in dieser Verbindlichkeit eingegangen sind, kann dennoch zu ihrem Ende kommen. Wenn wir etwas unbedingt wollen, ist das zwar eine gute Voraussetzung, dass wir es erreichen, jedoch noch lange keine Garantie. Zu unserem menschlichen Schicksal gehört es, dass wir uns unbedingt engagieren müssen, es aber doch nicht in der Hand haben, was dabei herauskommt. Das gilt auch für die Paarbeziehung. Mit diesem Risiko müssen wir leben, und wollten wir dieses Risiko nicht eingehen, würde gar nichts Rechtes herauskommen. Unser Leben würde schal und oberflächlich. »Nur wer an das Unmögliche glaubt, wird das Mögliche verwirklichen« – so oder ähnlich habe ich es unlängst auf einem Poster in einem Zugabteil gelesen. Dieser Satz gilt auch für die Paarbeziehung. Denn selbst wenn sie scheitert, werde ich sie in einer anderen Qualität gelebt haben, als wenn ich sie von Vornherein nur als Lebensabschnitts-Partnerschaft eingegangen wäre.
Kann Verbindlichkeit in der Beziehung denn nur in einer formellen Ehe gelebt werden, wie es die vorausgehenden Ausführungen nahezulegen scheinen? Braucht es die juristischen Konsequenzen, braucht es das Standesamt und das kirchliche Ritual? Diese Äußerlichkeiten schaffen doch nur Zwänge, die einer lebendigen Beziehung eher abträglich sind!
Der Akt der Beziehungsdefinition, von dem hier die Rede war, und die äußere Form sind natürlich zweierlei. Es kann gute Gründe geben, menschliche, juristische, steuerliche, vermögensrechtliche und so weiter, welche die beiden zu dem Entschluss bringen, das Standesamt und/oder das kirchliche Trauungsritual zu vermeiden und im juristischen Sinn ledig zu bleiben, obwohl man sich eindeutig zu einer verbindlichen Lebensgemeinschaft miteinander bekennt. Das steht für mich außer Frage.
Andererseits: Wir Menschen sind leibliche und soziale Wesen. Das bedeutet in unserem Zusammenhang zweierlei: Damit etwas für uns volle Wirklichkeit wird, wollen wir es nach außen zum Ausdruck bringen, und wir wollen es anderen mitteilen und mit anderen teilen. Darum entspricht ein Ritual in der Gemeinschaft und vor Vertretern dieser Gemeinschaft, wie es beim Eingehen einer Ehe üblich ist, genau dem, worum es hier geht. Die Vermeidung dieses Ausdrucks im Ritual, die Vermeidung der Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang, auch die Vermeidung der entsprechenden rechtlichen Konsequenzen, sind darum nicht selten Symptome dafür, dass der Mut und der Wille zur Verbindlichkeit doch nicht ganz vorhanden waren und dieser Schritt ein Stück weit vermieden worden ist. Ich habe mir darum angewöhnt, ohne von Vornherein etwas zu unterstellen, unverheiratete Paare, die zu mir kommen, immer zu fragen: »Warum sind sie nicht verheiratet?« Oft steche ich damit in ein Wespennest, denn ich thematisiere Grundfragen dieser Beziehung, die vom Paar bisher zu stellen tunlichst vermieden worden sind.
In den vorausgehenden Ausführungen wird so getan, als ob man Liebe »beschließen« könnte, und das »ein für allemal«. Birgt das nicht die Gefahr in sich, dass man träge wird, dass man meint, es sei mit der klaren Beziehungsdefinition getan, und sie so zu einer leeren Hülle wird, hinter der die lebendige Liebe modert und stirbt? Muss sich Liebe nicht jeden Tag neu erweisen, neu bewähren, und ist es da nicht besser, der Entwicklung einen offenen Raum zu lassen – statt sich festzulegen?
Zum menschlichen Leben gehört beides: Es muss sich etwas entwickeln können – dafür ist es wichtig, abzuwarten, sich Zeit zu lassen. Aber es gibt auch den Moment, den »Kairos«, da muss entschieden, gehandelt werden, selbst dann, wenn noch die eine oder andere Unklarheit und Unsicherheit vorhanden ist. Das ist die Kunst, von der hier die Rede ist: Zuwarten können, der Beziehung Zeit lassen, sich zu entwickeln – also eine gewisse Passivität; und dann, wenn wir spüren, dass es Zeit ist, sich entscheiden, sich festlegen – also aktiv werden, handeln. Wenn nicht irgendwann spürbar wird, dass »es« jetzt dran ist, ist das wie gesagt ein Grund, ernsthaft über Trennung nachzudenken.
Dabei sehe und erlebe ich natürlich auch immer wieder die Gefahr, in der vor allem die Männer stehen, nämlich zu meinen, mit diesem Schritt, zum Beispiel mit der Heirat, alles Wesentliche für die Beziehung getan zu haben. Aber das wäre ein großes Missverständnis dessen, was ich hier sagen möchte. Die Entscheidung füreinander muss im täglichen Leben umgesetzt, eingeholt, immer wieder neu vollzogen werden. Darüber wird in diesem Buch noch ausführlich die Rede sein. Auch wenn ich es nicht in der Hand habe, dass es gelingt: Der Akt der Verbindlichkeit beinhaltet, dass ich alles daransetzen werde, diese Verbindlichkeit im täglichen Leben zu realisieren.
Hinweise
Wenn Sie in einer »undefinierten« Beziehung leben und bei sich das Bedürfnis spüren: Jetzt müsste ein nächster Schritt erfolgen, ich möchte mehr Klarheit, mehr Sicherheit, mehr Eindeutigkeit haben, dann stellen Sie diesen Impuls nicht gleich wieder in Frage. Manche werten solche Wünsche sogleich ab: als kindliches Sicherheitsbedürfnis oder unangemessenes Bestreben, den anderen besitzen zu wollen. Sicher ist es gut, die eigene Motivation hier kritisch zu befragen. Aber Sie dürfen auch damit rechnen, dass dieses Bedürfnis die innere Konsequenz Ihrer Liebe zueinander ist und das Zeichen, dass der nächste Schritt Ihrer Weiterentwicklung dran ist. Darum haben Sie den Mut, darüber mit dem Partner zu sprechen.
Wenn Sie den Schritt zur verbindlichen Beziehungsdefinition auf dem Standesamt beziehungsweise in der Kirche vollziehen, lassen Sie es nicht allein bei den vorgesehenen Ritualen und überlassen Sie die Regie nicht einfach dem Standesbeamten oder dem Pfarrer. Füllen Sie das Ritual durch eigene Gestaltung mit Leben und geben Sie dem Vollzug ihre persönlichen Züge: durch selbst gewählte Texte, Musik, Gesten und Symbole. Dies ist heute vor allem im kirchlichen Bereich durchaus möglich. Haben Sie den Mut, im Ritual ihre eigenen Vorstellungen von dem Schritt, den sie jetzt tun, zu verwirklichen.