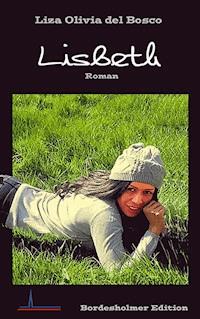
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman 'Lisbeth' schildert ein berührendes Frauenschicksal: Zusammen mit ihren neun Geschwistern verbringt Lisbeth in ärmsten Verhältnissen ihre ersten traurigen Kindheitsjahre in einem kleinen Ort in der Nähe von Belo Horizonte in Brasilien. Mit dreizehn entflieht sie der Familie, nachdem sie ihren Bruder beim Versuch, sie zu vergewaltigen, mit Messerstichen verletzt hatte. Durch glückliche Fügung schafft sie es dennoch bis in die ersten Semester eines Marketingstudiums, entscheidet sich dann aber, verführt durch ihre eigene Schönheit und Begehrtheit, für ein Leben als Tänzerin und Edelhure ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
Zusammen mit ihren neun Geschwistern verbringt Lisbeth in ärmlichen Verhältnissen ihre ersten traurigen Kindheitsjahre in einem kleinen Ort bei von Belo Horizonte in Brasilien. Mit dreizehn entflieht sie der Familie, um den sexuellen Übergriffen ihres Bruder zu entgehen. Durch glückliche Fügung schafft sie es bis in die ersten Semester eines Marketingstudiums, entscheidet sich dann aber, verführt durch ihre eigene Schönheit und Begehrtheit, für ein leichtsinniges Leben als Tänzerin und Edelhure ...
Zur Autorin:
Lisa Olivia del Bosco ist identisch mit Lisbeth, der Protagonistin ihres ersten gleichnamigen Romans. Möchte man mehr über sie erfahren, empfiehlt es sich, diesen Roman zu lesen.
Für Bernhard
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Prolog
Liebe.
Liebe? Welche?
Zuneigung, Begehren, Verlangen, Mitleid,
Jagdfieber, Besitzerstolz, Machtausübung,
Gewohnheit, Ehepflicht, gesellschaftlicher Druck?
Von ihm? Von ihr?
Es wurden 10.
Ich war das vierte. Zweites Mädchen.
Es kamen noch sechs,
vier Jungen, zwei Mädchen,
dann versiegte es.
Was? Die Liebe?
Die war viel früher gestorben.
„Make love“ hatte sie überlebt.
Körperlichkeit. Minimalismus.
Cool.
Man gewöhnt sich daran.
Bildet Hornhaut.
Noch zwei Jahre.
1. Kapitel
In unserem Gedächtnis vermischen sich die Erinnerungen an wirkliche Erlebnisse aus der Kindheit mit Erzählungen der Eltern. Am Ende sind wir nicht mehr sicher, was eigenes Erleben und was fremde Überlieferung ist.
Aber meine Angst vor den Fledermäusen, dabei bleibe ich, die stammt nicht aus Erzählungen. Bis heute sind mir diese Tiere gruselig.
Wir wohnten damals in einem verlassenen Bahnwärterhäuschen mitten in einem Gewirr von Eisenbahnschienen. Das kleine Häuschen war mit Schilf gedeckt. Und in dem Schilfdach wohnten Scharen von Fledermäusen. Abends schwirrten sie um das Haus herum. Bis heute erinnere ich mich, wie einmal ein ganzer Schwarm von diesen ekligen Tieren so nahe an meinem Kopf vorbei flog, dass mich ihre Flügel berührten. Und obwohl es in Wahrheit vielleicht auch nur deren Windhauch war, glaubte ich, sie fielen über mich her und ich müsste sterben. Fortan weigerte ich mich, nach Sonnenuntergang aus dem Haus zu gehen. Und wenn es denn sein musste, trug mich meine Mutter auf dem Arm, den Kopf eingewickelt in ein Handtuch.
Nicht selbst erlebt dagegen habe ich den nächtlichen Lärm der unmittelbar neben unserem Haus vorbeidonnernden Güterzüge. Im Gegensatz zu den Eltern und Geschwistern hatte ich wohl einen gesunden Schlaf. Außerdem kannte ich den Lärm von Geburt an, und er hatte daher nichts Bedrohliches für mich. Nein, von diesem Getöse weiß ich nur aus Erzählungen.
Von den Zuggeleisen weiß ich noch gut, dass es uns Kinder streng verboten war, in ihrer Nähe zu spielen. Vielleicht zog es mich gerade deshalb immer wieder zu ihnen hin. Ich liebte die Eisenbahn. Auch das weiß ich wirklich noch von damals. Ebenso die Schelte, wenn ich beim Spiel zwischen den Schienen erwischt wurde. Davon hat mir bestimmt keiner erzählt.
Und ich erinnere mich, dass ich es sehr aufregend fand, wenn mein ältester Bruder João mich an die Hand nahm, mit mir zu dem Geleis ging und Schottersteine auf die Schiene legte, wenn ein Zug kam.
„Weg, Lisbeth, weg!“ schrie er dann, und ich musste mich in einiger Entfernung auf den Boden legen, damit ich nicht von Steinsplittern getroffen werden konnte. Ich habe noch heute das kurze Knallen der zerplatzenden Steine in den Ohren, das man trotz des Gedröhnes des vorbeirasenden Zuges deutlich hören konnte. Aber Steinsplitter habe ich nie gesehen.
Mein Vater war Profifußballer gewesen. Nach seiner Verletzung, ausgerechnet beim Aufstiegsspiel in Sao Paulo, war es aus mit der Karriere. Die Versicherung zahlte eine Prämie. Der Verein löste gegen eine gute Abfindung den Vertrag und besorgte ihm einen neuen Job. Wir konnten uns ein anderes Haus leisten. Wir zogen in ein größeres Haus am Rande von Colatina. Weit weg von den Bahngeleisen. Zwischen verwilderten Gärten mit viel Müll, Eukalyptus, Palmen und Agaven. Aber in einer richtigen Straße.
Es war noch nicht verputzt und auch sonst noch nicht ganz fertig, als wir einzogen. Aber es gab ein WC und ein Bad. Nur mit kaltem Wasser, aber immerhin.
Die Straße endete drei Häuser weiter. Wir Kinder spielten auf der Straße. Autos gab es kaum. Und wenn dann doch einmal eines kam, hörten wir es schon von weitem, weil es auf dem staubigen Untergrund des sandigen Fahrweges und wegen der tiefen Löcher nur ganz langsam herankam. Selbst die umherlaufenden Hühner konnten sich in aller Ruhe überlegen, in welche Richtung sie sich wenden sollten, um sich dann – nicht ohne bisweilen in letzter Minute die Entscheidung zu revidieren - behutsam in Sicherheit zu bringen. Die Hunde der Nachbarn schauten nur träge zum herankommenden Wagen, schlossen die Augen und blieben unbeeindruckt liegen. Sollte das Auto doch sehen, wie es vorbei kam. Das tat es dann auch. Nie ist den Tieren etwas zugestoßen.
Sonst ist mir aus dieser ersten Zeit in unserer Straße nicht viel in Erinnerung geblieben. Nur, dass ich mich geborgen fühlte, dass meine Eltern sich liebten, Vater tagsüber weg war, weil er arbeitete, und Mutter sich um das Haus und uns Kinder kümmerte.
Wir waren nicht wohlhabend, aber das wenige Geld reichte für das Notwendige.
Ach doch, noch eines habe ich in schöner Erinnerung behalten: Jeden Sonntag ging meine Mutter mit mir zur Messe in die Kirche. Meine Geschwister hatten keine Lust, den Sonntagmorgen mit einem Kirchgang zu beginnen, vor allem wohl, weil es bis dorthin ein Fußmarsch von einer dreiviertel Stunde war. Ich dagegen liebte es, an der Seite meiner Mutter durch den Ort bis hinaus zur Kirche zu wandern. Ich genoss es, sie für ein paar Stunden ganz für mich zu haben. Während der Woche hatte ich kaum etwas von ihr. Ich war ja nur eines von zehn Kindern, um die sie sich kümmern musste.
Sicher fand sie es gut, dass ich sie bei ihrer sonntäglichen Andacht treu begleitete und sie nicht ganz allein zur Messe gehen musste. Meist trafen wir auf unserem Weg andere Frauen, die wie meine Mutter zur Kirche gingen. Einerseits war es schön, zu sehen, dass sie sich freuten, meine Mutter zu treffen, die sie offenbar sehr schätzten. Anderseits machten sie mich eifersüchtig. Sie störten unsere Zweisamkeit.
Unser Ziel war die wunderschöne alte Wallfahrtskirche auf einem Hügel am Ortsrand. Schon der Anblick war eine Belohnung für den langen Fußweg. Und dann die heilige Stille im Inneren, der wohltuende Duft nach Weihrauch, die sonntäglich gekleideten Menschen, alles erzeugte eine Atmosphäre, die ich liebte.
Die Predigt war eigentlich langweilig. Ich hörte nicht zu. Wozu auch. Der Priester redete lateinisch. Aber die feierliche Melodie seiner Sprache machte Eindruck auf mich, auch wenn ich nicht ahnte, was seine geheimnisvollen Worte bedeuteten.
Wenn Mutter betete, tat sie es ganz leise. Danach nahm sie meist meine Hand. Wenn sie niederkniete, kniete auch ich. Wenn sie sich bekreuzigte, tat ich es ihr gleich. Auch wenn ich nicht recht wusste, warum sie es tat.
„Mama, warum gehst du immer in die Kirche?“, fragte ich sie auf dem Heimweg.
„Um Gott zu danken und um zu beten“, war ihre Begründung.
„Wofür dankst du ihm denn?“
„Dafür, dass wir leben dürfen. Dass wir alle gesund sind. Ach, für all das Gute, das er uns gibt.“
„Und das Schlechte, macht er das auch?“
Sie antwortete nicht.
„Letzte Woche war ich doch krank. Hat er mich da extra krank gemacht?“
„Ich weiß nicht, warum du krank geworden bist. Aber jedenfalls hat er dich schnell wieder gesund gemacht.“
„Hast du dafür gebetet?“
„Ja.“
„Und das hat er gehört, und dann hat er mich schnell wieder gesund gemacht?“
Irgendwie fand ich es seltsam, das mit Gott. Aber an der Seite meiner Mutter machte ich alles mit. Ich dankte Gott, dass so schönes Wetter war, dass ich endlich neue Schuhe bekommen habe, dass Mama mich mit in die Kirche nahm. Und ich betete, dass er mich später einmal ganz reich machen sollte.
*
Wäre alles so einfach geblieben, gäbe es dieses Buch nicht – es wäre zu langweilig. Schon jetzt haben gewiss einige mit Recht ungeduldige Leser bereits die Hoffnung aufgegeben, ein spannendes Buch vor sich zu haben und beginnen, um diese Vermutung zu prüfen, – heimlich – zu blättern, ob es so langweilig bleibt oder sich vielleicht doch noch etwas Dramatisches entwickelt. Aber nur Geduld, sie sollen leider allzu bald schon belohnt und fündig werden.
Mein Vater arbeitete in seinem neuen Job als Techniker in einer Elektrizitätsgesellschaft und war häufig auf Dienstreisen. Für uns Kinder war das angenehm. Mutter hatte dann mehr Zeit für uns, und wir blieben von den strengen und meist tätlichen Erziehungsversuchen unseres Vaters verschont.
Mein ältester Bruder ließ sich als erster nicht mehr alles von ihm gefallen – er war inzwischen mitten in der Pubertät – und wehrte sich. Zank und Geschrei hielten Einzug in unsere Familie. Meine Mutter schwieg zu allem.
Als die Reisen meines Vaters häufiger und länger wurden und das Geld, das er mitbrachte, immer weniger, bekamen wir Kinder deutlich zu spüren, dass etwas nicht in Ordnung war. Wir hatten weniger zu Essen. Fleisch gab es nach einiger Zeit überhaupt nicht mehr. Vater wurde immer gereizter, wenn er zu Hause war. Nicht nur uns Kindern gegenüber. Auch zwischen den Eltern gab es Streit. Und wenn er wieder auf Reisen war, schickte er zu wenig Geld. Es reichte nicht. Meine Mutter musste zusätzlich arbeiten, um uns Kinder – inzwischen war die Schar auf 10 angewachsen – kleiden und ernähren zu können.
Sie fing an, für Nachbarn Näharbeiten zu übernehmen. Mit viel Geschick besserte sie alte Kleider aus und schneiderte neue. Bald hatte sie eine feste Kundschaft.
Vater war nun fast nie mehr zu Hause. Es kam kaum noch Geld von ihm. Schließlich ist er ein Jahr lang nicht heimgekommen. Da war klar, dass er andere Frauen hatte und mit der Familie nichts mehr zu tun haben wollte. Am Ende schickte er überhaupt kein Geld mehr.
Einmal noch tauchte er bei uns auf. Er hatte sich ein Auto gekauft, und fuhr stolz damit vor.
Vermutlich konnte er die Raten nicht bezahlen. Jedenfalls wollte er von unserer Mutter Geld haben. Es gab Streit und Handgreiflichkeiten. Er durchsuchte Schränke und Schubladen nach verstecktem Geld. Als er auf die Kommode zuging, in der meine Mutter ihr weniges Geld aufbewahrte, stellte sie sich davor, versperrte ihm den Weg und stieß ihn zurück. Mein Vater brüllte sie an und schob sie zur Seite. Sie wehrte sich so gut sie konnte. Vergeblich. Es gab ein wildes Gerangel. Plötzlich schrie Vater auf, da sie ihm das Gesicht blutig kratzte. Wir Kinder bekamen es mit der Angst. Die Kleinsten liefen heulend davon.
„Raus aus diesem Haus! Für immer!“, hörten wir meine Mutter brüllen. Da schlug mein Vater zu. Vor den Augen von uns Kindern. João rettete sie. Mit einem Messer bedrohte er seinen Vater und trieb ihn aus dem Haus.
Fluchend und Drohungen ausstoßend lief er auf die Straße, stieg in sein Auto und raste davon.
Wir alle hatten Angst vor seiner Rückkehr.
*
Meiner Mutter blieb nichts anderes übrig, als zusätzlich zu ihrer Näherei weitere Arbeiten anzunehmen. Sie putzte und wusch die Wäsche für andere Familien. Danach, am Abend, erledigte sie die Nähaufträge.
Tagsüber spielten wir Kinder auf der Straße. Nur João war oft weg. Er war damals wohl schon fünfzehn oder sechzehn. Irgendwo hatte er eine Arbeit gefunden. Welche Art von Arbeit es war, wussten wir nicht.
Früh morgens ging meine Mutter aus dem Haus. Sie ließ für jeden ein Stück Brot da. Das hatte zu reichen. Nahm sich einer zwei Stücke, war nicht mehr für alle etwas da, und wir mussten hungern.
Wenn wir so allein gelassen waren, hatten die Nachbarn ein mehr oder weniger - meist weniger - wachsames Auge auf uns. In schlimmen Fällen, wenn sich jemand verletzte und schrie, kamen sie uns zu Hilfe. Aber eigentlich waren wir allein.
Für die Ordnung im Haus und die Beaufsichtigung der Kinder machte meine Mutter João verantwortlich. Ich sollte für meine jüngeren Geschwister sorgen, vor allem auf die Kleinste aufpassen, Renita, die gerade erst 18 Monate alt war. Dabei war ich selbst erst sieben Jahre. Immerhin hatte ich so erstmalig eine sinnvolle Aufgabe, die ich bereitwillig übernahm.
João regierte, sowie er das Haus betrat, mit eiserner Hand. Erteilte pausenlos Befehle und prügelte, wenn sie nicht so ausgeführt wurden, wie er wollte. Aber seine Befehle konnte man kaum ausführen, schon gar nicht so schnell wie er es verlangte. Es waren unsinnige Befehle. Er schrie uns an, er schlug uns. Befehle, Prügel, Befehle, Prügel, eine nicht enden wollende teuflische Kette. Wir alle hatten Angst vor ihm. Und dennoch war das Haus in schrecklichem Zustand, wenn meine Mutter abends heimkehrte: Geschirr zerbrochen, Toilette schmutzig, Dreck auf den Fußböden.
Sie war völlig überarbeitet und gab nicht João sondern uns Jüngeren die Schuld. Wir wagten nicht, etwas zu sagen.
Ich war todunglücklich. Tagsüber floh ich mit meiner Schutzbefohlenen auf die Straße. Dort konnten wir wenigstens nicht geschlagen werden. Oder wir versteckten uns neben dem Haus in einem der Gärten zwischen stacheligen Büschen und Agaven an einem Ort, wo uns João vom Haus aus nicht sehen konnte.
Obwohl meine Mutter den ganzen Tag bei anderen Familien arbeitete und dann abends bis in die Nacht hinein nähte, reichte das Geld hinten und vorne nicht.
Zum Essen gab es nur Brot. Ganz selten einmal Obst, Kartoffeln oder Gemüse, wenn sie statt Geld mit Nahrungsmitteln bezahlt wurde. Fleisch gab es seit Jahren nicht mehr. Fast immer hatten wir Hunger.
Meine Mutter kam auf die Idee, neben unserem Haus in einem der verwilderten Gärten Obst und Gemüse anzubauen. In den nächsten Jahren ernteten wir dann Bananen, Avocados, Bohnen, Paprika, Salat, Zwiebeln und anderes Gemüse. Das half ein wenig, war aber bei weitem nicht genug. Jana, meine ältere Schwester, sollte aus dem, was sie ernten konnte, eine Mahlzeiten für uns Kinder bereiten. Aber nur selten reichte das Geerntete dafür.
Im Haus gab es nur noch Streit und Prügelei. Jana versuchte, sich aufzulehnen. Vergebens.
Nie werde ich vergessen wie João sie eines Tages anschrie, als er heimkam und kein Essen gekocht war. Als sie sich rechtfertigen wollte, schlug er sie zusammen. So brutal schlug er sie ins Gesicht, dass ihr Auge anschwoll und sie kaum noch etwas sehen konnte. Erst Monate später ging sie zum Arzt. Zu spät. Das Auge war fast blind. Irreparabel. Bis heute.
*
Ich war erst sieben, als João begann sich in eigentümlicher Weise um mich zu kümmern. Natürlich war ich längst aus dem Alter heraus, in dem man mir beim An- und Ausziehen hätte helfen müssen. Aber João begann, mir zuzuschauen, wenn ich im Bad war. Er beobachtete mich, wenn ich unter der Dusche war, trocknete mich behutsam ab, streichelte mich, betrachtete mich mit neugierigen Blicken von oben bis unten und wollte mir beim Anziehen helfen. Wär es meine Mutter gewesen, ich hätte es bestimmt schön gefunden, von ihr verwöhnt zu werden. Aber bei João war das irgendwie etwas anderes. Ich fühlte, dass das so nicht normal war. Ich hatte keine Ahnung, warum er es tat. Ich versuchte, ihn abzuwehren. Ich wollte seine seltsame Fürsorglichkeit nicht. Umsonst. Da ich aber ohnehin in ständiger Angst vor ihm lebte, ließ ich ihn. Ich wollte keine Prügel riskieren.
Seltsam, dass ich weder meiner Mutter, noch Jana davon erzählte. Aber ich schämte mich. Über so etwas sprach man nicht.
Zu der Zeit hatte mein kleiner Bruder Jamiro eine Idee: Er hatten herausgefunden, dass unsere Mutter zum Einkaufen leere Pfandflaschen und -dosen zum Supermarkt zurückbrachte und dafür Geld bekam. Was Mutter konnte, das konnte er auch, sagte er sich, und brachte heimlich selbst unsere Pfandflaschen zum Supermarkt zurück, kassierte das Pfandgeld und kaufte sich Süßigkeiten.
Natürlich flog die Sache auf.
Aber die Idee war gut. Zusammen mit Jamiro und Caique, meinen beiden jüngeren Brüdern, begann ich, die Müllcontainer in der Straße nach Flaschen und Dosen zu durchsuchen. Wir durchwühlten im ganzen Viertel die Müllcontainer und verkauften, was wir fanden. Von dem Erlös erstanden wir Schokolade und anderes Essbares.
Nach einiger Zeit entdeckten wir, dass wir die Schokolade, die wir billig im Supermarkt kauften, leicht zu einem höheren Preis weiterverkaufen konnten, wenn wir sie bei der nächsten Ampelkreuzung den Fahrzeugen anboten, die bei Rot halten mussten. – Wir wurden zu Unternehmern mit einem sehr erfolgreichen Geschäftsmodell.
*
Eigentlich kannten wir alle Menschen, die in unserer kleinen Straße wohnten. Aber diesen freundlichen Mann hatten wir noch nie gesehen. Eine Weile schon hatte er uns beim Durchsuchen eines Müllcontainer beobachtet. Dann sprach er uns an.
„Ihr seid aber fleißig!“, begann er.
Erstaunt sahen wir ihn an. Da er sonst nichts sagte und nur weiter zu uns herüberschaute, machten wir in unserer Arbeit weiter.
„Ihr sucht wohl nach Flaschen, die ihr verkaufen könnt.“
Meine Brüder nickten. Mir war das ganze unheimlich, und ich wollte ins Haus gehen. Da kam er auf mich zu. „Zu Hause bei mir stehen ganz viele Flaschen. Die könntest du dir alle holen und verkaufen.“
Ungläubig sah ich ihn an.
„Ja. Wirklich und viele, viele Dosen, die du auch verkaufen könntest.“
„Und wo ist das?“
„Ich kann es dir zeigen.“
„Ist das weit?“, fragte ich.
„Komm mit, ich zeige es dir.“
Ich schüttelte den Kopf und wollte weglaufen. Doch meine Brüder waren neugierig geworden.
„Lass uns alle zusammen gehen. Dann können wir auch mehr tragen.“
„OK. Wenn Ihr wollt, kommt alle mit“, bestärkte der Mann die beiden.
Zögernd willigte ich ein, und zu dritt folgten wir dem fremden Mann.
Hatte er uns schon früher beim Verkaufen der Schokolade beobachtet? Jedenfalls führte er uns zunächst an unsere Verkaufsampel. Das war schon ziemlich weit, und weder ich, noch meine Brüder waren jemals ohne unsere Mutter weiter vom Haus weg gegangen.
Jamiro blieb stehen.
„Weiter traue ich mich nicht“, verkündete er.
„Ich auch nicht“, kam es ängstlich von Caique.
„Aber du, du bist doch ein großes Mädchen und willst Dir die Flaschen und Dosen sicher nicht entgehen lassen. Oder bist Du etwa auch so ein Angsthase wie deine kleinen Brüder? Komm mit, es lohnt sich bestimmt“, ermunterte mich der fremde Mann, nahm mich an die Hand und zog mich mit sich, vorbei an der Kreuzung.
Widerwillig kam ich mit. Als ich mich umschaute, waren Jamiro und Caique schon nicht mehr zu sehen.
Wir waren vielleicht ein Kilometer gegangen, als wir in eine Nebenstraße einbogen. Fragend schaute ich den Mann an. Plötzlich erkannte ich ihn. Hatte er mir nicht vor ein paar Tagen an der Kreuzung Schokolade abgekauft. Ich erinnerte mich noch an seinen roten Kleinlastwagen.
„Nur Mut, gleich sind wird da. Da vorne, siehst du, da nehmen wir die Einfahrt. Da hinter ist ein alter Schuppen. Du wirst staunen, wie viele Flaschen in dem Schuppen sind.“
Und wirklich, auf dem großen Hof hinter der Einfahrt stand der rote Lieferwagen.
Allein mit diesem Mann auf dem fremden Hof, bekam ich plötzlich Angst. Ich wollte weglaufen, aber er hielt mich fest und zog mich zu dem Schuppen.
Die Tür der Bude war geöffnet.
„Und schau nur, ganz viel Spielzeug gibt es da auch.“
Er zeigte auf die geöffnete Tür. Ich sah hinein und entdeckte einen Holzroller, Spielzeugautos und auf einem Sofa ganz viele Puppen und Teddybären. So viele hatte ich noch nie gesehen. Aber es gab dort weder Flaschen noch Dosen.
Ich bekam es mit der Angst und versuchte, mich loszureißen. Aber der Mann hielt mich am Handgelenk fest.
Zu Hause erzählten Jamiro und Caique der Mutter, was geschehen war. Entsetzt sprang sie von ihren Näharbeiten auf.
„João! Schnell! Komm! Hilf uns! Es ist etwas Schreckliches passiert!“
Es war Samstag, und weder sie noch João arbeiteten außer Hause. Die Mutter nahm sich, ohne lange zu fragen, blitzschnell das Fahrrad des Nachbarn, drückte es dem erstaunten João in die Hände.
„Hier das Rad! Ihr müsst ganz schnell Lissi finden, ehe es zu spät ist. Nimm Caique hinten drauf, er weiß, in welcher Richtung sie verschwunden sind, und fahrt so schnell ihr könnt!“
Es war bekannt, dass zu jener Zeit nicht selten Kinder verschwanden und nie wieder auftauchten. Missbraucht? Ermordet? Entführt und verkauft? Die Polizei hatte es aufgegeben, solche Fälle ernsthaft zu verfolgen. Zu gering die Aufklärungsquote.
Ein Pferdegespann fuhr über den Hof. So laut ich konnte, schrie ich um Hilfe. Der Kutscher wurde auf uns aufmerksam, hielt an und sah zu uns herüber. Da lockerte sich der Griff des Mannes um mein Handgelenk, und ich stürmte davon. Raus aus dem Hof auf die Straße. Bald hatte ich die Hauptstraße erreicht, die wir gekommen waren. Schon sah ich die Ampellichter „unserer“ Kreuzung. Da bemerkte ich den roten Lieferwagen hinter mir. Ich lief, blind vor Angst, auf die andere Straßenseite – fast hätte ich João und Jamiro umgerannt…
Dies und alles was die folgenden Seiten beschreiben, hätte nie jemand zu lesen bekommen, wäre nicht Samstag gewesen, meine Mutter und João zu Hause, das Fahrrad des Nachbarn vor der Tür, das Pferdegespann vorbeigefahren oder wenn der Kutscher mich nicht bemerkt hätte.
Ich wusste plötzlich, ein Wunder hatte mich aus tiefster Not erlöst. João hatte mir das Leben gerettet.
*
Mit sieben kam ich in die Schule, und eine neue Qual begann.
Meine Mutter hatte sich einen Vormittag frei genommen, um mich anzumelden. Am Tage vorher hatte sie mein bestes Kleidchen ausgebessert, am Morgen wurde ich gebadet, meine Haare wurden gewaschen, und sie steckte mir eine ihrer goldenen Haarspangen in meinen schwarzen Lockenkopf, damit ich etwas bürgerlicher aussehen sollte und nicht wie das Straßenmädchen, das ich in Wahrheit war. Auch sie selbst zog ihre besten Sachen an.
„Na, was habt ihr denn vor?“, fragte die Nachbarin, als wir an ihrem Haus vorbei gingen. Wir blieben stehen.
„Lisbeth soll zur Schule angemeldet werden“, erklärte meine Mutter unseren ungewohnten Aufzug.





























