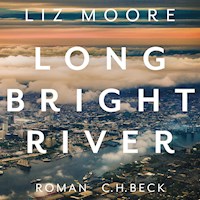9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Einst waren sie unzertrennlich, seit fünf Jahren sprechen sie nicht mehr miteinander, doch die eine wacht insgeheim über die andere. Jetzt aber ist die Lage bedrohlich geworden: Mickey, Streifenpolizistin in Philadelphia, findet ihre drogenabhängige Schwester Kacey nicht mehr auf den Straßen der Blocks, die sie kontrolliert und auf denen Kacey für ihren Konsum anschaffen geht.
Gleichzeitig erschüttert eine Reihe von Morden an jungen Prostituierten die von Perspektivlosigkeit und Drogenmissbrauch geplagte Stadt. In ihrem enorm spannenden Roman erzählt Liz Moore die Familiengeschichte von Mickey und Kacey und deren Entfremdung parallel zur Geschichte der Jagd nach einem Frauenmörder, die auch Mickey in große Gefahr bringt. Zugleich entwirft Liz Moore in diesem großen Roman das umwerfend authentische Porträt einer Stadt und einer Gesellschaft in der Krise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Liz Moore
Long Bright River
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
C.H.Beck
Zum Buch
Einst waren sie unzertrennlich, seit fünf Jahren sprechen sie nicht mehr miteinander, doch die eine wacht insgeheim über die andere. Jetzt aber ist die Lage bedrohlich geworden: Mickey, Streifenpolizistin in Philadelphia, findet ihre drogenabhängige Schwester Kacey nicht mehr auf den Straßen der Blocks, die sie kontrolliert und auf denen Kacey für ihren Konsum anschaffen geht.
Gleichzeitig erschüttert eine Reihe von Morden an jungen Prostituierten die von Perspektivlosigkeit und Drogenmissbrauch geplagte Stadt. In ihrem enorm spannenden Roman erzählt Liz Moore die Familiengeschichte von Mickey und Kacey und deren Entfremdung parallel zur Geschichte der Jagd nach einem Frauenmörder, die auch Mickey in große Gefahr bringt. Zugleich entwirft Liz Moore in diesem großen Roman das umwerfend authentische Porträt einer Stadt und einer Gesellschaft in der Krise.
Über die Autorin
Liz Moore, geboren 1983, hat zunächst als Musikerin in New York gearbeitet und anschließend begonnen Romane zu schreiben. «Long Bright River» ist ihr vierter Roman, der in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Liz Moore hat für ihre Romane u.a. den Rome Prize erhalten. Sie lebt mit ihrer Familie in Philadelphia.
Über die Übersetzer
Ulrike Wasel und Klaus Timmermann arbeiten seit Jahrzehnten als Übersetzer in Düsseldorf. Für C.H.Beck übersetzten sie u.a. mehrere Werke von Andre Dubus III, zuletzt «Der Garten der letzten Tage» (2009).
Inhalt
liste
jetzt
damals
jetzt
damals
jetzt
damals
jetzt
damals
jetzt
damals
jetzt
damals
jetzt
liste
jetzt
danksagung
Für M. A. C.
Was kann man über das heutige Kensington mit seinen zahllosen Geschäftsstraßen, den prunkvollen Villen und wunderschönen Häusern sagen, das wir nicht schon wissen? Eine Stadt in der Stadt, die sich an den Busen des friedlichen Delaware River schmiegt. Strotzend vor Unternehmergeist, übersät mit so vielen Fabriken, dass der aufsteigende Rauch den Himmel verschleiert. Das Dröhnen von Maschinen ist allüberall zu hören. Glückliche und zufriedene Bürger, die ein üppiges Leben in einem üppigen Land genießen. Bevölkert von wackeren Männern, schönen Frauen und einer robusten Jugend, die die Zügel in die Hand nehmen wird, wenn die Väter dahingeschieden sind. Ein Hoch auf Kensington! Eine Ehre des Kontinents – ein Kronjuwel der Stadt.
–aus Kensington: A City Within a City (1891)
Herrscht Streit auf diesem Inselland, dem schönen?
Lasst, was zerbrach, zerbrochen sein!
Schwer sind die Götter zu versöhnen –
Schwer stellt daheim sich wieder Ordnung ein.
Kampf gibt es schlimmern dort als Tod,
Wilde Verwirrung, Schmerz und Pein,
Für graue Häupter Sorg’ und Noth,
Ein traurig Loos für Herzen, müd’ der Schlacht,
Und Augen, trüb vom Schaun auf Stern’ und Wogennacht.
Doch, hingestreckt auf lauchdurchwirkten Moosen,
Wie süß, umfächelt von der Lüfte Kosen,
Mit halbgeschlossenem Lid,
Unter des Himmels Purpurrosen
Zu schauen, wie der Fluß mit seinen großen
Gewässern still zum Meere zieht;
Zu hören, wie mit leisem Hallen
Von Schlucht zu Schlucht herniedertropft der Thau;
Zu hören, wie smaragdne Fluthen wallen
Durch manch gewundnes Feld von Bärenklau;
Zu hören und zu sehn das Meer, so tief und blau,
O süß schon wäre Das, ruhnd an der Fichte Bau!
Alfred Lord Tennyson, aus «Die Lotosesser»[Adolf Strodtmann, Lieder- und Balladenbuch amerikanischer und englischer Dichter der Gegenwart, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1862, in: Classic Reprint Series, Forgotten Books, London, 2018, S. 201/2]
liste
Sean Geoghehan; Kimberly Gummer; Kimberly Brewer, Kimberly Brewers Mutter und Onkel; Britt-Anne Conover; Jeremy Haskill; zwei der jüngeren DiPaolantonio-Jungs; Chuck Bierce; Maureen Howard; Kaylee Zanella; Chris Carter und John Marks (einen Tag auseinander, Opfer derselben verdorbenen Ladung, meinte mal jemand); Carlo, dessen Nachnamen ich mir einfach nicht merken kann; Taylor Bowes’ Freund und ein Jahr später dann Taylor Bowes; Pete Stockton; die Enkelin unserer früheren Nachbarn; Hayley Driscoll; Shayna Pietrewski; Dooney Jacobs und seine Mutter; Melissa Gill; Meghan Morrow; Meghan Hanover; Meghan Chisholm; Meghan Greene; Hank Chambliss; Tim und Paul Flores; Robby Symons; Ricky Todd; Brian Aldrich; Mike Ashman; Cheryl Sokol; Sandra Broach; Ken und Chris Lowery; Lisa Morales; Mary Lynch; Mary Bridges und ihre gleichaltrige Nichte und ihre Freundin; Jim; Mikey Hughes’ Vater und Onkel; zwei Großonkel, die wir selten sehen. Unser früherer Lehrer Mr. Paules. Sergeant Davies im Dreiundzwanzigsten. Unsere Cousine Tracy. Unser Cousin Shannon. Unser Vater. Unsere Mutter.
jetzt
An dem Gleis entlang der Gurney Street liegt eine Leiche. Weiblich, Alter unklar, wahrscheinlich Überdosis, sagt die Zentrale.
Kacey, denke ich. Das ist eine Zuckung, ein Reflex, etwas Scharfes und Unterbewusstes, das in mir lebt und jedes Mal, wenn eine Tote gemeldet wird, dieselbe Botschaft rasend schnell an denselben primitiven Teil meines Gehirns schickt. Dann kommt der rationalere Teil angezockelt, lethargisch, lustlos, ein gehorsamer, träger Soldat, um mich an Wahrscheinlichkeiten und Statistiken zu erinnern: neunhundert Drogenopfer in Kensington letztes Jahr. Keines davon Kacey. Außerdem, so rügt mich dieser Wachposten, hast du anscheinend vergessen, wie wichtig es ist, professionell zu bleiben. Straffe die Schultern. Lächle ein bisschen. Halte das Gesicht entspannt, die Stirn faltenfrei, das Kinn hoch. Mach deinen Job.
Die ganze Zeit habe ich Lafferty für uns auf Einsatzmeldungen von der Zentrale antworten lassen, damit er Übung darin bekommt. Jetzt nicke ich ihm zu, und er hüstelt und wischt sich über den Mund. Nervös.
«2613», sagt er.
Unsere Fahrzeugnummer. Richtig.
Die Zentrale erklärt, dass die Meldung anonym war. Der Anruf kam von einem Münztelefon auf der Kensington Avenue, wo es noch eine ganze Reihe davon gibt, aber meines Wissens nur ein Einziges funktioniert.
Lafferty sieht mich an. Ich sehe ihn an. Ich gestikuliere. Mehr. Frag nach mehr.
«Verstanden», sagt Lafferty in sein Funkgerät. «Over.»
Falsch. Ich hebe meins an den Mund. Ich spreche klar und deutlich.
«Gibt es genauere Informationen zum Fundort?», sage ich.
Nachdem ich den Anruf beendet habe, gebe ich Lafferty ein paar Tipps, erinnere ihn daran, dass er mit der Zentrale ganz normal sprechen kann – viele Anfänger haben die Neigung, hölzern und betont männlich zu reden, was sie sich wahrscheinlich aus Filmen oder Fernsehserien abgeguckt haben –, und ich erinnere ihn ebenfalls daran, dass er sich von der Zentrale so viele Infos wie nur möglich geben lassen soll.
Doch noch ehe ich fertig bin, sagt Lafferty wieder: «Verstanden.»
Ich sehe ihn an. «Ausgezeichnet», sage ich. «Freut mich.»
Ich kenne ihn erst eine Stunde, aber ich bekomme allmählich ein Gespür für ihn. Er redet gern – ich weiß schon mehr über ihn, als er je über mich wissen wird –, und er ist ein Heuchler. Ein Streber. Mit anderen Worten, ein Angeber. Jemand, der vor lauter Angst davor, für arm oder schwach oder dumm gehalten zu werden, keinerlei Defizite in dieser Hinsicht zugeben kann. Ich dagegen bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass ich arm bin. Mehr denn je, seit keine Schecks mehr von Simon kommen. Bin ich schwach? Wahrscheinlich in gewisser Weise: stur vielleicht, verbohrt, störrisch, unwillig, Hilfe anzunehmen, selbst wenn es gut für mich wäre. Auch körperlich ängstlich: keine Polizistin, die sich als Erste schützend vor einen Freund werfen würde, um eine Kugel abzufangen, keine Polizistin, die sich als Erste bei der Verfolgung eines flüchtigen Täters in den fließenden Verkehr stürzen würde. Arm: ja. Schwach: ja. Dumm: nein. Ich bin nicht dumm.
Heute Morgen bin ich zu spät zur Einsatzbesprechung gekommen. Wieder mal. Ich muss leider zugeben, dass es das dritte Mal in einem Monat war, und ich hasse es, zu spät zu kommen. Eine gute Polizistin ist vor allem eines: pünktlich. Als ich den Gemeinschaftsbereich betrat – ein trister, heller Raum ohne Möbel und nur mit welligen Polizeiplakaten an der Wand geschmückt –, wartete Sergeant Ahearn mit verschränkten Armen auf mich.
«Fitzpatrick», sagte er. «Schön, dass Sie’s einrichten konnten. Sie fahren heute mit Lafferty im 2613.»
«Wer ist Lafferty?», fragte ich, ohne zu überlegen. Ich wollte wirklich nicht witzig sein. Szebowski, in der Ecke, lachte laut auf.
Ahearn sagte: «Das da ist Lafferty», und zeigte quer durch den Raum.
Da war er, Eddie Lafferty, den zweiten Tag im Revier. Er war dabei, sich sein leeres Einsatzprotokoll anzusehen. Er warf mir einen raschen und unsicheren Blick zu. Dann bückte er sich, als hätte er irgendwas an seinen Schuhen bemerkt, die frisch geputzt waren und irgendwie glänzten. Er spitzte die Lippen. Pfiff leise. In dem Moment tat er mir fast leid.
Dann nahm er auf dem Beifahrersitz Platz.
Dinge, die ich im Lauf der ersten Stunde unserer Bekanntschaft über Eddie Lafferty erfahren habe: Er ist dreiundvierzig, also elf Jahre älter als ich. Er ist erst spät zur Polizei gekommen. Hat letztes Jahr die Prüfung abgelegt und bis dahin auf dem Bau gearbeitet. («Mein Rücken», sagt Eddie Lafferty, «macht mir noch immer Probleme. Aber nicht weitersagen.») Er hat gerade seine praktische Ausbildung abgeschlossen. Er hat drei Ex-Frauen und drei fast erwachsene Kinder. Er hat ein Haus in den Poconos. Er macht Gewichtheben. («Bin ein Fitness-Freak», sagt Eddie Lafferty.) Er leidet unter Sodbrennen. Gelegentlich auch unter Verstopfung. Er ist in South Philadelphia aufgewachsen und wohnt jetzt in Mayfair. Er teilt sich Dauerkarten für die Philadelphia Eagles mit sechs Freunden. Seine bislang letzte Ex-Frau war irgendwas über zwanzig. («Das war vielleicht das Problem», sagt Lafferty, «ihre Unreife.») Er spielt Golf. Er hat zwei Pitbull-Mischlinge aus dem Tierheim, Jimbo und Jennie. Er hat an der Highschool Baseball gespielt. Damals war tatsächlich unser späterer Sergeant in seiner Mannschaft, Kevin Ahearn, und der hat ihn auf die Idee gebracht, bei der Polizei anzufangen. (Erscheint mir irgendwie ganz einleuchtend.)
Dinge, die Eddie Lafferty in der ersten Stunde unserer Bekanntschaft über mich erfahren hat: Ich mag Pistazien-Eis.
Den ganzen Morgen habe ich mein Bestes gegeben, um Eddie Lafferty in seinen sehr seltenen Sprechpausen das Wesentliche beizubringen, was er über den Stadtteil wissen muss.
Kensington ist eines der neueren Viertel in der für amerikanische Verhältnisse sehr alten Stadt Philadelphia. Es wurde in den 1730er Jahren von dem Engländer Anthony Palmer gegründet, der ein kleines Stück unscheinbares Land erwarb und es nach einem königlichen Londoner Stadtteil benannte, der damals von der britischen Monarchie als Wohnsitz bevorzugt wurde. (Vielleicht war Palmer auch ein Angeber. Oder, freundlicher ausgedrückt, ein Optimist.) Der östliche Rand des heutigen Kensington ist eine Meile vom Delaware entfernt, aber in den Anfängen grenzte es direkt an den Fluss. Dementsprechend waren die ersten dort betriebenen Gewerbe Schiffsbau und Fischerei, doch um die Mitte des 19. Jahrhunderts nahm seine lange Blütezeit als Wirtschaftszentrum ihren Anfang. In seiner Hochphase hatte es Hersteller von Eisen, Stahl, Textilien und – passenderweise vielleicht – Pharmazeutika vorzuweisen. Doch als ein Jahrhundert später die Fabriken in diesem Land zuhauf dichtmachten, setzte auch in Kensington ein zunächst langsamer und dann rasanter wirtschaftlicher Niedergang ein. Viele Bewohner zogen auf der Suche nach Arbeit ins Stadtzentrum oder weiter weg; andere blieben, teils aus Treue, teils aufgrund der falschen Hoffnung auf einen baldigen Umschwung. Heute besteht Kensington fast zu gleichen Teilen aus irischstämmigen Amerikanern, die im 19. und 20. Jahrhundert hierherzogen, und aus einer neuen Einwohnerschaft von Familien puerto-ricanischer oder anderer lateinamerikanischer Herkunft. Außerdem gibt es diverse Bevölkerungsgruppen, die zunehmend kleinere Stücke in Kensingtons demografischem Tortendiagramm repräsentieren: Afroamerikaner, Ostasiaten, Leute aus der Karibik.
Das heutige Kensington wird von zwei Hauptverkehrsadern durchzogen: Front Street, die am Ostrand der City nach Norden führt, und Kensington Avenue – meist bloß die Ave genannt, eine mal freundliche, mal verächtliche Bezeichnung, je nachdem, wer sie benutzt –, die an der Front Street beginnt und in einem Schwenk nach Nordosten verläuft. Die Elevated Line – eine Hochbahn, im Volksmund kurz die El, denn in einer Großstadt, die Philly genannt wird, muss alles, was zu ihrer Infrastruktur gehört, abgekürzt werden – fährt sowohl über die Front als auch über die Kensington, wodurch beide Straßen den längsten Teil des Tages im Schatten liegen. Große Stahlträger stützen die Bahnlinie, blaue Pfeiler im Abstand von zehn Metern, sodass die ganze Konstruktion aussieht wie eine riesige und bedrohliche Raupe, die über dem Viertel hängt. Die meisten Transaktionen (Drogen, Sex), die in Kensington stattfinden, fangen auf einer dieser beiden Hauptstraßen an und enden auf einer der vielen kleineren Straßen, die sie kreuzen, oder noch häufiger in den verlassenen Häusern oder auf leeren Grundstücken, von denen es in den Seitenstraßen und Gassen des Viertels jede Menge gibt. Entlang der größeren Straßen finden sich Nagelstudios, Imbissbuden, Handy-Läden, Mini-Märkte, Ramschläden, Elektroläden, Pfandhäuser, Suppenküchen, andere gemeinnützige Einrichtungen und Bars. Etwa ein Drittel der Ladenfronten ist verriegelt und verrammelt.
Und doch – wie die Eigentumswohnungen bezeugen, die jetzt links von uns auf einem Grundstück gebaut werden, das brach gelegen hat, seit die Fabrik, die dort stand, der Abrissbirne zum Opfer fiel – ist das Viertel im Aufwind. Neue Bars und Geschäfte entstehen an der Peripherie, in Richtung Fishtown, wo ich aufgewachsen bin. Neue junge Gesichter bevölkern diese Geschäfte: ernst, reich, naiv, reif zur Ernte. Daher sorgt sich der Bürgermeister zunehmend um den äußeren Anschein. «Mehr Polizei», sagt der Bürgermeister. «Mehr Polizei, mehr Polizei, mehr Polizei.»
Es regnet heute heftig, und ich bin gezwungen, langsamer zu fahren, als ich das sonst tun würde, wenn ich auf eine Meldung von der Zentrale reagiere. Ich nenne die Geschäfte, an denen wir vorbeikommen, nenne ihre Besitzer. Ich schildere einige Straftaten der letzten Zeit, von denen Lafferty meiner Ansicht nach wissen sollte (Lafferty stößt jedes Mal einen Pfiff aus, schüttelt den Kopf). Ich zähle Verbündete auf. Draußen vor unseren Fenstern: die übliche Mischung von Leuten, die einen Schuss brauchen, und solchen, die sich einen gesetzt haben. Die Hälfte der Leute auf den Gehwegen sinkt allmählich Richtung Erde, weil ihre Beine sie nicht mehr tragen können. Die Kensington-Rutsche, sagen manche, die über so was Witze reißen. Ich tue das nie.
Wegen des Wetters haben einige Frauen, an denen wir vorbeifahren, Regenschirme aufgespannt. Sie tragen Wintermützen und bauschige Jacken, Jeans, dreckige Sneaker. Vom Teenager bis zur Seniorin sind alle Altersgruppen vertreten. Die große Mehrheit ist weiß, obwohl Rauschgiftsucht niemanden diskriminiert, und hier sind alle Hautfarben und Religionen vertreten. Die Frauen tragen kein Make-up oder höchstens schwarzen, dick aufgetragenen Eyeliner. Die Frauen, die auf der Ave arbeiten, tragen nichts, was ihr Metier verrät, aber jeder weiß Bescheid: Es liegt an dem Blick, mit dem sie jeden vorbeikommenden Mann, jeden Fahrer der vorbeikommenden Autos mustern, lang und hart. Ich kenne die meisten dieser Frauen, und die meisten kennen mich.
«Das da ist Jamie», sage ich zu Lafferty, als wir an ihr vorbeifahren. «Das ist Amanda. Das ist Rose.»
Ich betrachte es als Teil seiner Ausbildung, ihm diese Frauen vorzustellen.
Am Ende des Blocks, an der Kensington, Ecke Cambria, sehe ich Paula Mulroney. Sie geht heute an Krücken, schwankt mitleiderregend auf einem Fuß, wird nass vom Regen, weil sie nicht auch noch einen Schirm halten kann. Ihre blaue Jeansjacke hat sich verstörend dunkel verfärbt. Ich wünschte, sie würde ins Trockene gehen.
Ich sehe mich rasch um, suche nach Kacey. An dieser Ecke sind sie und Paula normalerweise zu finden. Manchmal streiten oder verkrachen sie sich, und eine von beiden steht dann eine Zeit lang woanders, aber eine Woche später sehe ich sie wieder dort, vereint, die Arme vergnügt umeinandergeschlungen, Kacey mit einer Zigarette im Mund, Paula mit einem Wasser oder einem Saft oder einem Bier in einer Papiertüte.
Heute kann ich Kacey nirgends entdecken. Tatsächlich fälltmir auf, dass ich sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen habe.
Paula bemerkt unseren Wagen, als wir auf sie zufahren, und späht mit zusammengekniffenen Augen in unsere Richtung, sieht, wer drin sitzt. Ich hebe zwei Finger vom Lenkrad: ein Winken. Paula sieht erst mich an, dann Lafferty, und dann hebt sie leicht das Gesicht nach oben, gen Himmel.
«Das ist Paula», sage ich zu Lafferty.
Ich überlege, mehr zu sagen. Ich bin mit ihr zur Schule gegangen, könnte ich sagen. Sie ist eine Freundin der Familie. Sie ist die Freundin meiner Schwester.
Doch Lafferty ist schon bei einem anderen Thema: das Sodbrennen, das ihm schon fast das ganze Jahr zu schaffen macht.
Mir fällt keine Antwort ein.
«Bist du immer so still?», sagt er unvermittelt. Es ist die erste Frage, die er mir stellt, seit er meine Lieblingseissorte herausgefunden hat.
«Bloß müde», sage ich.
«Hattest du schon viele Partner vor mir?», sagt Lafferty, und dann lacht er, als hätte er einen Witz gemacht.
«Das hat sich jetzt irgendwie falsch angehört», sagt er. «Sorry.»
Gerade lange genug sage ich nichts.
Dann sage ich: «Nur einen.»
«Wie lange habt ihr zusammengearbeitet?»
«Zehn Jahre.»
«Was ist mit ihm passiert?», fragt Lafferty.
«Er hat sich im Frühjahr das Knie verletzt», sage ich. «Er ist eine Weile krankgeschrieben.»
«Wie hat er sich verletzt?», fragt Lafferty.
Ich wüsste nicht, was ihn das angeht. Trotzdem sage ich: «Im Dienst.»
Falls Truman will, dass jeder die ganze Geschichte kennt, soll er sie selbst erzählen.
«Hast du Kinder? Bist du verheiratet?», fragt er.
Ich wünschte, er würde wieder über sich reden.
«Ein Kind», sage ich. «Unverheiratet.»
«Ach ja? Wie alt?»
«Vier. Fast fünf.»
«Gutes Alter», sagt Lafferty. «Ich fand’s schön, als meine in dem Alter waren.»
Als ich an dem von der Zentrale genannten Zugang zum Gleis halte – eine Bresche im Zaun, die irgendwer vor Jahren reingetreten hat und die nie repariert worden ist –, sehe ich, dass wir schneller als der Rettungsdienst vor Ort sind.
Ich schaue Lafferty an, taxiere ihn. Unvermutet empfinde ich einen Anflug von Mitleid mit ihm, wegen dem, was wir gleich sehen werden. Seine praktische Ausbildung hat er im dreiundzwanzigsten Revier absolviert, das gleich an unseres angrenzt, dessen Kriminalstatistik aber deutlich niedriger liegt. Außerdem wird er überwiegend Fußstreife gemacht haben, Kontrolle bei Massenveranstaltungen, solche Sachen. Ich glaube kaum, dass er je einen Einsatz wie diesen hier hatte. Es gibt keine taktvolle Art, jemanden zu fragen, wie viele Tote er in seinem Leben schon gesehen hat, deshalb beschließe ich, mich vage auszudrücken.
«Hast du so was schon mal gemacht?», frage ich ihn.
Er schüttelt den Kopf. Er sagt: «Nee.»
«Na, dann wollen wir mal», sage ich forsch.
Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Es ist unmöglich, jemanden ausreichend darauf vorzubereiten.
Als ich vor dreizehn Jahren anfing, kam es nur einige Male im Jahr vor, dass jemand nach einer tödlichen Überdosis schon so lange tot war, dass jeder Rettungsdiensteinsatz sich erübrigt hatte. Häufiger waren Notrufe, dass jemand überdosiert hatte, aber noch lebte, und meistens konnten diese Menschen wiederbelebt werden. Mittlerweile ist oft nichts mehr zu machen. Dieses Jahr hält allein Philadelphia stramm auf tausendzweihundert Fälle zu, und die überwiegende Mehrheit davon gab es in unserem Revier. Die meisten sind relativ frische Drogentote. Bei anderen hat die Verwesung bereits eingesetzt. Manchmal werden sie von Freunden oder Partnern, die dabei waren, ungeschickt versteckt, weil sie keine Scherereien wollen, keine Lust haben, erklären zu müssen, wie es passiert ist. Häufiger kommt es vor, dass sie einfach irgendwo rumliegen, an einem versteckten Ort für immer eingenickt. Manchmal werden sie von Angehörigen gefunden. Manchmal von ihren Kindern. Manchmal finden wir sie: Wir sehen sie vom Streifenwagen aus, lang gestreckt oder in sich zusammengesunken, und wenn wir ihre Vitalzeichen checken, haben sie keinen Puls. Sie fühlen sich kalt an. Sogar im Sommer.
Lafferty und ich gehen von der Öffnung im Zaun hinunter in eine kleine Senke. In meinen Jahren bei der Polizei bin ich so einen Weg schon Dutzende oder vielleicht Hunderte Male gegangen. Diese verwilderte Gegend liegt in unserem Streifenbereich, theoretisch. Wenn wir hierherkommen, finden wir immer irgendwas oder irgendwen. Als Truman noch mein Partner war, ist er immer vorgegangen. Er war dienstälter. Heute gehe ich vor, ziehe sinnloserweise den Kopf ein, als könnte mich das irgendwie trockener halten. Aber der Regen lässt nicht nach. Er prasselt so laut auf meine Mütze, dass ich mein eigenes Wort nicht verstehe. Meine Schuhe rutschen im Matsch.
Wie viele Teile von Kensington ist der Lehigh Viaduct – inzwischen fast nur noch «das Gleis» genannt – ein Streifen Land, der seinen Sinn verloren hat. Einst viel befahren von Güterzügen, die in Kensingtons industrieller Glanzzeit eine bedeutende Rolle spielten, liegt das Gleis jetzt brach und ist völlig überwuchert. Unkraut und Laub und Äste verdecken Spritzen und Drogentütchen, mit denen der Boden übersät ist. Niedrige Baumgruppen verbergen Aktivitäten. Seit Kurzem überlegen die Stadtverwaltung und die Eisenbahngesellschaft Conrail, das Gleis zu planieren, aber das ist bislang noch nicht passiert. Ich bin skeptisch: Ich kann mir hier nichts anderes vorstellen als das, was es ist, ein Versteck für Leute, die einen Schuss brauchen, für die Frauen, die auf der Ave arbeiten, und ihre Freier. Falls das hier wirklich planiert wird, werden mir nichts, dir nichts neue Enklaven im Umkreis entstehen. Das ist immer so.
Ein kurzes Rascheln zu unserer Linken: Ein Mann taucht aus dem Gestrüpp auf. Er sieht gespenstisch und seltsam aus. Er bleibt mit hängenden Armen stehen, und kleine Wasserrinnsale laufen ihm übers Gesicht. Es wäre unmöglich zu sagen, ob er weint.
«Sir», spreche ich ihn an, «haben Sie hier in der Gegend irgendwas gesehen, was wir wissen sollten?»
Er antwortet nicht. Starrt weiter. Leckt sich die Lippen. Er hat diesen abwesenden, hungrigen Blick von jemandem, der einen Schuss braucht. Seine Augen sind unnatürlich hellblau. Vielleicht, denke ich, trifft er sich hier mit einem Freund oder einem Dealer: mit jemandem, der ihm helfen wird. Schließlich schüttelt er langsam den Kopf.
«Sie dürfen sich hier unten nicht aufhalten, wissen Sie», sage ich zu ihm.
Gewisse Officers würden sich mit dieser Formalität nicht abgeben, sie zwecklos finden. Ist wie Rasenmähen, sagen manche. Anders ausgedrückt: Wächst alles gleich wieder nach. Aber ich mache mir immer die Mühe.
«Sorry», sagt der Mann, aber er sieht nicht so aus, als würde er sich umgehend entfernen, und ich nehme mir nicht die Zeit, noch mal nachzuhaken.
Wir gehen weiter. Rechts und links von uns haben sich große Pfützen gebildet. Laut der Zentrale soll die Leiche von dem Loch im Zaun, durch das wir gekommen sind, gut hundert Meter geradeaus und dann leicht rechts hinter einem umgekippten Baumstamm liegen. Der anonyme Anrufer habe eine Zeitung auf den Baumstamm gelegt, damit wir die Leiche schneller finden. Danach halten wir jetzt Ausschau, als wir uns weiter und weiter von dem Zaun entfernen.
Lafferty entdeckt den Baumstamm als Erster, biegt von dem Weg ab, der eigentlich kein Weg ist, bloß ein im Laufe der Jahre ausgetretener Trampelpfad. Ich folge ihm. Wie immer frage ich mich, ob ich die Frau kenne, ob ich sie schon mal festgenommen habe oder ob ich zigmal auf der Straße an ihr vorbeigefahren bin. Und dann, ehe ich mich bremsen kann, spult sich in meinem Kopf die vertraute Leier ab. Oder Kacey. Oder Kacey. Oder Kacey.
Lafferty, zehn Schritte vor mir, beugt sich über den Baumstamm und späht dahinter. Er sagt nichts, steht einfach weiter so da, den Kopf zur Seite geneigt, und schaut.
Als ich bei ihm bin, mache ich das Gleiche.
Die Frau ist nicht Kacey.
Mein erster Gedanke: Gott sei Dank, ich kenne sie nicht. Mein zweiter: Sie ist erst vor Kurzem gestorben. Sie liegt noch nicht lange da. Nichts an ihr ist weich, nichts schlaff. Stattdessen ist sie steif, liegt auf dem Rücken, ein Arm nach oben gedreht, sodass ihre Hand wie eine Kralle wirkt. Das Gesicht ist verzerrt und spitz, ihre Augen sind abscheulich offen. Normalerweise sind sie bei Drogentoten geschlossen, was ich immer irgendwie als tröstlich empfinde. Immerhin sind sie friedlich gestorben, denke ich. Aber diese Frau wirkt erstaunt, als könnte sie das Schicksal nicht fassen, das sie ereilt hat. Sie liegt auf einem Bett aus Laub. Bis auf ihren rechten Arm ist sie gerade wie ein Zinnsoldat. Sie ist jung. Etwa Mitte zwanzig. Ihr Haar ist – war – zu einem straffen Pferdeschwanz nach hinten gebunden, aber es ist zerzaust worden. Aus dem Haargummi, das es zusammenhält, haben sich Strähnen gelöst. Sie trägt ein Tanktop und einen Jeansrock. Es ist zu kalt für so ein Outfit. Der Regen fällt direkt auf ihren Körper und ihr Gesicht. Das ist ganz ungünstig für die Beweissicherung. Instinktiv will ich sie zudecken, sie irgendwie warm einpacken. Wo ist ihre Jacke? Vielleicht hat jemand sie ihr ausgezogen, als sie schon tot war. Wie nicht anders zu erwarten, liegen neben ihr auf der Erde eine Spritze und eine provisorische Aderpresse. War sie allein, als sie starb? Meistens sind sie das nicht, die Frauen: Meistens sind Partner dabei oder Kunden, die sie dann einfach liegen lassen, wenn sie sterben, aus Angst, in die Sache verwickelt zu werden, aus Angst, in etwas hineingezogen zu werden, womit sie nichts zu tun haben wollen.
Wir sind angewiesen, als Erstes die Vitalzeichen zu überprüfen. Normalerweise würde ich mir das in einem so offensichtlichen Fall ersparen, aber Lafferty beobachtet mich, also mache ich alles nach Vorschrift. Ich wappne mich innerlich, klettere über den Baumstamm und strecke die Hand nach ihr aus. Ich will ihr gerade den Puls fühlen, als ich Schritte und Stimmen in der Nähe höre. «Mist», sagen die Stimmen. «Verdammter Mist.» Es regnet jetzt noch stärker.
Der Rettungsdienst hat uns gefunden. Es sind zwei junge Männer. Sie haben es nicht eilig. Sie wissen schon, dass sie diese Frau nicht retten können. Sie ist tot; sie ist nicht mehr. Das muss ihnen nicht erst ein Gerichtsmediziner sagen.
«Noch frisch?», ruft einer von ihnen. Ich nicke langsam. Es gefällt mir nicht, wie sie – wir – manchmal über die Toten reden.
Die zwei jungen Männer schlendern zu dem Baumstamm, schauen gelassen hinüber.
«Jesses», sagt der eine – laut seinem Namensschild heißt er Saab – zu dem anderen, zu Jackson.
«Wenigstens ist sie leicht», sagt Jackson, was sich für mich wie ein Schlag in die Magengrube anfühlt. Dann klettern sie beide über den Baumstamm, gehen um die Tote herum, knien sich neben sie.
Jackson legt seine Finger an ihren Hals. Er versucht mehrmals pflichtgemäß, irgendetwas zu finden, steht dann auf. Er sieht auf seine Uhr.
«Unbekannte weibliche Person, Tod festgestellt um 11.21 Uhr», sagt er.
«Notier das», sage ich zu Lafferty. Ein Vorteil daran, wieder einen Partner zu haben: Er kann das Einsatzprotokoll ausfüllen. Lafferty hat seines in seine Jacke gesteckt, um es vor dem Regen zu schützen, und jetzt holt er es hervor, beugt sich darüber, damit es möglichst trocken bleibt.
«Moment mal», sage ich.
Eddie Lafferty blickt erst mich an und dann die Leiche.
Ich bücke mich zwischen Jackson und Saab und sehe mir das Gesicht des Opfers genauer an. Die offenen Augen sind jetzt trüb, fast milchig, der Kiefer schmerzhaft verkrampft.
Da, unter den Augenbrauen und oben auf den Wangenknochen, sind kleine rosa Pünktchen verstreut. Von Weitem sah es bloß so aus, als wäre die Gesichtshaut gerötet; von Nahem sind sie deutlich zu erkennen, wie kleine Sommersprossen oder Punkte von einem Stift auf einem Blatt Papier.
Saab und Jackson beugen sich ebenfalls vor.
«Oh ja», sagt Saab.
«Was denn?», fragt Lafferty.
Ich hebe mein Funkgerät an den Mund.
«Mögliches Tötungsdelikt», sage ich.
«Wieso?», sagt Lafferty.
Jackson und Saab ignorieren ihn. Sie sind noch immer vorgebeugt, inspizieren die Leiche.
Ich lass das Funkgerät sinken. Wende mich an Lafferty. Seine Ausbildung, seine Ausbildung.
«Petechien», sage ich und zeige auf die Punkte.
«Wie bitte?», fragt Lafferty.
«Geplatzte Blutgefäße. Ein Anzeichen für Strangulation.»
Kurz darauf treffen die Kriminaltechnik, die Mordkommission und Sergeant Ahearn ein.
damals
Als ich meine Schwester das erste Mal tot auffand, war sie sechzehn. Das war im Sommer 2002. Achtundvierzig Stunden zuvor, an einem Freitagnachmittag, war sie nach der Schule mit Freundinnen losgezogen und hatte mir gesagt, sie käme am Abend nach Hause.
Sie kam nicht.
Am Samstag rief ich vor lauter Angst Kaceys Freundinnen an und fragte sie, ob sie wüssten, wo sie sein könnte. Aber keine von ihnen wusste es oder wollte es mir sagen. Ich war damals siebzehn, sehr schüchtern, bereits fest für die Rolle besetzt, die ich mein ganzes Leben gespielt habe: die Verantwortliche. «Eine kleine, alte Lady», sagte meine Großmutter Gee. «Ernster, als gut für sie ist.» Kaceys Freundinnen hielten mich garantiert für eine Art Mutterfigur, eine Autoritätsperson, vor der es Informationen zu verschweigen galt. Wieder und wieder entschuldigten sie sich gelangweilt und verneinten, irgendwas zu wissen.
Kacey war damals ausgelassen und laut. Wenn sie zu Hause war, was immer seltener vorkam, war das Leben besser, das Haus wärmer und fröhlicher. Ihr ungewöhnliches Lachen – ein lautloses Zittern mit offenem Mund, gefolgt von einer Reihe spitzer, hoher, lautstarker Atemzüge, wobei sie sich krümmte, als würden sie ihr Schmerzen bereiten – hallte von den Wänden wider. Ohne dieses Lachen war ihre Abwesenheit spürbar, die Stille im Haus unheimlich und fremd. Ihre Geräusche waren ebenso verschwunden wie ihr Geruch, irgendein grässliches Parfüm namens Patchouli Musk, das sie und ihre Freundinnen benutzten – wahrscheinlich um zu überdecken, was sie rauchten.
Ich brauchte ein ganzes Wochenende, bis ich Gee überredet hatte, die Polizei zu rufen. Sie schaltete nur sehr ungern Außenstehende ein. Ich glaube, aus Angst, sie würden einen kritischen Blick auf ihre Erziehungsmethoden werfen und sie irgendwie für ungeeignet halten.
Als sie endlich zustimmte, verwählte sie sich prompt auf ihrem olivgrünen Telefon mit Wählscheibe und erreichte die Polizei erst beim zweiten Versuch. Ich hatte sie noch nie so ängstlich und so wütend erlebt. Sie zitterte heftig, als sie auflegte – vor Wut oder Sorge oder Scham. Ihr längliches, gerötetes Gesicht bewegte sich auf eine Weise, die beunruhigend und ungewohnt war. Sie sprach leise mit sich selbst, unverständliche Sätze, die sich wie ein Fluch oder ein Gebet anhörten.
Dass Kacey einfach so verschwand, war einerseits überraschend, andererseits auch wieder nicht. Sie war schon immer kontaktfreudig gewesen und hatte sich in letzter Zeit einer bunt zusammengewürfelten Clique angeschlossen. Ihre Freundinnen waren umgänglich, aber faul, beliebt, aber nicht ernst zu nehmen. In der achten Klasse hatte sie eine kurze Hippiephase, gefolgt von etlichen Jahren, in denen sie sich wie ein Punk kleidete, die Haare mit Manic Panic färbte, sich einen Nasenring zulegte und ein unseliges Tattoo – eine Spinne in einem Netz – stechen ließ. Sie ging mit Jungen aus. Ich hatte noch nie einen Freund gehabt. Sie war beliebt, setzte ihre Beliebtheit aber meist für etwas Gutes ein: In der Mittelschule nahm sie sich eines unglücklichen Mädchens namens Gina Brickhouse an, die wegen ihres Gewichts, ihrer Körperhygiene, ihrer Armut und ihres bedauerlichen Namens so schlimm gehänselt wurde, dass sie im Alter von elf praktisch verstummt war. Dann zeigte Kacey Interesse an ihr, und unter Kaceys Schutz blühte sie auf. Am Ende der Highschool wurde Gina Brickhouse «das Unikum» genannt, eine Auszeichnung, die sonderbaren, aber angesehenen Anarchos vorbehalten war.
In letzter Zeit jedoch hatte Kaceys gesellschaftliches Leben eine Wende genommen. Sie hatte sich regelmäßig so großen Ärger eingehandelt, dass ihr schon der Schulverweis drohte. Sie trank viel, sogar in der Schule, und nahm verschiedene rezeptpflichtige Medikamente, die damals niemand für bedenklich hielt. Zum ersten Mal in ihrem Leben versuchte Kacey, mir Dinge zu verheimlichen. Bis dahin hatte sie mir immer alles anvertraut, oft mit einem dringlichen und flehenden Unterton in der Stimme, als wollte sie von mir die Absolution. Aber ihre ungewohnten Geheimhaltungsversuche waren erfolglos. Ich konnte es spüren – natürlich konnte ich es spüren. Ich beobachtete eine Veränderung in ihrem Verhalten, ihrer Physis, ihrem Blick. Kacey und ich teilten uns ein Zimmer und schliefen im selben Bett, unsere ganze Kindheit hindurch. Es gab eine Zeit, da kannten wir einander so gut, dass wir vorhersagen konnten, was die andere als Nächstes sagen würde. Wir unterhielten uns schnell und für andere unverständlich, fingen Sätze an und ließen sie unvollendet, führten längere Verhandlungen ausschließlich mit Blicken und Gesten. Deshalb war ich fraglos beunruhigt, als meine Schwester immer häufiger bei Freundinnen übernachtete oder in den frühen Morgenstunden nach Hause kam und nach irgendwas roch, was ich da noch nicht identifizieren konnte.
Und als ich zwei Tage hintereinander nichts von ihr gehört hatte, fand ich weder ihr Verschwinden überraschend noch den Gedanken, dass irgendwas mit ihr furchtbar falsch lief. Das Einzige, was mich überraschte, war der Gedanke, dass Kacey mich so vollständig aus ihrem Leben ausschließen konnte. Dass sie ihre wichtigsten Geheimnisse selbst vor mir derart verbergen konnte.
Kurz nach Gees Anruf bei der Polizei meldete sich Paula Mulroney bei mir. Paula war eine von Kaceys besten Freundinnen in der Highschool und eigentlich die einzige, die mich ernst nahm, die die Bedeutung unserer familiären Bindung verstand und respektierte. Sie sagte, sie habe von Kacey gehört, und sie glaubte zu wissen, wo sie war.
«Aber kein Wort zu eurer Großmutter», sagte Paula, «falls ich mich täusche.»
Paula war ein hübsches Mädchen, stark und groß und tough. Sie erinnerte mich irgendwie an eine Amazone – vom Volk der Amazonen hörte ich zum ersten Mal, als wir in der Neunten die Aeneis lasen, und dann wieder mit fünfzehn, als ich begeistert Comic-Hefte verschlang –, doch als ich Kacey gegenüber einmal die Ähnlichkeit erwähnte, was ich als Kompliment für Paula meinte, sagte sie: «Mick. Erzähl das bloß keinem.» Jedenfalls, obwohl ich Paula mochte – noch immer mag –, war mir schon damals klar, dass sie vermutlich einen schlechten Einfluss auf Kacey hatte. Ihr Bruder Fran war ein Dealer, und Paula arbeitete für ihn, und das wusste jeder.
An dem Tag traf ich mich mit Paula an der Kensington, Ecke Allegheny.
«Komm mit», sagte Paula.
Sie erzählte mir, dass sie und Kacey vor zwei Tagen in diesem Viertel zu einem Haus gegangen waren, das einem Freund von Paulas Bruder gehörte. Ich wusste, was das bedeutete.
«Ich musste gehen», sagte Paula, «aber Kacey wollte noch ein bisschen bleiben.»
Paula führte mich die Kensington Ave hoch zu einer kleinen Seitenstraße, an deren Namen ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, und dann zu einem baufälligen Reihenhaus mit einer weißen Sturmtür. An der Tür war eine schwarze Metallsilhouette von einem Pferd und einer Kutsche, bloß dass dem Pferd die Vorderbeine fehlten: Ich konnte es mir lange genug ansehen, weil wir fünf Minuten klopfen mussten, ehe einer aufmachte.
«Glaub mir, die sind zu Hause», sagte Paula. «Die sind immer zu Hause.»
Als die Tür endlich aufging, stand vor uns ein Gespenst von einer Frau mit schwarzen Haaren. Sie war unglaublich dünn, hatte das rötliche Gesicht und die schwerlidrigen Augen, die ich später mit Kacey in Verbindung bringen sollte. Damals wusste ich noch nicht, was es bedeutete.
«Fran ist nicht da», sagte die Frau zu Paula. Sie war vielleicht zehn Jahre älter als wir, obwohl das schwer zu schätzen war.
«Wer ist das?», fragte die Frau, ehe Paula etwas erwidern konnte.
«Meine Freundin. Sie sucht ihre Schwester», sagte Paula.
«Keine Schwestern hier», sagte die Frau.
«Kann ich mit Jim sprechen?», wechselte Paula das Thema.
Der Juli in Philadelphia kann heftig sein, und in dem Haus mit seinem schwarzen Teerdach war es heiß wie in einem Glutofen. Es roch nach Zigaretten und irgendwas Süßlichem. Es machte mich sehr traurig, als ich daran dachte, für wen das Haus mal gebaut worden war: für eine funktionierende Familie vielleicht, einen Fabrikarbeiter mit Frau und Kindern. Jemand, der jeden Tag in einem der riesigen Backsteingebäude schuftete, die jetzt leer standen, aber noch immer Kensingtons Straßen säumten. Jemand, der am Ende jedes Arbeitstages nach Hause kam und vor dem Abendessen ein Dankgebet sprach. Wo wir in diesem Augenblick standen, war vielleicht mal ein Esszimmer gewesen. Jetzt war es leer geräumt bis auf ein paar Metallklappstühle, die an einer Wand lehnten. Aus Respekt vor dem Haus versuchte ich, mir den Raum so vorzustellen, wie er vor einer Generation gewesen sein könnte: ovaler Tisch mit Spitzentischtuch. Dicker Teppich auf dem Boden. Polstersessel. An den Fenstern Gardinen, die jemandes Großmutter genäht hatte. An der Wand ein Bild von einer Schale mit Obst.
Jim, der Besitzer des Hauses, wie ich vermutete, kam in einem schwarzen T-Shirt und in Jeansshorts ins Zimmer und sah uns an. Seine Arme hingen schlaff herab.
«Du suchst Kacey?», sagte er zu mir. In dem Moment fragte ich mich, woher er das wusste. Vermutlich wirkte ich unschuldig, wie eine Retterin, wie eine Beschützerin, wie eine, die suchte und nicht floh. Diese Wirkung hatte ich schon immer. Tatsächlich brauchte ich, nachdem ich bei der Polizei angefangen hatte, eine ganze Weile, um mir gewisse Gewohnheiten und Eigenarten zuzulegen, damit mich die Straftäter, die ich verhaftete, auch wirklich ernst nahmen.
Ich nickte.
«Oben», sagte Jim. Ich glaube, er schob noch nach: «Ihr geht’s nicht besonders», aber ich hörte nicht genau hin, und er hätte alles Mögliche gesagt haben können. Ich war bereits aus dem Raum.
Jede Tür auf dem oberen Flur war geschlossen, und dahinter, so dachte ich, konnten namenlose Schrecken lauern. Ich hatte ehrlich gesagt Angst. Ich stand eine Weile reglos da. Später sollte ich mir wünschen, ich hätte das nicht getan.
«Kacey», sagte ich leise in der Hoffnung, sie würde einfach auftauchen.
«Kacey», sagte ich wieder, und jemandes Kopf lugte aus einer Tür, verschwand dann wieder.
Der Flur war dämmrig. Von unten herauf konnte ich hören, wie Paula Small Talk machte: über ihren Bruder, über die Nachbarn, über die Polizei, die in letzter Zeit verstärkt auf der Ave Streife fuhr, zum Frust aller.
Schließlich nahm ich all meinen Mut zusammen, klopfte leise an die Tür, die mir am nächsten war, und öffnete sie nach kurzem Zögern.
Da war meine Schwester. Ich erkannte sie zuerst an ihrem Haar, das sich Kacey kürzlich grell pink gefärbt hatte und das jetzt hinter ihr auf der nackten Matratze ausgebreitet war. Sie lag auf der Seite, mit dem Rücken zu mir, und in Ermangelung eines Kissens war ihr Kopf seltsam abgewinkelt.
Sie trug nicht genug Kleidung.
Ich wusste, dass sie tot war, ehe ich bei ihr war. Ihre Haltung war mir vertraut, nachdem ich die ganze Kindheit hindurch neben ihr im selben Bett gelegen hatte, aber ihr Körper hatte an dem Tag eine andere Art von Schlaffheit. Ihre Gliedmaßen wirkten zu schwer.
Ich zog an ihrer Schulter und drehte sie auf den Rücken. Ihr linker Arm plumpste aufs Bett. Ein Streifen von einem BaumwollT-Shirt hing, jetzt gelockert, unten um ihren Bizeps. Unterhalb von dieser provisorischen Aderpresse: der lange, leuchtende Fluss ihrer Vene. Ihr Gesicht war schlaff und bläulich, der Mund offen, die Augen geschlossen, bis auf einen schmalen Spalt Weiß, der unter den Wimpern zu sehen war.
Ich schüttelte sie. Ich rief ihren Namen. Die Spritze lag neben Kacey auf dem Bett. Ich rief wieder ihren Namen. Sie roch nach Fäkalien. Ich schlug ihr ins Gesicht, fest. Damals hatte ich noch nie Heroin gesehen. Ich hatte noch nie jemanden auf Heroin gesehen.
«Ruft einen Krankenwagen», schrie ich – was im Rückblick ziemlich lustig ist. Nie im Leben hätte jemand aus dem Haus einen Krankenwagen oder gar die Polizei gerufen. Aber ich schrie es noch immer, als Paula ins Zimmer gerannt kam und mir eine Hand auf den Mund drückte.
«Ach du Scheiße», sagte Paula, als sie Kacey sah, und dann – ich staune noch immer über ihre Unerschrockenheit, ihre Besonnenheit, ihre raschen und sicheren Bewegungen – schob sie einen Arm unter Kaceys Knie und einen Arm unter ihre Schultern und hob sie von dem Bett. Kacey war auf der Highschool mollig, aber das schien Paula nichts auszumachen. Sie trug sie energisch und stapfte mit ihr die Treppe hinunter, den Rücken an die Wand gedrückt, um ja nicht zu stolpern, und dann zur Haustür hinaus. Ich folgte hinterdrein.
«Ruft bloß nicht von irgendwo hier in der Nähe an», sagte die Frau, die die Tür geöffnet hatte.
Sie ist tot, dachte ich, sie ist tot, meine Schwester ist tot. Ich hatte Kaceys totes Gesicht vor mir auf diesem Bett gesehen. Obwohl weder Paula noch ich überprüft hatten, ob Kacey atmete, war ich überzeugt, dass ich sie verloren hatte, und meine Gedanken eilten bereits voraus durch eine Zukunft ohne meine Schwester: meine Schulabschlussfeier, ohne Kacey. Meine Hochzeit. Die Geburt meiner Kinder. Gees Tod. Und aus Selbstmitleid begann ich zu weinen. Weil ich den einzigen anderen Menschen verloren hatte, der imstande war, die ganze Last zu schultern, die uns von Geburt an aufgebürdet worden war. Die Last unserer toten Eltern. Die Last von Gee, an deren gelegentliche Freundlichkeit wir uns inniglich klammerten, aber deren Gefühlskälte für uns Alltag war. Die Last unserer Armut. Mir liefen Tränen über die Wangen. Ich sah den Boden nur noch verschwommen. Ich stolperte über die Kante einer Gehwegplatte, die von einer tastenden Wurzel hochgeschoben worden war.
Sekunden später erblickte uns ein junger Officer, der neu in dem Revier war: einer der vielen zusätzlichen Polizisten, über die Jim und Paula gejammert hatten. Minuten später kam ein Krankenwagen, und ich fuhr hinten bei meiner Schwester mit und sah zu, wie sie mit einer Dosis Narcan von den Toten auferweckt wurde, mit Macht, wie durch ein Wunder, laut schrie, vor Schmerz und Übelkeit und Verzweiflung, uns anflehte, sie zurückkehren zu lassen.
An dem Tag erfuhr ich folgendes Geheimnis: Keiner von ihnen will gerettet werden. Sie wollen alle wieder zurücksinken in Richtung Erde, um vom Boden verschluckt zu werden, um weiterzuschlafen. In ihren Gesichtern liegt Hass, wenn sie wiederbelebt werden. Diesen Ausdruck habe ich inzwischen schon zigmal gesehen, im Job: wenn ich irgendeinem armen Rettungssanitäter über die Schulter schaue, dessen Aufgabe es ist, sie aus dem Jenseits zurückzuholen. Es war der Ausdruck in Kaceys Gesicht, als sie an dem Tag die Augen aufschlug, als sie fluchte, als sie weinte. Er galt mir.
jetzt
Lafferty und ich werden vom Fundort entlassen. Es obliegt jetzt Sergeant Ahearn, alles Weitere zu koordinieren, die Rechtsmedizin, die Detectives, die Kriminaltechnik.
Lafferty, neben mir im Wagen, ist endlich still. Ich entspanne mich, bloß ein wenig, lausche auf das Schmatzen der Scheibenwischer, auf das leise Knistern des Funkgeräts.
«Alles in Ordnung?», sage ich zu ihm.
Er nickt.
«Irgendwelche Fragen?»
Er schüttelt den Kopf. Wieder versinken wir in Schweigen.
Ich denke über die verschiedenen Arten von Stille nach, die es gibt: Diese Stille ist unangenehm, angespannt, das Schweigen von zwei Fremden, zwischen denen etwas Unausgesprochenes steht. Prompt vermisse ich Truman, dessen Schweigen friedlich war, dessen regelmäßige Atemzüge mich immer ermahnten, ruhiger zu werden.
Fünf Minuten vergehen. Und schließlich ergreift er das Wort.
«Schon bessere Tage gesehen», sagt er.
«Bitte?», sage ich.
Lafferty deutet mit einem Armschwenk auf unsere Umgebung.
«Ich hab gesagt, das Viertel hat schon bessere Tage gesehen. Es war eine anständige Gegend, als ich klein war. Bin immer hergekommen, um Baseball zu spielen.»
Ich runzele die Stirn.
«Ist kein schlechtes Viertel», sage ich. «Es hat seine guten und seine schlechten Seiten, schätze ich. Wie die meisten Viertel.»
Lafferty zuckt die Achseln, keineswegs überzeugt. Er ist noch kein ganzes Jahr bei der Polizei, und schon beklagt er sich. Manche Officers haben die unschöne und destruktive Angewohnheit, ständig an den Revieren herumzumäkeln, in denen sie Streife fahren. Ich habe viele Officers – darunter leider auch Sergeant Ahearn persönlich – über Kensington in einer Art und Weise reden hören, die sich nicht gehört für jemanden, der die Aufgabe hat, ein Gemeinwesen zu schützen und zu bewahren. Drecksdorf, sagt Sergeant Ahearn manchmal bei der Einsatzbesprechung. Ketamin-City. Kackstadt, USA.
«Ich brauch einen Kaffee», sage ich jetzt zu Eddie Lafferty.
Normalerweise trinke ich meinen Kaffee in einem kleinen Eckladen, wo Glaskannen auf Warmhalteplatten stehen und der Geruch nach Katzenstreu und Ei-Sandwiches in die Wände eingebrannt ist. Alonzo, der Betreiber, ist inzwischen ein Freund. Aber ich habe schon länger ein neues Café im Auge. Bomber Coffee, eines von einer ganzen Reihe von Läden, die in letzter Zeit an der Front Street aufgemacht haben, und ich vermute, der Grund, warum ich ihn vorschlage, ist Laffertys Geringschätzung des Viertels.
Diese neuen Läden – vor allem das Bomber – haben etwas an sich, das mich jedes Mal anlockt. Vielleicht ihre Inneneinrichtung, aus kühlem Stahl oder warmem und klingendem Holz. Vielleicht die Leute darin, die mir vorkommen, als wären sie von einem anderen Planeten in unseren Bezirk gefallen. Worüber sie nachdenken und reden und schreiben, kann ich mir nur vorstellen: Bücher und Klamotten und Musik und was für Pflanzen sich für ihre Häuser eignen. Sie überlegen, welche Namen sie ihren Hunden geben sollen. Sie bestellen Getränke mit unaussprechlichen Bezeichnungen. Gelegentlich will ich einfach nur mal kurz runter von der Straße, um unter Leute zu kommen, die solche Sorgen haben.
Als ich vor dem Bomber Coffee anhalte, blickt Lafferty mich an. Skeptisch.
«Ist das dein Ernst, Mike?», sagt er. Das ist eine Anspielung auf Der Pate. Wahrscheinlich denkt er, ich würde sie nicht erkennen. Er weiß ja nicht, dass ich alle Teile von Der Pate mehrmals gesehen habe, nicht aus freien Stücken, und dass ich es jedes Mal furchtbar fand.
«Bist du bereit, vier Dollar für deinen Kaffee zu bezahlen?», fragt er.
«Ich würde dich gern einladen», sage ich.
Ich bin nervös, als wir hineingehen, und ich ärgere mich deshalb über mich selbst. Unisono stutzen alle Gäste einen Moment, als sie unsere Uniformen, unsere Waffen wahrnehmen. Ein kurzer Blick von oben nach unten, an den ich mich längst gewöhnt habe. Dann wenden sie sich wieder ihren Laptops zu.
Das Mädchen hinter der Theke ist dünn und hat einen Pony, der ihr schnurgerade in die Stirn fällt, und eine Art Wintermütze, die ihn an Ort und Stelle hält. Der Junge neben ihr hat Haare, die an den Wurzeln dunkel und zu den Spitzen hin platingrau gebleicht sind. Seine Brille ist groß und eulenartig.
«Was darf’s sein?», fragt der Junge.
«Zwei mittelgroße Kaffee, bitte», sage ich. (Ich sehe mit einiger Zufriedenheit, dass diese Größe nur zwei Dollar fünfzig kostet.)
«Sonst noch was?», fragt der Junge. Er steht jetzt mit dem Rücken zu uns, während er den Kaffee eingießt.
«Ja», sagt Lafferty. «Tun Sie einen Schuss Whiskey rein, wenn Sie schon mal dabei sind.»
Er lächelt, als er das sagt, wartet auf Anerkennung. Diese spezielle Art von Humor kenne ich von meinen Onkeln: abgedroschen, vorhersehbar, harmlos. Lafferty ist groß und sieht einigermaßen gut aus, und er ist es wahrscheinlich gewohnt, gemocht zu werden. Er grinst noch immer, als der Junge sich umdreht.
«Wir verkaufen keinen Alkohol», sagt der Junge.
«Das war ein Witz», sagt Lafferty.
Der Junge reicht uns feierlich unseren Kaffee.
«Könnte ich mal Ihre Toilette benutzen?», fragt Lafferty. Er hat seine Freundlichkeit jetzt abgelegt.
«Außer Betrieb», sagt der Junge.
Aber ich kann sie sehen, eine Tür weiter hinten, klar und deutlich, ohne ein Schild dran, nichts, was darauf hindeutet, dass die Toilette defekt ist. Seine Kollegin, das Mädchen, meidet den Blickkontakt mit uns.
«Habt ihr nur die eine?», fragt Lafferty. Mit vielen Lokalen haben Streifenpolizisten eine Übereinkunft: Wir haben kein Büro, und wir hocken den ganzen Tag in unseren Fahrzeugen. Öffentliche Toiletten sind ein wichtiger Bestandteil unseres Arbeitsalltags.
«Ja», sagt der Junge. «Sonst noch was?», fragt er wieder.
Ich gebe ihm wortlos mein Geld. Ich gehe. Unseren Nachmittagskaffee werden wir wieder im Eckladen von Alonzo trinken. Alonzo lässt uns seine dämmrige, schmuddelige kleine Toilette benutzen, selbst wenn wir nichts kaufen. Er lächelt uns an. Er kennt Kacey. Er weiß, wie mein Sohn heißt, und er fragt nach ihm.
«Echt nette Kids», sagt Lafferty draußen. «Richtige Herzchen.»
Seine Stimme klingt bitter. Seine Gefühle sind verletzt. Zum ersten Mal mag ich ihn.
Willkommen in Kensington, denke ich. Tu nicht so, noch nicht, als würdest du es kennen.
Am Ende unserer Schicht parke ich unseren Wagen auf dem Parkplatz – ich inspiziere ihn noch gründlicher, als ich das normalerweise tun würde, achte darauf, dass Lafferty genau zusieht –, und dann gehen wir ins Revier, um unser Einsatzprotokoll abzugeben.
Sergeant Ahearn ist zurück in seinem Büro, einem Raum nicht größer als eine Besenkammer, mit Betonwänden, die schwitzen, wenn die Klimaanlage läuft –, aber es ist seins, etwas, das ihm gehört. Er hat ein Schild an der Tür mit der Aufschrift Erst klopfen.
Wir tun es und treten ein.
Er sitzt an seinem Schreibtisch und guckt sich irgendwas auf seinem Computer an. Wortlos nimmt er das Protokoll entgegen, ohne uns anzusehen.
«Nacht, Eddie», sagt er, als Lafferty geht.
Ich verharre einen Moment auf der Türschwelle.
«Nacht, Mickey», sagt er. Betont.
Nach kurzem Zögern frage ich: «Können Sie mir irgendwas über unser Opfer sagen?»
Er seufzt. Blickt von seinem Bildschirm auf. Schüttelt den Kopf.
«Noch nicht», sagt er. «Nichts Neues.»
Ahearn ist ein kleiner, schmächtiger Mann mit grauem Haar und blauen Augen. Er sieht nicht schlecht aus, aber er ist unsicher wegen seiner Statur. Mit meinen ein Meter zweiundsiebzig schaue ich mindestens fünf Zentimeter auf ihn herab. Aufgrund des Größenunterschieds stellt er sich manchmal auf die Zehenspitzen und bleibt in der Position, während er mit mir redet. Heute, da er an seinem Schreibtisch sitzt, bleibt ihm diese Demütigung erspart.
«Nichts?», sage ich. «Ist sie noch nicht identifiziert?»
Wieder schüttelt Ahearn den Kopf. Ich weiß nicht, ob ich ihm glauben soll. Ahearn ist seltsam: Er lässt sich nicht gern in die Karten schauen, selbst wenn er keinen Grund dazu hat. Eine Angewohnheit, mit der er hauptsächlich die relativ geringfügige Macht demonstrieren will, die er über uns hat, glaube ich. Er konnte mich von Anfang an nicht leiden. Ich führe das auf einen Fehler zurück, den ich kurz nach seiner Versetzung in unseren Bezirk gemacht habe: Bei der Einsatzbesprechung gab er uns eine Falschinformation über einen Täter, den wir suchten, und ich hob die Hand, um ihn zu korrigieren. Es war eine dumme und gedankenlose Reaktion von mir. Ich hätte ihn erst hinterher darauf aufmerksam machen sollen, um die Rangordnung zu wahren, das wurde mir später klar, doch die meisten Sergeants würden über so einen kleinen Lapsus hinwegsehen, sie würden Danke sagen und vielleicht einen Witz darüber machen. Ahearn dagegen warf mir einen Blick zu, den ich so bald nicht vergessen werde. Truman und ich haben oft gewitzelt, Ahearn hätte mich auf dem Kieker. Und obwohl wir das halb im Scherz sagten, glaube ich, dass wir beide deshalb in Wirklichkeit beunruhigt waren.
Jetzt sage ich zu Ahearn: «Ich habe sie noch nie auf der Straße gesehen. Nur für den Fall, dass Sie sich das gefragt haben.»
«Hab ich nicht», sagt Ahearn.
Sollten Sie aber, würde ich am liebsten sagen. Das ist eine wichtige Information. Sie könnte bedeuten, dass die Frau entweder neu in unserem Revier war oder einfach auf der Durchreise. Wir Streifenpolizisten kennen unsere Bezirke am besten. Wir sind ständig auf den Straßen unterwegs, lernen jeden Laden und jedes Wohnhaus kennen, die Menschen, die dort leben. Immerhin haben die Detectives, die am Fundort der Leiche waren, mir diese Frage und auch noch etliche andere Fragen gestellt, deren Gewissenhaftigkeit mich beruhigt hat.
Ich sage nichts von alldem. Ich klopfe einmal an den Türrahmen. Wende mich zum Gehen.
Doch dann ergreift Ahearn wieder das Wort. Er schaut dabei auf seinen Computer, sieht mich nicht an.
«Wie geht’s Truman?», fragt er.
Ich stutze. Perplex.
«Gut, vermutlich», sage ich.
«Haben Sie in letzter Zeit nichts von ihm gehört?»
Ich zucke die Achseln. Manchmal ist es schwierig, Ahearns Absichten zu durchschauen, aber ich weiß aus Erfahrung, dass er immer welche hat.
«Seltsam», sagt Ahearn. «Ich dachte, Sie wären befreundet.»
Dann blickt er auf und sieht mich einen kleinen Moment länger an, als mir lieb ist.
Auf dem Nachhauseweg rufe ich Gee an. Wir telefonieren mittlerweile nur selten. Wir sehen uns noch seltener. Als Thomas geboren wurde, fasste ich den Entschluss, ihm eine ganz andere Kindheit zu bieten, als ich sie erlebt habe, und das bedeutet so wenig Kontakt zu Gee – im Grunde zu allen O’Briens – wie möglich. Widerwillig, aus irgendeinem unverwüstlichen familiären Pflichtgefühl heraus, vollziehe ich das formelle Ritual, Gee um Weihnachten herum mit Thomas zu besuchen, und ich rufe sie sporadisch an, um mich zu vergewissern, dass sie noch lebt. Sie beklagt sich zwar manchmal darüber, aber ich glaube nicht, dass sie uns wirklich vermisst. Sie ruft mich nie an. Sie bietet nie an, mal auf Thomas aufzupassen, obwohl sie fit genug ist, ihren Catering-Job zu stemmen und obendrein stundenweise im Supermarkt Thriftway zu arbeiten. Seit einiger Zeit glaube ich, wir würden nie wieder miteinander sprechen, wenn ich aufhören würde, mich bei ihr zu melden.
«Ich höre», sagt Gee, als sie nach mehrmaligem Klingeln abhebt. So meldet sie sich immer am Telefon.
«Ich bin’s», sage ich, und Gee sagt: «Ich wer?»
«Mickey», sage ich.
«Oh», sagt Gee. «Hab deine Stimme gar nicht erkannt.»
Ich stocke, lasse die Andeutung sacken. Sie will mir ein schlechtes Gewissen machen. Wie immer.
«Ich wollte nur mal fragen», sage ich, «ob du in letzter Zeit was von Kacey gehört hast.»
«Wieso interessiert dich das?», fragt Gee argwöhnisch.
«Nur so», sage ich.
«Nein», sagt Gee. «Du weißt, ich halte mich von ihr fern. Du weißt, ich will mit ihrem Scheiß nichts zu tun haben. Ich halte mich fern», wiederholt sie, nur der Deutlichkeit halber.
«Alles klar», sage ich. «Gibst du mir Bescheid, falls du was von ihr hörst?»
«Was hast du vor?», fragt Gee. Misstrauisch.
«Nichts», sage ich.
«Du würdest auch auf Abstand bleiben», sagt Gee, «wenn du wüsstest, was gut für dich ist.»
«Mach ich», sage ich.
Nach einer kurzen Pause sagt Gee: «Das weiß ich doch.»
Beruhigt.
«Wie geht’s meinem Kleinen?», wechselt Gee das Thema. Sie war schon immer netter zu Thomas, als sie je zu uns war. Sie verwöhnt ihn, wenn sie ihn sieht, zaubert aus ihrer Handtasche bergeweise uralte, verklebte Bonbons hervor, die sie auspackt und ihm eigenhändig in den Mund steckt. Wahrscheinlich spiegeln diese kleinen Gaben die Art und Weise wider, wie sie mit ihrer eigenen Tochter umgegangen ist, Lisa, unserer Mutter.
«Er ist in letzter Zeit ganz schön frech», sage ich. Was gar nicht stimmt.
«Ach, hör auf», sagt Gee. Endlich höre ich ganz schwach ein Lächeln in ihrer Stimme. «Hör auf damit. Rede nicht so über meinen Jungen.»
«Ist er aber», sage ich.
Ich warte. Ein Teil von mir hofft noch immer, dass Gee als Erste nachgibt, dass sie mich bittet, Thomas vorbeizubringen, dass sie sich als Babysitterin anbietet, dass sie vorschlägt, uns in unserer neuen Wohnung zu besuchen.
«Sonst noch was?», sagt Gee schließlich.
«Nein», sage ich. «Ich denke, das ist alles.»
Bevor ich noch ein weiteres Wort sagen kann, hat sie aufgelegt.
Meine Vermieterin, Mrs. Mahon, harkt ihren Vorgarten, als ich in die Einfahrt biege. Mrs. Mahon wohnt in einem alten zweigeschossigen Haus im Kolonialstil, das sie planlos um eine zweite Etage für eine Einliegerwohnung aufgestockt hat. In die Wohnung – die seit fast einem Jahr unsere ist – gelangt man über eine wackelige Treppe auf der Rückseite des Hauses. Das Grundstück ist klein, aber hinter dem Haus ist ein langer Garten, den Thomas und ich nutzen können, und eine alte Reifenschaukel, die an einem Baum hängt. Ein wesentlicher Vorteil der Wohnung, neben dem Garten, ist die Miete: fünfhundert Dollar im Monat, einschließlich Nebenkosten. Ich fand sie über einen Kollegen, dessen Bruder gerade dort auszog. «Ist nichts Tolles», sagte der Bruder, «aber sie ist sauber, und die Vermieterin lässt schnell einen Handwerker kommen, wenn was kaputt geht.»
«Ich nehme sie», sagte ich. Am selben Tag bot ich mein Haus in Port Richmond zum Verkauf an. Es tat mir in der Seele weh; ich liebte das Haus. Aber ich hatte keine andere Wahl.
Ich winke Mrs. Mahon durchs Fahrerfenster zu, und sie unterbricht ihre Arbeit, als sie mich sieht, stützt sich mit dem Ellbogen auf den Holzstiel ihrer Harke.
Ich steige aus. Winke noch einmal. Auf dem Rücksitz liegt eine volle Einkaufstüte, und ich greife mit beiden Händen danach, gebe leise Geräusche von mir, um anzudeuten, wie gehetzt ich wieder mal bin. Ich spüre bei Mrs. Mahon immerzu eine Bedürftigkeit, habe aber keine große Lust, der näher auf den Grund zu gehen. Sie steht fast immer im Vorgarten, wo sie darauf wartet, dass irgendwer vorbeikommt, den sie ansprechen kann (mir ist aufgefallen, dass auch der Postbote unsicher dreinblickt, wenn er sich nähert), und ich finde, dass sie immer besorgt und hoffnungsvoll zugleich aussieht, als würde sie gern gefragt werden, was sie beunruhigt, damit sie sich eine Weile darüber auslassen kann. Ungebeten erteilt sie Ratschläge – zur Wohnung, zum Auto, zur Wahl unserer Kleidung, die Mrs. Mahon zufolge meist für das Wetter ungeeignet ist – und das mit einer Dringlichkeit, wie man sie normalerweise bei medizinischen Notfällen einsetzen würde. Sie hat kurzes weißes Haar, und wenn sie den Kopf bewegt, pendeln zwischen Kinn und Schlüsselbein weiche Hautlappen. Sie trägt gern weite Bluejeans und Sweatshirts mit Motiven, die zur Jahreszeit passen. Von Nachbarn gleich nebenan habe ich gehört, dass sie mal verheiratet war, aber falls das stimmt, weiß anscheinend niemand, was aus ihrem Mann geworden ist. Wenn ich nicht gut auf sie zu sprechen bin, stelle ich mir vor, dass er an Verdruss gestorben ist. Immer wenn Thomas sich beim Ein- oder Aussteigen mal schlecht benimmt, kann ich darauf wetten, dass Mrs. Mahon uns von ihrem Fenster aus beobachtet wie eine Schiedsrichterin ein Spiel. Hin und wieder kommt sie sogar aus dem Haus, um besser zuschauen zu können, mit verschränkten Armen und ungehaltener Miene.
Als ich mich heute vom Rücksitz aufrichte, die Einkaufstüte in der Hand, sagt Mrs. Mahon: «Es war jemand da, der zu Ihnen wollte.»
Ich runzele die Stirn.
«Wer?», sage ich.
Mrs. Mahon scheint sehr erfreut, dass ihr diese Frage gestellt wird.
«Er hat seinen Namen nicht genannt», sagt sie. «Hat nur gesagt, dass er noch mal wiederkommt.»
«Wie hat er ausgesehen?», frage ich.
«Groß», sagt Mrs. Mahon. «Dunkles Haar. Sehr attraktiv», sagt sie verschwörerisch.
Simon. Ein kleines Stechen im Unterleib. Ich sage nichts.
«Was haben Sie ihm gesagt?», frage ich.
«Dass Sie nicht zu Hause sind.»
«Hat er sonst noch was gesagt? Hat Thomas ihn gesehen?»
«Nein», sagt Mrs. Mahon. «Er hat bloß bei mir geklingelt. Er hat sich vertan. Ich glaube, er hat gedacht, Sie würden in meinem Haus wohnen.»
«Und haben Sie ihn korrigiert?», frage ich. «Haben Sie ihm gesagt, dass wir in der Wohnung oben wohnen?»
«Nein», sagt Mrs. Mahon. Sie blickt finster. «Ich kannte ihn nicht. Ich hab ihm gar nichts gesagt.»
Ich zögere. Alles in mir sträubt sich dagegen, Mrs. Mahon irgendetwas aus meinem Leben zu erzählen, aber in diesem Fall bleibt mir wohl keine andere Wahl.
«Wieso?», fragt Mrs. Mahon.
«Wenn er noch mal kommt», erwidere ich, «sagen Sie ihm doch einfach, wir sind ausgezogen. Sagen Sie ihm, wir wohnen hier nicht mehr. Irgendwas in der Art.»
Mrs. Mahon nimmt eine etwas aufrechtere Haltung ein. Vielleicht aus Stolz, einen Auftrag erteilt zu bekommen.
«Hauptsache, Sie bringen mir keinen Ärger ins Haus», sagt sie. «Ich will keinen Ärger in meinem Leben.»