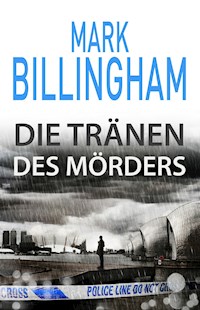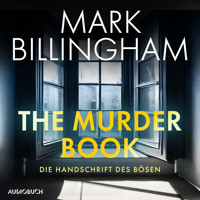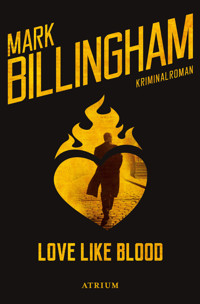
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG Zürich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller aus Großbritannien! In einem friedlichen Wohnviertel wird eine Frau in ihrem eigenen Haus mit Säure begossen und brutal ermordet. Der Polizei fehlt jede Spur. Niemand scheint einen Grund gehabt zu haben, der Lehrerin etwas anzutun. Ihre Lebensgefährtin hingegen war Polizistin, und ermittelte in einer Reihe ungelöster Fälle die alle auf organisierte Ehrenmorde hindeuteten. War sie das eigentliches Ziel der Täter? DI Tom Thorne übernimmt die Ermittlungen und betritt eine gefährliche Welt, in der Familien ihre eigenen Gesetze haben. Thorne setzt alles daran, zu verhindern, dass Eltern im Namen der Ehre zu Mördern ihrer eigenen Kinder werden – und muss erfahren, was es bedeutet, wenn Liebe zu Blut gerinnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Billingham
Love Like Blood
Roman
Aus dem Englischen von Peter Torberg
Für Claire
Und in Gedenken an Banaz Mahmod und Rahmat Sulemani
Was ist Ehre? Ein Wort. Was steckt in dem Wort Ehre? Was ist diese Ehre? Luft.
William Shakespeare, König Heinrich IV.
Sie unterbrachen ihr Gespräch abrupt, als die Frau auftauchte, auf die sie gewartet hatten.
Sie beobachteten, wie Nicola Tanners Wagen bremste und dann ein paar Häuser weiter gekonnt einparkte. Sie schauten zu, wie die Frau ausstieg und etwas aus dem Kofferraum auslud. Sie hielten den Atem an, als sie ihr Auto per Funksteuerung verschloss und sich ihrem Haus näherte. Als sie den Schein einer Straßenlaterne durchquerte, war sie für ein, zwei Sekunden deutlich zu sehen.
»Gut, sie hat Gepäck.«
»Warum ist das gut?«
»Weil sie die Hände voll hat und abgelenkt ist.«
»Gut.«
Bei den Worten war der Hauch ihres Atems zu sehen, und sie wandten ihren Blick nicht von der Frau ab, während diese ihre Umhängetasche ein wenig höher zog und vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzte, um nicht auf den feuchten Blättern auszurutschen.
»Was, glaubst du, ist in den Taschen?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Die sehen schwer aus.«
»Ist doch egal.«
Als die Frau auf den Pfad zu ihrem Haus einbog, traten sie aus dem Schatten und überquerten die Straße. Schnell, aber nicht zu schnell, das richtige Timing war wichtig. Sie hatten die Köpfe gesenkt und die Kapuzen ihrer Hoodies übergezogen, und waren darauf gefasst, einfach kehrtzumachen, falls jemand vorbeikommen würde. Ein Hundehalter beim Gassigehen oder eine neugierige Nachbarin. Sie kamen zwischen den Fahrzeugen hervor und gingen durchs Tor, als die Frau gerade ihren Haustürschlüssel ins Schloss steckte. Während sie sich vorbeugte, um ihre Taschen von der Stufe aufzuheben, rief einer von ihnen ihren Namen.
Sie hatten bereits die Wasserpistolen gezückt.
Die Frau öffnete den Mund, doch die Worte, der Schrei wurden durch den doppelten Strahl Wäschebleiche schnell erstickt. Als sie blind rückwärts ins Haus stolperte, stürzten sie sich auf sie.
Sie steckten ihre Wasserpistolen wieder ein und kickten die Taschen beiseite, um die Tür schließen zu können. Schnellhefter und Akten purzelten auf den Teppichboden im Flur, und eine Flasche Orangensaft, ein Notizbuch, ein Stift. Die beiden standen da und schauten zu, wie die Frau prustete, nach ihnen trat und Zentimeter für Zentimeter bis zum Fuß der Treppe robbte.
»Wo will sie denn hin?«
»Sie kann nirgendshin.«
Die Frau trat noch immer um sich und schob sich weiter voran, bis sie die unterste Treppenstufe erreicht hatte und sich hinzusetzen versuchte. Sie presste sich eine Hand vor das Gesicht und krallte sich mit der anderen in den Teppich. Sie stöhnte, außer sich durch das Brennen in Augen und Mund, doch der Schrei wurde von der Bleiche erstickt, die ihr die Kehle hinunterlief.
»Sie sieht aus wie ein Krebs oder so was.«
Die Frau nahm die Hand vom Gesicht, schnappte nach Luft und versuchte, die Augen aufzuschlagen. Sie blinzelte und schluchzte.
»Kann sie uns überhaupt sehen?«
»Ist doch egal.«
»Nein, mal ernsthaft, glaubst du, sie sieht uns?«
Die Frau erstarrte, als einer der beiden ein Messer zog und sich neben ihr hinkniete.
»Ja, gerade so«, antwortete er.
EINS
Wer freut sich nicht über ein unverhofftes Lächeln?
Angesichts des Ortes, an dem er sich gerade befand, dachte Tom Thorne intensiv über diese Frage nach. Im Allgemeinen wurde in einem Gerichtssaal nicht sonderlich viel gelächelt. Und wenn die Person mit dem Lächeln auch noch die war, die gerade wegen Mordes verurteilt und von der Anklagebank geführt wurde – was sie größtenteils Thorne zu verdanken hatte –, dann war das, gelinde gesagt, befremdlich.
Thorne erwiderte das Lächeln, hob zusätzlich noch zwei Finger zum Sieg und verließ dann auf schnellstem Wege den Gerichtssaal.
Der Prozess hatte es zwar auf die Titelseite des Standard geschafft und war den Nachrichtensendern vor Ort ein paar Minuten Sendezeit wert gewesen, doch vor dem Old Bailey hatten sich trotzdem nicht gerade massenweise Neugierige eingefunden. Kein Rechtsanwalt, der eine vorbereitete Stellungnahme vor einer Batterie von Mikrofonen ablas, kein Gewimmel von Kameraleuten, die um die beste Position kämpften. Keine sorgfältig gewählten Worte über Gerechtigkeit oder Leid. Nur ein paar Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, die sich die Hände schüttelten, und der Vater des Opfers, der sich mit einer jungen Frau unterhielt, die Thorne schon einmal gesehen hatte.
Er beobachtete, wie die beiden sich ungelenk umarmten, dann sah er, wie die Frau sich umdrehte und auf ihn zukam.
Sie war etwa Mitte dreißig und recht klein. Trug einen braunen schlichten Bob, der Pony sah ein wenig strähnig aus, die Frisur umrahmte ihr rundes Gesicht. Der dunkelblaue Rock und der Blazer wirkten ebenso praktisch und geschäftsmäßig wie die Frau selbst, so war zumindest Thornes erster Eindruck, aber vielleicht hatte sie ihre Garderobe auch nur dem Anlass entsprechend ausgewählt. Thorne hatte ja selbst seinen dunklen Anzug angezogen, den er nur zu Beerdigungen und Gerichtsterminen aus dem Schrank holte oder wenn er ihn zur Reinigung brachte. Als die Frau sich näherte, zupfte Thorne seine Hose in Form und ermahnte sich, den Schnellimbiss in Zukunft öfter zu meiden, wenn er weiter in diesem Aufzug vor Gericht erscheinen wollte; auf Beerdigungen zu verzichten würde ihm dagegen weniger schwerfallen.
Thorne trat von einem Bein auf das andere und wartete.
»Das ist doch gut gelaufen«, sagte die Frau, als sie schließlich vor ihm stand.
Thorne hatte sich schon darauf vorbereitet, ihre Hand zu schütteln, doch sie legte offenkundig keinen großen Wert auf Förmlichkeiten. »Dank Ihnen«, sagte er.
»Aber nur, was die Anfangsphase betrifft.«
»Sie hatten die ganze Rennerei.«
»Ja, schon …« Sie schien mit diesem Ausdruck der Anerkennung einverstanden zu sein. Sie stand da und schaute überallhin, nur nicht zu Thorne, so als wollte sie den Augenblick hinauszögern, ihm zu sagen, was sie tatsächlich beschäftigte.
»Ja, wirklich«, bekräftigte Thorne. »Ich bin doch erst kurz vor Abpfiff eingewechselt worden. Als Joker.«
»Wie ein Ersatzspieler beim Fußball?«
»Ja …«
Thorne wusste natürlich, wer Detective Inspector Nicola Tanner war, obwohl sie sich noch nie persönlich begegnet waren. An dem Tag, als sie ausgesagt hatte, war er nicht im Gericht gewesen. Sechs Monate zuvor hatte sie die Ermittlungen in dem Mordfall einer jungen Frau namens Heather Finlay geleitet und den Verdacht aufgestellt, dass der Mörder die wöchentliche Therapiegruppe besuchte, an der auch Finlay und andere ehemalige Drogensüchtige teilgenommen hatten. Als die Ermittlungen an diesem Punkt ins Stocken geraten waren, hatte man Thorne hinzugezogen, der sich der Gruppe undercover angeschlossen hatte und nach mehreren Monaten regelmäßiger Teilnahme an den Sitzungen einen Hauptverdächtigen identifizieren konnte.
Eben jene Person, die vor einer Viertelstunde wegen Mordes verurteilt worden war.
»Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?«, fragte Tanner.
Thorne war sich nicht sicher, auf wessen Initiative hin sie sich in Bewegung gesetzt hatten, doch als Tanner diese Frage stellte, ließen sie bereits das Gebäude hinter sich. Die goldene Statue der Justitia hoch über ihnen reckte ihr Schwert himmelwärts, so als wolle sie damit andeuten, dass sie bereit war, mehr als nur eine einstweilige Verfügung auszuteilen. »Ja … ich glaube schon.«
Sie folgten der Hauptstraße in Richtung Newgate Street. »Vielen Dank«, sagte Tanner.
»Kein Problem.«
Wieder gewann Thorne den Eindruck, dass Tanner auf diese Unterhaltung nicht gerade erpicht war. Das beunruhigte ihn ein wenig. Er wusste, welchen Ruf sie hatte, und er fragte sich, ob sie ihn wegen eines Verfahrensfehlers im späteren Stadium des Finlay-Falls drankriegen wollte. Oder vielleicht wollte sie auch einfach nur mit Nachdruck klarstellen, dass er mal einen neuen Anzug brauchte.
»Überhaupt sollten wir das feiern«, sagte Thorne. »Um die Ecke gibt es ein gutes Pub.« Er nickte zum Viaduct hinüber, einer ehemals noblen Ginbar am früheren Standort eines Schuldgefängnisses. Meist befanden sich für Thornes Geschmack zu viele Juristen unter den Gästen, aber es gab eine ordentliche Auswahl an Sandwiches, und das Bier war gut.
Ein paar Schritte weiter sagte Tanner: »Können wir nicht einfach einen Kaffee trinken gehen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht?«
»Na ja, ein Caffè Latte entspricht zwar nicht gerade meiner Vorstellung von Feiern, aber wenn Ihnen das lieber ist.«
»Sorry.«
»Müssen Sie noch ins Büro?«
Tanner blickte starr geradeaus. »Ich habe Sonderurlaub.«
Thorne holte Luft und sagte: »Oh. Das tut mir leid.« Er nahm an, dass es einen guten Grund dafür geben musste, Bedauern darüber auszudrücken, doch da er befürchtete, dass seine Worte im Lärm eines vorbeifahrenden Taxis untergegangen sein könnten, wiederholte er sie.
Tanner ging noch ein paar Schritte weiter und blieb dann stehen. Der Nieselregen, der sich schon den ganzen Tag lang angekündigt hatte, wurde stärker. Sie suchte in ihrer Handtasche nach einem Regenschirm. »Meine Partnerin wurde umgebracht.« Sie spannte den Schirm auf und schaute darunter hervor. »Sie ist vor zwei Wochen ermordet worden. Ich meine damit nicht eine Arbeitskollegin.«
Thorne brauchte ein, zwei Sekunden, um die beiden sehr unterschiedlichen Informationen zu verarbeiten. »Um Gottes willen …«
»Sie hieß Susan Best.« Tanner lächelte ganz leicht. »Sie war Lehrerin.«
Thorne nickte. Er hatte von dem Fall gehört; das Mordopfer, dessen Lebenspartnerin Polizistin war. Ein Mord im Polizeiumfeld, so etwas sprach sich rum, auch wenn der Name der betroffenen Polizistin nie genannt worden war. Er dachte an seine Freundin Helen und sagte erneut: »Tut mir leid.« Er wusste nicht, was er sonst hätte sagen können.
»Ich darf mich natürlich nicht an den Ermittlungen beteiligen«, sagte Tanner. »So sind nun mal die Regeln, und das ja auch aus guten Gründen.«
Thorne hatte genug über Nicola Tanner gehört, um zu wissen, dass sie für gewöhnlich großen Wert auf Regeln legte. Ein Merkmal, das sie beide nicht teilten. »Ist ganz schön schwierig für mich, gute Gründe hin oder her.«
Tanners Blick verriet deutlich, wie schwierig es für sie war. »Deshalb wollte ich mit Ihnen reden.«
»Na ja, ich habe mit den Ermittlungen auch nichts zu tun.« Thorne glaubte langsam zu erkennen, wohin der Hase lief, und achtete darauf, möglichst viel Distanz zu wahren. Er wäre wohl bereit, ein paar Telefonate zu führen und weiterzugeben, was er womöglich herausfand, aber für alles, was darüber hinausging, hatte er schon zu viel um die Ohren. »Wo ist sie getötet worden?«
»In Hammersmith. Susan ist … bei uns zu Hause ermordet worden. Ich weiß, das ist außerhalb Ihres Bezirks, aber das macht nichts, weil ohnehin nichts von alledem in den Akten auftauchen wird.«
»Nichts von alledem?«
»Ich muss die Leute finden, die sie umgebracht haben«, sagte Tanner.
»Das verstehe ich«, sagte Thorne. »Ich bin mir sicher, dass das Team, das an dem Fall arbeitet, sie auch finden wird.«
»Ich brauche Ihre Hilfe.«
»Einen Augenblick mal –«
»Sie haben sie für mich gehalten.« Tanner sah Thorne einen Augenblick lang direkt an, dann wandte sie sich ein wenig ab, um dem Regen zu entgehen, den der Wind seitlich heranwehte, oder um ihren Gesichtsausdruck zu verbergen. »Sie war mit meinem Auto unterwegs. Die haben Susan umgebracht, aber eigentlich waren sie hinter mir her.«
Jetzt war es Thorne, der den Blick abwenden musste. Ein paar Sekunden lang beobachtete er den Verkehr, der an der St Paul’s Cathedral vorbeischlich, und verfolgte den chaotischen Festzug der Regenschirme, aber er spürte den Blick in seinem Rücken, das prüfende Augenpaar der goldenen Statue, die von der Kuppel hinter ihnen heruntersah. Das gezückte Schwert bereit zum Strafgericht.
Thorne trat beiseite und legte Tanner eine Hand auf die Schulter, um sie sanft zu führen.
»Pub«, sagte er.
ZWEI
Thorne schaute von der Bar aus zu Tanner, die ruhig an einem Tisch in der Ecke auf ihn wartete. Er sah, wie sie nach ihrem Handy griff, ein paarmal über das Display wischte, und es dann wieder hinlegte. Dann beobachtete er, wie sie das Handy mit zwei Fingern an der Tischkante ausrichtete, sich dann zurücklehnte und die Hände im Schoß faltete.
Ein paar Sekunden später machte sie sich erneut ans Herumschieben des Handys.
Während Thorne versuchte, die Aufmerksamkeit des Barkeepers auf sich zu lenken, betrachtete er das überreiche viktorianische Dekor des Pubs: verschnörkelte Marmorsäulen, Spiegel in vergoldeten Rahmen und Zierglas. Schön, wenn man so etwas mochte, aber er selbst bevorzugte es schlichter. Ein Holzschild zeigte den Gästen die Regeln im alten Gefängnis, ein zweites, gleich hinter der Eingangstür, wies stolz darauf hin, dass das Pub zu den Häusern gehörte, die am heftigsten von Gespenstern heimgesucht wurden und eine beliebte Station auf Londons Geistertouren war. Thorne fragte sich, ob es sich bei den Gespenstern wohl um die Seelen jener Gäste handelte, die verstorben waren, während sie auf die Bedienung gewartet hatten.
»Schauen Sie sich mal den Hintern von der Letzten da an.«
Thorne drehte sich um und sah den Barkeeper, der auf eine Reihe von großen Gemälden an der hinteren Wand deutete. Drei in Togen gewandete Frauengestalten – Jungfrauen, nahm Thorne an – in unterschiedlichen schwermütigen Posen. Dazu die Darstellung einer Weizengarbe …
»Landwirtschaft, Handel und Künste«, sagte der Barkeeper. »Eine Allegorie oder wie das heißt. Die Letzte hat allerdings ein ziemlich übles Loch im Hinterteil … sehen Sie?«
Thorne reckte höflich den Hals, sah aber nichts.
»Ein Soldat im Ersten Weltkrieg hat drauf geschossen oder sein Bajonett reingebohrt oder so was.«
»Kritisieren ist immer leicht, was«, meinte Thorne.
Er brachte ein Glas Glenfiddich und ein Pint Guinness an den Tisch. Thorne hob sein Glas, Tanner tat es ihm gleich, und ein, zwei Sekunden lang sahen sie sich verlegen an. Feierten sie hier ihren Sieg vor Gericht oder erhoben sie das Glas auf Tanners ermordete Freundin?
»Also gut.« Thorne blickte in sein Bier und führte das Glas dann zum Mund.
Tanner stürzte ihren Whiskey zur Hälfte hinunter und begann zu erzählen. Obwohl sie auf dem kurzen Weg zum Pub kein Wort mehr über ihre tote Partnerin verloren hatten, war es so, als würde sie den Faden nach einer kurzen Unterbrechung wiederaufnehmen. So, als hätte Thorne sie gebeten fortzufahren.
»Nach dem Finlay-Fall habe ich eine Weile beim Dezernat für Ehrverbrechen gearbeitet«, erklärte sie. »Nichts Besonderes.« Sie schwieg ein paar Sekunden. »Ein paar ungelöste Mordfälle. Einige wirkten wie Ehrenmorde, aber das konnte keiner beweisen.«
»Wie viele Ehrenmorde gibt es denn so?«
»Erheblich mehr, als die offiziellen Zahlen vorgeben, aber das kommt ganz darauf an, von welcher Art Ehrenmord wir hier reden.« Tanner griff nach einem Bierdeckel und stellte ihr Glas darauf ab. »Manche Täter strengen sich ungeheuer an, einen eindeutigen Ehrenmord zu kaschieren, damit es nach einem Sexualdelikt, einem zufälligen Verbrechen oder einem Selbstmord aussieht. Manchmal verschwindet das Opfer einfach, fliegt angeblich zur Hochzeit ins Ausland und kehrt nie wieder zurück. Und ich bin auch auf ein paar Fälle gestoßen, die ganz verdächtig nach getürkten Autounfällen aussehen.«
Thorne nickte. Bislang war er solchen Fällen noch nicht allzu häufig begegnet, aber sie waren ihm bekannt. »Und die übrigen?«
Tanner lächelte leise. »Ich wusste, Sie würden die richtigen Fragen stellen.«
Thorne nahm einen Schluck Guinness und dachte: Oder die falschen. Aus der Nähe konnte er erkennen, dass sich in Tanners Haar mehr graue Strähnen fanden, als er bislang bemerkt hatte; dass ihr zurückhaltendes Make-up die tiefen Falten um den Mund nicht verbergen konnte, ebenso wenig wie ihre dunklen Augenringe.
Ein Gesicht, gezeichnet von vierzehn Tagen voller Tränen und zu wenig Schlaf.
Tanner lächelte und beugte sich vor. Es war offensichtlich, dass die Antwort auf Thornes Frage der Grund dafür war, warum sie hier zusammensaßen. »Nun, das Problem mit den Ehrenmorden … für die, die sie begehen, meine ich … besteht darin, dass jeder Polizist, der auch nur ein wenig Grips hat, sofort weiß, nach wem er suchen muss. Meistens ist es der Vater oder der Bruder, der Onkel oder sonst irgendein Verwandter. Natürlich haben wir es dabei mit unzähligen Lügen und Vertuschungen zu tun, aber am Ende landen wir doch immer an dieser Stelle. Kein eindeutiger Fall, aber schon ziemlich nahe dran.«
»Aber es sind nicht immer nur Männer, richtig?«
»Nein, das nicht, aber in neun von zehn Fällen steckt ein Verwandter dahinter.«
»Lassen Sie mich raten: Sie interessieren sich für den einen Fall von zehn.«
Tanners Gesichtsausdruck sagte alles. »Sehen Sie, an den Taten dieser Menschen ist nichts Ehrenwertes. Gar nichts. Es sind schlicht und einfach Morde, die vorgeben, etwas anderes zu sein, doch manche der Verantwortlichen nehmen zumindest hin, dass sie dafür ins Gefängnis gehen. Die Strafe gehört auf irgendeine schräge Art und Weise auch dazu. Für manche von ihnen ist es völlig in Ordnung, ihre Schwester oder Tochter zu erdrosseln, anschließend aufs nächstgelegene Polizeirevier zu spazieren und sich Handschellen anlegen zu lassen.«
»Ehrenmänner«, meinte Thorne; das Bier schmeckte längst nicht mehr so gut wie noch kurz zuvor.
»Andere sind noch erbärmlicher, wenn das überhaupt möglich ist. Sie wollen nicht erwischt werden, also bezahlen sie andere dafür, sich zu stellen.«
Thorne zuckte mit den Schultern. »Ergibt Sinn. Jedenfalls wenn man zu diesen Mistkerlen gehört, die davon ausgehen, dass ihr eigen Fleisch und Blut es verdient hat zu sterben, nur weil es einen Rock trägt, mit dem sie nicht einverstanden sind.«
»Richtig. Vielleicht kann man es auch nicht riskieren, ins Gefängnis zu wandern, weil man eine bedeutende Person ist. Man hat ein Unternehmen zu leiten und eine Familie zu ernähren. Man ist wichtig.« Tanner nahm noch einen Schluck, langsam kam sie auf den Geschmack. »Vor Susans Tod hatte ich den Eindruck, auf mehrere Fälle gestoßen zu sein, bei denen es genau darum ging. Die Vorgehensweisen unterschieden sich, und die Tatorte auch, aber ich bin mir sicher, dass die Mörder in diesen Fällen von der Familie des Opfers bezahlt wurden.«
»Auftragskiller.«
»Wenn Sie so wollen. Zwei, genauer gesagt. Ich glaube, dass dieses Duo auf der ganzen Welt bezahlte Ehrenmorde begeht. In Pakistan, in der Türkei, in Syrien. Wie gesagt, unterschieden sich die Morde, von denen ich hier rede, leicht voneinander, doch in allen Fällen war von zwei Männern die Rede. Zwei Männer in einem Auto vor dem Haus, zwei Männer, die das College des Opfers beobachteten. Zwei Männer, die sich am Tatort herumtrieben. Ich habe ein paar Personenbeschreibungen und ein ziemlich gutes digitales Fahndungsfoto.«
»Und damit sind Sie zu Ihren Vorgesetzten gegangen, richtig?«
»Natürlich.«
»Und …«
»Nicht dass die Oberen kein Interesse daran gezeigt hätten, aber meine Recherchen haben ziemliche Unruhe ausgelöst. Sprecher der verschiedenen Gemeinden sind auf die Barrikaden gegangen, es gab Beschwerden. E-Mails sind zwischen den verschiedenen Chief Constables hin- und hergeschossen. Im gegenwärtigen politischen Klima ist so etwas ein heißes Eisen, schätze ich. Ich versteh schon, warum sie … vorsichtig sind.«
»Man will ja niemandem auf die Füße treten.«
»Ja, was für ein Scheiß.«
Thorne war erstaunt, Tanner so fluchen zu hören, doch es zeigte ihm, wie leidenschaftlich und wütend sie war. »Sehe ich auch so«, sagte er. »Um ehrlich zu sein, trete ich anderen ganz gern auf die Füße.«
»Das ist einer der Gründe, warum ich mit Ihnen reden wollte.«
Thorne lächelte, wollte aber auch gern erfahren, welche Gründe es sonst noch gab.
»Ehrlich gesagt, glaube ich, dass mein Sonderurlaub allen ganz gut in den Kram passt. Aber ich weiß, dass ich recht habe mit meinen Vermutungen, also werde ich den Teufel tun und einfach aufgeben.«
Thorne wartete ab.
»Ich bin mir sicher, dass diese zwei Männer auch Susan umgebracht haben.« Tanners Stimme klang tiefer und ein wenig brüchig. »Ich glaube, dass ich ihren Auftraggebern so langsam lästig wurde und sie deshalb alle zusammengelegt haben, um mich aus dem Weg zu räumen. Da haben sie einen Fehler gemacht.«
Thorne sah den Ausdruck auf Tanners Gesicht, offenkundig hatten die Männer, von denen sie sprach, mehr als nur einen Fehler begangen. »Und warum kommen Sie mit dieser Angelegenheit zu mir?«
»Weil Sie im Finlay-Fall so Großartiges geleistet haben und weil einer der Fälle, die ich mir angeschaut habe, Ihrer war.«
Thorne stellte sein Glas ab.
»Meena Athwal.«
Thorne erinnerte sich an den Fall, weil der Mord nie aufgeklärt worden war. Einige Fälle konnte er nur schwer vergessen; ungelöste Verbrechen, und einige Killer, die er tatsächlich geschnappt hatte. Die besonderen Typen.
»Sie wurde vor vier Jahren vergewaltigt und erdrosselt.«
»Ich weiß.« Die Worte blieben Thorne im Halse stecken. Meena Athwal war Studentin gewesen. Klug und ehrgeizig, sie wollte auf eigenen Füßen stehen. »Natürlich haben wir auch an einen Ehrenmord gedacht. Wir haben ein paar Spezialisten hinzugezogen, sind aber nicht weitergekommen.«
»Natürlich nicht«, sagte Tanner. »Alle Verdächtigen hatten wasserdichte Alibis. Vater, Brüder, alle. Schon komisch.«
Thorne versuchte, sich an die Details zu erinnern; Zeugenaussagen, Befragungen der Nachbarschaft. Hatte es damals irgendwelche Hinweise auf die zwei Männer gegeben, von denen Tanner eben gesprochen hatte?
»Also, was genau kann ich tun?«, fragte er.
»Das weiß ich noch nicht. Ich wollte nur mal sehen, was Sie von allem halten, mehr nicht. Wohin Sie … tendieren.«
Thorne tendierte in diesem Augenblick dazu, so schnell wie möglich noch ein Pint hinunterzustürzen.
»Ach, übrigens, wie sind Sie überhaupt darauf gekommen?«, fragte Tanner.
»Worauf?«
»Bei dieser Therapiegruppe. Wie sind Sie auf den Täter gekommen?«
»Ein Lächeln«, antwortete Thorne. »So ein ganz bestimmtes, wissendes Lächeln. Sie hat gemerkt, dass ich mich für jemand anderen ausgab, und ich wusste sofort, dass sie das nur erkannt hatte, weil sie selber etwas vortäuschte.«
»Und heute haben Sie noch eins bekommen«, sagte Tanner. »Ein Lächeln.« Sie stand auf und schnappte sich ihre Handtasche. »Dasselbe noch mal?«
»Gern.« Thorne sah zu, wie Tanner zur Bar ging, eine Hand hob und sofort die Aufmerksamkeit des Barkeepers auf sich zog. Auf Thorne wirkte sie wie eine Frau, die bekam, was sie wollte.
Wohin Sie tendieren.
Als wenn sie nicht genau wüsste, wohin er tendierte …
Thorne leerte sein erstes Pint und riss die Ecken seines Papieruntersetzers ab. Er hatte jetzt schon das Gefühl, dass das Lächeln eines Mörders sich als der Höhepunkt des Tages erweisen könnte.
DREI
Kaum hatte Amaya Shah die Glastüren des Barnet College aufgedrückt und war in die frische Luft hinausgetreten, knöpfte sie ihren Mantel zu und sah sich um. Passanten eilten an ihr vorbei die Betonstufen hinauf, die meisten in Richtung Ye Olde Mitre Inne oder zu der billigen Pizzeria auf der anderen Straßenseite, ein paar andere zum Einkaufszentrum. Viele versammelten sich in kleinen Gruppen vor den Türen, unterhielten sich, rauchten, machten Pläne für den restlichen Tag. Andere drängten sich schon an der Bushaltestelle. Amaya erkannte viele Gesichter – Studierende, Mitarbeiter –, doch keines, das sie beunruhigte. Zur Sicherheit sah sie sich noch einmal um, wie immer.
Dann streckte sie die Hand aus und nahm ihren Hidschāb ab.
Während sie das blaue Kopftuch sorgfältig in ihrer Schultertasche verstaute, blickte sie auf und sah Kamal auf sich zukommen. Er winkte und warf ihr dieses schiefe Grinsen zu, das sie so an ihm mochte.
Sie blickte sich noch einmal um. Sie würden sich nicht berühren, nicht umarmen, bis sie an einem Ort waren, an dem sich beide sicher fühlten, doch die Vorsicht war ihnen zur zweiten Natur geworden.
Er nickte in Richtung ihrer Tasche. »Ich dachte, den trägst du hier nicht.«
»Tu ich auch nicht«, sagte Amaya. »Ich wollte nur sicherstellen, dass ich ihn aufhabe, wenn ich aus dem College komme, mehr nicht. Mein Bruder hat hier mal auf mich gewartet.«
»Und er hat sich nicht gerade darüber gefreut.«
»Was glaubst du denn?«
»Du setzt ihn also auf und nimmst ihn dann gleich wieder ab?«
»Genau. So wie du ja wohl kaum das Hemd da angehabt hast, als du zu Hause losgegangen bist.«
Kamal fuhr sich mit den Fingern über den glänzenden Stoff des zweifarbigen Hemds, das über seiner muskulösen Brust spannte, rot und goldfarben wie ein Sonnenuntergang. »Gefällt es dir?«
Amaya nickte. »Und was hast du in der Tasche? Einen netten, braven Pullover vielleicht? Den blöden mit den vielen Streifen?«
»Mein Arsenal-Trikot.« Wieder grinste er schief. »Wonach ist dir denn jetzt?«
Sie dachte kurz nach und nickte dann zur anderen Straßenseite hinüber. »Pancakes.« Sie grinste und zog sich zum Schutz vor dem Nieselregen die Kapuze ihres Anoraks über. »Mit Schokosoße …«
Amaya bestellte genau das, was sie bereits angekündigt hatte. Kamal entschied sich für eine Bananen-Toffee-Waffel mit Eis. Sie tranken Genmaicha und Vanille-Milchshakes. Von ihrem kleinen Tisch am Fenster aus hatten sie einen guten Blick auf die Straße, die parkenden Autos und die Passanten.
»Hast du meine SMS gekriegt?«, fragte Kamal.
Amaya nickte und aß weiter.
»Also, machen wir das jetzt oder nicht?«
Sie sah ihn an. Seine makellosen Zähne und die schöne Haut. Kamal hatte schnell aufgegessen und saß nun da und starrte sie an, seine schlanken Finger trommelten auf der Tischplatte, und er summte regelrecht vor Energie. Seine Stärke hatte sie beide so weit gebracht, und dafür war sie sehr dankbar; daran konnte sie sich festhalten, davon zehren, aber seine Aufregung machte sie auch nervös. Wie konnte er nur so zuversichtlich sein? Warum wollte er nie darüber sprechen, was passieren könnte, wenn sich die Dinge nicht so entwickelten, wie sie es sich wünschten?
»Ich bin mir mit dem Weglaufen nicht so ganz sicher«, sagte sie.
»Das machen wir doch nur, wenn wir es wirklich müssen.«
»Aber du weißt schon, dass ich das nicht wirklich möchte.«
»Natürlich nicht, aber vielleicht haben wir keine andere Wahl.«
Wieder nickte Amaya, doch trotz allem kämpfte sie immer noch dagegen an, zu glauben, dass es jemals wirklich so weit kommen sollte. Die Brüllerei und … Schlimmeres. Wann immer sie an ihre Mutter dachte, sah sie das strahlende Lächeln vor sich, spürte die weichen Arme um sich, konnte sich den Duft der Gewürze vorstellen, der an ihren Kleidern, in ihren Haaren hing; Garam Masala, Kardamom und Kreuzkümmel. Ihr Vater war anders, sicher, aber Amaya wollte weiter daran glauben, dass er sie über alles liebte, dass sein Wunsch, sie glücklich zu sehen, am Ende alles andere in den Hintergrund drängen würde. Sie konnte all das nachvollziehen, was er gegenüber seinen Freunden, seiner Frau, seinen Söhnen sagen musste, wusste, welchen Eindruck es vor all den anderen wichtigen Männern aufrechtzuerhalten galt.
Sie verstand, wie wichtig ein guter Ruf war.
Doch letzten Endes war er immer noch ihr Vater.
»Wir müssen es ihnen gleichzeitig sagen«, meinte Kamal. »Unseren Eltern. Das weißt du doch noch, oder?«
»Ja, natürlich.«
Amaya wandte ihren Blick ab und zog das letzte Stück Pancake durch einen Fleck Schokosauce. Ihre Ma war bestimmt schon dabei, das Abendessen zu machen; sicher beugte sie sich gerade über Töpfe und Pfannen oder hackte, hackte, hackte …
»Was ist los?« Kamal lehnte sich vor und berührte Amayas Hand für einen kurzen Augenblick. »Du hast ihnen doch noch nichts gesagt?«
»Ihnen nicht.«
»Wem dann?« Plötzlich hörte sich Kamal nicht mehr so selbstsicher an. Er war nervös, Angst mischte sich in sein Flüstern.
»Einer Freundin vom College.« Amaya sah ihn an. »Ist schon in Ordnung, eine Weiße. Sie wird kein Wort sagen.«
»Niemandem sonst? Sag es mir …«
Amaya wusste, dass sie bei der Wahrheit bleiben musste. Wenn sie jemals in die Tat umsetzten, was sie vorhatten, dann musste Ehrlichkeit zwischen ihnen herrschen, und davon abgesehen, war Kamal die letzte Person auf Erden, die sie jemals belügen würde.
»Mein Bruder nimmt manchmal mein Handy.«
»Und? Er kennt doch deine PIN nicht, oder?«
»Er hat mich dazu gezwungen, sie ihm zu sagen.« Amaya schloss die Augen. Sie wollte sich nicht daran erinnern, wie er es getan hatte. »Er meinte, ich dürfte keine Geheimnisse vor der Familie haben, und wenn ich nichts zu verbergen hätte, müsste ich mir ja keine Sorgen machen.«
»Ich hab’s dir doch gesagt«, meinte Kamal. »Ich hab dir gesagt, du sollst meine Nachrichten löschen.«
»Hab ich doch«, zischte Amaya ihn über den Tisch hinweg an. »Ich bin ja nicht blöd. Nur … vielleicht hat er was gesehen, bevor ich es löschen konnte. Ich sag nur: vielleicht.«
Kamal schaute ernst, aber nur kurz, dann zuckte er mit den Schultern, und sein Lächeln kehrte zurück, das Lächeln, das nie lange verschwand. »Na, ein Grund mehr, es unseren Alten so bald wie möglich zu sagen, oder?«
»Vielleicht«, meinte Amaya.
Sie schwiegen eine Weile, schauten auf ihre Handys und warfen alle paar Sekunden prüfende Blicke auf die Straße. Der Regen schlängelte sich die Scheibe hinunter, und draußen wurde es dunkel.
»Und was ist mit der Party?« Kamal streckte die Hände aus. »Wenn du dieses Hemd schon toll findest, dann warte mal ab, was ich mir für heute Abend besorgt habe.«
»Ist das schon heute?«
»Komm schon, Amee.« Er knurrte vor gespielter Empörung. »Das habe ich dir letzte Woche in einer SMS geschrieben.«
Amaya sah ihn mit aufgerissenen Augen an. »Ich hab die Nachricht gelöscht, so, wie du es mir gesagt hast, du Genie«, sagte sie sarkastisch.
»Aber du kommst doch mit, ja?«
»Das ist echt spät. Ich müsste nach dem Abendessen noch raus.«
»Es ist eine Party. Hör mal, ich kann das Konto meines Vaters angeben und uns einen Wagen über Uber bestellen.«
Amaya dachte darüber nach. »Na, jemand muss ja auf dich aufpassen, schätze ich. Damit du nicht wieder in Schwierigkeiten gerätst.«
»Ha, wie witzig.«
»Ich kann ihnen ja sagen, dass ich zum Lernen zu Sarah gehe. Das ist die Kommilitonin, von der ich dir erzählt habe.«
»Na also.«
»Die werden ihre Nummer haben wollen, aber das ist kein Problem. Ich hab ihr oft genug meine Notizen gegeben, sie wird mich schon decken, wenn ich sie darum bitte.«
»Und pack dir richtige Partysachen ein. Nichts von deinem Billigplunder, okay? Ich will nicht, dass du mich blamierst.«
Amaya grinste und streckte ihm die Zunge heraus. Sie wusste schon, was sie anziehen wollte, sah das silberne Top vor sich, das sie letzte Woche bei River Island gekauft und nach Hause geschmuggelt hatte. Es steckte hinten in ihrem Schrank in einem alten Koffer, wo ihr Bruder es niemals finden würde.
Kamal streckte die Hand aus und zog ihr den Teller weg. Er nahm die Gabel. »Und wenn du deine tolle Figur behalten willst, dann solltest du mich das besser aufessen lassen.«
VIER
Bei dem Lärm aus dem Nebenzimmer und dem farbenfrohen Chaos aus Spielsachen zu seinen Füßen war es schwer, einen klaren Gedanken zu fassen und den Kopf frei zu bekommen. Dies war einer der Momente, in denen sich Thorne wünschte, wieder allein zu sein, zurück in seiner Wohnung auf der Sonnenseite des Flusses. Im Augenblick war die Wohnung allerdings an zwei junge Streifenbeamte vom Revier vor Ort untervermietet. Die Wohnung seiner Freundin lag südlich von Brixton und war zwar auch nicht größer als seine eigene, aber im Augenblick sprach einiges für die gegenwärtige Wohnsituation, trotz der täglichen Fahrt zu seinem Büro in Colindale und zurück. Die Wohnung lag in der Nähe von Helens Arbeit in Streatham. Helens Sohn Alfie ging in einen Kindergarten im selben Stadtteil, und die Notfall-Kinderbetreuung in Form von Helens nützlicher, wenn auch nerviger Schwester Jenny war nicht weit weg.
Jetzt war also einer dieser seltenen Momente.
Wenn man ihn dazu drängte, würde Thorne sogar zugeben, dass er es an den meisten Tagen merkwürdig beruhigend fand, nach der Arbeit hierherzukommen. Eine willkommene Ablenkung. Lärm und Chaos und ein aufgedrehter Dreijähriger, der sich immer freute, ihn zu sehen.
Das machte es leicht, die Morde mal für ein paar Stunden zu vergessen.
Leichter zumindest …
Helen tauchte im schmalen Flur auf, der zu den Schlafzimmern führte. Sie musste gar nicht erst erwähnen, dass sie nach einem Arbeitstag und ein paar Stunden mit ihrem Sohn – Essen, Baden, Zubettbringen – völlig erledigt war.
Sie seufzte und sagte: »Hoffen wir das Beste.«
»Mal wieder Der kleine Bär?«
Sie schloss die Augen und schüttelte den Kopf. »Heute nur dreimal hintereinander. Bei jedem Lesen dichte ich was Neues dazu, damit ich nicht einschlafe. Am liebsten würde ich ihn beim nächsten Mal abmurksen lassen.«
»Dann mal los«, sagte Thorne. »Kapitel 26. Die Bärenfalle.«
Helen lächelte und ging auf ihn zu, kickte mit der Spitze ihrer Sneakers einen Quietsche-Dino beiseite und ließ sich neben Thorne aufs Sofa plumpsen. Sie griff hinter sich, grub einen halben Plastikjeep unter einem der Sofakissen aus und pfefferte ihn auf den Teppich.
»Soll ich die Nudeln warm machen?«
»Gleich«, sagte Helen. Sie drehte sich um und sah ihn flehend an. »Brauche. Dringend. Wein.«
Thorne wuchtete sich hoch und holte den Weißwein aus dem Kühlschrank. Da er schon mal davorstand, nahm er sich auch noch eine Dose Bier heraus, obwohl das Guinness von der Mittagszeit noch nachwirkte. Er konnte seinen Freund Phil Hendricks förmlich sagen hören, was für eine Lusche aus ihm geworden sei und wie die Jahre wohl langsam ihre Spuren an ihm hinterlassen hätten. Und wahrscheinlich hätte sich Thorne nicht mal damit aufgehalten, etwas dagegenzuhalten. Vor ein paar Monaten hatte er zur Mittagszeit ein unbeschwertes Treffen mit einem V-Mann gehabt und sich fest vorgenommen, hinterher wieder ins Büro zu gehen. Mit vier Pints zu viel war er an einem schwülen Nachmittag in der U-Bahn eingedöst und erst in Edgware wieder aufgewacht.
Thorne brachte jetzt die Drinks zum Sofa und setzte sich wieder.
»Ein guter Erfolg heute«, sagte Helen.
Thorne nickte. »Passiert selten genug.« Kaum war das Urteil verkündet worden, hatte er Helen eine SMS geschickt, doch bis jetzt hatten sie noch keine Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Als Thorne nach Hause gekommen war, war sie bereits mit Alfie beschäftigt gewesen.
»Du warst in der ganzen Zeit ein bisschen … komisch.« Helen nahm einen Schluck Wein. »Als du immer bei diesen Therapiesitzungen warst.«
Thorne drehte sich zu ihr hin. »Was meinst du mit komisch?«
»Keine Ahnung … du hast dich scheinbar richtig in die Rolle hineingesteigert. Wie Robert De Niro oder so.«
»Ach, komm schon.«
»Ich schwöre es. Na ja, nicht gerade so, dass ich nach deinem geheimen Kokslager gesucht hätte, aber diese Zeit hat mir eine ziemlich gute Vorstellung davon vermittelt, wie es wohl sein muss, mit einem Junkie zusammenzuleben.« Sie lächelte. »Ständig hatte ich den Eindruck, du würdest mich anlügen. Mehr als üblich zumindest.«
»Mehr als üblich?«
»Du weißt schon, Alltagskram. Da lügen wir doch beide, oder? Tut doch jeder. Ich hab zum Beispiel gerade bei Alfies Gute-Nacht-Geschichte gelogen. Die habe ich nur zweimal vorgelesen, aber dreimal hörte sich besser an. Ach, ich meine nichts Wichtiges. Ich rede nur dummes Zeug.«
Thorne dachte ein paar Sekunden darüber nach. Er hob seine Bierdose, trank aber nicht. »Ich fand mich nicht komisch.«
Helen lachte. »Und Süchtige glauben nicht, dass sie süchtig sind, oder?« Sie nahm einen weiteren Schluck. »Ich will nur sagen … es war schwierig, mit dir zusammenzuleben, das ist alles.« Sie hielt inne und setzte zum perfekten Tiefschlag an. »Etwas schwieriger als sonst …«
»O Mann.«
»Was denn?«
»Als ob es so einfach wäre, mit dir zusammenzuleben.«
Helen setzte eine Unschuldsmiene auf. »Hab ich ja auch nie behauptet.«
Tatsächlich war die Stimmung zwischen ihnen seit den Ereignissen vor neun Monaten in Helens Heimatstadt Polesford etwas angespannt. Der Fall, an dem sie dort gearbeitet hatten, war schockierend genug gewesen, hatte aber außerdem noch zu einer privaten Enthüllung geführt, mit der zu leben sie sich noch immer abmühten. Ein Geheimnis, das noch dunkler geworden zu sein schien, seit sie es teilten.
»Hat sich aber gelohnt«, sagte Helen. »Das Komische.« Sie hatte offenbar immer noch Spaß daran, ihn aufzuziehen. »Wegen heute, meine ich. Wie du schon sagtest, das geht nicht immer so erfolgreich aus, oder?«
Thorne nickte. Bei einem Prozess ein paar Monate zuvor hatte ein Medizinexperte Beweise dafür vorgelegt, dass der Angeklagte während der Befragung ein halbes Promille mehr Alkohol im Blut hatte, als die Promillegrenze erlaubte, und daher nicht in einem befragungsfähigen Zustand gewesen war. Thorne konnte nur ohnmächtig zuschauen, wie die solide Aufklärung eines Mordfalls schneller zerlegt wurde als die Ambitionen von Arsenal London um den Meistertitel.
»Und gab’s hinterher ein ordentliches Besäufnis?«
Helen hatte sofort gerochen, dass er Bier getrunken hatte.
»Nicht übel, ja«, sagte Thorne. »Haben uns gegenseitig auf die Schulter geklopft. Die Anwälte haben ihre Gläser auf Heather Finlay erhoben und über Autos und Ferienhäuser gequatscht. Das Übliche.«
»Mannomann.«
»Was denn?«
»Du freust dich aber schon, dass du gewonnen hast, oder?«
Thorne schaute sie an.
»Und wann willst du das deinem Gesichtsausdruck mitteilen?« Helen trank ihren Wein aus und stand auf. »Ihr Mordermittler müsst echt noch lernen, wie man feiert.«
Thorne lächelte und sah zu, wie Helen zum Kühlschrank ging und sich nachschenkte. Sie fragte, ob er noch ein Bier wolle, doch er winkte ab und meinte, dass er mittags schon genug getrunken habe.
Noch immer spürte er das Guinness auf der Zunge prickeln.
Thorne fiel kein guter Grund ein, warum er das Treffen mit Nicola Tanner erwähnen sollte. Die Chancen standen gut, dass ohnehin nichts aus der Sache wurde. Außerdem sprachen Helen und er generell selten über die Arbeit, wenn es sich vermeiden ließ. Er war bei der Mordkommission, sie Polizeibeamtin im Dezernat für Kindesmisshandlungen. Über die Kollegen redete man vielleicht noch, aber nicht über die Arbeit. Ab und zu verlangte die Situation danach, ein wenig Dampf abzulassen, oder die Geschichten waren viel zu witzig oder skurril, um sie nicht zu erzählen, doch ansonsten waren sie stillschweigend übereingekommen, die Arbeit spätestens an der Wohnungstür hinter sich zu lassen.
Das bedeutete natürlich nicht, dass sie ihnen nicht doch in den Köpfen herumspukte, eine dunkle elektrische Spannung, die sich zwischen ihnen auflud, doch das war kein Stoff für leichte Gespräche.
»Ich glaube, ich kümmere mich mal um die Nudeln«, sagte Helen und nahm die Schüssel mit den Resten aus dem Kühlschrank.
»Nein …« Thorne wollte aufstehen, doch Helen beugte sich schon zum Kühlschrank hinunter.
»Du lässt doch sowieso jedes Mal die Pfanne anbrennen«, sagte sie.
Thorne lehnte sich zurück und versuchte, sich wieder zu konzentrieren.
Wir haben ein paar Spezialisten hinzugezogen, sind aber nicht weitergekommen.
Obwohl er wegen des Gerichtstermins freigestellt worden war, war Thorne aufs Revier zurückgefahren, kaum dass Tanner und er sich verabschiedet hatten. Im Becke House waren ein paar Kollegen auf ihn zugekommen, um ihm zum Gerichtsurteil zu gratulieren und ihn auf noch mehr Drinks nach Dienstschluss einzuladen, doch Thorne hatte sich entschuldigt und war bei der ersten sich bietenden Gelegenheit verschwunden. Er hatte sich an einen Computer in einer ruhigen Ecke gesetzt und war noch einmal die Akten zum Fall Meena Athwal durchgegangen: alle Aussagen, sämtliche Aufnahmen der Überwachungskameras, jedes einzelne Detail, das vor vier Jahren zu einem Beweisstück hätte werden können, wenn die Ermittlungen jemals richtig in Gang gekommen wären.
Es hatte nicht lange gedauert, das zu finden, wonach er gesucht hatte.
Eine von Meenas Freundinnen hatte einem Polizisten berichtet, dass Meena glaubte, verfolgt zu werden. Sie hatte von zwei Männern gesprochen. Die Aussage war aufgenommen, später aber verworfen worden, nachdem man entschieden hatte, dass Meena Opfer eines zufälligen Überfalls geworden sein musste. Schließlich arbeiteten Vergewaltiger selten in Teams.
Hatten sie bei den Ermittlungen also völlig falschgelegen?
Könnte es sich hier um dieselben zwei Männer handeln, von denen Tanner gesprochen hatte?
Helen sagte etwas, und als Thorne aufschaute, registrierte er aus dem Augenwinkel links eine Bewegung und sah Alfie in der Tür stehen. Mit einem Fuß auf dem anderen bot er das perfekte Bild lang eingeübten Kummers und Elends.
»Hallo, Kumpel. Alles okay?«
Alfie schüttelte den Kopf und sah zu Boden; der beste Trickbetrüger, den Thorne je gesehen hatte.
Helen drehte sich um und nahm die Pfanne vom Herd. Sie seufzte, sah Thorne an und verdrehte die Augen. »Na, komm …«
Alfie lächelte, als Helen zu ihm kam, seine Hand nahm und ihn zurück in Richtung Bett führte.
Ein paar Sekunden später hörte Thorne den vertrauten Singsang von Helens Stimme aus Alfies Zimmer. Ätzender kleiner Bär …
Thorne streckte die Hand aus und hob ein Spielzeug vom Boden auf, einen Miniatur-Basketballkorb an einem Plastikgriff, der Ball baumelte am Ende einer Kordel. Er beschloss, sich damit ein wenig abzulenken.
Er schnickte gegen den Ball und verfehlte den Korb.
Dann stellte er die Bierdose ab und versuchte es erneut.
Nicola Tanner saß auf der Hälfte der Treppe und blickte in die fleckenlose hellbeige Leere des Teppichbodens im Eingangsbereich hinunter. Der hübsche neue Bodenbelag, dessen Geruch sie auch noch nach zwei Wochen wie eine Ohrfeige getroffen hatte, als sie vor einer halben Stunde zur Haustür hereingekommen war.
Sie hatte keine andere Wahl gehabt.
Blut, Schmutz … Durcheinander. Natürlich musste der Fleck beseitigt werden, trotzdem war es ihr so vorgekommen, als würde sie auch noch das letzte bisschen von Susan ausradieren. Den letzten Rest von ihr, der noch real gewesen war. Natürlich gab es da noch … Dinge, wie Kleidung und Bücher, aber den Gang zum Secondhandladen schob sie weiter vor sich her. Es kam ihr falsch vor, den Pappkarton einfach abzustellen und sich umzudrehen, so, als würde es sich bei dem Inhalt um nichts als unerwünschten Krempel ohne jede Bedeutung handeln.
Sie zog den Mantel fester um sich und dachte an ihr Treffen mit Tom Thorne zurück. Er war nett gewesen, was sie überrascht hatte, angesichts dessen, was sie über diesen Mann gehört hatte, aber sie war sich nicht sicher, ob er wirklich Interesse hatte.
Warum sollte er auch?
Sie konnte diesen Fall aber doch nicht alleine aufklären, oder? Man hatte ihr den Dienstausweis zwar nicht entzogen, aber Sonderurlaub bedeutete eben nun mal Urlaub. Doch würde nicht jeder Polizist, ob nun beurlaubt oder nicht, einer Sache nachgehen, wenn er keine andere Wahl hatte? Kein Polizist, der den Titel verdiente, würde bei Verdacht auf ein Verbrechen tatenlos danebenstehen und nichts tun.
Doch das war gegen die Regeln, egal, wie man es drehte und wendete, und Nicola hatte noch nie gegen die Regeln verstoßen. Sie hatte sogar eine besondere Art von Verachtung für jene, die Regeln missachteten. Nein, die Sache war ganz einfach: Sie brauchte Hilfe. Sie brauchte eine rechtliche Absicherung, wenn sie weitermachen und wieder einen Stein nach dem anderen umdrehen wollte.
Sie sah zu Boden, fühlte sich leer, ausgeweint für heute. Sie war immer noch wütend auf sich selbst, weil sie die Beherrschung verloren hatte, doch als sie weinend im Pub gesessen hatte, war ihr bewusst geworden, dass ihre Tränen ihr vielleicht nützlich sein könnten. Thorne war offenkundig keine Mimose, aber sie hatte schon ganz andere kennengelernt, die einer rührseligen Geschichte nicht widerstehen konnten.
So viel Blut.
An unförmige Flügel hatte sie gedacht, oder an deren rostrote Überreste, als Nicola am Abend die Haustür aufgeschlossen und Susans Leiche vorgefunden hatte. Das Blut war in den Boden eingesickert, dazu zahllose weiße Flecken, die überall verteilt waren und von Bleiche stammten, wie man ihr später mitteilte. War es zu viel, zu hoffen, dass Susan schon blind gewesen war, als sie ihr Leben auslöschten, so viel Leben? Dass sie nicht hatte sehen können, wer sie umbrachte?
Himmel, worüber dachte sie da nach? Das war doch nicht wichtig. Susan war tot, und das alles nur, weil man sie für Nicola gehalten hatten. Susans eigener Wagen war an jenem Tag in der Werkstatt gewesen …
Hellbeige.
Wie traurig, wie unfassbar bescheuert war das denn?
Nicola hatte die Arme um ihre Knie geschlungen und spürte, wie sich ein Lächeln auf ihre Lippen drängen wollte; sie hatte in den vergangenen zwei Wochen so selten gelächelt, dass es ihr direkt auffiel. Nein, sie konnte sich nicht vorstellen, mit einem bunten Teppichboden im Flur zu leben, oder mit Wänden, die nicht weiß waren. Sie konnte sich kein t ohne Strich und kein i ohne Punkt vorstellen; keine unklare Vereinbarung, keine spontane Entscheidung.
Sie konnte sich kein Leben ohne die Frau vorstellen, die sie geliebt hatte.
Noch immer liebte.
Was sie sich jedoch gut vorstellen konnte, waren die beiden Männer, die Susan das angetan hatten. Wie sie zu Tanner hochschauten und um ihr Leben bettelten. Sie konnte sich das Entsetzen auf ihren Gesichtern vorstellen, die langsam einsetzende Erkenntnis, ihre Schreie, wenn sie die Bleiche in ihre Augen tropfen ließ – einen hübschen dicken Tropfen nach dem anderen, bewusst langsam.
Sie ließ den Kopf sinken und schüttelte ihn. Rachefantasien waren ganz normal, das wusste sie. Aber sie wusste auch, dass es sich nur um Fantasien handelte; selbst wenn die beiden Männer gefesselt und hilflos vor ihr liegen würden, selbst wenn sie eine Flasche Domestos in den Händen halten würde, sie könnte so etwas niemals tun.
Sie hob den Kopf.
Sie war so berechenbar wie der Teppichboden, und so würde sie auch immer bleiben.
Langsam stand sie auf, drehte sich um und ging die Treppe hinauf, um sich ein Bad einzulassen.
FÜNF
Selbst Kamal musste zugeben, dass die Party ein Reinfall war. Ein mäßig berühmter DJ, der ein kleines Vermögen damit verdiente, eine beschissene Playlist auf seinem iPod herunterzunudeln. Smirnoff Ice für acht Pfund die Flasche, und nirgendwo konnte man sich hinsetzen. Nach nicht mal einer Stunde hatte Kamal vorgeschlagen zu gehen. Er musste Amaya regelrecht ins Ohr brüllen, um gegen den Lärm eines House-Hits für Teenager, der jeden Nachmittag auf Capital Radio lief, anzukämpfen.
»Das ist Schrott. Und dafür hab ich ein gutes Hemd verschwendet.«
Amaya hatte nichts dagegen einzuwenden. Sie hatte ohnehin die meiste Zeit allein herumgestanden, während Kamal durch den Club gezogen war. Sie hielt sich in einer Ecke an ihrem Drink fest und beobachtete die Gesichter, über die die bunten Lichter hinwegtanzten, nur für alle Fälle.
»Schade.« Sie hatten die Positionen gewechselt, und nun redete Amaya; sie wies auf den Idioten hinter dem Mischpult, ihren Sarkasmus herausbrüllend. »Und ich wollte ihn schon fragen, ob er auf unserer Hochzeit den DJ macht.«
Kamal hatte gegrinst und sie am Arm genommen. »Na komm, verschwinden wir. Dann erwischen wir wenigstens noch die U-Bahn, und ich muss meinem Alten nicht das mit dem Uber erklären.«
In der U-Bahn aßen sie Schokolade vom Bahnhofskiosk und quatschten fröhlich über Amayas Collegekurse und Kamals Job in der Druckerei seines Vaters.
»Vielleicht müssen wir beides hinschmeißen und uns was anderes suchen«, meinte Kamal.
Amaya sah ihn an. »Hoffentlich nicht.«
»Ja, hoffentlich nicht. Aber vielleicht schon.«
»Und womit verdienen wir unser Geld, wenn es wirklich so weit kommt?«, fragte Amaya. »Wovon leben wir, wenn du deine Arbeit nicht mehr hast?«
»Ich such mir einen anderen Job.«
»Das ist ja auch so einfach.«
»Dann geh ich eben zum Amt, wenn es sein muss.«
Als die Bahn an der nächsten Station hielt, schwiegen beide und beobachteten, wie mehrere Leute ausstiegen. Die Bahn fuhr jetzt überirdisch und wurde von Haltestelle zu Haltestelle leerer.
Die Türen schlossen sich wieder, und es ging weiter.
»Aber wenn du deinen Job verlierst, dann doch, weil sie nicht gerade begeistert davon sind, dass wir heiraten wollen, richtig?« Amaya sah Kamal an. Der nickte. »Das heißt also, wir müssen wegziehen und von Sozialhilfe leben.« Sie beugte sich näher zu ihm hin; das Rattern um sie herum machte die Unterhaltung nur unwesentlich leichter als auf der Party. »Aber wenn wir mit diesem ganzen offiziellen Kram zu tun haben, Sozialamt oder Wohnungsamt oder was auch immer … dann wird es kein Problem sein, uns zu finden.«
Kamal nickte und nagte an einem Fingernagel. »Ich lass mir schon was einfallen, keine Sorge.«
»Außerdem möchte ich schon gern weiter aufs College gehen.«
»Ja, klar.«
»Das ist eine gute Ausbildung, weißt du? Eine gute Qualifikation.«
Kamal nahm ihre Hand. »Hör mal, ich sag ja nur, dass es dazu kommen könnte. Wir wären ja blöd, wenn wir uns nicht auf alles vorbereiten würden. Vergiss nicht, warum wir das alles überhaupt machen. Weißt du eigentlich, wie das für mich ist? Ich weiß jedenfalls genau, wie das für dich ist, ich hab das bei meinen zwei Schwestern gesehen. Ich rede doch nur davon, was passieren könnte, wenn ihnen das nicht gefällt. Wenn es ihnen überhaupt nicht gefällt. Nur für den Fall der Fälle. Okay?«
Er wartete. »Amee …?«
Amaya sah zu einem Mann hinüber, der ein paar Plätze links von ihnen auf der anderen Seite des Wagens saß. Er lehnte sich an der Trennwand an, das blond gefärbte Haar gegen das Plexiglas gepresst, und beobachtete sie. Er trug eine grüne Jacke, die mit weißer Farbe besprenkelt war, darunter ein schmutzig braunes T-Shirt und verdreckte Arbeitsschuhe. Kamal bemerkte seinen Blick und sah schnell weg.
Der Mann schien das als Aufforderung zu verstehen.
»Ja, du solltest auch besser weggucken.« Er richtete sich auf und starrte Amaya an. Dann schürzte er die Lippen und machte Knutschgeräusche.
Am Wagenende saß eine Frau mittleren Alters, die in ihre Zeitung vertieft war. Amaya schaute zu ihr hinüber und bemerkte, wie die Frau die Zeitung noch ein wenig höher nahm.
Amaya sah Kamal an. Er hatte den Kopf gesenkt. Sie drückte seine Hand, spürte, wie er sich neben ihr verkrampfte, dann wandte sie ihren Blick wieder dem Mann in der grünen Jacke zu.
»Na, da schau mal einer an«, sagte er mit einer tiefen Raucherstimme und alkoholschwerer Zunge. »Ganz schön mutig, wie? Aber dein Freund scheißt sich gerade in die Hose. Schau ihn dir doch nur mal an, verdammt.«
Amaya hatte Angst, den Blick von dem Mann abzuwenden. »Haben Sie ein Problem?«, fragte sie.
Der Mann beugte sich vor und verringerte den Abstand zwischen ihnen. »Ja, euch«, sagte er. »Ihr seid mein Problem. Ihr seid für alle ein Problem.« Die Bahn näherte sich der nächsten Station und wurde langsamer, doch der Mann redete einfach weiter. »Ihr braucht euch überhaupt nicht in diesen bescheuerten schwarzen Säcken verstecken oder Hüte und Bärte tragen.« Er wedelte mit einer Hand in ihre Richtung und musterte die beiden von oben bis unten. »Macht ja Sinn, sich wie ganz normale Leute anzuziehen und sich anzupassen, damit ihr uns was vormachen könnt.« Er nickte in Richtung von Amayas Füßen, zu den Beuteln, in denen sich die Kleidung befand, in der Kamal und sie zu Hause losgegangen waren. »Was ist denn da drin?«
Die Türen öffneten sich, und die Frau mit der Zeitung heftete den Blick auf den Boden vor sich und stieg an der von Amaya und dem Mann in der grünen Jacke am weitesten entfernten Tür eilig aus.
»Ich hab gefragt, was in den Beuteln ist.«
Amaya schaute schnell nach links in den nächsten Abschnitt der U-Bahn hinüber und stellte fest, dass es nur noch zwei weitere Fahrgäste gab. Ein junger Kerl, der sich mit seinem Handy beschäftigte, und ein paar Plätze weiter ein gut gekleideter Pakistani. Alt, mindestens vierzig oder so; für einen kurzen Augenblick begegnete er Amayas Blick und schüttelte den Kopf. Sie überlegte immer noch, was das wohl zu bedeuten hatte, als der Mann weitersprach.
»Schätze, ihr werdet ja wohl keine ordentliche Bombe an einen leeren Zug verschwenden, oder? Hat ja keinen Sinn, dafür in den Himmel zu kommen, oder wie ihr Leute das auch nennt.« Der Mann stand plötzlich auf, hielt sich an der oberen Haltestange fest, baute sich vor seinem kleinen Publikum auf und rief zu den beiden anderen Fahrgästen hinüber. »Lohnt sich nicht, sich nur für uns drei in die Luft zu jagen, oder?« Er zeigte auf den Pakistani, der ihn beobachtete. »Um dich wär’s aber auch nicht wirklich schade.«
Amaya rückte dichter an Kamal heran, drückte seine Hand mit der einen und hielt sich den Oberschenkel mit der anderen Hand, um das Zittern zu unterdrücken, das ihren Fuß wackeln ließ. Sie beugte sich vor und flüsterte: »Das wird schon, er ist nur betrunken«, dann setzte sie sich wieder gerade hin, und der Mann drehte sich um und baute sich vor ihr auf.
»Also, er kriegt die kleinen Jungfrauen, richtig?« Er stupste Kamals Bein mit dem Schuh an. »Und du, kriegst du die Kerle, die noch nie rumgemacht haben? Ist das so? So ’ne Art kranker Rudelbums mit Turban –«
Er unterbrach sich und schaute verwirrt, als der Pakistani aus dem nächsten Wagen plötzlich näher kam und sich neben Amaya setzte.
»Ach, hallo, da ist ja schon der Nächste.« Der Mann verengte die Augen zu Schlitzen, als würde es ihm Mühe bereiten, den Neuankömmling deutlich zu erkennen. »Wer zur Hölle hat dich denn hergebeten?« Er trat beiseite, plumpste rücklings auf einen Sitz und ließ die Arme neben sich fallen.
Der Pakistani beugte sich zu Amaya und flüsterte schnell: »Nächste Station.«
Amaya nickte.
»Hä? Wer hat dich denn gefragt?«
Da der Mann in der grünen Jacke sich nun offenbar mehr für sein neuestes Opfer interessierte, nutzte Amaya die Chance, sich vorzubeugen und Kamal die Aufforderung zuzuflüstern.
»Ich muss nicht gefragt werden.« Der Pakistani drückte sich gewählt aus, seine Stimme klang ruhig und fest. »Dies ist ein freies Land.«
»Ja, und ein paar von uns wollen, dass das auch so bleibt! Und dazu muss man solche wie dich loswerden.«
Wieder wurde die Bahn langsamer.
»Ich bin genauso britisch wie Sie.«
»Das wage ich ernsthaft zu bezweifeln.«
»Ist es vielleicht britisch, fremde Menschen anzupöbeln?«
»Du vorlautes Arschloch.«
»Oder zu beschimpfen?«
»Soll ich dir eine reinhauen? Na?«
Amaya zählte die Sekunden, während die Bahn in die Station einfuhr. Die in Dunkelheit getauchten Häuser und Gärten wichen Nebengleisen und einem dürftig beleuchteten Parkplatz; Schilder und Plakate wurden langsam lesbar. Der Mann war ganz rot im Gesicht geworden, und Amaya konnte sehen, dass er die Hände zu Fäusten ballte. Wieder schaute er sie aus seinen eiskalten Augen an.
»Mit wem soll ich anfangen?«
Die Bahn war fast zum Stehen gekommen.
»Wie wär’s mit deinem Weichei von Freund?«
Amaya hielt seinem Blick stand, bis die Bahn ruckend anhielt. Der Mann neben ihr sagte: »Los«, und die drei sprangen auf und waren draußen, noch bevor die Türen sich ganz geöffnet hatten.
Sie rannten über den Bahnsteig, und kurz bevor sie die Treppe erreicht hatten, drehte Amaya sich um und sah, dass der Mann in der grünen Jacke ebenfalls ausgestiegen war. Er entdeckte sie und folgte ihnen.
Der Pakistani packte sie am Arm. »Schnell«, sagte er.
Sie rannten die kurze Metalltreppe hinauf, Amaya wühlte in ihrer Tasche nach ihrer Oyster-Card, doch Kamal wies mit dem Gesicht nach vorn, und Amaya schrie beinah laut auf vor Erleichterung, als sie sah, dass die Ticketschranke offen war.
Sie zwängten sich hindurch nach draußen.
Als sie über den Parkplatz in Richtung der Straße eilten, schaute Amaya sich um und entdeckte keine Spur von dem Mann aus der Bahn.
»Alles okay«, sagte der Pakistani.
Kamal drehte sich immer noch alle paar Schritte um. »Scheiße … Scheiße …«
»Keine Sorge, alles gut.« Jetzt wühlte ihr Retter in der Tasche, zog einen Autoschlüssel hervor und drückte auf den Knopf. Fünfzig Meter entfernt blinkten Lichter auf, und Amaya und Kamal folgten dem Mann zu dem Wagen.
»Ich fahre euch nach Hause«, sagte der Mann, als sie einstiegen.
Amaya schloss die hintere Tür und rutschte neben Kamal. »Vielen Dank …«
»Ja, danke.« Kamal packte Amayas Hand. Beide keuchten schwer.
»Kein Problem.« Der Mann ließ den Wagen an. »Und wohin geht die Fahrt?«
»Zwischen Whetstone und Barnet«, antwortete Kamal. »Nicht weit.« Er sah Amaya an und drückte ihre Hand.
Sie warteten. Amaya rutschte auf dem Sitz nach vorn und sah, wie der Pakistani in den Rückspiegel schaute, doch bevor sie den Mund aufmachen konnte, wurde die Tür schon aufgerissen, und der Mann in der grünen Jacke quetschte sich hinein und zwang Kamal und sie, Platz zu machen.
»Hallo«, sagte er.
Er klang gar nicht mehr betrunken.
Mit einem leichten Klack verriegelten sich die Türen, und Amaya fing an zu weinen.
SECHS
Es war kurz vor achtzehn Uhr, drei Tage nachdem Thorne mit Nicola Tanner gesprochen hatte, als sie ihn anrief. Er spielte gerade Poolbillard mit Phil Hendricks im Grafton Arms, einem Pub in der Nähe seiner alten Wohnung, den sie im Laufe der Jahre ziemlich häufig besucht hatten.
Der Wirt hatte ganze Arbeit darin geleistet, nicht allzu erfreut über das Wiedersehen zu wirken.
Thorne war direkt nach der Arbeit nach Kentish Town gefahren, vorgeblich wegen einer Beschwerde seiner Zwischenmieter über einen Boiler, der verrücktspielte. Thorne wusste über defekte Boiler in etwa so viel wie über Astrophysik. Er hatte nur einen kurzen Blick auf das Gerät geworfen und gesagt: »Ich schicke einen Installateur vorbei.« Dann hatte er sich noch kurz umgesehen – einige frische Flecken auf dem Teppichboden, ein paar CDs von Coldplay, die in ihm sofort das Bedürfnis auslösten, die Miete zu erhöhen – und sich anschließend mit Phil auf der anderen Straßenseite getroffen.
Er wollte sich nur entspannen, eine Weile über nichts Wichtiges reden und sich womöglich ein paar Pfund dazuverdienen.
»Wir haben vielleicht wieder einen Fall«, sagte Tanner am Handy.
»Okay«, meinte Thorne und dachte: Wieder? Dann: Wir?
Hendricks kreidete seine Queuespitze ein und formte mit dem Mund: »Wer ist dran?«
Thorne schüttelte den Kopf und wandte sich seinem Handy zu.
»Ein vermisstes Pärchen«, sagte Tanner. »Bangladescher. Die Familien haben die beiden vor zwei Tagen als vermisst gemeldet.«
»Ein Pärchen?«
»Bei Ehrenmorden ist das nicht ungewöhnlich. Eine verheiratete Frau, die mit einem anderen Mann durchbrennt. Ein Mädchen, das sich weigert, denjenigen zu heiraten, den ihre Eltern für sie ausgesucht haben, und mit dem Jungen, den sie liebt, wegläuft.«
»Wie alt sind die beiden?«
»Achtzehn, beide.«
»Na ja, vielleicht ist es das«, meinte Thorne. »Verliebte Teenager, die zusammen abhauen.«
»Genau deshalb könnten sie in Gefahr sein.«
»Ach, ermitteln Sie jetzt schon bei Verbrechen, bevor sie begangen wurden?«
»Vielleicht werden die beiden gar nicht wirklich vermisst«, sagte Tanner. Dann legte sie eine Kunstpause ein. »Oft werden die Kinder als vermisst gemeldet, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen.«
Thorne erwiderte nichts darauf und beobachtete, wie Hendricks seinen nächsten Stoß vorbereitete.
»Noch nimmt niemand das sonderlich ernst, aber das ist der Punkt, deshalb glaube ich, dass wir eine Chance haben, uns die Sache mal anzuschauen, ohne allzu viele Leute aufzuschrecken.«
Von mir mal abgesehen, dachte Thorne.
»Hören Sie, falls Sie kein Interesse haben –«
»Das habe ich nicht gesagt …« Thorne sah zu Hendricks hinüber und verdrehte die Augen. »Ich vermute nur, dass man die Angelegenheit nicht ernst nimmt, weil es sich hier um zwei Erwachsene handelt, das ist alles. Es gibt doch keinerlei Hinweise darauf, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte, oder?«
»Im Augenblick nicht. Nicht offenkundig.«
»Oder dass es irgendeine Verbindung zu dem Mord an Meena Athwal gibt?«
Ein paar Sekunden war Stille. Thorne hörte Tanners Enttäuschung, ja Verärgerung, regelrecht in der Leitung knistern.
»Es wäre sehr viel einfacher, wenn wir uns persönlich darüber unterhalten könnten«, sagte Tanner schließlich.
Thorne hatte dieses Gefühl, das ihn auch manchmal überkam, wenn er sich mit einem Vorgesetzten stritt. Es gehörte zwar zu seinen typischen Eigenschaften, aussichtslose Kämpfe zu führen, er verspürte aber diesmal nicht den Hauch eines Verlangens danach.
Auch Meena Athwal war als vermisst gemeldet worden, bevor man sie tot auffand.
»Also gut«, seufzte er.
»Könnten Sie später noch mal vorbeischauen?«
»Hat das nicht auch bis morgen Zeit?«
»Je früher, desto besser.«
»Es wird spät werden.« Thorne schaute auf die Uhr. Er hatte noch ein paar Runden Poolbillard vor sich. »Wann gehen Sie schlafen?«
»Ich werde wach sein«, sagte Tanner.
Thorne notierte sich ihre Adresse und legte auf. Dann berichtete er Hendricks von dem Gespräch und seinem Treffen mit Nicola Tanner im Viaduct, vor allem von ihrer Theorie, es könnte ein Team von Killern geben, die sich für Ehrenmorde beauftragen ließen. Er brauchte in etwa so viel Zeit dafür, wie Hendricks benötigte, um die restlichen Kugeln über den Tisch zu verteilen und die schwarze ganz beiläufig in der Ecke zu versenken.
»Du hast trainiert«, stellte Thorne fest.
Hendricks ging an den Tisch hinüber und nahm sich sein Glas. Er schüttelte den Kopf. »Ich fasse es immer noch nicht, dass Tanner lesbisch ist.«
»Sie geht damit eben etwas subtiler um als du«, sagte Thorne. »Wobei, das schafft ja selbst Elton John.«
Hendricks kannte Tanner schon eine Weile. Er war der verantwortliche Gerichtsmediziner bei der Obduktion von Heather Finlay gewesen. Als Kollegen war ihre Beziehung immer etwas heikel gewesen; zu der Zeit hatte Hendricks Thorne gegenüber sogar erwähnt, dass er Tanner für schwulenfeindlich hielt.
Thorne sammelte die Kugeln aus den Taschen ein und ließ sie über den Tisch rollen. »Vielleicht liegt es auch nur an dir, dass sie dich nicht mag.«
»Das ist alles ein bisschen … dünn«, meinte Hendricks. »Diese Geschichte mit den vermissten Leuten. Hört sich fast so an, als wäre sie davon besessen.«
»Sie hat ja auch allen Grund dazu«, sagte Thorne.
»Ja, schon.«
»Schmerz treibt Menschen zu allem Möglichen.«
Hendricks stellte die Kugeln auf und sortierte die vollen und halben korrekt zu einem Dreieck. »Wie geht’s Helen?«
Thorne sah ihn an, und begriff, warum sein Freund die Verbindung zwischen der einen und der anderen Art von Trauer hergestellt hatte. Hendricks war auch in Polesford gewesen. Er stand Helen nahe, und wie Thorne vermutete, vertraute sie sich ihm häufiger an.
»Ach, ganz okay, glaub ich.«
»Gut.«
»Hat mit Alfie alle Hände voll zu tun, aber sonst … Na, du weißt schon.« Thorne ermahnte sich, auf dem Weg zu Tanner noch bei Helen anzurufen, um ihr zu sagen, dass es spät werden würde.
»Sie wird’s schon packen«, meinte Hendricks. »Sie ist eine Kämpferin. Tja, das muss sie ja auch sein, wenn sie mit dir zusammenwohnt.«
Er musste über den Themenwechsel lächeln und war froh, das Gespräch in weniger ernste Gefilde zu überführen. »Jetzt fang du nicht auch noch an. Habt ihr beiden euch abgesprochen?«
»Das Ganze steht auf der Kippe, hm?«
»Stößt du jetzt an oder nicht?«