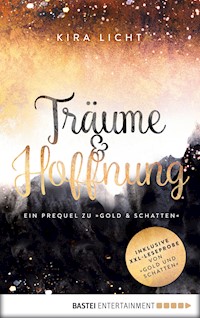9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lovely Curse
- Sprache: Deutsch
Es ist dein Erbe, der Welt das Ende zu bringen. Es ist dein Schicksal, genau dies zu verhindern. Arias Welt bricht zusammen, als ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen und sie zu ihrer Tante in die texanische Provinz ziehen muss. Die neuen Mitschüler an der Highschool lassen die rebellische Aria auflaufen. Doch der charmante Simon scheint ein Auge auf sie geworfen zu haben und der tägliche Schlagabtausch mit Bad Boy Dean wird zur willkommenen Abwechslung – bis Aria eines Morgens mit weißblonden Haaren aufwacht. Und sie ist nicht die einzige, die sich über Nacht verändert. Denn eine uralte Prophezeiung entfaltet ihre Wirkung: Das Ende der Welt naht und Aria ist die erste von vier Todesboten. Band 1 des betörend-gefährlichen Romantasy-Zweiteilers von Kira Licht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2019Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2019 Ravensburger Verlag GmbHPostfach 2460, 88194 Ravensburg© 2019 by Kira LichtDieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.Herzlichen Dank an die Brighton Verlag GmbH und Josepha Gelfert, Autorin von »Traum und Schwert«, für die freundliche Genehmigung der Verwendung des Untertitels »Erbin der Finsternis«.Umschlaggestaltung: Anna Rohner unter Verwendung von Fotos von Inara Prusakova/Shutterstock, Casther /AdobeStock, nizas/Shutterstock und Yevhen Rehulian/ShutterstockLektorat: Charlotte HüttenAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN 978-3-473-47981-8www.ravensburger.de
»Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.«
Søren Kierkegaard
Kapitel 1
Es war nicht die Trauer, die Wut oder die Verzweiflung, die mich verrückt machen würde. Es war die Stille.
Dieses unerträgliche Fehlen vertrauter Alltagsgeräusche: das Hupen der Taxen, die Sirenen der Polizei, das Rattern der Müllcontainer und die Musik aus den Cafés.
Nicht mal der Wind schien hier ein Geräusch zu machen. Lautlos bog er das hüfthohe Präriegras und strich um die Stallungen wie ein neugieriger Fuchs auf der Hühnerjagd.
Ich streckte die Hand aus. Komm her, Wind. Lass mich fühlen, dass du da bist. Lass mich fühlen, dass ich da bin.
Eine hauchzarte Brise wand sich um meine Finger, kühl und weich. Ich lachte leise auf und es schien, dass sich selbst der Boden zu meinen Füßen vor dem Klang meiner Stimme erschrak. Oh, diese Stille. Was gäbe ich nun darum, die ewig streitenden Nachbarn über uns zu hören. Früher waren sie mir auf die Nerven gegangen – Cally und Svensson, das Künstlerpaar, das sich nie einig zu sein schien –, jetzt fehlten sie mir.
Ich stand auf einer kleinen Anhöhe und sah auf das, was seit einer Woche mein Zuhause war: eine Ranch, gebaut aus kräftigem whiskyfarbenen Holz und umgeben von wackligen Zäunen, deren Farbe bereits abblätterte. Nahe des Haupthauses befanden sich große Stallungen, an die sich unzählige Hektar Weideland anschlossen. Windschief, idyllisch, gemütlich. Hier konnten Touristen rustikal eingerichtete Gästezimmer mieten, um fernab des Großstadttrubels ein paar Tage Urlaub zu machen. Mir gehörte ein großes Zimmer unter dem Dach. Sie hatten sich so viel Mühe gegeben: Möbel bestellt, Deko gekauft und mein Zimmer liebevoll hergerichtet. Und ich wollte nichts anderes, als weg von hier. Ich fühlte mich roh, wund und noch so gar nicht bereit. Für einen Neuanfang. Eine neue Heimat. Ein neues Leben.
»Ariana?«
Geh weg. Ich zog den Kopf ein. Niemand nannte mich Ariana. Vielleicht konnte ich mich noch tiefer in die Kapuze meines Hoodies verkriechen. Einfach darin verschwinden.
»Ariana?«
Geh weg. Ich holte tief Luft. »Ja?«
Suzan blieb neben mir stehen.
»Wir wollen abendessen. Ich konnte dich auf dem Handy nicht erreichen.«
Was vermutlich daran lag, dass es die Handymasten noch nicht bis nach Texas geschafft hatten? Der Empfang war außerhalb des Wohnhauses praktisch nicht existent und selbst dort reichte das WLAN kaum bis in mein Zimmer unter dem Dach. »Ich hab keine Nachricht bekommen.«
Suzan beugte sich vor, bis sie an der Barriere der Kapuze vorbei in mein Gesicht sehen konnte. Sie hatte Moms Augen. Schnell sah ich weg.
»Alles in Ordnung?«
Ich wertete das als rhetorische Frage und gab keine Antwort. Der Unfall war jetzt vier Wochen her. ›In Ordnung‹ würde bei mir in naher Zukunft so gar nichts sein.
Mom war nach ihrem Schulabschluss aus Texas geflohen, weil sie das ländliche Leben nicht mehr aushielt. Sie hatte in New York studiert und bald meinen Vater kennengelernt, mit dem sie sich eine winzige Bude in Chinatown mietete, während Suzan die elterliche Farm in Littlecreek übernahm. Die beiden Schwestern hatten sich nie wirklich nahegestanden. Trotzdem hatte meine Tante sofort ihre Koffer gepackt, die Ranch ihrem Ehemann und zwei Verwaltern überlassen und war zu mir nach New York geeilt, als sie von dem Unfall erfahren hatte.
Ich war das letzte Mal vor acht Jahren bei ihr zu Besuch gewesen, wobei wir verfrüht abgereist waren, weil Mom und Suzan sich mal wieder gestritten hatten. Dementsprechend steif war unser erstes Aufeinandertreffen ausgefallen. Dad hatte keine Geschwister und meine Großeltern waren schon lange tot. Suzan, als meine einzige Verwandte, war mir so fremd, dass ich mich an den Gedanken, bei ihr zu wohnen, nur schwer gewöhnen konnte.
Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Okay, ich komme mit.«
Ich gehöre hier nicht hin. Warum wache ich nicht endlich auf?
Suzan erwiderte mein Lächeln. Sie wirkte erleichtert. »Macy hat dir einen Obstsalat gemacht.«
Bei dem Gedanken an die lebenslustige Köchin der Ranch hellte sich meine Stimmung ein wenig auf.
Suzan streckte den Arm nach mir aus, doch dann zögerte sie. Ich schlüpfte darunter weg und gemeinsam spazierten wir den Hügel hinab.
Eine Tante, die eine Fremde für mich war, ein ungewollter Neuanfang und die unendlichen Weiten der texanischen Prärie. Ob es sich jemals richtig anfühlen würde?
»Und freust du dich auf den ersten Schultag?«
Mein Onkel Richard blinzelte im nächsten Moment, weil Suzan ihm einen ziemlich eindringlichen Blick zuwarf. »Ich meine … äh …« Er nahm seine Brille ab und putzte die Gläser an seinem Hemd. »Also … das wird schon.« Er lächelte tapfer.
Suzan mir gegenüber verdrehte die Augen, doch um ihre Mundwinkel zuckte es amüsiert.
Der große Tisch in der Mitte der gemütlichen Ranchküche brach unter all den von Macy zubereiteten Köstlichkeiten fast zusammen. Gegrilltes Fleisch, Coleslaw und ein paar Klassiker der Tex-Mex-Küche wie Fajitas, Enchiladas und Tortillas türmten sich auf bunt gemusterten Tellern. Schon beim Reinkommen war mir das Wasser im Mund zusammengelaufen. Derzeit waren die Gästezimmer nicht vermietet, trotzdem ließ es sich Macy nicht nehmen, das volle Programm aufzutischen. Während die Touristen normalerweise mit im Haupthaus aßen und das authentische Ranchfeeling erlebten, hatten die Arbeiter einen eigenen kleinen Speiseraum in einem der Nebengebäude, aber auch sie wurden von Macys Kochkünsten verwöhnt.
»Danke, Richard.« Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen, während ich mir vom Coleslaw nachnahm. Richard wirkte selbst nach Jahren auf der Ranch in Jeans und Karohemd verkleidet. Er hatte Geschichte und Archäologie studiert, sogar promoviert und war dann der Liebe wegen hier im Grasland gestrandet. Richard und die freie Natur jedoch schienen einander so spinnefeind wie gleich gepolte Magnete. Nicht nur, dass er das ganze Jahr unter Heuschnupfen und einer Katzenallergie litt, er war – und das kam hier im Rinderstaat Texas einer achten Todsünde gleich – Vegetarier. Mit der goldgerahmten Nickelbrille, den weichen Gesichtszügen und dem schlanken, hoch aufgeschossenen Körperbau sah er aus wie ein Akademiker, der einfach fehl am Platz schien. Er half Suzan mit der Buchhaltung und erledigte kleinere Arbeiten auf der Farm. Hauptberuflich unterrichtete er jedoch Geschichte an einem College in Odessa, der nächstgrößeren Stadt.
Ich sah zu Suzan und erhaschte gerade noch den Blick, mit dem sie ihn bedachte, begleitet von einem feinen Lächeln, das die zarten Falten unter ihren Augen kräuselte. Sie liebte ihn. Vermutlich auch, weil er es ihr zuliebe jeden Tag aufs Neue mit einer Flora und Fauna aufnahm, die ihm so feindlich gesonnen schien.
»Ich bin mir sicher, du wirst dich hier gut einleben, Ariana«, sagte Suzan. »Schließlich bist du kaum eine Woche bei uns.« Der erzwungene Optimismus in ihrer Stimme ließ sich auch durch ihr strahlendes Lächeln nicht vertuschen. »Da kommt mir eine Idee. Was würdest du davon halten, in Zukunft eines unserer Pferde zu betreuen? Ich könnte mir vorstellen, dass du so das Ranchleben besser kennenlernst.«
Ich wand mich innerlich. »Äh …« Ein Pflegepferd? In New York hielten die Menschen sich kleine Haustiere wie Katzen oder Hunde. Ich selbst hatte nie etwas Größeres als einen Hamster besessen. Suzans American Quarter Horses waren im Gegensatz dazu riesige, majestätische Tiere und schüchterten mich, um ehrlich zu sein, ganz schön ein.
»Ich überleg es mir«, antwortete ich möglichst unverbindlich.
Richard, der wohl spürte, dass ich mich unwohl bei dem Gedanken fühlte, sprang in die Bresche und wechselte abrupt das Thema, bevor Suzan weiter nachhaken konnte. »Wir werden noch mehr Wasser dazukaufen müssen.«
Suzan schob ihren halb vollen Teller von sich, als sei ihr plötzlich der Appetit vergangen. »Wie soll das bloß weitergehen?«
»Geht es um das Algenproblem?« Ich hatte Suzan und Richard immer wieder darüber tuscheln hören, das Ausmaß der Lage aber bisher nicht begriffen. Die einzigen Algen, die ich kannte, verstopften schon mal den Brunnen im Central Park, waren ansonsten aber ungefährlich.
Suzans Blick wurde ernst. »Die roten Algen sind hochgiftig und die Pferde nehmen sie beim Trinken auf. Selbst winzige Blättchen sind bereits tödlich. Sie überwinden jeden Filter, jedes noch so moderne System. Wir haben keine Ahnung, woher sie so plötzlich gekommen sind. Und komischerweise scheinen die anderen Dörfer im Umkreis nicht betroffen. Mittlerweile pumpen wir Grundwasser ab, obwohl das verboten ist. Doch es ist das einzige Wasser, das bisher noch nicht befallen scheint.«
Ich wollte etwas erwidern, doch mir blieben die Worte im Hals stecken.
Suzan nahm eine Scheibe geröstetes Weißbrot von ihrem Teller, brach ein Stück davon ab und zerbröselte es gedankenverloren zwischen den Fingern. »Für uns ist es eine Katastrophe, da wir normalerweise einen Großteil des Wassers für die Ranch aus den Flüssen schöpfen. Wir brauchen es zum Tränken der Tiere, zum Sauberhalten der Ställe, für alles Mögliche. Es ist sehr teuer, Wasser dazuzukaufen, und auf Dauer nicht tragbar.«
»Aber unternimmt denn die Regierung nichts dagegen?«, warf ich ein.
Suzan lächelte knapp. »Die County Regierung ist bereits informiert. Es waren Vertreter der Umweltschutzbehörde hier und haben Proben genommen. Doch seitdem haben wir nichts mehr von offizieller Stelle gehört.« Als Suzan mein betroffenes Gesicht sah, schien sie innerlich einen Schalter umzulegen. »Aber genug davon. Das sind unsere Sorgen und nicht deine. Morgen ist dein erster Schultag, darüber wollten wir reden.« Sie nahm ihren Teller, stand auf und schüttete die Krümel in den Müll, bevor sie ihn in die Spüle stellte. »Die Littlecreek High hat einen sehr guten Ruf. Ich bin mir sicher, du wirst dort schnell Freunde finden. Alle Jugendlichen der umliegenden Farmen gehen dort zur Schule. Ich verspreche dir, du wirst dich dort leicht eingewöhnen.«
»Ja, bestimmt.« Ich seufzte innerlich. Die Cowgirls, die Farmerboys und ich … wir würden dicke Freunde werden.
Oder ich würde endlich aus diesem Albtraum aufwachen. In unserer chaotischen Wohnung mitten in Brooklyn. Umgeben von meinen Eltern, meinen Freunden und dem vertrauten Lärm in den Straßen.
Ich war so tief in diesen sehnsüchtigen Gedanken versunken, dass ich zusammenzuckte, als Suzan mir eine Hand auf die Schulter legte. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie zu mir rübergekommen war. »Bist du fertig mit essen? Wir haben noch eine kleine Überraschung für dich.«
Gemeinsam mit Suzan und Richard ging ich über den ordentlich gefegten Hof. Die unerträgliche Hitze des Tages ließ langsam nach und die Pferde waren schon zurück in die Stallungen gebracht worden. Nur ein leises Grillenzirpen und die gedämpften Stimmen der Arbeiter aus dem Nebengebäude waren zu hören. Wir steuerten auf eine alte Scheune zu. Bei meinem ersten Rundgang über die Ranch hatte Suzan mir erklärt, dass hier die Wagen für die Rancharbeiter geparkt und größere Werkzeuge gelagert wurden. Ich selbst war aber noch nie dort drin gewesen. Suzan öffnete das Schloss und schob mit Richards Hilfe die großen Flügel des Holztors auseinander. Die sanften Sonnenstrahlen fielen in das Innere der Scheune und gaben den Blick auf einen Pick-up frei. Ein Ungetüm von Auto, froschgrün lackiert und mit breiten Reifen. Der Wagen sah aus, als habe er schon so einiges erlebt, aber er wirkte immer noch beeindruckend. Das Chrom war aufpoliert und der Rost im Lack geschickt kaschiert worden. Statt zwei Scheinwerfern besaß er vier. Ein Paar war oben auf dem Dach montiert und sogar die Halterungen leuchteten in diesem wirklich auffallend fröhlichen Grün. Für den Bruchteil einer Sekunde starrte ich die Front des Wagens an und fragte mich, an wen oder was er mich erinnerte. Mein Blick glitt erneut zu den abstehenden Scheinwerfern auf dem Dach, die irgendwie aussahen wie Ohren. Da fiel es mir ein: Shrek. Ich liebte den abenteuerlustigen Oger aus dem DreamWorks-Film. Er besaß die gleiche Farbe, und seine Ohren sahen genauso aus und standen genauso ab wie die Scheinwerfer des Pick-ups. Dieses Auto musste einfach Shrek heißen.
Suzan kam auf mich zu und drückte mir etwas Kühles, Metallisches in die Hand. »Für dich.«
Ich sah auf die Autoschlüssel in meiner Handfläche. »Für mich?«, fragte ich ungläubig. Ich sollte Shrek fahren?
Richard nickte vergnügt. Suzan grinste mich erwartungsvoll an.
»Siehst du sonst noch jemanden hier draußen?«
»Oh«, flüsterte ich total überrumpelt. »Ich meine …« Ich sah sie beide an. »Danke. Vielen Dank. Das ist echt großzügig.« Ich wollte lächeln, mich freuen, doch die Erinnerungen schlugen über mir zusammen wie eine schwarze Welle. Bisher war ich immer nur mit Dad gefahren. Wir hatten im verrückten New Yorker Straßenverkehr geübt und er hatte sich Halt suchend am Armaturenbrett abgestützt, wenn ich versuchte, sein geliebtes Auto rückwärts einzuparken. Eine Gänsehaut jagte meine Wirbelsäule hinab. Seit dem Unfalltod meiner Eltern hatte ich mich nicht mehr hinter ein Lenkrad gesetzt. Der Gedanke, in Shrek herumzufahren und in dieser Einöde mobil zu sein, war verlockend, aber … Ich straffte entschlossen die Schultern und hielt Suzan die Autoschlüssel entgegen. »Es tut mir leid, aber ich kann das nicht annehmen. Ich weiß nicht, ob ich schon dazu bereit bin … und überhaupt, die Pferde sind wichtiger. Kauft davon Wasser dazu und ich nehme den Schulbus.«
Suzans Mundwinkel sanken nach unten. Sie hatte wohl damit gerechnet, dass ich ihr um den Hals fallen würde. Richard und sie sahen mich sprachlos an, und da Suzan den Schlüssel nicht nehmen wollte, verschränkte ich unbehaglich die Arme vor der Brust. »Unsinn«, stieß Suzan plötzlich hervor. Sie schien sich wieder gefangen zu haben. »Der Wagen gehört zur Ranch und verkauft wird er nicht. Wenn du in zwei Jahren aufs College gehst, wird er als Ersatzfahrzeug genutzt, so wie vorher auch.« Sie kam auf mich zu und legte mir eine Hand auf die Schulter. Instinktiv schien sie zu wissen, dass ich zu einer Umarmung noch nicht bereit war. »Was mit deinen Eltern passiert ist, war ein furchtbarer Unfall und ich weiß, du hast Angst. Aber hier in der Prärie ist ein Auto unverzichtbar.«
Ich schaute in Suzans so vertraute und doch fremde Augen und drehte unsicher den Autoschlüssel in meiner Hand hin und her.
»Wie wäre es erst mal mit einer Probefahrt?« Richard, der die Daumen in die Taschen seiner Jeans gehakt hatte, lächelte mich aufmunternd an.
Erneut sah ich zwischen Suzan und ihm hin und her. Die beiden meinten es nur gut und ich wollte sie nicht enttäuschen. »In Ordnung.«
»Dann los.« Suzan nickte mir zuversichtlich zu. »Der Wagen hat keine einzelnen Sitze, sondern eine Bank. Da passen wir locker nebeneinander.«
Mit zitternden Händen schloss ich die Tür auf und wir quetschten uns ins Wageninnere. Es roch nach einer Mischung aus Bienenwachs und Zitrusreiniger, und das abgeschabte Leder der Sitzbank zerrte an meiner Jeans, als ich mich zurechtsetzte.
»Im Navi sind bereits alle wichtigen Adressen in Littlecreek eingespeichert«, erklärte Suzan und zeigte auf das kleine Gerät, das mit Saugnäpfen an der Innenseite der Frontscheibe angebracht war. Sie beugte sich quer über Richard, öffnete das Handschuhfach und deutete hinein. »Hier findest du außerdem eine Tankkarte. Sie gilt für die Tankstelle in Littlecreek. Du brauchst also nicht mit Bargeld zu bezahlen, es sei denn, du tankst außerhalb.«
»Vielen Dank, das ist sehr großzügig«, wiederholte ich etwas steif. Sie hatten wirklich an alles gedacht.
»Magst du den Motor mal starten?«, ermutigte mich Suzan.
»Klar.« Ich klang optimistischer, als ich mich fühlte. Moms und Dads Unfall war erst vier Wochen her. Obwohl ich nicht im Fahrzeug gesessen hatte, bekam ich seitdem in Autos immer ein mulmiges Gefühl. Als Richard Suzan und mich vom Flughafen abgeholt hatte, hatte es mich all meine Kraft und Überwindung gekostet, in diesen fremden Wagen zu steigen. Ich atmete einmal tief durch. Du schaffst das. Du bist stark. Du wirst die Angst nicht gewinnen lassen. Ich schnallte mich an, dann drehte ich entschlossen den Schlüssel im Zündschloss und legte meine vor Nervosität schweißnassen Hände auf das Lenkrad. Ich lasse die Angst nicht gewinnen. Ich bin stark. Ich schaffe das. Shrek hörte sich an, als würde ein Flugzeug starten. Er knurrte und brummte, bockte einmal und dann tuckerte der Motor wie der Takt eines schlagenden Herzens. Und auch mein Herz schien dadurch erstaunlicherweise wieder im Takt zu schlagen. Hi, Shrek, dachte ich. Wir beide packen das schon, oder?
Ich drehte ein paar zaghafte Runden auf dem Hof, bevor ich mich auf die schmale Straße wagte, die zur Ranch führte. Auch wenn er von einer Servolenkung noch nie etwas gehört zu haben schien, hatte Shreks Motor ordentlich PS. Beim Lenken fühlte es sich an, als würde ich das störrische Steuerrad eines Schiffes drehen. Dennoch absolvierte ich die Probefahrt ohne Zwischenfall und fühlte mich danach glücklich und erleichtert. Suzan und Richard schien es ähnlich zu gehen. Ich hatte meiner Angst ins Auge gesehen und als ich mich jetzt noch einmal bei den beiden bedankte, meinte ich es von ganzem Herzen.
Beide winkten bescheiden ab, stattdessen schickten sie mich lachend ins Bett mit dem Argument, dass ich morgen Schule hätte. Das war natürlich nur ein Spaß, aber es fühlte sich ungezwungener an als bisher. Suzan wollte noch mal nach einer trächtigen Stute sehen, Richard seinen Unterricht für die kommende Woche vorbereiten, und ich würde ein bisschen mit meiner besten Freundin Tammy texten und dabei eine Netflix-Serie laufen lassen. Fast wie eine ganz normale Familie.
Der Gedanke versetzte mir einen schmerzhaften Stich, doch ich ließ es nicht zu, dass die Traurigkeit wieder die Oberhand gewann. Suzan und Richard würden Mom und Dad niemals ersetzen, aber vielleicht konnten wir uns irgendwie arrangieren, wenn wir uns besser kennengelernt hatten. Wenn es sich nicht mehr anfühlte, als sei ich nur zu Besuch.
Obwohl ich Tammy von meinem Zimmer aus mehrmals antextete, antwortete sie nicht. Ich stöberte ein wenig auf Instagram, aber auch dort gab es keine neuen Fotos von ihr. Komisch. Das passte so gar nicht zu ihr. Tammy lud gerne energiegeladene Fotos ihrer Kampfmoves hoch und erfreute sich dafür einer vierstelligen Follower-Zahl. Was vermutlich daran lag, dass sie mit ihren knapp 1,50 Meter, den langen schwarzen Haaren und dem Puppengesicht nicht das Klischee eines muskulösen Karatemeisters erfüllte. Vielmehr sah sie aus wie eine Kampf-Elfe, die es so ziemlich mit jedem aufnehmen konnte. Da sie Kampfsport machte, seit sie laufen konnte, war sie beeindruckend gut und ich gönnte ihr jeden Like. Ich schrieb ihr ein letztes Mal und ging dann ins Bad, um mir schon mal meinen Schlafanzug anzuziehen.
In dem kleinen Raum roch es nach frisch gewaschenen Handtüchern und kürzlich versiegelten Armaturen, denn Suzan hatte das Bad extra renovieren lassen. Hätte sie mich vorher eingeweiht, hätte ich ihr klargemacht, dass ich solchen Luxus nicht brauchte. Unser Bad daheim in New York war das gefühlt älteste der Welt – mit quietschenden Kupferrohren, abgesplitterten Porzellanarmaturen und Wasserhähnen, deren Chrom schon lange blind geworden war. Mom und Dad hatten ewig davon gesprochen, es renovieren zu lassen, aber nie das Geld dafür gehabt. Und ich hatte unser Chaos geliebt.
Dieses Bad hingegen wirkte so neu und steril wie in einem Hotel. Nur die pinken Handtücher sorgten für einen fröhlichen Farbklecks. Ich schlüpfte in meinen Schlafanzug, der aus Shorts und einem von Dads alten Bandshirts bestand, und putzte mir die Zähne, bevor ich zurück in mein Zimmer tappte.
Immer noch keine Antwort von Tammy. Ich ließ das Handy frustriert zurück aufs Bett fallen und sah mich etwas unschlüssig um. Zwar war es erst kurz nach neun, aber ich konnte weder meine beste Freundin erreichen, noch hatte die neue Folge »Shadowhunters« mich wirklich packen können. Und vielleicht war es gar keine schlechte Idee, etwas früher ins Bett zu gehen. Immerhin sollte ich mich noch vor Unterrichtsbeginn zu einem kurzen Gespräch mit Direktor Carmack treffen. Außerdem kannte ich das Schulgelände nicht und hatte keine Ahnung, wo sich meine Klassenräume oder mein Spind befanden. Also zog ich die Jalousien runter und kuschelte mich in die Kissen. Jetzt im Halbdunkel fühlte sich das Zimmer besonders fremd an. Von meinen geliebten Vintagemöbeln aus New York hatte ich kaum etwas mitnehmen können. Unter diese Schrägen hätten sie sowieso nicht gepasst. Suzan hatte wohl einen kreativen Schreiner zur Hand, denn alle Regale und Schränke fügten sich perfekt in den Raum unterm Dach ein. Das Zimmer war raffiniert unterteilt, sodass man jeden Winkel wirklich nutzen konnte. Doch die meisten Umzugskartons standen immer noch unberührt in der Ecke. In den ersten Nächten auf der Ranch war ich nachts wach geworden und hatte gar nicht gewusst, wo ich war. Ich zog die Decke hoch bis zur Nase. Es war meine eigene Bettwäsche und sie roch noch nach dem Weichspüler, den Mom immer benutzt hatte. Mein Herz krampfte sich schmerzlich zusammen.
In letzter Zeit hatte es zu viele letzte Male gegeben: die letzte Nacht in unserer Wohnung, der letzte Besuch am Grab meiner Eltern. Ein letzter Gang durch das vertraute Wohnzimmer. Ein letzter Blick in Moms Kleiderschrank. Eine letzte Schüssel selbst gekochte Lasagne im Gefrierfach.
Zum Glück mussten wir die Wohnung nicht räumen, denn meine Eltern hatten sie vor Jahren gekauft, als Suzan Mom ihren Erbanteil ausgezahlt hatte. Jetzt erschien es Suzan zu stressig, die Wohnung zu vermieten, da sie nicht vor Ort sein konnte, wenn es Probleme mit den Mietern gab.
Deshalb hatte sie nur die Schränke ausgeräumt, gründlich durchgewischt und die Zimmerpflanzen einer Nachbarin angeboten, damit sie nicht vertrockneten. Wir hatten weiße Laken über die Möbel geworfen und dem Verwalter des Wohnhauses einen Schlüssel übergeben, damit er regelmäßig nach dem Rechten sah. Mom und Dad hatten bei meiner Geburt ein Konto für mich angelegt, damit ich später aufs College gehen konnte. Ich war erleichtert, dass ich die Wohnung auch deswegen nicht würde verkaufen müssen. Denn eines hatte ich mir geschworen: Ich würde wieder dort wohnen. In New York, meiner Heimat, meinem Zuhause.
Eine nervöse Unruhe überkam mich und ich richtete mich auf, um noch einen Schluck Wasser zu trinken. Doch das reichte nicht aus, um mich zu beruhigen. Ich musste irgendetwas mit meinen Händen machen. Ich musste mich irgendwie beschäftigen, damit meine Gedanken nicht ständig zurück zu Mom und Dad wanderten. Morgen war mein erster Schultag, und obwohl ich keine Lust auf die neue Schule, die fremden Mitschüler und die Lehrer hatte, wollte ich einen guten ersten Eindruck machen. Denn um später mein absolutes Wunschfach studieren zu können, musste ich meinen guten Notendurchschnitt halten.
Ich schwang die Beine über die Bettkante, knipste die Nachttischlampe an und stand auf. Wieder ließ ich meinen Blick durch das Zimmer schweifen, bis er an einer dunklen Holzkiste hängen blieb. Mom und ich hatten die Kiste auf einem Flohmarkt in der Bronx erstanden, und der Verkäufer hatte behauptet, dass sie antik sei. Mir war egal gewesen, ob er die Wahrheit sagte, denn ich hatte mich sofort in sie verliebt. Sie war groß, ziemlich schwer und massiv verarbeitet. Das Schloss war in Form eines großen bronzefarbenen Fisches gestaltet, der den Riegel des Schlosses zu verschlingen schien. Von innen hatte die Kiste ganz schwach nach Sandelholz gerochen und ich hatte das dunkle rotbraune Holz immer wieder poliert, um ihm neues Leben einzuhauchen. Ich ging in die Hocke und öffnete behutsam den schweren Deckel der Kiste. Unzählige kleine Fläschchen aus braunem Glas reihten sich ordentlich nebeneinander. Dad hatte das hier scherzhaft meinen ganz persönlichen Giftschrank genannt. Er hatte immer behauptet, die kleinen dunklen Fläschchen mit den schwarzen Verschlüssen sähen aus wie die Ausstattung eines Auftragskillers. Was natürlich Quatsch war, denn die Fläschchen enthielten kein Gift, sondern ätherische Öle.
Andere Mädchen interessierten sich für teure Klamotten und Make-up, gingen täglich zum Sport oder gaben all ihr Geld für Bücher aus. Meine Welt hingegen waren die Düfte.
Mein Dad hatte als Chemiker für einen großen Konzern gearbeitet und dort Düfte für Putzmittel kreiert, die nach frisch gewaschener Wäsche oder sauberen Badezimmern rochen. Von ihm hatte ich meine feine Nase geerbt. Ich nahm die Welt nicht nur in Farben und Geräuschen wahr, sondern erinnerte mich vor allem an Gerüche. Ich wusste noch, wie die Luft gerochen hatte, als ich mit Tammy zum letzten Mal im Central Park gewesen war, und genauso erinnerte ich mich an das Aroma der heißen Schokolade mit Zimt, die meine Eltern mir vor Jahren an der Schlittschuhbahn des Rockefeller Centers gekauft hatten. Ich schloss die Augen und holte tief Luft. Das Potpourri verschiedener Öle stieg mir in die Nase, so dicht und episch wie ein Konzert in der Carnegie Hall. Regelmäßig trainierte ich meinen Geruchssinn mit diesen Fläschchen. Ich schloss die Augen, schraubte wahllos eines auf und benannte den Duft. Ich wollte zwar nicht in Dads Fußstapfen treten und den Menschen Putzmittel verkaufen, aber ich wollte genauso wie er Chemie studieren und danach eine Ausbildung zur Parfümeurin machen. Anders als Dad jedoch nicht in einem Konzern, sondern in einer der berühmten französischen Schulen. Es war mein Traum und ich hatte gewusst, was ich werden wollte, schon lange bevor die meisten Kinder überhaupt darüber nachgedacht hatten. Obwohl die Kiste eine gefühlte Tonne wog, klappte ich den Deckel zu und schleppte sie zu meinem Schreibtisch, wo ich sie vorsichtig abstellte. Ich wollte keinen Krach machen, denn ich wusste nicht, ob Richard und Suzan schon ins Bett gegangen waren. Dann wandte ich mich zu einem der Umzugskartons und wühlte darin herum. Ich seufzte erleichtert auf, als ich die Sojawachsflocken fand. Schnell knipste ich auch noch das Licht am Schreibtisch an und wühlte erneut in dem Karton, um ein paar Gläser und einige vorgefertigte Dochte herauszuholen.
Doch dann hielt ich inne. Wie würde Suzan es finden, wenn ich mitten in der Nacht in ihrer Küche Duftkerzen herstellte? Ich seufzte leise, sortierte die Dochte ordentlich auf der Schreibtischunterlage und schob den Gedanken energisch beiseite. Ich würde ja nicht gleich das ganze Haus abfackeln. Immerhin produzierte ich schon seit über einem Jahr meine eigenen Kerzen und verkaufte sie in meinem Etsy-Shop. Der monatliche Verdienst war zwar nicht riesig, aber ich konnte mir mein Taschengeld ein wenig aufbessern. Ich hatte den Shop natürlich offline genommen, nachdem das mit Mom und Dad passiert war.
Doch heute wollte ich sowieso nichts Kommerzielles produzieren. Ich nahm ein kleines Mischgefäß aus der Kiste und legte einen Spatel dazu. Dann setzte ich mich und ließ meinen Blick über die Aromafläschchen gleiten. Ich entschied mich für Zypresse. Die immergrüne Zypresse als Zeichen für ewiges Leben, war genau die richtige Basisnote. Mit einem traurigen Lächeln schraubte ich den Deckel des Fläschchens ab und schloss die Augen. Der Duft war harzig, würzig und geradlinig. Ich ließ ein paar Tropfen in die kleine Schüssel fallen und griff erneut in die Kiste. Vanille bildete das weiche, schmeichelnde Pendant zur Zypresse – süß, harmonisch und sanft. Sie roch nach warmem Pudding und selbst gebackenem Kuchen. Als ihren Gegenspieler wählte ich Beifuß. Das kräftig-bittere Aroma von schwarzem Tee stieg mir in die Nase und weckte Erinnerungen an meinen Dad, der den typisch britischen Earl Grey so geliebt hatte. Bei dem Fläschchen mit der Aufschrift »Rose« musste ich an Moms Lieblingsparfüm denken, das aus fünf verschiedenen Sorten seltener Rosenessenzen bestanden hatte. Obwohl es ein Vermögen kostete, hatte Dad es sich nicht nehmen lassen, ihr jedes Jahr zu ihrem Hochzeitstag eine neue Flasche davon zu schenken. Tränen stiegen mir in die Augen, als der zarte Duft sich entfaltete. Zum Schluss fügte ich noch meinen Lieblingsduft hinzu: Sandelholz. Ich rührte vorsichtig um und musste dann ein letztes Mal in dem Umzugskarton wühlen, um das Tablett zu finden, auf dem ich die drei Schraubgläser samt Docht und die Schüssel mit den gemischten Duftölen transportieren konnte. Außerdem legte ich noch einen kleinen Flakon dazu, in dem ich das übrig gebliebene Öl auffangen würde. Die teuren Essenzen wollte ich nicht verschwenden. So leise wie möglich verließ ich mein Zimmer.
Im Rest des Hauses war es schon dunkel, doch zu meiner Überraschung brannte in der Küche noch Licht. Ich spähte neugierig durch den Türschlitz. Macy stand an der Theke und schrubbte die Arbeitsfläche.
»Kannst du nicht schlafen, Liebes?« Ich schreckte zusammen und ließ dabei fast das Tablett fallen. Macy schien Augen und Ohren wie ein Luchs zu besitzen, denn sie hatte mich sofort bemerkt.
Ich schob die Tür mit dem Fuß auf und betrat den Raum. »Erwischt«, sagte ich scherzhaft und grinste, als ich Macys kritischen Gesichtsausdruck sah. Mit zusammengezogenen Brauen musterte sie das Tablett in meiner Hand und griff dann mit spitzen Fingern nach den Sojawachsflocken.
»Sag mir nicht, dass das irgendein neumodischer Kram ist, den man jetzt in New York isst. Wehe, du wirfst diesen Mist in mein Müsli!« Sie deutete mit dem Zeigefinger auf drei große Glasbehälter mit selbst kreierten Müslimischungen, die schon für das morgige Frühstück bereitstanden.
»Das würde ich nie wagen«, sagte ich in gespieltem Entsetzen und Macy stimmte in mein Lachen ein.
»Also, was treibt dich so spät noch um?«, wollte Macy wissen, als wir uns wieder beruhigt hatten. Ich stellte das Tablett auf der Arbeitsfläche ab und sah Macy, die mich mit einem Lächeln bedachte, nachdenklich an. Ihr dunkles Haar wand sich in weich fallenden Locken bis zu ihrem Kinn. Sie trug ein etwas altmodisch geschnittenes Kleid, das um ihren Busen spannte, und goldene Zehensandalen. Mein Blick verweilte einen Moment auf ihren grün lackierten Fußnägeln, die einen stylischen Bruch zu ihrem coolen Retrostil bildeten. Trotz ihres stressigen Jobs auf der Ranch schien sie immer gut gelaunt und hatte für jeden ein offenes Ohr. Selbst wenn man um zehn Uhr abends in ihrer Küche auftauchte und so aussah, als habe man die Werkstatt eines irren Wissenschaftlers überfallen.
»Ich bin einfach etwas nervös wegen morgen.« Selbst bei Macy fiel es mir schwer, über meine Eltern zu sprechen. »Ich dachte, es könnte mich ablenken, ein paar Kerzen zu gießen.«
»Dafür ist all das Zeug also da«, stellte sie fest und zeigte auf das voll beladene Tablett. Sie schien zu merken, dass mir noch mehr auf der Seele brannte, drängte mich aber nicht. Dafür war ich ihr sehr dankbar.
»Genau. Ist es okay, wenn ich das Wachs kurz im Wasserbad erhitze?«
Macys Blick glitt besorgt zu ihren blitzblank geputzten Kochtöpfen, die ordentlich gestapelt in einem der großen Küchenschränke hinter Glas standen. Ich hob zwei Finger in die Höhe. »Ich schwöre, du wirst kein Wachs an deinen Töpfen finden.«
»Na gut.« Sie kapitulierte und kramte einen Topf aus der hintersten Ecke des Schrankes. An einer Seite hatte er eine deutliche Beule und einige Kratzer zierten die polierte Oberfläche. Ich musste grinsen, denn so ganz schien sie mir nicht zu vertrauen. »Produzierst du Kerzen grundsätzlich im Pyjama?«, fragte sie beiläufig, während sie etwas Wasser in den Topf laufen ließ, und entlockte mir damit ein weiteres Grinsen.
»Nur dann bin ich kreativ.«
Macy machte eine große Geste mit der freien Hand und seufzte. »Künstler.«
Sie platzierte den Topf auf dem Herd und ich sah ihr fasziniert dabei zu, wie sie die Gasflamme anzündete. In diesem Moment war ich froh, sie noch erwischt zu haben, denn den Profi-Gasherd mit seinen acht Platten hätte ich garantiert nicht bedienen können.
»Das geht jetzt relativ zügig, weil Gas viel schneller heizt als Elektro«, erklärte Macy. »Willst du, dass ich noch hierbleibe, oder musst du allein sein, damit die Kreativität fließt?«
Ich schüttelte den Kopf. »Quatsch, ich freue mich, wenn du bleibst und mir hilfst. Ich hätte vermutlich noch nicht mal den Herd anbekommen.«
Während wir darauf warteten, dass das Wasser zu kochen begann, reichte ich Macy die Schüssel mit dem selbst kreierten Duft. »Möchtest du mal riechen?«
Sie beugte sich zu dem Behältnis und schnupperte. »Mhmm …« Sie seufzte genüsslich. »Ich rieche auf jeden Fall Vanille, aber es hat auch eine erdige Note.«
Ich nickte erfreut und erklärte ihr, welche Öle ich verwendet hatte. Sie sah mich anerkennend an. »Auf diese Kombination wäre ich nie gekommen. Du hast wirklich Talent.«
»Vielen Dank, es macht mir richtig Spaß und …«, ich zögerte, denn plötzlich kamen die Erinnerungen wieder in mir hoch. Zuletzt hatte ich mit meinem Dad so vertraut in der Küche gestanden und die verschiedensten Duftkombinationen ausprobiert. Tränen stiegen mir in die Augen und ich drehte mich eilig weg. Reiß dich zusammen, Aria. Mit fahrigen Bewegungen platzierte ich die Dochte in die Mitte der Gläser. Da spürte ich eine warme Hand im Rücken.
»Setz dich nicht so sehr unter Druck. Du bist keine Maschine, du musst nicht funktionieren. Gib dir und deinem Herzen Zeit, das Erlebte zu verarbeiten.« Macy ließ die Hand sinken und stellte sich neben mich. »Es ist gut, dass du ein Ventil hast. Dass du kreativ sein kannst, um mit alldem umzugehen. Es gibt Menschen, die fressen alles in sich hinein, bis sie platzen. Oder sie werden einfach immer stiller und ziehen sich komplett zurück.«
Ich spürte ihr sanftes Lächeln mehr als ich es sah und nickte. »Danke.« In diesem Moment begann das Wasser im Topf zu blubbern und ich konzentrierte mich auf die nächsten Arbeitsschritte.
Ich nahm den Topf von der Platte, drehte die Flamme aus und ließ das Wasser einen Moment abkühlen.
Nach einem prüfenden Blick auf die Uhr stellte ich die Gläschen in den Topf. Die Wachsflocken schmolzen fast augenblicklich. Macy schaute fasziniert zu. »Man könnte meinen, es wäre Eis.«
Ich nickte. »Wenn das Wachs vollständig geschmolzen ist, nehmen wir die Gläschen wieder raus und lassen sie noch einmal einen Moment abkühlen. Das Wachs darf nicht zu heiß sein, sonst verfliegen die Aromen der ätherischen Öle.«
»Das ist ja eine richtige Wissenschaft für sich.« Macy reichte mir ein paar Topflappen. Vorsichtig hob ich die Gläser aus dem Wasserbad. Mit einem kleinen Löffel dosierte ich das Duftöl und rührte das Wachs schnell um, bevor es wieder fest wurde. Das restliche Öl füllte ich vorsichtig in den kleinen Flakon ab. Aus den Gläsern stieg inzwischen ein zarter Duft auf.
Macy schloss die Augen. »So schön! Die Kerzen, die man im Laden kaufen kann, riechen alle irgendwie nach Chemie.«
»Ich verwende nur natürliche Essenzen, konserviert in Öl.«
»Das hört sich ziemlich teuer an.«
Ich nickte. »Stimmt, aber ich sammle meine Fläschchen schon seit fast drei Jahren. Mittlerweile besitze ich über sechzig ätherische Öle. Wenn du magst, kann ich sie dir gerne zeigen.«
»Ein andermal sehr gerne. Aber jetzt muss ich wirklich ins Bett. In knapp sechs Stunden klingelt mein Wecker.« Macy gähnte hinter verstohlen vorgehaltener Hand.
Wie unsensibel von mir. Ich wusste schließlich, dass sie noch vor allen anderen aufstand, um das Frühstück vorzubereiten.
»Natürlich, entschuldige. Danke für deine Hilfe. Ich räume hier noch ein wenig auf und dann verschwinde ich auch ins Bett.«
»Schlaf gut.« Aufmunternd drückte Macy meine Schulter, dann drehte sie sich um und verließ leise die Küche.
Ich leerte das Wasser aus dem Topf, trocknete ihn ab und stellte ihn zurück in den Schrank. Nachdem ich den kleinen Löffel in der Spülmaschine untergebracht und meine Utensilien und die fertigen Kerzen auf das Tablett gestellt hatte, war ich startklar.
Das Wachs in den Gläsern begann schon fest zu werden und der Duft erfüllte die ganze Küche.
Vorsichtig und möglichst leise ging ich hinauf in mein Zimmer. Auf meinem Schreibtisch stellte ich das Tablett ab und betrachtete es eine Weile nachdenklich, bevor ich mich setzte. Dann zog ich einen Bogen Klebeetiketten aus meiner Schreibtischschublade hervor und suchte in meinem Federmäppchen nach einem Kalligrafie-Füller. Ich würde die Kerzen weder verschenken noch in meinem Etsy-Shop verkaufen. Ich trennte drei Klebeetiketten von dem Bogen ab, schloss dann für einen kurzen Moment die Augen und genoss, wie der Duft mein Zimmer eroberte. Zypresse für die unerschütterliche Liebe zwischen Eltern und Kind. Vanille für die Geborgenheit eines Zuhauses. Das hier waren wir. Schwarzer Tee, Rose und Sandelholz. Dad, Mom und ich. Ich zögerte keine Sekunde, als mein Blick auf die drei Klebeetiketten fiel. Ich nannte den Duft »Familie«.
Kapitel 2
Am frühen Morgen schreckte ich plötzlich auf. Dank des beruhigenden Dufts der Kerzen hatte ich tief und fest geschlafen, doch jetzt war ich hellwach. Ein kurzer Blick aufs Handy verriet mir, dass es erst halb sechs war … und dass Tammy immer noch nicht geantwortet hatte. Langsam machte ich mir echt Sorgen; auf dem Weg zur Schule würde ich sie auf jeden Fall anrufen.
Einen Augenblick blieb ich unschlüssig liegen, dann krabbelte ich aus dem Bett und schlich nach unten. Der bevorstehende Schultag machte mich viel zu nervös, um noch einmal einzuschlafen, und vielleicht konnte ich Macy bei der Zubereitung des Frühstücks zur Hand gehen. Immerhin hatte sie mir gestern auch geholfen. Doch als ich die Küche betrat, wurde ich enttäuscht. Zwar blubberte die Kaffeemaschine schon fröhlich vor sich hin und im Ofen backten goldgelbe Brötchen auf, aber von Macy fehlte jede Spur. Vermutlich war sie im Frühstücksraum der Rancharbeiter beschäftigt. Also schnappte ich mir ein paar Würfel Butterkäse aus dem Kühlschrank und beschloss, noch mal nach oben zu gehen, um mich anzuziehen und meine Sachen für den Tag zu packen.
Auf dem Rückweg von der Küche kam ich an Suzans Büro vorbei. Die Tür war angelehnt und ich konnte unterdrückte Stimmen hören. Eigentlich war es nicht meine Art zu lauschen, aber Suzans aufgeregter Tonfall ließ mich hellhörig werden. »Ich sage dir, das ist alles nicht mehr normal.«
»Liebling. Wir finden eine Lösung. So wie wir immer eine Lösung gefunden haben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Ranch finanziell in eine Schieflage gerät.« Ich hörte die Sorge in Richards Stimme, obwohl er alles daran zu setzen schien, meine Tante zu beruhigen.
»Das ist mehr als eine Schieflage. Die Wasserrechnung bricht uns das Kreuz.«
»Ariana wird es bald so gut gehen, dass es sie nicht mehr stört, wenn wir Gäste auf der Ranch haben. Es ist lieb von dir, auf Fremde auf der Ranch zu verzichten, damit sie sich leichter einlebt. Aber die Gästezimmer sind Teil unserer Einkünfte. Sie sind wichtig und ein monatlicher Puffer, auf den wir nicht länger verzichten können.«
»Ich weiß.« Suzan klang resigniert. »Ab nächste Woche inseriere ich wieder. Aber das löst nicht unser Problem. Diese rote Alge vergiftet unser Land. Sie vergiftet unsere Tiere. Und diese plötzlichen Unwetter … Richard, ich habe so etwas noch nie erlebt.« Meine Tante schluchzte auf und durch den Türspalt konnte ich sehen, wie Richard tröstend einen Arm um sie legte.
»Ich habe kaum genug Personal, die Pferde in Sicherheit zu bringen, wenn es wie aus dem Nichts losgeht. Die Blitze schlagen ein, als suchten sie geradezu nach einem Ziel. Ich habe solche Angst.«
Ich schluckte betroffen. So hatte ich Suzan noch nie gesehen. Vor mir wirkte sie immer so tough und selbstsicher. Wieder meldete sich mein schlechtes Gewissen. Die Ranch hatte scheinbar massive Geldsorgen, und trotzdem hatte Suzan das Dachgeschoss aufwendig renoviert und stellte mir obendrein noch ein eigenes Auto zur Verfügung.
Ich hatte genug gelauscht. Leise ging ich die Treppe hinauf und zurück in mein Schlafzimmer. Vor lauter Unbehagen kuschelte ich mich noch einmal unter die Decke, bevor ich das Licht löschte. Ich hatte von den Gewittern gehört, die so rasend schnell und gewaltig über Littlecreek aufzogen. Blitze hatten Scheunen in Brand gesteckt, Bäume gespalten und Pferde getötet. Wie unheimlich!
Zwar hatte ich noch keins dieser Unwetter miterlebt, aber ich war auch nicht scharf darauf. Schon seit meiner Kindheit fürchtete ich mich vor diesem Naturphänomen.
Als ich Schritte auf der Treppe hörte, schloss ich schnell die Augen und tat so, als ob ich schliefe. Meine Tür ging auf, wurde aber kurz darauf wieder leise zugezogen. Bestimmt war es Suzan, die nach mir sah. Sie tat mir leid, weil sie neben dem ganzen Drama um mich und den Tod ihrer Schwester und ihres Schwagers noch so viele andere Probleme zu haben schien. Das war unfair. Genauso unfair, wie mit gerade mal sechzehn Jahren seine Eltern zu verlieren.
Natürlich war ich spät dran, obwohl ich beim ersten Klingeln des Weckers die Beine über die Bettkante geschwungen hatte. Macy, die wieder aufgetaucht war, zog mich liebevoll mit meiner Hektik auf. Suzan guckte finster und hielt sich an einem überdimensional großen Kaffeebecher fest. Richard war schon auf dem Weg zum College. Im Laufschritt eilte ich aus dem Haus, in einer Hand meine Schultasche, in der anderen die Autoschlüssel. Ich lief über den Hof und grüßte ein paar Rancharbeiter, dann zog ich Shreks Tür mit Schwung auf. Meine Sachen warf ich auf die Beifahrerseite, bevor ich auf die erhöhte Sitzbank kletterte. Zum Glück hatten wir Shrek gestern Abend nicht mehr in die Scheune gestellt und auch die Adresse der Highschool war bereits im Navi eingespeichert, sodass ich nicht noch mehr Zeit verlieren würde.
Doch auch wenn ich in Eile war, musste ich unbedingt mit Tammy sprechen. Also klemmte ich die Halterung meines Telefons knapp neben die des Navis, drückte die Kurzwahltaste und schaltete den Lautsprecher an, bevor ich Shrek sanft die Sporen gab und vom Hof rollte. Die schmale, nicht geteerte Landstraße und mein ungezügelter, temperamentvoller Oger forderten meine gesamte Aufmerksamkeit. Schließlich war ich bisher nur in dem braven Kleinwagen meines Vaters gefahren. Gleichzeitig hörte ich mit einem Ohr nervös auf das Klingeln meines Handys. Trotz einer Stunde Zeitverschiebung war ich mir sicher, Tammy zu erreichen. Sie war eine Frühaufsteherin, ganz im Gegensatz zu mir. Es klingelte viermal und ich wollte schon auflegen, als ich plötzlich Tammys vertraute Stimme hörte: »Guten Morgen.«
Vor Überraschung hätte ich fast die falsche Abzweigung genommen.
»Hallo«, antwortete ich knapp. Zwar war ich ihr nicht böse, aber wegen ihres merkwürdigen Verhaltens machte ich mir wirklich Sorgen. »Seit wann spiele ich in unserem Chat denn den Alleinunterhalter?« Ich stimmte absichtlich einen versöhnlichen Ton an, so als würde ich nur Spaß machen.
Normalerweise wäre Tammy darauf eingestiegen, hätte mich »Blödmann« genannt und wir hätten uns so lange gegenseitig aufgezogen, bis wir wieder beste Freundinnen gewesen wären. Stattdessen wirkte sie seltsam kühl und distanziert, als sie weitersprach. »Müsstest du nicht längst in der Schule sein?«
Mein Magen krampfte sich schmerzhaft zusammen. Sie redete so neutral, als sei ich nicht länger Teil ihres Lebens. Aus den Augen, aus dem Sinn. So als habe sie mir am Flughafen zwar nachgewinkt, aber danach meine Nummer direkt aus ihren Kontakten gelöscht.
»Tams, was ist denn bloß los?« Mir war nicht mehr nach Spaßen zumute.
Wieder Schweigen am anderen Ende der Leitung. Um mich herum erstreckte sich die weite Prärie und die Sonne knallte trotz der frühen Uhrzeit unerbittlich vom Himmel. Zum Glück musste ich nur der Landstraße folgen, bis ich in das kleine Industriegebiet gelangte, in dem meine neue Schule lag. Auf dem Weg konnte ich mich nicht mehr verfahren. Also konzentrierte ich mich ganz auf Tammy. »Ich schreibe dir ständig und du reagierst einfach nicht. Tams, ich brauche dich. Ich brauche dich mehr denn je. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo gestrandet und heute ist mein erster Schultag an einer fremden Schule. Ich hätte mir gewünscht, dass wir vorher irgendwie darüber geredet hätten. Immerhin bist du meine beste Freundin! Du hättest für mich …«
»Es tut mir leid«, unterbrach Tammy mich und ihre Stimme klang ernst. »Hier war einfach so viel los …«
Ich spürte ganz deutlich, dass etwas nicht stimmte. »Tammy, was ist passiert? Geht es deinen Eltern gut? Was ist denn los? Oder ist da ein Kerl, von dem ich nichts weiß, der dir das Herz gebrochen hat? Seit ich New York verlassen habe, habe ich ja überhaupt keine Ahnung mehr, was du den ganzen Tag so treibst.«
Mein leidenschaftlicher Wortschwall entlockte ihr ein Lachen und plötzlich klang sie wieder etwas mehr nach der Tammy, die ich kannte. »Nein, kein Kerl in Sicht.«
»Gab es Stress mit deinen Eltern? Musstest du wieder so viel aushelfen?«
»Nein, im Restaurant läuft alles gut. Mom hat gerade erst einen neuen Kellner eingestellt.«
Tammys Eltern besaßen ein Spezialitätenrestaurant, das berühmt für seine pazifische Küche war. Seitdem es in einem landesweiten Zeitungsartikel erwähnt wurde, pilgerten sogar kulinarische Experten aus allen US-Staaten nach New York, um dort essen zu gehen. Das war toll, aber der Erfolg forderte auch harte Arbeit. Und so musste Tammy immer wieder einspringen, wenn ein Kellner krank wurde oder ihre Eltern eine große Gesellschaft erwarteten.
»Was ist es dann? Ich merke doch, dass etwas nicht stimmt.«
Wieder Schweigen.
Nervös klopfte ich mit den Fingern auf das Lenkrad. Ein Blick auf das Navi verriet mir, dass mir nicht mehr viel Zeit blieb, um meiner besten Freundin eine Antwort zu entlocken. »Tammy? Bist du noch dran? Ich bin gleich schon da. Wenn du mir etwas zu sagen hast, solltest du es also jetzt tun.«
Tammy seufzte. »Es ist nichts, okay?«
»Tamsin Malia Firelight.« Mittlerweile klang meine Stimme regelrecht warnend, denn ich wusste einfach, dass sie mir etwas verschwieg. Immerhin waren wir seit dreizehn Jahren befreundet, hatten uns kennengelernt, als ich kaum geradeaus laufen konnte und sie noch die winzigste Dreijährige war, die die Welt je gesehen hatte. Wir gehörten zusammen und zwar in guten wie in schlechten Zeiten.
So schnell würde ich nicht aufgeben, denn bestimmt nahm sie nur Rücksicht, weil sie dachte, dass ich mit dem Tod meiner Eltern schon genug Sorgen hatte.
Tammy, die wusste, dass es ernst wurde, wenn ich sie bei ihrem vollen Namen nannte, seufzte leise.
»Bald«, sagte sie. »Lass mich hier erst einiges klären und ich verspreche dir, ich erzähle dir alles. Bald …«, wiederholte sie. »Gib mir etwas Zeit. Und bitte hab Verständnis, auch wenn es dir schwerfällt.«
Ein komisches Gefühl kroch in mir hoch und ich musste mich konzentrieren, Shrek weiterhin so sicher die Landstraße hinunter zu kutschieren. Das alles hörte sich überhaupt nicht gut an. »Ich will dich einfach nicht verlieren, Tams.« Ich schluckte heftig, um die aufkommenden Tränen zu unterdrücken. In letzter Zeit hatte ich schon zu viel verloren, was mir etwas bedeutete.
»Das wirst du nicht«, erwiderte sie leise und sehr sanft. »Ich denke oft an dich. Ich glaube, ich denke öfter an dich, als du dir das vorstellen kannst. Nur im Moment ist mein Kopf so voll, dass er fast zu platzen droht. Es gibt hier so viel zu organisieren, dass ich einfach nicht dazu komme, dir zu antworten und dir die Aufmerksamkeit zu schenken, die dir zusteht. Das tut mir total leid und ich hoffe, das weißt du auch. Ich mache das nicht absichtlich. Es ist nur einfach, weil …« Wieder brach sie ab. Im Hintergrund hörte ich sie mit Geschirr klappern.
»Ich verspreche dir, ich melde mich. Und bald werde ich dir alles erzählen. Nur gib mir noch ein wenig Zeit.«
Ich musste ihr glauben, ich wollte ihr glauben … ja, ich würde ihr glauben. Sie war meine beste und älteste Freundin, und ich vertraute ihr blind. Daran würden auch die fast 2000 Meilen nichts ändern, die uns nun trennten. »Einverstanden. Aber melde dich, wenn du mich brauchst.«
»Klar.« In Tammys Stimme konnte ich die Erleichterung hören und auch ich war froh, dass wir genug Zeit zum Reden gefunden hatten.
Im selben Moment ragte ein Schild vor mir auf: »Littlecreek Highschool.« Gleich würde ich in das winzige Industriegebiet abbiegen müssen. Es lag noch vor Littlecreek und bereits jetzt war dort mehr los, als ich erwartet hatte. Direkt vor mir bogen zwei riesige Traktoren ab und ich konnte einige Mitschüler in ihren Wagen entdecken. Bei den Entfernungen hier ging wohl niemand zu Fuß, weshalb ich mich jetzt wirklich konzentrieren musste, vor allem weil ich mich noch nicht an Shreks Ausmaße gewöhnt hatte. »Du, ich fahre jetzt in das Industriegebiet und muss ein bisschen aufpassen.«
»Wie? Du fährst?«, fragte Tammy neugierig.
»Ich habe ein Auto geschenkt bekommen. Er heißt Shrek und ich liebe ihn.«
Tammy lachte. »Ich fasse es nicht. Wieso habe ich noch kein Bild von ihm?« Endlich war sie wieder meine alte Tammy.
»Ich habe dir noch kein Foto geschickt, weil du auf meine anderen Nachrichten auch nicht geantwortet hast. Und Shrek und ich konnten warten.«
Tammy lachte schon wieder. »Ich will einen ausführlichen Lagebericht, Miss Clark, und zwar pronto.«
»Wirst du darauf antworten?«
»Das werde ich, versprochen.«
Ein breites Lächeln malte sich auf mein Gesicht. »Abgemacht. Dann bis später.«
»Bis später.«
Wir legten auf und ich manövrierte Shrek die breite Straße entlang. Immer wieder ließ ich den Blick nach links und rechts schweifen, um mir die einzelnen Fabriken anzuschauen. Eine Fabrik verarbeitete Cranberrys, eine stellte alles Mögliche aus Mais her und zwei weitere bauten technische Geräte. Scheinbar war die Wirtschaft hier auf die umliegenden Farmen ausgerichtet. Als ich um die nächste Straßenecke bog, kam das Schulgebäude in Sicht. Nichts daran erinnerte mich an die chaotisch kreative Highschool, die ich in New York besucht hatte. Kein einziges Graffito verunstaltete die schneeweiß getünchten Hauswände, kein Müll lag herum und die Autos auf dem Parkplatz standen nicht kreuz und quer, sondern adrett nebeneinander. Die meisten Schüler hier schienen größere Wagen wie SUVs oder Pick-ups zu fahren. Zumindest mit Shrek würde ich also nicht allzu sehr auffallen. Ich fand einen Parkplatz und stellte den Motor aus, dann zückte ich mein Handy, um ein paar Fotos für Tammy zu machen. Die Grünflächen um das Gebäude herum wirkten perfekt gepflegt, und jeder Baum und Strauch war akkurat geschnitten. Die Wege waren mit breiten Steinplatten belegt, zwischen denen keinerlei Unkraut wuchs. Einige Schüler standen in Grüppchen zusammen und trugen alle eine Art Einheitslook. Die meisten Jungs hatten Bermudas und Polohemden oder schlichte T-Shirts an, während die Mädchen in Shorts oder kurzen Kleidchen unterwegs waren. Alles in allem eher leger und praktisch. Ich erinnerte mich daran, was Suzan mir beim Abendessen erzählt hatte. Vermutlich kamen die meisten meiner Mitschüler von den umliegenden Farmen und waren es gewohnt, bei der Landarbeit mit anzupacken. Auch deshalb schienen sie sich nichts aus ausgefallener Mode zu machen. Niemand schubste irgendjemanden herum, niemand rauchte und bei den meisten hatte ich den Eindruck, dass sie sich schon seit ihrer Kindergartenzeit kannten.
Ich seufzte tief, dann gab ich mir einen Ruck und stieg aus. Eine Gruppe Mädchen, alle bekleidet mit bunten Cowboystiefeln zum Sommerkleidchen, spazierten lachend auf dem Gehweg an mir vorbei. Zum Glück war ich noch halb von der Tür meines riesigen Shreks verdeckt, sodass ich ihnen nicht auffiel. Prüfend sah ich an mir herunter. Meine dunkelgraue Röhrenjeans war an den Knien modisch zerrissen. Dazu trug ich weder Cowboystiefel noch niedliche Ballerinas, sondern meine heiß geliebten neonpinken Chucks. Mein schlichtes weißes Shirt zierte die Aufschrift: »Jeder Mensch ist ein Künstler.« Ich hatte es gemeinsam mit Tammy im Museumsshop des Metropolitan Museum of Art gekauft, das wir häufig zusammen besucht hatten. Irgendwie hatte ich gehofft, dass der Spruch das Eis brechen konnte und ein paar Schüler mich darauf ansprechen würden. Und vielleicht hätte auch jemand das Logo des beliebten New Yorker Kunstmagazins erkannt, das am Saum abgedruckt war. Hier jedoch, da war ich mir plötzlich sicher, würde ich mit diesem Shirt keinen Treffer landen.
Ich griff nach meiner Schultasche, hängte sie mir einmal quer über und schlug dann Shreks Tür zu. Als ich aus dem Schatten der hohen Autos hervortrat, hörte es sich an, als ginge ein leichtes Raunen durch die Luft. Die Tonalität der vorher so ausgelassenen Gespräche änderte sich. Ich spürte förmlich, wie alle sich fragten, wer ich wohl sei. Anscheinend gab es hier nicht oft ein neues Gesicht. Ich versuchte es mit einem freundlichen Lächeln in die Runde, doch die meisten wandten sich ab, sobald sich unsere Blicke trafen. Sie wichen sogar zur Seite, als ich mich auf die Treppe hinauf zum Schultor begab. Das Raunen wurde lauter und ich zog unwillkürlich den Kopf ein, dann passierte ich den Eingang. Hier gab es keine Metalldetektoren, kein Sicherheitspersonal, ja nicht mal Kameras! Das wäre in New York nicht denkbar gewesen. Der Linoleumboden zu meinen Füßen war sauber und spiegelglatt poliert. Keine Brandflecke, keine verschmierten Pop-Tarts in den Ecken, ja sogar der Trinkbrunnen glänzte, als diene er lediglich zur Dekoration. Es roch nach Plastik, Putzmitteln und einem zitrushaltigen Raumspray. In der Schule, auf die Tammy und ich bisher gegangen waren, hatte es zeitlebens nach altem Frittierfett aus der Mensa, stinkenden Turnschuhen und kaltem Zigarettenqualm gerochen, weil eigentlich ständig irgendjemand heimlich auf der Toilette geraucht hatte.
Hier hingegen wirkte alles seltsam perfekt und irgendwie unecht. Die vielen bunten Plakate an den Wänden und die Teilnahmelisten für die AGs hatte niemand heruntergerissen oder mit Obszönitäten beschmiert, und die offiziellen Aushänge mussten nicht hinter Glas geschützt werden. Ungläubig schüttelte ich den Kopf und schoss noch ein Foto für Tammy, dann folgte ich dem Schild mit der Aufschrift: »Schulleitung«.
Auf dem Weg kam ich an mehreren Spindreihen vorbei, wo die Schüler ihre Unterlagen für den heutigen Tag ordneten. Manche drehten sich um und musterten mich neugierig. Aber niemand, auch wirklich niemand, sagte Hallo. Stattdessen sahen sie mich an, als wäre ich eine Außerirdische, die sich nur zufällig nach Littlecreek verirrt hatte. Na, herzlichen Dank. Suzans Prophezeiung, dass ich an der Littlecreek High schnell Freunde finden würde, schenkte ich nun keinen Glauben mehr.
Direktor Carmack klappte meine Akte energisch zu. Die dünnen Haarsträhnen, die er quer über seine beginnende Glatze gekämmt hatte, wehten kurz hoch, um dann leicht zerzaust zurück auf ihren Platz zu sinken.
»Gut, Miss Clark. Das waren die Formalitäten. Sie bringen gute Noten mit, deshalb bin ich mir sicher, dass Sie auch bei uns gut zurechtkommen werden.«
Damit war ich entlassen und stand im nächsten Moment – bewaffnet mit meinem Stundenplan und einem Stapel Bücher – etwas ratlos vor Direktor Carmacks Büro. Normalerweise tauchte zu diesem Zeitpunkt ein Nerd mit Pickeln, Brille und Schulsprecherambitionen auf, der einen herumführte. Oder die lustige überdrehte Außenseiterin, die irgendwann zur besten Freundin werden würde. In meinem Fall erschien niemand. Ich musste meinen Klassenraum wohl alleine finden.
Zum Glück war die Littlecreek High aufgebaut wie die meisten amerikanischen Schulen: durchnummerierte Klassenräume, dazwischen lange Reihen mit Spinden für die Schüler, eine kleine Mensa, eine Schulbibliothek, das Lehrerzimmer mit angrenzendem Sekretariat und ein Raum, der das Reich der Schulkrankenschwester war.
Ich studierte also meinen Stundenplan und wollte mich gerade auf den Weg machen, als mich ein dunkles, warmes Lachen aufblicken ließ.
Neben dem Trinkbrunnen an der nächsten Ecke stand ein großer blonder Typ, der von gleich vier Cheerleadern umringt war. Er trug eine blauweiße Jacke mit einem Pegasus-Emblem, dem Wappentier der Schule. Seine Schultern waren breit und er überragte die Mädchen um fast einen ganzen Kopf. Sie kicherten über jedes Wort, das er von sich gab. Er sah gut aus, aber ich vermutete, dass er eines dieser arroganten Sportasse war, die Frauen gleich grüppchenweise abschleppten. Und genau deshalb sah ich schnell weg, als er meinen Blick auffing und mich anlächelte. Außerdem wollte ich nicht schon am ersten Tag zu spät kommen, also verstaute ich meine neuen Bücher in der Tasche und ging eilig weiter.
Mit klopfendem Herzen betrat ich den Klassenraum, in dem meine erste Stunde stattfinden würde. Unzählige Augenpaare sahen mich an. Ich murmelte ein »Hallo« und suchte nach einem freien Platz.
»Der ist schon belegt«, sagte eine Blondine mit hollywoodreifem Schmollmund, als ich meine Tasche auf den Platz vor ihr legen wollte. Ihr hellrosafarbenes Polohemd spannte über ihrem Busen. Sie musterte mich aus seltsam farblosen, grauen Augen, die nur durch die dick getuschten Wimpern mehr Kontur bekamen. Ihre Haare waren so glatt geföhnt, dass sie fast wie ein Spiegel glänzten, und ich vermutete, dass sie im Gegensatz zu den meisten unserer Mitschüler nicht auf einer Farm aufgewachsen war. Mit ihrem auffälligen Make-up und den perfekt manikürten Nägeln passte sie eher in das sonnige Beverly Hills als in die einsamen Weiten Texas’.
»Oh, tut mir leid«, murmelte ich und wollte den freien Tisch neben ihr belegen.
»Der ist auch nicht mehr frei.«
Ich sah sie an und erntete ein zuckersüßes Lächeln.
»Okay.« Ich deutete auf einen Tisch zwei Plätze weiter. »Und der?«
»Sorry. Belegt.«
Um uns herum hob ein verhaltenes Kichern an. Meine Wangen brannten. »Ist das dein Ernst?«
»Such dir einen anderen Platz.« Sie schien wirklich Spaß daran zu haben.
Ich deutete auf den letzten freien Platz. »Und der?«
Sie schüttelte den Kopf. »Leider nein. Wie wäre es mit dem Fußboden?« Noch mehr Gekicher im Hintergrund. Sie stützte die Ellenbogen grazil auf dem Tisch ab, faltete die Hände und legte dann ihr Kinn darauf. »Oder du gehst dahin zurück, wo du hergekommen bist.«
Ich starrte sie an. Mit so viel offener Feindseligkeit hatte ich nicht gerechnet. »Was ist dein Problem?«
Sie lächelte, aber ihre Augen sprühten Funken. »Wie redest du mit mir? Verschwinde einfach, Großstadtmädchen, und nimm deine geschmacklosen Klamotten gleich mit, ja?« Dann wendete sie sich ab, als sei mein Anblick eine zu große Zumutung für ihre Augen.
Eigentlich hatte ich mir ein Outfit ausgesucht, das eher in die Kategorie ›Hey-sprecht-mich-an-ich-bin-nett‹ fallen sollte, aber offenbar hatte ich das genaue Gegenteil erreicht.
Ich wollte etwas erwidern, irgendetwas Schlagfertiges, Bissiges, das sie in ihre Schranken weisen würde. Doch mir blieben die Worte im Hals stecken. Stattdessen begann alles in mir zu flattern.
Oh nein, bitte keine Tränen.
»Ah, Sie müssen Miss Clark sein.«
Ich drehte mich zu der Stimme um. Ein Mann Mitte vierzig, in staubbraunen Hosen und ungebügeltem Hemd ließ seine Tasche auf das Pult fallen und lächelte mich an. »Willkommen. Ich bin Mr Mallory. Suchen Sie sich doch einen Platz, dann stelle ich Sie kurz der Klasse vor, bevor wir loslegen.«
Etwas hilflos blieb ich stehen.
»Wie wäre es neben Miss Gladis?« Er deutete auf den freien Platz neben der Schmollmund-Blondine, die gerade einen Spiegel und Lipgloss zückte, als wären wir Luft.
»Okay.« Ich ließ mich auf den Platz gleiten, woraufhin Mr Mallory zufrieden zu seinem Pult ging.
Ein Mädchen huschte durch die Reihen nach vorn und stellte der Blondine eine kleine Flasche auf den Tisch. »Dein Wasser, Noemi.«
Noemi sagte weder danke, noch beachtete sie das Mädchen großartig.
Mr Mallory schüttelte den Kopf, schien das Prozedere aber zu kennen. »Wenn wir dann so weit wären, Miss Gladis?«
Noemi ließ ihren Spiegel sinken. »Aber sicher, Mr Mallory.«
Ich warf ihr einen ungläubigen Seitenblick zu. Warum behandelten sie alle wie eine Prinzessin? Ich war ziemlich sicher, dass es die Monarchie in Texas nie gegeben hatte.
Mr Mallory beschränkte sich auf ein paar knappe Infos zu meiner Person, bevor er die Arbeitsblätter austeilte. Ich war der Meinung, nun würde es besser. Doch dann ließ Noemi ihren Kugelschreiber mit voller Absicht vom Tisch rollen. Er fiel geräuschlos zu Boden. Als ich sie ansah, deutete sie mit dem Kopf auf den Kuli. Ich hätte fast gelacht, so absurd war diese Situation. Sie wollte, dass ich ihn für sie aufhob? War das ihr Ernst?
Noch mal deutete sie auf den Kuli.
Ich schüttelte den Kopf.
Sie hob das Kinn und ihre vollen Lippen formten das Wort: »Sofort.«
Mein Herz raste. Ich schüttelte erneut den Kopf und versuchte mich auf den Unterricht zu konzentrieren.
Als Mr Mallory sich zur Tafel drehte, huschte ein Schüler los, hob den Kuli auf und legte ihn auf Noemis Tisch. Wieder kein Dankeschön.
Jetzt öffnete Noemi ihre Wasserflasche. Ich ahnte Böses.
Und richtig, im nächsten Moment stieß sie die Flasche schwungvoll um. Ein Schwall kalten Wassers ergoss sich über mich, bevor die kleine Flasche klappernd auf dem Boden aufkam.
Mein erstickter Laut ließ Mr Mallory herumfahren. Er musterte erst mich, dann wandte er sich an Noemi, als habe er die Situation sofort durchschaut.
»Es tut mir so leid, Mr Mallory.« Noemi lächelte wie ein Unschuldsengel. »Das war ein Versehen. Ich bin mit dem Ellenbogen gegen die Flasche gestoßen.«
Mir rann das Wasser vom Bauch die Oberschenkelinnenseiten hinunter. Ich sah aus, als hätte ich mir in die Hose gemacht. Schon wieder begann alles in mir zu flattern.
Bitte, lass mich aufwachen. Lass mich endlich aus diesem Albtraum aufwachen.
»Miss Clark, suchen Sie ruhig einen der Waschräume auf und trocknen sich etwas ab.« Er sah mich mitleidig an. Ich nickte nur, weil ich einen Kloß im Hals hatte, der mir das Sprechen unmöglich machte. Die Klasse kicherte, als ich aufstand und nach meinem Handy griff. Ich schluckte und sah niemanden an. Als ich zur Tür stürzte, standen Tränen in meinen Augen.
Nachdem ich mich in einem der Waschräume notdürftig wieder hergerichtet hatte, kehrte ich nicht zurück in dieses Haifischbecken, das sich ›Klassenzimmer‹ nannte. Stattdessen kaufte ich mir mit dem letzten zerknüllten Dollar aus meiner Hosentasche eine Coke an einem der Getränkeautomaten und setzte mich auf die Treppe vor dem Schuleingang.