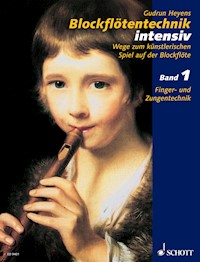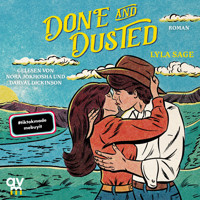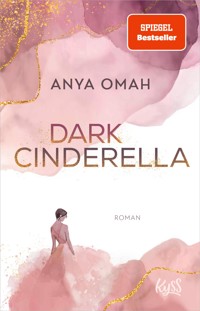2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Plattini-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ferrara 1580. Im Wettstreit der norditalienischen Fürstenhöfe um die brillantesten Dichter und Musiker ihrer Zeit, ziehen Herzog Alfonso II. d`Este und seine blutjunge Gemahlin Margherita Gonzaga mit einer Aufsehen erregenden Neuheit alle Blicke auf sich: Sie stellen drei junge Sängerinnen ein, die unter dem Namen Concerto delle Donne große Berühmtheit erlangen sollen. Im Mittelpunkt des höfischen Lebens mit all seinen Eitelkeiten, persönlichen Niederlagen, Intrigen und Affairen stehen die glanzvollen Feste, bei denen sich Musik, Ballett und Maskenaufzüge in fantasievollster Prachtentfaltung präsentieren. An der Seite der Bellissima, im Schatten der schönen, bewunderten Sängerin Laura Peverara, ist Costanza Leonora Bellincampi auf der Suche nach ihrer wahren Identität und einem Leben jenseits des schönen Scheins.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
MADRIGAL
GUDRUN HEYENS
1. Auflage 2021
ISBN 978-3-947706-49-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de
© Plattini-Verlag – Alle Rechte vorbehalten.
https://www.plattini-verlag.de
Lektorat: Silvia Hildebrandt (Reutlingen) Umschlaggestaltung: Dream Design (Eitzweiler) Konvertierung: Sabine Abels (Hamburg)
GUDRUN HEYENS
MADRIGAL
Zum Buch
Ferrara 1580. Im Wettstreit der norditalienischen Fürstenhöfe um die brillantesten Dichter und Musiker ihrer Zeit, ziehen Herzog Alfonso II. d`Este und seine blutjunge Gemahlin Margherita Gonzaga mit einer Aufsehen erregenden Neuheit alle Blicke auf sich: Sie stellen drei junge Sängerinnen ein, die unter dem Namen Concerto delle Donne große Berühmtheit erlangen sollen.
Im Mittelpunkt des höfischen Lebens mit all seinen Eitelkeiten, persönlichen Niederlagen, Intrigen und Affairen stehen die glanzvollen Feste, bei denen sich Musik, Ballett und Maskenaufzüge in fantasievollster Prachtentfaltung präsentieren. An der Seite der Bellissima, im Schatten der schönen, bewunderten Sängerin Laura Peverara, ist Costanza Leonora Bellincampi auf der Suche nach ihrer wahren Identität und einem Leben jenseits des schönen Scheins.
1Von Mantua nach Ferrara1580
Es war Mai, sehr früh am Morgen.
Costanza stand unter dem hölzernen Vordach, die Tür hinter ihr war zugefallen. Das Licht über den Zinnen des Palazzo, wohin sie blickte, um die Zeit abzuschätzen, war von einem blassen Grau, das noch nichts vom Rosa der aufgehenden Sonne in sich trug. Die Luft war kühl, nur von den Ställen wehte ein warmer Hauch herüber. Sie zog den Umhang enger um sich, doch die Kälte war in ihrem Inneren und ließ sich nicht durch Tuch und Wolle vertreiben. Noch immer war sie benommen von der Nacht, in der schwere Gedanken sie für Stunden wachgehalten hatten, so dass sie kaum wusste, wie sie des Morgens in ihre Kleider gekommen war. Auch hatte sie keinen Bissen Brot zu sich nehmen können, den Brei nicht angerührt und die Milch kalt werden lassen; beherrscht von Unruhe und banger Erwartung verspürte sie keinen Hunger. Hatte sie an alles gedacht, was auf die Reise mitzunehmen war? Sie sah an sich herab, ihre Füße in den neuen, geschnürten Stiefeln standen rechts und links fest neben dem Ledersack, damit er nicht vom Holzsteg auf die nassen, von Pferdemist und Stroh beschmutzten Steine glitt. In ihm war alles, was sie hatte.
Hufgeklapper kam vom Marstall her, sie blickte auf, sah ihren Vater das Gespann vor die Kutsche führen, humpelnd, schief und in der Hüfte eingeknickt von einem lang zurückliegenden Zusammenstoß mit einem Gespann. Sichtbar mühevoll schirrte er die Pferde an, die kleine Wolken in die Luft schnaubten und die Köpfe hochwarfen, so dass das Leder der Geschirre ächzte.
Sie würde ihn für lange Zeit nicht wiedersehen, doch Abschiedsschmerz empfand sie nicht bei dem Gedanken.
Die herzogliche Kutsche stand schon am Tor bereit, in ihr saßen Laura und ihr Vater, der Lehrer Peverara, hinter den burgunderroten Schlägen, auf denen das Gonzaga–Wappen mit seinen schwarzen Adlern rot und gelb leuchtete, selbst im fahlen Morgenlicht. Costanza sah den Kutscher prüfende Blicke auf Deichsel und Geschirr werfen, bevor er auf den Bock stieg und rückwärts in ihre Richtung etwas rief, das wie »Bereit!« klang.
Sie griff nach ihrem Ledersack, wollte schon losgehen, da traf ein kühler Luftzug ihren Nacken, die Tür ging auf, sie wurde hart bei den Schultern gepackt und ins Haus zurückgezogen, wo sie erst vor wenigen Minuten stummen Abschied genommen hatte.
Die Mutter stand vor ihr, sah aus, als kämpfe sie mit sich, als wolle sie ihr etwas mit auf den Weg geben, ein Lebewohl vielleicht, ein Bleib gesund! ein Komm recht bald wieder her, mein Kind. Wie sehnte sich Costanza nach liebevollen Worten, da es das erste Mal war, dass sie den Palazzo für lange Zeit verließ. Aber solche Herzenswärme war nicht üblich zwischen ihnen.
Stattdessen trat die Mutter einen Schritt zurück, entrollte wortlos und in Hast ein Papier vor ihren Augen, das sie in ihren Händen gehalten hatte. Im schwachen Kerzenlicht sah Costanza das Wappen der Gonzaga, das Siegel des Herzogs.
Sie blickte auf, verstand nichts.
»Lies!« Die Mutter starrte sie durchdringend an und flüsterte, obwohl niemand sie hätte hören können: »Dieses ist dein wahrer Name.«
Costanza Leonora Bellincampi di Gonzaga. Das war sie, Costanza.
Die Buchstaben vor ihren Augen führten einen wilden Tanz auf.
Ihr Herz tat einen schweren Schlag, er machte ihr für einen Augenblick das Atmen schwer, trieb dann mit Macht das Blut in ihren Kopf, so dass es hinter ihren Schläfen pochte.
»Lies!« drängte die Mutter sie mit einem Blick, der Costanza ängstigte.
Ich anerkenne, dass diese meine Tochter ist.
Guglielmo Gonzaga, Duca von Mantua. Mai, Anno 1580
Ihre Gedanken stoben davon wie die Funken einer Glut, in die man einen Scheit geworfen hatte, ihr Kopf war leergefegt, als hätte sich kein einziger Gedanke je darin befunden. Sie griff nach dem Tisch, aus Angst zu fallen.
Verschwommen erst, dann immer klarer erschien ihr der Gonzaga vor den Augen; die dünne, scharfe Nase und der zu einer Spitze sorgfältig gestutzte Bart, das dunkle Kraushaar über kindlich runder Stirn und seine engen Augen mit dem listigen Ausdruck eines Fuchses.
Der Duca, mein Vater?, wollte sie fragen, doch bevor ihr die Worte über die Lippen kommen konnten, entriss ihr die Mutter das Dokument, legte es in eine schäbige Schatulle, versenkte diese unter einer losen Holzplanke im Boden und trat sie mit ihrem derben Schuh fest.
Dann packte sie Costanza erneut bei den Schultern, zog ihren Kopf so nah zu sich heran, dass sie ihren warmen Atem spürte, und sagte mit beschwörendem Blick, als wolle sie Costanza mit einem Zauberbann belegen: »Nun weißt du es: Du bist die dritte Tochter des Gonzaga.
Doch kein Wort darüber zu niemandem. Niemals! Gelobe es!«
Costanza war zutiefst erschrocken, hob drei Finger ihrer rechten, bebenden Hand und sagte schwach, so dass sie es selbst kaum hören konnte: »Ich gelobe es …«
»Lauter!«, forderte die Mutter in scharfem Flüsterton.
»Ich gelobe es!« Costanza ahnte jetzt, hier ging es um ihr Leben.
Mit einem Ruck gab die Mutter sie frei, trat einen Schritt zurück und sah sie an mit Augen, in denen etwas aufleuchtete, das ein Triumph sein mochte, doch nur so kurz, dass es kaum zu deuten war. Anstelle eines Abschiedswortes riss sie die Tür auf, und ehe Costanza noch irgendetwas äußern konnte, war sie von den harten Händen der Mutter hinausgeschoben worden.
Sie stolperte über die hohe Schwelle, verfing sich mit einem ihrer Stiefel im Saum ihres Umhangs, wäre fast gestürzt. Krachend fiel die Tür ins Schloss.
In ihren Ohren sauste es, und ihre Gedanken flatterten durch ihren Kopf, ein Schwindel erfasste sie, Halt suchend lehnte sie sich an die Mauer, die unter ihren Händen wohltuend kühl war.
»Costanza!« Der Vater rief.
Sie griff nach dem Ledersack zu ihren Füßen. Camillo Bellincampi, der nie ihr Vater gewesen war, stand bei der Kutsche, hielt die schlaffen Zügel in der Hand und wartete, dass sie käme und einstieg – als wäre sie dieselbe wie vor Minuten.
Wie er so dastand, gebeugt, mit hängendem Kopf, als ginge er in Trauer, war ihr, als sähe sie ihn zum allerersten Mal. Er war ihr fremd wie nie zuvor, kein Tropfen seines Blutes rann durch ihre Adern, das dachte sie in diesem Augenblick und wusste doch zugleich, das hatte sie schon immer im tiefsten Inneren gespürt. Müsste er ihr, der Tochter des Duca, nicht Respekt erweisen?
Wie sollte er? Ganz sicher wusste er kein Wort von dem, was sie jetzt wusste und was sie selbst nicht glauben konnte.
Und trotzdem blieb sie unbeweglich stehen, als wäre er ihr Diener.
Da kam er auf sie zu geschlurft, schulterte stumm den schweren Sack, trug ihn zur Kutsche und ließ den Tritt herunter, wartete fast demütig, bis sie ihm folgte. Mit gesenktem Kopf hielt er ihr die Hand hin, um ihr beim Einsteigen zu helfen. Sie ergriff sie, raffte mit der anderen ihr Kleid, den Umhang, setzte ihren Fuß auf den Tritt, sah ihm in die trostlosen Augen und fühlte eine tiefe Scham für ihr hochmütiges Verharren, das ihn, den Arglosen, herabgewürdigt hatte. Was hatte sie dazu getrieben? Stumm bat sie um Vergebung, sagte: »Ade …«, und legte alle Wärme in dieses eine Wort, doch Vater wollte ihr nicht über die Lippen kommen.
»Gott schütze Euch, und auch die Mutter – sagt ihr dies von mir.« Sie hörte ihre Stimme wie von Ferne, als spräche eine der steinernen Statuen, die in den Sälen standen.
»Tochter. Reise wohl«, antwortete Camillo Bellincampi so leise, dass sie ihn kaum verstand; auch nahm die Zahnlücke, durch die wie stets ein feiner Speichelregen sprühte, seinen Worten alle Klarheit. Sie neigte ihren Kopf zum Abschied, warf einen letzten Blick zurück; hier war sie groß geworden, hier hatte man ihr Kleider und Nahrung gegeben, dies kleine Häuschen bei den Ställen war ihr Zuhause.
Am Fenster bewegte sich das Tuch, dahinter war gewiss die Mutter und sah ihr nach. Doch war sie aufgewühlt und sorgenvoll? Entbehrte sie ihr Kind? Nein, ganz gewisslich nicht. Und wenn es doch so wäre, sie würde es nie eingestehen, das war nicht ihre Art. Die Mutter war ihr niemals zärtlich zugewandt gewesen, war scheinbar ohne Mitgefühl. Selbst als sie ihr vor Wochen verkündet hatte, dass sie, Costanza, nun nach Ferrara müsse, dass sie nun die Zofe von Laura Peverara sei und beide in dem Dienst der Este stünden, dass sie vielleicht nie mehr zurückkehrte nach Mantua – selbst da hatte nicht eine Träne in ihren Augen geschimmert. Vor dieser Herzenskälte war sie mehr zurückgewichen als vor dem Inhalt ihrer Worte, die ihr ganzes Leben auf einen Schlag verändern würden.
Costanza straffte ihren Rücken, hob den Kopf, stieg ein.
Camillo schloss den Wagenschlag, nahm die Zügel und führte die Pferde über den Hof bis hinter die erste Kutsche, neben der die Soldaten der Eskorte bereits aufsaßen. Die Kutscher schnalzten mit der Zunge, die Pferde zogen an. Sie verließen den Hof des Palazzo Ducale in Mantua.
Durch das rückwärtige Fenster sah Costanza Camillo Bellincampi stehen und ihr nachsehen, bis sie über die Zugbrücke gefahren und außerhalb der Schlossmauern war.
Zu dieser frühen Stunde war es noch sehr kühl, in der Karosse aber nahm ihr Lauras Gepäck die Luft zum Atmen. Costanza saß eingezwängt zwischen Truhen und Kisten, die bis unter das Dach aufeinandergestapelt waren. Dicht neben ihr in Pferdedecken und wollene Tücher gehüllt, fest verschnürt, stand Lauras Harfe, eine Kostbarkeit, die sie, käme es zu einem Überfall, mit ihrem Leben zu verteidigen hätte. Über das Kutschendach hinweg wechselten die Wachsoldaten Worte über Wegelagerer und räuberisches Gesindel, mit dem in den waldigen, unübersichtlichen Abschnitten ihrer Wegstrecke zu rechnen sei. Die von lautem Lachen unterbrochenen Bemerkungen jagten ihr umso mehr einen Schrecken ein, als es so klang, als wollten die Soldaten sich selbst Mut machen, indem sie die Banditen verhöhnten.
Auf den unebenen Wegen, wo sich schlammgefüllte Löcher mit sandigen Verwehungen abwechselten, geriet die Kutsche immer wieder aus dem Gleichgewicht; Costanza wurde bald nach rechts, bald nach links geworfen, stieß sich an den messingbeschlagenen Kanten und scharfen Ecken der Truhen und meinte jeden Kiesel zu spüren, über den die Kutschenräder holperten; die Bank, auf der sie saß, war aus rauem Holz und hatte keine Kissen. Staubige, kalte Luft zog durch das offene Fenster, vor dem ein grauer Fensterlappen flatterte. Sie umschlang den schweren Ledersack auf ihren Knien wie etwas Liebgewonnenes, das sie nie wieder loslassen wollte. Er war alles, was sie hatte.
Ich bin eine Gonzaga. Dies dachte sie mit ungläubigem Stolz. Und doch traute sie der Empfindung nicht, die plötzlich die Angst vor der unbekannten Zukunft, die sie in den letzten Wochen eingehüllt hatte wie eine frostige Decke aus Eis, dahinschmelzen ließ. Als wäre sie jetzt eine, die in ihrem Leben nichts mehr zu befürchten hätte! Als wäre sie nicht mehr die, die nach Ferrara reisen sollte als Zofe der Bellissima, welche vor ihr in der herzoglichen Kutsche saß. Als müsse sie nicht länger verzagt auf freundliche Aufnahme beim Duca von Ferrara hoffen – war sie nicht die Schwester seiner Frau, die Schwester Margheritas? Ja, so war es wohl, wenn sie der Mutter glauben konnte. Doch wusste außer ihr dies irgendjemand? Nein. Daher hatte es keinerlei Bedeutung. Rein gar nichts hatte sich für sie geändert. Nicht einmal Margherita wusste etwas anderes, als dass sie Costanza wäre, die Tochter der Bellincampis, der Zofe und des Stallmeisters, die Margherita schon seit Kindesbeinen kannte und die sie wieder bei sich haben wollte in Ferrara. Ihre Zukunft war so ungewiss, wie sie es schon gestern und vorgestern gewesen war. Nach wie vor konnte ihr niemand sagen, was sie zu erwarten hätte und auch nicht, wie viele Jahre Laura in Ferrara bleiben würde. Doch gleich, wie lange Laura bliebe, so lange blieb auch ihre Zofe.
Um die Mittagszeit hatten sie die unwegsame Strecke hinter sich gelassen, ein blauer Himmel spannte sich weit über das frühsommerlich heitere Land. Wenn der Fahrtwind den Fensterlappen blähte, blitzte grelles Sonnenlicht in den düsteren Kutschenraum; Costanza legte beide Hände über ihre Augen. Im bunten Farbenspiel hinter ihren Lidern tauchte das Gesicht Guglielmo Gonzagas auf, sein gleichgültiger Blick, der sie wie zufällig gestreift hatte, nachdem er Laura und ihren Vater gebührend verabschiedet hatte. Sie kannte diesen Blick; so hatte der Duca sie schon angesehen, als sie noch das stille, blasse Kind war, das gemeinsam mit seinen wahren Kindern in dem Schulzimmer über den Büchern saß. Die Male, die er unvermittelt hereingepoltert war und den Unterricht unterbrochen hatte, gleich ob sie gerade lasen oder schrieben, hatte Signor Peverara wie erstarrt und mit höflich gebeugtem Kopf abwartend dagestanden, bis der Duca sein Söhnchen Vincenzo in komischer Manier hatte salutieren lassen und Margherita, seinem Füchslein, zärtlich die roten Locken gezaust hatte. Über sie, Costanza, war sein Blick hinweggeglitten, als wäre da nur ein leerer Stuhl; und doch hatte sie vor ihm gesessen, wie eine von ihnen. Er, der Duca, ihr wahrer Vater, das wusste sie seit wenigen Stunden, schämte sich für sie und hatte sie verleugnet. Wenn sie ihm jemals in den Sinn käme, wenn er sie je erwähnen müsste, würde er sie Bastard nennen. Sie war nur seine illegitime, nicht anerkannte Tochter und damit wenig mehr als nichts. Gewiss kam es ihm gerade recht, dass Margherita sie in Ferrara haben wollte; ein zweifacher Gewinn: Er gab sie einfach Laura mit, so hatte diese eine Zofe, und obendrein galt er, Guglielmo, als liebevoller Vater, der sich wie stets dem Füchslein gegenüber großzügig erwies. Sähe alle Welt auch sie, Costanza, als Guglielmos Kind an, wie Margherita, Vincenzo und die kleine Anna Caterina, dann säße sie jetzt stolz und aufrecht in der ersten Kutsche, dann reiste sie als Hofdame von Margherita nach Ferrara und nicht als Lauras Zofe.
Da wendete Laura ihren Kopf und sah durch das schlammbespritzte Fenster der ersten Kutsche über Pferde und Kutschbock hinweg zu Costanza, als hätte sie gespürt, dass diese an sie dachte. Sogleich fühlte Costanza eine zärtliche Rührung, wollte Laura zuwinken, war so froh, ihr schönes Gesicht zu sehen. Aber Laura lächelte nicht zurück, hielt nur den Kopf erhoben und sah sie ohne Ausdruck an, hob dann mit spitzen Fingern die Kapuze ihres Capes und legte sie behutsam über ihre Haare, damit die Flechten keinen Schaden nähmen. Dann drehte sie sich wieder um und sah nach vorn.
Enttäuscht ließ Costanza die Hand sinken, Laura war jetzt schon eine andere. Doch nein – was für ein einfältiger Gedanke! War Laura nicht schon immer anders als sie alle gewesen, schon immer mehr als nur die Tochter des Lehrers Peverara? Gewiss. Als sie, Costanza, im Frisieren und im Nähen unterwiesen worden war und Margherita sich mit dem Französisch plagte, da wurde Laura von den besten Meistern unterrichtet, lernte singen, übte sich im Harfenspiel. Sie war schon immer eine andere und hatte stets vermocht, das Schöne, das sie in sich trug, der Welt zu zeigen; sie wurde die Bellissima. Da war es nicht verwunderlich, dass der Duca von Ferrara Laura an seinen Hof wünschte, nachdem er sie ein einziges Mal nur hatte singen hören.
Die Kutsche kam mit einem Ruck zum Stehen, schlenkerte schwer hin und her, Kisten, Gepäck und Harfe schwankten, die Fenstertücher flatterten und Staub wehte herein, kratzte Costanza in der Kehle und brannte in ihren Augen. Sie raffte ihren Umhang um sich, öffnete die Wagentür, beugte sich hinaus und sog die kühle Luft ein. Die Kutscher kletterten von den Böcken, auch die Soldaten waren abgesessen und berieten sich über die nächste Etappe des Weges. Costanza setzte vorsichtig einen Fuß auf den von Kutschenrädern zerfurchten Boden und wünschte sich Laura herbei; könnte sie nur zwei, drei Sätze mit ihr wechseln, sie würde sich weniger verlassen fühlen, aber Laura saß in der ersten Kutsche, ihr mit dem Rücken zugewandt. Die blaue Kapuze war auf ihre Schultern gefallen, so dass ihr schmaler, weißer Hals sichtbar wurde, darüber schimmerte ihre Haarkrone wie Gold auf einem alten Gemälde. Sie saß so aufrecht, als wären alle ihre Gedanken in gespannter Erwartung auf die Zukunft gerichtet; dass diese eine glanzvolle sein würde, das war ausgemachte Sache. Sie, Costanza, stünde hinter der Bellissima im Schatten, mit allen Sinnen auf deren Wohl bedacht, damit diese frei von alltäglichen Verrichtungen sich ganz ihrer Kunst widmen könne. Was sie für Laura zu tun hätte, war in Stein gemeißelt, es war nichts anderes, als ihre Mutter für Eleonore, die Gemahlin des Duca, tat. So wie Lavinia Eleonores Haare frisierte, würde auch sie Laura die Haare frisieren, würde ihr das Waschwasser zubereiten, den Abtritt–Stuhl säubern, würde ihre Gewänder bürsten und flicken, sie ankleiden, das Feuer im Kamin bewachen und sie auf Tritt und Schritt begleiten, damit es ihr an nichts fehlte. Gewiss war Signor Peverara besorgt, denn seine schöne Tochter fuhr ins Ungewisse, genau wie sie, Costanza, ihre Zofe. Doch Laura war der Herzenswunsch des Duca von Ferrara, sie wüsste ihn stets hinter sich und hatte außer ihm auch alle Kunst auf ihrer Seite.
Costanza war auf einmal, als täte sich die Erde vor ihr auf, ein tiefer Riss trennte die herzogliche Kutsche von ihrer grauen für die Dienstboten; Lauras Kutscher stand auf der einen, der ihre auf der anderen Seite, wie ein Symbol dafür, dass alle Gemeinsamkeiten hier endeten. Tränen brannten ihr in den Augen, sie drängte sie zurück, aber ihre Hand, die den Knauf der Wagentür umklammert hielt, zitterte. Von einer plötzlichen Mutlosigkeit kraftlos geworden, stieg sie mit unsicheren Beinen wieder ein, ließ sich auf die harte Bank sinken. Könnte sie doch nur neben Signor Peverara sitzen; sie würde, um auf andere Gedanken zu kommen, ihm Geschichte um Geschichte entlocken, als zöge sie Bücher aus den hohen Regalen der Bibliothek. Denn Erzählen konnte er wie kein anderer, so dass sie ihn stets nur widerwillig verlassen hatte und in die dunkle, enge Stube der Eltern zurückgegangen war. Dort hatten Worte nichts gegolten, und Anerkennung gab es nur für stumme Arbeit und blankgeschrubbte Bodendielen.
Costanza zog die Kapuze über den Kopf und schlug den Stoff ihres Umhangs über ihre Beine.
Wie lange wird dies Leben dauern? Sie war schon achtzehn Jahre alt. Wäre sie in Mantua geblieben, würde Camillo ihr einen Ehemann suchen; Gespräche hatte es bereits gegeben. Doch dann hatte Guglielmo Gonzaga sie nach Ferrara verfügt, und ihre Mutter hatte sich ihr offenbart.
Mit Einbruch der Dunkelheit hielten sie in Felonica, um zu übernachten.
Vor der Herberge warteten die Wirtsleute, hielten Laternen in den Händen, die ein geisterhaftes Licht auf ihre mageren Gesichter warfen. Um sie herum drängten sich Kinder, gut fünf an der Zahl, nur spärlich bekleidet, mit grobgeschnitzten, viel zu großen Holzschuhen an den nackten Füßen.
»Madonna …«, hörte Costanza Laura flüstern. Sie hielt den Arm ihres Vaters umklammert und drückte sich mit der anderen Hand ein Tuch auf die Nase. Hinter ihr betrat Costanza die dunkle Wirtsstube, in der Rauchschwaden wie Gewitterwolken unter den schwarzen Deckenbalken hingen. Ein hochloderndes Feuer leckte an einem rußigen Kessel, und über der Kochstelle trockneten in langen Reihen Mais und aufgezogene Bohnen. Aus einer düsteren Ecke grölten ihnen zwei bärtige Gestalten entgegen, die ihre Bierkrüge wie zur Begrüßung hochgerissen hatten und sie, halb über dem Tisch liegend, mit gierigen Augen betrachteten.
Ein schlechter Geruch ließ Costanza unverzüglich ihren Hunger vergessen, und auch Laura schlug ein Nachtmahl aus, so dass Costanza nur um eine Karaffe mit Wasser für die Signora bat und Laura in die Kammer folgte, wohl der besten, die man hier hatte.
Ein Federbett, ein kleiner Tisch und eine Waschschüssel neben einer Laterne, in der eine Kerze glimmte.
Laura stand inmitten des niedrigen Raumes, dessen tiefe Deckenbalken kurz über ihrem Kopf endeten.
Mit angewidertem Gesichtsausdruck sah sie um sich. »Hilf mir aus dem Gewand heraus, Costanza«, sagte sie, und Costanza versetzte es einen Stich, dass sie nicht Liebelein gesagt hatte, wie es bisher unter ihnen üblich gewesen war.
Wenige Minuten später kletterte sie die Stiege hoch zu der Kammer unter dem Dach, die man ihr zugewiesen hatte. Ein Knecht mit Lauras Harfe ging voran und nahm die schiefen, ausgetretenen Stufen allzu unbesorgt. Er weiß ja nicht, was er da trägt, dachte sie in heller Sorge und dankte ihm dennoch freundlich für seine Dienste, als er das Instrument auf dem Boden absetzte. Erstaunt sah er sie an, als hätte niemals zuvor jemand so mit ihm gesprochen, zauste sich dann das ungeschnittene Haar mit beiden Händen, stolperte hinaus und zog die Tür mit übertriebener Sorgfalt hinter sich zu.
Costanza sank auf das Bett, das ihr besonders klein vorkam. Das Stroh im Bettsack knisterte, Halme bohrten sich durch das derbe Sackleinen. Etwas lief am Boden entlang. Durch die Ritzen der rohen Bretter vor dem Fenster drang ein dünner, blasser Strahl vom halben Mond. Sie blies die Kerze aus, legte eine Hand auf Lauras Harfe an ihrer Seite.
Morgen würde Margherita sie Liebelein rufen.
2Die Ankunft
Als sie am nächsten Tag über die gepflasterten Straßen auf Ferrara zu ratterten und die Stadtmauer in ihr Sichtfeld kam, als sie sich in den Strom von Kutschen, Fuhrwerken und mit schwankenden Körben übervoll beladener Wagen, Händlern und fein gekleideten Reisenden zu Pferd einreihten, fühlte Costanza trotz des beängstigenden Gewimmels, wie die Bedrückung von ihr wich. Hier schien eine andere Luft zu wehen, eine verheißungsvolle, die ihr Herz höherschlagen ließ. Es duftete nach Pfefferminze, Anis und Dill und stank nach Pferdemist und Dung, der in der Sonne dampfte. Sie passierten Reiter mit ritterlichem Aussehen auf schweren Rössern, drängten sich vorbei an Eseln, die unter prallen Säcken schwankten und keinen Schritt zur Seite wichen, bis der Kutscher die Peitsche auf sie niedersausen ließ. Die Straße wurde eng, sie durchfuhren einen Markt mit Ständen dicht bei dicht und Buden, vor denen sich Tonwaren auftürmten und Gänse und Hühner ihre Hälse aus Weidenkäfigen streckten; Hasen und Fasane hingen aufgeknüpft kopfüber von niedrigen, windschiefen Holzdächern herab, umwabert von Wolken schwarzer Schmeißfliegen. Sie fuhren so zügig, dass die Menschen angstvoll auseinandersprangen und ihnen Drohgebärden nachschickten.
Die Wachen am nördlichen Stadttor salutierten, traten beiseite, um die herzogliche Kutsche durchzulassen. Costanzas Kutsche jedoch hielt man an. Sie fuhr entsetzt zusammen, als sich ihr durchs Fenster ein grobes Gesicht entgegenstreckte und eine Stimme aus einem von wilden Barthaaren überwucherten Mund »Signora« sagte.
Zusammengekniffene Augen musterten sie, blieben allzu lang an ihrem Hals hängen, sie widerstand dem Drang, dorthin zu fassen. Dann glitten diese unverschämten Augen langsam an ihr herab, über ihr Brusttuch und ihre im Schoß fest verschlungenen Hände, bis sie sich endlich von ihr abwendeten und über die Kisten und das Gepäck schweiften.
»Dieses hier – was führt Ihr da mit euch?« Die Wache deutete auf die Harfe, öffnete schließlich den Wagenschlag und beugte sich herein, um den unförmigen Gegenstand besser in Augenschein nehmen zu können.
Costanza wich vor der mächtigen Gestalt zurück, die Ecke einer Kiste drückte sich ihr schmerzhaft in den Rücken. Sie wollte sich jedoch keine Einschüchterung anmerken lassen und gab ihrer Stimme Festigkeit: »Ein Musikinstrument, Signor. Eine Harfe. Eigentum der Sängerin Peverara, die vom Duca erwartet wird.«
Nach einem Augenblick des Überlegens sprang der Mann vom Trittbrett, schlug die Wagentür zu und gab dem Kutscher ein Zeichen. Die Pferde trabten an, passierten das Stadttor von Ferrara.
Costanza ließ sich zurücksinken, atmete schwer, griff nach einem Tuch und wischte sich mit zitternder Hand die Schweißperlen von der Stirn.
Als sie sich endlich wieder gefasst hatte, wagte sie einen Blick hinaus; sie fuhren in scharfem Tempo geradewegs auf das Castello zu, das sich gebieterisch mit seinen hochaufragenden, roten Mauern vor ihr auftürmte. Wie ein Heiligtum erschien es ihr und ganz anders als der Palazzo zu Hause in Mantua, mit seiner hellen, heiteren Leichtigkeit, trotz seiner unfassbaren Größe.
Die Kutschen fuhren um das Castello herum, dann über eine Zugbrücke und schließlich in einen gepflasterten Hof hinein, das hörte sie am wechselnden Klang der Räder und des Hufschlags. Jetzt erst schlug sie zögernd das Fenstertuch zurück. Die Maisonne füllte den ganzen Himmel aus und strahlte auf einen Ziehbrunnen herunter, neben dem sie zum Stehen gekommen waren. Ein sanfter Wind ließ die Eisenketten, die den Eimer hielten, klimpern und einen filigranen Schatten auf dem Marmor tanzen. Zuversicht keimte in Costanza auf, ließ sie die Bänder ihres Umhangs lösen; indem er auf den Sitz herunterglitt, fiel etwas von ihr ab, das schwer auf ihren Schultern gelegen haben musste, das spürte sie erst jetzt. Doch als der Kutscher die Wagentür öffnete, blieb sie sitzen, wusste nicht, was nun zu tun sei, wohin sie gehen sollte.
In diesem Augenblick sah sie Margherita in den Hof laufen. Sie tauchte so plötzlich hinter einem der schweren Palmenkübel am Rand des Platzes auf, als hätte sie dort nach ihr Ausschau gehalten, um gleich zur Stelle zu sein. Schnellen Schrittes kam sie auf die Kutschen zu, Costanzas Herz flog ihr entgegen, doch gerade noch rechtzeitig gebot sie sich Einhalt. Sie hatte sich zu mäßigen, bis Signor Peverara und Laura ausgestiegen waren; es gehörte sich nicht, dass die Zofe vor der Dame begrüßt wurde. Mit wehendem, von keinem Band gehaltenem Haar, wirr und lockig wie bei einem Wildling, wäre die Duchessa dem Nächstbesten in die Arme gefallen, so wenig machte sie sich aus der Etikette. Ein wenig hinter ihr, in schwarzer Seide, schritt ernst und gemäßigt der Duca, Alfonso II.
Costanza wusste, dass er dreißig Jahre älter war als sie, seine dritte Frau, das hatte Margherita ihr gesagt und auch, dass dies nichts zur Sache täte, da sie ihn liebe und ganz gewisslich er auch sie. Ja, dachte Costanza, das kann wohl sein, so wie Alfonso ihr ausgelassenes Gebaren hinnimmt und ihr mit einer milden Wärme in der Miene nachschaut, fast wie ein kluger Vater.
Der Herzog begrüßte nun Laura mit einem Lächeln, aus dem die reine Freude alle Zurückhaltung vertrieben hatte. Sein Ziel war erreicht, die schöne Sängerin war sein, er würde sie singen lassen, so oft er wollte.
»Signora«, sprach er mit Herzlichkeit, »Ihr seht mich hocherfreut. Ihr wart sehnlich erwartet von mir und der Duchessa, da es schon lange mein Wunsch war, das Castello von Eurem Gesang erfüllt zu hören. Ihr wisst – ich sagte es so viele Male schon und schrieb es auch –, nichts Schöneres habe ich je vernommen. Nun seid Ihr da, Ihr sollt es nicht bereuen. Wir heißen Euch willkommen!«
Costanza stand in angemessener Entfernung, sah Laura zurückhaltend lächeln, jedoch mit einer Röte auf den Wangen, die man nur selten bei ihr bemerkte. Sie schwieg, ihr Vater sollte wohl für sie antworten, doch noch während Signor Peverara sich zeremoniell verbeugte, ergriff bereits Margherita ungeduldig das Wort: »Jetzt ist mein Leben vollkommen, da ich meine liebsten Freundinnen bei mir habe!« Sie klatschte in die Hände wie ein Kind, sprach mit heller, aufgeregter Stimme und mäßigte sich erst, als Alfonsos Blick sie streifte.
Als der Herzog Costanza zu sich gewunken hatte und sie die wenigen Schritte auf ihn zugegangen war, sah sie zu Boden und beugte ein Knie um wenige Zentimeter. Nur eine Andeutung der Ehrerbietigkeit. Sie würde sie nach und nach verringern, bis sie gerade stehenblieb und auch den Blick nicht länger senkte, sondern offen in jedermanns Augen schaute.
Das hatte sie sich vorgenommen.
»Die Herzogin ist erfreut – da sie es ist, bin ich es gleichwohl auch«, sagte Alfonso, indem er sie mit leichter Hand emporzog. Eine heiß aufwallende Freude fuhr ihr ins Herz, das sich plötzlich mit allem, was sich an Sorgen darin angesammelt hatte, wie von selbst ausschütten wollte. Noch bevor sie diese Regung unterdrücken konnte, hörte sie sich sagen: »Hoheit, ich bin voll des Dankes gegenüber Eurer Großzügigkeit und auch der Freundlichkeit der Duchessa, dass sie mich nicht zurückgelassen hat in Mantua …«
Sie stockte, errötete, wurde sich der Ungehörigkeit bewusst, gesprochen zu haben, während Laura, ihre Dame, schwieg. Signor Peverara zupfte an seinem Rock, als wäre dort etwas in Unordnung geraten, das es zu richten galt. Der Herzog blickte Costanza verwundert an. Madonna, was dachte er von ihr und ihrem ungehobelten Benehmen? Scham überspülte sie; und doch hielt das Gefühl der Zuversicht an. Eine Stille trat ein. Die Pferde schnaubten und scharrten mit den Hufen.
Margherita rührte sich als Erste und rief: »Aber Liebelein, was redest du! Was wären wir ohne dich?«
Sie lachte, ergriff mit der einen Hand Costanza, mit der anderen Laura und rief dem bei den Kutschern wartenden Lakaien zu, er möge die Dame d`Arco herbeiholen, die gewiss schon längst zur Begrüßung bereitstünde.
In dem Moment kam Livia, die Kleine, die Margherita vor einem Jahr als ihre Hofdame mit sich genommen hatte, schon über den Hof gelaufen. Mit einer Hand das Kleid unziemlich hochhaltend, so dass man ihre roten Strümpfe sah, lief sie vorbei an den ratlos herumstehenden Kutschern, die keine Order bekommen hatten, wohin mit den Pferden, den Kutschen und wohin mit sich selbst, hungrig, durstig und müde nach der zweitägigen Reise. Livia hatte sich um keinen Deut verändert, dachte Costanza, eine Dame war aus ihr noch nicht geworden, auch merkte man ihr heute so wenig an wie je zuvor, dass Livia von Adel war. Wie eigenartig tröstlich war ihr der Gedanke und wie vertraut ihr kleines, herzförmiges Gesicht!
Costanza streckte beide Arme nach ihr aus im Überschwang, doch Livias schmale, braune Augen gingen unschlüssig hin und her zwischen der Bellissima und ihr. Costanza ließ sogleich die Arme sinken, und Livia verstand das Zeichen, lief hin zu Laura und umarmte diese. Deren Miene zeigte eher Gleichmut als Wiedersehensfreude; sie strich steif über Livias rührend kindliche Wange, der vom berühmten Tasso besungenen in fünf Sonetten und drei Madrigalen – in dieser Hinsicht standen Laura und Livia sich in nichts nach. Doch kannte man den Grund für Tassos Ehrung: Bei Livia war es der Stand, bei Laura deren Kunst, obwohl auch Livia als Sängerin und Gambenspielerin am Hofe war. »Doch ist sie jung und braucht noch Zeit, bis man sie als Sängerin wird präsentieren können«, hatte Margherita Costanza nach Mantua geschrieben. »Bisher noch zeigt sie sich geduldig, lässt sogar Unterweisungen im Sticken und Spinnen über sich ergehen, danach aber eilt sie stets unverzüglich in ihre kleine Kammer und zieht die Tür hinter sich zu. Über viele Stunden sirren gleich darauf Töne durch die Ritzen der Tür in den Flur, so dass die Pagen aufhorchen und für Augenblicke ihre Schritte zügeln.« Was ihren Gesang jedoch betrifft, hatte Margherita noch hinzugefügt, brauche es allerdings wohl noch seine Zeit; Signor Luzzaschi, der die Aufsicht über alle Musik am Hofe hatte, rechne schon noch mit einigen Jahren.
»Liebelein!«, rief Livia und eilte nun auf Costanza zu. Eine Strähne löste sich aus ihren Haaren, deren haselnussbraune Farbe dieselbe ihrer Augen war. Die Strähne fiel ihr in die Stirn, sie blies sie unbekümmert fort, wie sie es immer schon getan hatte.
Costanza breitete erneut ihre Arme aus und drückte Livia so fest an sich, dass diese sie schließlich sanft von sich schob.
»Liebelein«, sagte Livia noch einmal, jetzt ein wenig atemlos, und Costanza musste die Tränen zurückhalten, so innig und vertraut klang ihre Stimme, »wie schön, dass du gekommen bist!«
3Das Concerto delle Donne
Ein schwacher Strahl der Nachmittagssonne fiel durch die schmale Glasscheibe in der Wand, die Costanzas fensterloses Zimmer von Lauras Gemach trennte. Bei Laura war es noch hell und sonnig, während sie schon in den frühen Abendstunden die Lampen anzünden musste.
Costanza war unsicher, ob sie durch das mit dicken Trauben– und Weinblattornamenten verzierte Holz der Verbindungstür Lauras Stimme hören würde, wenn diese nach ihr verlangte, deshalb ließ sie die Tür stets einen winzigen Spaltbreit offenstehen.
Einer kleinen Schatulle entnahm sie das einzige Schmuckstück, das sie besaß, einen grünen, klaren Bernstein in der Form eines Tropfens, der an einem schmalen Lederband hing. Ihn heute zu tragen, würde ihren ersten Tag in Ferrara in besonderer Weise würdigen. Still für sich wollte sie diesem Tag Glanz verleihen, wollte den Schritt in ihr neues Leben zuversichtlich und mit allen Sinnen tun als die, die sie im Innersten war, ganz gleich, als was man sie ansah.
Ein letzter Lichtstrahl ließ den Bernstein in ihrer Hand aufleuchten wie ein wertvolles Juwel. Sie nahm das als ein gutes Omen und legte das Band um ihre Stirn, den Stein in die Mitte über ihre Augenbrauen, da, wo sie zusammentrafen, und verknüpfte das Band am Hinterkopf. Ihr Haar, dunkel wie das einer Sizilianerin, hatte sie zu einem kunstvollen Knoten verschlungen, der bis in den Nacken fiel und oberhalb der mit roten Ornamenten bestickten Einfassung ihres Kleides endete. Das Gewand war ihr durch einen Lakaien geschickt worden, als eines von vielen, die noch folgen würden.
»Der Hof kleidet seine Damen und die Zofen seiner Damen«, hatte er sie belehrt, als er ihre Verwunderung bemerkte. Es war ein Kleid aus einem leichten, weichen Tuch, kastanienbraun mit lichten Seidenschleifen an den Schultern und an den weiten, bis auf die Hand fallenden Ärmeln. Sie waren nach der Mode geschlitzt und nur über den Handgelenken durch ein Seidenband zusammengehalten. Ein ähnlich schönes Kleid hatte sie nie besessen, und doch wünschte sie sich ihr altes, einfaches Gewand zurück, das die Blicke von ihr auf Laura lenken würde. Allein der Bellissima stünde solcherlei Glanz und Beachtung zu, ihr Platz war in Lauras Schatten.
Die Zeiger der kleinen Standuhr auf dem Marmorsims bewegten sich gegen fünf. Stand Laura wohl schon bereit für den Empfang der Sängerinnen in der Sala Grande?
Die Gemächer des Duca lagen auf der anderen Seite des Castello, um den Löwenturm herum, weit ab von ihren, die zu Margheritas Gemächern gehörten. Sie und Laura hätten einen Weg zurückzulegen, den sie nicht kannten; ohne einen Pagen, der sie führte, wären sie verloren, kämen nicht zur rechten Zeit. Das wäre undenkbar.
Die Tür ging auf, im Rahmen stand Laura, eingefasst von dem dunklen Holz wie ein Gemälde. So schön wie sie war keine, so unvergleichlich zart. Perlenreihen schimmerten auf ihrer hellen Haut, auf der es nichts zu überpudern gab. Blassblaue Seide umhüllte sie wie eine Wolke aus glitzernden Eiskristallen, und Spitze, hellgrün und kostbar wie die zerbrechliche Schale eines Stareneis, bedeckte ihre Brust. Ihre Augen jedoch, wasserblau wie die Farbe ihres Gewandes, waren kalt wie der Steinboden, auf den man frühmorgens die Füße setzte, und sie sprach im neuen Italienisch, das nicht üblich war zwischen ihnen.
»Wird es nicht Zeit, Costanza? Solltest du mich nicht mahnen?«
»Gewiss, Bellissima.«
Costanza überwand einen Widerstand, sagte sich, dass Laura nervös sein musste; es hing so viel von diesem ersten Zusammentreffen der Sängerinnen ab, Alfonso und Margherita setzten ihre höchsten Erwartungen in sie. Nun müsse Laura beweisen, dass sie die war, die man im ganzen Land lobte. Laura war besorgt, das war verständlich, sie brauchte ihre Nachsicht und ihre ganze Gutherzigkeit.
»Ich rufe nach dem Pagen, der uns den sichersten und schnellsten Weg zeigt«, sagte Costanza in ruhigem, freundlichem Ton, hob ihr Kleid an und eilte auf beflissene, doch nicht unterwürfige Weise davon.
Wenige Minuten später traten sie durch die Tür der Sala Grande.
Margherita stand in der Mitte des Saales umgeben von prunkvollen, mannshohen Spiegeln, an ihrer Seite Livia, die ihre Hände fest verschlungen hielt. Man wartete auf den Duca. Die dritte Sängerin fehlte.
Margherita hatte eine strenge Miene aufgesetzt, winkte sichtbar ungeduldig einen Lakaien herbei und gab ihm die Order, er möge sich zum Haus des Dichters Guarini begeben.
»Eine Botschaft an die Dame Guarini: Man erwarte sie zur Begrüßung Laura Peveraras und zur ersten Zusammenkunft des Concerto delle Donne. Der Duca selbst wird die Sängerinnen beehren und in Augenschein nehmen.«
Sie hielt kurz inne und setzte dann in schärferem Ton hinzu:
»Wie sie wohl weiß … Beeile Er sich!«
Der Lakai entfernte sich rückwärts und gebeugt, dann im Laufschritt durch die Tür.
Costanza stand wenige Schritte hinter Laura, die unschlüssig schien, was sie zu tun hatte, und abwartete.
So gut es ihr bei gesenktem Kopf möglich war, ließ Costanza ihren Blick durch den Saal wandern, fragte sich, wo ihr Platz sei, wenn Laura zu Margherita gerufen wurde.
Weit hinten, an der Kopfseite, vor einer Wand mit golddurchwirkten Tapisserien, die eine liebliche Landschaft zeigten, stand ein Cembalo, leuchtend Blau wie Lapislazuli. Daneben, wie von einem Meister wirkungsvoll an diesen Platz gestellt, ein mittelgroßer, hagerer Mann in rosenroten Kniehosen, die weißen Strümpfe in glänzenden Schnallenschuhen, eine Hand geziert auf den Rand des Instrumentes gestützt. Er stand reglos, pfeilgerade.
Die letzten Sonnenstrahlen fielen durch eines der hohen Fenster, Margheritas Locken sprühten.
Sie ist mehr noch ein Kind als eine Duchessa, dachte Costanza, so, wie sie angekleidet ist mit diesem Margeriten–Stirnband und dem weißen, blumenbestickten Kleid, das sie umspielt wie der Frühlingswind.
Da gab Margherita Laura ein Zeichen, und diese ging zu ihr hin, setzte dabei ihre Füße mit exquisiter Genauigkeit auf, als liefe bei der kleinsten Erschütterung ihres Körpers die Haarkrone Gefahr, von ihrem Kopf herunterzurutschen – dabei hatte Costanza zehn Perlennadeln hineingesteckt.
Jetzt erst bemerkte Costanza zwei winzige Gestalten, die auf der anderen Seite der Tür Posten bezogen hatten.
Nie zuvor hatte sie Zwerge gesehen, zwar von ihnen gehört, das schon, jedoch hatte man keine in Mantua gehabt. Die beiden hüpften in komischer Manier und warfen rote Kappen, die Dogenhüten glichen, in die Luft. Indem sie sie auffingen und wieder lustig hochwarfen, sprachen sie kein einziges Wort, nur ihre Augen zwinkerten, und ihre rotbemalten Münder lachten. In dem des Weibleins sah sie schlechte Zähne, gelb und vereinzelt, und die Haare des Männleins waren grau und borstig wie bei einem alten Mann. Seine vom Grimassieren groben, runzligen Gesichtszüge passten gar nicht zu der Ausgelassenheit, die er ohne Ursache zur Schau stellte. Costanza fühlte eine Schamröte in ihre Wangen steigen, konnte aber den Blick nicht abwenden von ihren großen Köpfen auf den winzigen Körpern, an denen sonst alles vorhanden zu sein schien, als wären sie Kreaturen des Schöpfers wie ihresgleichen. Und doch, wie hatte man ihnen zu begegnen, sich ihnen gegenüber zu verhalten?
»Ercolino und Nicoletta!«, stellte Margherita die beiden vor. Sie musste wohl Costanzas Ratlosigkeit bemerkt haben und wies zuerst auf das Männlein, das in seinen kurzen giftgrünen Samthöschen eine komische Verbeugung machte, so dass seine Nase fast den Boden berührte. Dann auf das Weiblein, das im ebenfalls grünen Röckchen knickste, als sei sie ehrerbietig, aber durch ein Zuspitzen ihrer Lippen einen Kuss formte, was so unerhört war, dass Costanza meinte, einen Spuk gesehen zu haben. Ihr kam nichts anderes in den Sinn, als dass es sittsam wäre, ihnen die Hand zu reichen. Schon machte sie einen Schritt auf sie zu, da rief Margheritas Stimme sie zurück:
»Aber Liebelein!«
Ein neuer, harter Klang lag in diesen beiden Worten, der Costanza zusammenzucken ließ. Die Kleinwüchsigen dienerten und knicksten und lachten weiter, doch Margherita machte eine Handbewegung, als wolle sie etwas Lästiges verscheuchen. Und wirklich: Die beiden Zwerge huschten lautlos in ihren Samtstiefelchen davon und auf ein Türchen zu, das in der Nähe der großen Saaltür in die Wand eingelassen war. Verwirrt sah Costanza ihnen nach und wunderte sich, dass beide ohne Mühe und ohne sich auch nur zu ducken verschwanden. Ihr Herz schlug heftig, als sie sich den Frauen wieder zuwandte und Margherita sie herbeiwinkte, damit sie sich begrüßen konnten.
»Zwerge, Liebelein«, sagte sie mit noch kühler Stimme, »zu unserer Unterhaltung. Die Hoheiten vor mir hielten sie sich immer schon. Beachte sie nicht, sie sind bloß Ornament.«
Damit breitete sie ihre Arme aus.
Costanza zögerte. Bei allem, was sie über ihr neues Leben in Ferrara besprochen hatten, war nie die Sprache darauf gekommen, wie sie zukünftig miteinander umzugehen hatten unter den neuen Verhältnissen und der unübersehbaren Ungleichheit. Doch dann ging sie auf Margherita zu, legte ihre heiße Wange an die kühle des Füchsleins und umfing ihre Mädchenschultern mit ihren Armen. Über sie hinweg sah sie Laura lächeln, ein feines Lächeln, das nicht zu deuten war.
Da trat der Duca ein, und eine Dame, hochgewachsen, mit blassem Antlitz, das eine stille Würde beherrschte, schritt an seiner Seite. Das musste Anna Guarini sein.
Die Lakaien schlossen die Tür hinter ihnen, nahmen Aufstellung rechts und links, Costanza gab Margherita frei und trat zurück.
Alfonso durchmaß den hellen, langgestreckten Raum mit großen Schritten, ging auf eine Gruppe Lehnstühle in der Nähe des Cembalos zu, die Duchessa und die Damen folgten ihm, nahmen Platz. Auch Luzzasco Luzzaschi am Cembalo forderte er auf, dass er sich setze. Costanza beachtete er nicht, nahm wohl an, dass die Zofe wusste, wo sie zu stehen hatte. Zögernd ging sie auf eine der Fensternischen zu, in die Holzbänke eingelassen waren; doch setzte sie sich nicht, um rasch zur Stelle zu sein, wenn Laura sie brauchte. Nur hob sie hin und wieder den Kopf so weit, dass sie unbemerkt betrachten konnte, wie Laura, Anna und Livia vor den Hoheiten standen. Ein zauberhaftes Bild: Drei junge Sängerinnen von großer Schönheit und Anmut, unterrichtet von den besten Meistern der Musik, wenn man den Berichten Glauben schenken durfte. Drei Damen, die nur für den Duca und die Duchessa singen würden; eine Musica secreta.
Alfonso glühte, sah jünger aus als gestern noch, jetzt, da er seine Sängerinnen erstmalig zusammenstehend vor sich sah. Und auch das wohlgefällige Lächeln fiel Costanza auf, mit dem er die Damen sich setzen hieß und zusah, wie sie ihre Kleider ordneten. Mit der rechten Hand strich er sich währenddessen über den grauen, spitz zugeschnittenen Bart, die Linke spielte mit den Gliedern einer Goldkette, die unter seinem schwarzen Seidenrock sichtbar wurde.
Margheritas Blick, der über Annas Gesicht streifte, war ernst, als prüfe sie, wie die Guarini Laura, die neue Sängerin, aufnähme. Anna hätte eine widerspenstige, stolze Natur, wusste Costanza von Laura, auch habe sie sogar die Ehre, im Castello Wohnung zu nehmen, missachtet und war bei ihrem Vater wohnen geblieben; zwar wenig mehr als in Rufweite, aber doch außerhalb der Schlossmauern.
Anna wendete Costanza ihr sanft geformtes Profil zu. Ein zartes, netzartiges, von kleinen Edelsteinen besetztes Gespinst hielt ihre schweren, dunklen Haare zusammen, die hohe Stirn zierte ein schwarzes Band mit einem großen, tiefrot funkelnden Granat. Tiefrot und schwarz war auch ihr Kleid aus Samt mit goldfarbenen Bordüren an den Schultern und am Mieder. Sie war größer als Livia und Laura und von kräftiger, ebenmäßiger Gestalt, das fiel Costanza ins Auge, auch, dass ihr Atem heftig ging. Im sichtbaren Auf und Ab ihrer Brust sprühte ein mit Edelsteinen besetztes Medaillon vielfarbige Funken, als wäre tief in ihr ein mühsam unterdrücktes Feuer, das mit aller Macht hervorbräche, wenn sie nur den Mund aufmachte. Aber ihr Blick war gleichmütig, als wäre sie mit den Gedanken weit weg, als ginge sie nicht an, was Alfonso jetzt bewegt zu ihr, Laura und Livia sprach:
»Die größte Kunst wird nun auf den Umgang mit den Damen zu verwenden sein, die bisher für uns sangen und die zu hören uns immer ein Vergnügen war: Donna Marchesa Bentivoglio und Donna Contessa Macchiavelli.
Sie bleiben, was sie waren und sind: edle Damen des Hofes. Wir schätzen sie und begegnen ihnen weiterhin mit unverminderter, größter Hochachtung.«
Alfonso sprach langsam, als wähle er seine Worte mit Bedacht, machte deutlich, dass er Herabsetzung und Neid vermeiden wollte, dieses schade dem Ruf des Hofes, der in dieser Hinsicht andere Herzogtümer übertraf.
»Gleichwohl haben sich die Zeiten geändert und mit ihnen die Kunst; wie sehr auch die Musik, weiß Signor Luzzaschi am besten zu sagen – meint Er nicht?«
Luzzaschi erhob sich von seinem Cembaloschemel, deutete steif eine Verbeugung an und setzte sich wieder.
»Auf anderen Gebieten kenne ich mich besser aus,« fuhr Alfonso fort, »wüsste, was die Jagd angeht, sehr genau alle Einzelheiten zu beschreiben, auch, was die antiken Traditionen betrifft …«
Er hob den Blick an die Decke, nicht ohne Stolz, alle Augenpaare folgten ihm. Auch Costanza hob ihren Kopf, rasch, unauffällig, sah unbekleidete Athleten ringend und Steine werfend auf Holzkassetten gemalt, die ihr von oben entgegenblickten.
»Gleichwohl ist die Musik meine Leidenschaft; was ich höre, erfüllt mein Herz, vorausgesetzt, der Gesang ist von erlesener Güte und zeichnet sich durch vielfältige Einfälle aus. Die neue Art zu singen schätze ich hoch und möchte sie zu noch schönerer Blüte bringen, wenn ich auch den Unterschied zum alten Stil nicht genau zu benennen weiß, das gesteh ich frei …«
Hier hielt Alfonso inne, verfiel in eine kurze Grübelei, hob aber dann wach den Blick und sah Livia d`Arco an, der sogleich eine Röte in die Wangen schoss.
»Ihr, Signora d`Arco, habt euch noch zu gedulden und weiterhin zu vervollkommnen. Derweil Signor Giulio Brancaccio eure Stelle einnehmen wird, ein altgedienter …« Hier stockte er, fuhr aber nach kurzem Bedenken und einer kleinen wegwerfenden Handbewegung fort: »Ein altgedienter Sänger, ein Basso. Ich ziehe in Erwägung, ihn an den Hof zurückzuholen, aus Rom. Möglicherweise in wenigen Monaten schon. Zu unserer Freude.«
Ein Räuspern war zu hören, es kam von Luzzaschi am Cembalo. Er saß unverändert, die Hand auf dem Rand des Instrumentes, ein Bein vor dem anderen, die Füße in gezierter Position. Margherita hatte bis jetzt mit ihren Augen an den Lippen ihres Gemahls gehangen. Nun wechselten sie und Luzzaschi einen kurzen Blick, nur Livia schaute zu Boden. Die Kleine, dachte Costanza, sie hatte sich bestimmt von dieser Audienz versprochen, von nun an zu den Sängerinnen zu gehören, obwohl sie schon von Margherita einen Hinweis bekommen hatte, dass der Meister Luzzaschi noch Einwände hätte. Stünde sie nicht hier als Zofe an der Wand, hätte sie Livia fest in die Arme geschlossen, um ihren Kummer zu vertreiben.
»Zusätzlich sei gesagt«, ergänzte Alfonso, als hätte er gemerkt, wie seine Worte Livia trafen, »dass ein langsamer Beginn von Vorteil ist für alle. Um eines Tages hohe Kunst zu machen, die in aller Welt Anerkennung erfahren, ja, ein ehrfürchtiges Staunen hervorbringen wird, ist es vonnöten, dass man sich zunächst einander zuwenden und kennenlernen kann.«
Livia nickte, unterdrückte ihre Tränen, versuchte ein Lächeln; Costanza schmerzte ihr Anblick. Doch Alfonso ließ seine Augen zärtlich auf der Kleinen ruhen, als wüsste er schon jetzt, dass sie die drei Sopranstimmen aufs Allerfeinste ergänzen würde, talentiert, wie Livia war und überdies eifrig und leidenschaftlich auch im Gambenspiel. Als wolle er ihr nur Zeit zum Reifen geben.
4Laura singt
Luzzaschis Blick hing an Laura.
Eben noch hatte sie gesungen, als sei sie mit der Amsel, deren Flöten vernehmlich durch das weit geöffnete Fenster ihres Gemaches drang, in einen Wettstreit getreten.
Kleine Melodien, bestehend aus wenigen Tönen, ein Frage– und Antwortspiel, so schien es, in dem die Sängerin mit klarer, hoher Stimme Töne wie Perlen aneinanderreihte, während der Vogel langgezogene Pfiffe mit sprunghaftem Trillern und Tirilieren abwechselte; dazwischen Stille, als hörten sie sich zu, um voneinander zu lernen.
Aber so war es nicht. Die Sängerin stand vor dem Fenster, einzelne Blätter in der Hand haltend, von denen sie die kurzen Melodien abgesungen und so oft wiederholt hatte, bis sie keinen Blick mehr auf die Noten werfen musste.
Versunken und weltentrückt, wie sie Luzzaschi vorkam, nahm sie von keiner Amsel Kenntnis.
Er hatte sich in den Lehnstuhl neben dem Marmorsims gesetzt, um die Sängerin besser im Blick zu haben. Angesichts ihrer außerordentlichen Erscheinung war er froh, sich für diesen wichtigen Anlass angemessen gekleidet zu haben: Den Wams aus hellgrauer Seide, dazu die grillengrüne Kappe, die seine grauen Locken, die darunter hervorquollen, ins rechte Licht setzte. Es musste der Peverara von vorneherein klargemacht werden, wen sie vor sich hatte: Den Leiter der Cappella di musica, mit einem Wort, die wichtigste Person am Hofe für alle musikalischen Belange. Das wollte er ihr nicht wortwörtlich sagen müssen, aber erkennen sollte sie es schon.
Er selbst hatte der Sängerin die Notenblätter überbracht, im Namen des Duca, der ihn beauftragt hatte, Nachforschungen anzustellen, ob es ein Lehrwerk über die neue Art zu singen gäbe.
Natürlich hatte er gleich gewusst, an wen sich in dieser Angelegenheit zu wenden war; er hatte vielerlei Beziehungen nach Rom, Florenz, Venedig und kannte den Komponisten Bassano, der etwas verfasst hatte, was Bedeutung erlangen sollte. Diesem jedoch fehle das Geld und auch ein Fürsprecher, hieß es aus Venedig, der seinem Buch so viel Gewicht beimaß, dass man es in Druck geben könne. Gerne hatte er sich bereitgefunden, das Manuskript auf seine Brauchbarkeit hin zu prüfen. Wer, wenn nicht er, Luzzasco Luzzaschi?
Ganz nebenbei trug er selbst Nutzen davon, wenn er Alfonso so weitreichend zu Diensten sein konnte. Nicht dass auch nur der Schatten einer zu geringen Wertschätzung auf seine Person oder sein Amt gefallen wäre! Da war nichts. Höchstens, selten, hatte er bei den Damen und Herren des Hofes Belustigungen beobachtet, die sein Aussehen betrafen, das sich abhob vom bescheidenen Dunkel der Höflinge. Das nahm er eher als Kompliment denn als Kritik.
Neugierig hatte er einen Blick auf Bassanos Manuskript geworfen, das, fein säuberlich und gut lesbar geschrieben, so aussah, als hätte es verdient, sogleich gedruckt zu werden. Aber er war vorsichtig; endgültiges über die Qualität des vorliegenden Lehrwerks ließ sich erst nach dem Studium seines Inhalts mit Gewissheit sagen.
Bis heute hatte er die Peverara nicht gehört, nur ihren Ruhm vernommen, der allerdings ohnegleichen war. Von nichts weniger als engelsgleich war die Rede in vielen Briefen und Depeschen, das war ihm zugetragen worden.
Nun saß er verzückt, reglos und musste zugeben: Ähnliches hatten seine Ohren tatsächlich nie gehört.
Er suchte nach Worten, die diese Stimme beschreiben könnten; gerecht würde ihr kein einziges, jedenfalls keines, das ihm zu Gebot stand. Er dachte an flüssiges Gold, das, wäre es möglich, einen kühlen Grad der Erwärmung hätte, gerade so, dass es noch fließen, aber nichts verbrennen konnte. Ja, wie kühles, flüssiges Gold, sanft schimmernd, nicht gleißend, so klang die Stimme Laura Peveraras. Entstand möglicherweise dieser Eindruck in ihm, weil er die Dame vor sich stehen sah? So nah, in flüchtigem Blau, libellenzart unter den goldenen Flechten?
Er schloss die Augen.
»Wenn Sie doch die Passagi wiederholen mögen, Signora, auch die Cadenzie und auch das Beispiel der Diminution über bellezza«, bat er sie.
Er wusste wohl um die Schwierigkeit der Aufgabe, zumal, soviel war sicher, solcherlei Übungen vorher nie aufgeschrieben worden waren. Dieses Manuskript war das erste dieser Art und er der Erste, der es aus Bassanos Hand bekommen hatte.
Laura sang das Wort bellezza. Wie der Wasserstrahl sich versprüht, der auf den Stein trifft, so zerfielen die Silben, die ursprünglich aus drei Tönen bestanden, in eine Kaskade kleiner, schneller Klänge. Eine Koloratur über acht Töne zählte Luzzaschi, trotz ihrer Schnelligkeit alle sauber voneinander getrennt, so dass er sie benennen könnte, wäre da nicht der Zauber, der ihn verzückt gefangen hielt.
Er wollte sich Zeit nehmen für sein Urteil, das, wäre es erst ausgesprochen, Gültigkeit hätte – auch den ehemals singenden Hofdamen gegenüber. Im Stillen feilte er an einer Gratulation in gebotenem Wortlaut, die er dem Duca aussprechen müsste. Dessen Einschätzung, die bei aller hochwohlgeborenen Bildung doch der eines Liebhabers und nicht der eines Meisters der Musik entsprach, war in diesem Fall durchaus richtig.
Laura Peverara an den Hof verpflichtet zu haben, würde noch in fünfhundert Jahren in einem Atemzug mit dem Namen Alfonso d`Este Erwähnung finden.
So weit dachte Luzzaschi.
Die singenden Hofdamen Machiavelli und Bentivoglio bedrängten ihn schon, ob er sagen könne, was man von der Einstellung der neuen Sängerinnen zu halten habe und was man zu erwarten hätte; man habe ihre Sangeskunst das letzte Mal zu Karneval gewünscht, danach nicht mehr. Niemand wusste es besser als er, Luzzaschi, da er sie am Cembalo begleitet hatte.
Der Unmut der singenden Hofdamen, wenngleich unterdrückt, war dennoch für ihn spürbar gewesen, als schwele da etwas, das an einem nicht allzu fernen Tage ein Erdbeben hervorbringen würde, wie das vor nicht langer Zeit erlebte. Dieses hatte allerdings – und auch das war eine Wahrheit, die sich nicht leugnen ließ – Neues hervorgebracht, wie alles, was versinkt, Neues hervorbringt. Im schlimmen Fall des Bebens war es das Castello, dessen zerstörte Mauern durch Alfonso neu errichtet worden waren. Nun dachte der Herzog an Erneuerungen anderer, künstlerischer Art. Dafür mussten die singenden Hofdamen den wahren Sängerinnen weichen.
Es lag Monate zurück – dennoch erinnerte er sich gut, denn die Ereignisse waren minutiös beschrieben worden –, dass man anlässlich der Karneval–Vergnügungen wie üblich in die Gemächer Donna Lucrezias, der Schwester des Duca, gezogen war, wo bei angenehmer Temperatur und Kerzenschein die Damen Machiavelli und Bentivoglio sangen. Wie üblich unter großem Beifall der Edelleute, was nicht anders zu erwarten gewesen war; schließlich bereiteten die von ihm, Luzzaschi, komponierten Madrigale bewährtes Vergnügen. Im Übrigen hatte er durch die Erwähnung der Damen im Vorwort des Druckes der Ehrerbietung Genüge getan. Er wusste, was sich gehörte, man hatte sich gegenseitig einiges zu verdanken. Die Macchiavelli und die Bentivoglio waren von hohem Stand in Ferrara und führten große Häuser, ihre Ehemänner waren verdienstvolle Vertraute des Herzogs.
Doch hatte er, während seine Finger die Akkorde auf dem Cembalo griffen, seine Augen schweifen lassen und den Duca gähnen sehen. Und auch die Duchessa parlierte während des Gesanges mit dem Höfling Conosciuti. Das war sonst nicht ihre Art. Sollte sich der neue Stil weiter Bahn brechen, würden sich die Melodien für die Sängerinnen bis weit hinauf in himmlische Sphären erhöhen und so die Makellosigkeit des Gesanges um ein Beträchtliches erschweren. Er rechnete keineswegs damit, dass die beiden Hofdamen dem genügen konnten. Es wäre nicht länger damit getan, einfache Villanellen zu singen, es sei denn, man könne sie durch gewisse Zutaten zu einem kleinen Kunstwerk erblühen lassen. Dieses aus dem Moment heraus, versteht sich, und aufgrund einer göttlichen Eingebung. Undenkbar für die Machiavelli und die Bentivoglio, die von göttlichen Eingebungen so weit entfernt waren wie der graue Acker vom strahlenden Firmament, mochten sie sich auch noch so sehr bemühen.
Dann hatte ihm der Duca Order gegeben, nach einem Lehrwerk über diese Techniken zu forschen. Dieses Lehrwerk jedoch wäre nicht für die singenden Hofdamen, sondern für Laura Peverara gedacht, deren Ankunft bevorstünde, so Alfonso.
Luzzaschi war sehr gespannt, was aus all dem erwachsen würde.
Eine Stille war entstanden, die Sängerin schaute ihn an. Er hatte nicht bemerkt, dass sie geendet hatte, das war unhöflich. Er gab sich den Anschein von Versonnenheit, als müsse das Gehörte in ihm nachwirken, stand dann auf, schnippte ein Stäubchen von seinem Beinkleid, deutete eine Verbeugung gegen Laura an und sagte: »Ich bin durchaus zufrieden mit dem, was ich vernommen habe. Was das Diminuieren betrifft, hinterlässt es einen Eindruck in mir. Doch nun gilt es, Bassanos Übungen durch eigene Einfälle zu erweitern, damit der Signora solche Floskeln im Moment des Singens zu Gebot stehen. Die Hoheiten erwarten bereits mit Ungeduld, sich bald zum ersten Concerto in den Gemächern der Duchessa versammeln zu können; ich will nicht verschweigen, dass auch die Damen Macchiavelli und Bentivoglio anwesend sein werden, das gebietet schon die Höflichkeit. Die Signora möge sich darauf vorbereiten, wenn ich mir diesen Rat erlauben darf. Hohe Erwartungen sind zu erfüllen.« Mit einem schnellen Blick auf ihr Gesicht prüfte er, wie die Peverara seine Rede aufnahm. Er musste den angemessenen Ton dieser Dame gegenüber erst noch finden, sie setzte sich ab von allen anderen.
Laura dankte. Nicht mit Demut, wie er erwartet hatte, sondern so, als hätte sie mit nichts anderem als seiner guten Einschätzung gerechnet.
»Verzeiht, Maestro, eines noch, da Ihr es nicht erwähntet: Mein Harfenspiel, das ich Euch bisher nicht zu Gehör bringen konnte …«
Das hätte ihm nicht unterlaufen dürfen.
»Verzeiht, Signora, sagte ich nicht, dass dafür eine gesonderte Stunde vorgesehen ist? Gemeinsam mit Signora Guarini und – so ich es dann entschieden haben werde – auch mit Signora d`Arco. Harfe, Laute, Viola da Gamba …? Nun, meine Zeit ist begrenzt.«
Damit verließ er Laura, etwas steifbeinig vom langen Sitzen oder auch von der Ungehörigkeit, ihr zweites Talent vergessen zu haben unter dem Zauberbann ihres Gesanges. Solcherlei Fehler würde sie ihm nicht nachsehen. Nicht die Peverara.
Margherita schickte einen Pagen zu Costanza, der sie zu ihr bringen sollte. Sie nutzte Lauras Gesangsstunde, in der diese ihre Zofe nicht brauchte, um Costanza für sich zu haben, zum ersten Mal seit ihrer Ankunft. Bisher hatte es keine Gelegenheit gegeben, bei der sie sich von Costanzas Befinden einen Eindruck hätte verschaffen können. In des Liebeleins Seele muss Verwirrung herrschen, bei all dem Neuen, das nun auf sie eindringt, dachte Margherita bei sich, so gut kannte sie Costanza. Seit ihren frühesten Kindertagen hatte sie sich Costanza schwesterlich verbunden gefühlt, weit mehr als ihrer sehr viel jüngeren, leiblichen Schwester Anna Caterina.
Costanza musste sich hier fremd fühlen, auch dem Reglement gegenüber, das man hier bei Hofe befolgte, allerdings nicht mit besonderer Strenge. Alfonso war nachsichtig und großzügig im Umgang mit den Dreihundert, die an seinen Tischen saßen. Beides zwar mit kleinen Einschränkungen, räumte Margherita für sich ein, da er doch bisweilen auch einem Gerangel um die Macht entgegentreten musste, welches es hier wie überall gab, wo Menschen zusammen waren. Niemals könne man gänzlich neidlosen Frieden finden.
Aber auch Alfonso hatte dunkle Seiten, das wusste sie nach einem Jahr als seine Frau. Jäh konnten sich Schatten über sein sonst gleichbleibend gelassenes Gemüt legen, niemand hätte den Grund zu benennen gewusst. Sie hatte Alfonso behutsam danach befragt, natürlich nur im Rahmen der Etikette, die sie gerade in diesem heiklen Punkt besonders beachtete. Aber Alfonso schwieg wie ein Vater, der seine Sorgen nicht mit dem Kinde teilt. Besonders, wenn sie auf ihre nun schon ein Jahr lang andauernde Kinderlosigkeit zu sprechen kommen wollte. Stattdessen bekämpfte sie die Betrübnis, von der sie häufig unerwartet überfallen wurde, und hielt sich vor Augen, dass ihr die Hofärzte Hoffnung gaben, indem sie von ihrer Jugend sprachen. Daran wollte sie fest glauben. Sie verscheuchte auch den zerstörerischen Gedanken an die Kinderlosigkeit der beiden früheren Gemahlinnen Alfonsos. Ein Gedanke, der ihr immer wieder für Stunden die sonst so sorglosen Tage verfinsterte.
Margherita setzte sich vor den Spiegel und nahm ein hellblaues Samtband und eine Haarbürste auf, als es klopfte. Ihre Kammerzofe öffnete und ging hinaus, Costanza trat ein.
»Und welchen Ausdruck üben wir heute, Liebelein?«, sprach Margherita ohne förmliche Begrüßung in den Spiegel hinein, ganz so, als hätten sie sich gerade erst in Mantua getrennt, und es wäre nicht ein ganzes Jahr vergangen. »Nehmen wir das Fürstlichmild?«
Costanza zog einen Sessel heran, setzte sich zu ihr und senkte ihren Kopf, so dass ihre Gesichter dicht nebeneinander waren, ihr eigenes, von roten Locken eingerahmtes und das dunkle, schmale der Freundin mit den ernsten Augen. Ihre Blicke trafen sich in der Erinnerung an das Kinderspiel, bei dem sie alle Gefühle, sowohl die empfundenen und gelernten als auch die ihrer Fantasie entsprungenen, mit ihrer Mimik auszudrücken geübt hatten. Jedoch aus dem Spiegel sahen ihnen keine Kinderaugen mehr entgegen, das schien auch Costanza zu empfinden. Trotzdem verzog diese ihren Mund zu einem Lächeln, das heiter wirken sollte, und antwortete: »Wie wäre es mit himmelhochjauchzend? Oder besser noch marienhold?«
»Aber nein, Liebelein, das fürstlichmild!«, ordnete Margherita an, und beide schnitten die Grimasse, von der sie annahmen, dass sie dem Ausdruck entspräche.
»Wie ähnlich wir uns doch sehen!«, sagte Margherita plötzlich und lachte nach einem kurzen Moment der Verblüffung, wurde aber ernst, als sie Costanzas Blick bemerkte, der wie erstarrt an ihrem Spiegelbild hing, als hätte sie ein Feuerzeichen gesehen.
Wenig später rief Margherita von ihrer Liege her, auf der sie jetzt in halbaufrechter Haltung lag, den Kopf auf eine Hand gestützt: »Liebelein, deine Perlenzähne sind ohne Makel, rechne ich den kleinen Eckzahn nicht dazu … Doch gönnst du uns zu selten das Vergnügen, sie anschauen zu dürfen! Wann sieht man dich je lachen? Seit du hier bist, finde ich dich stiller als zuvor. Sag, was bedrückt dich?«