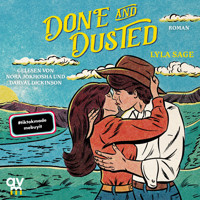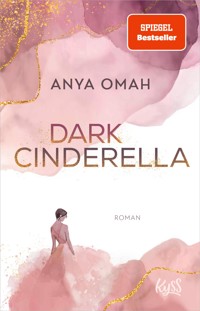7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Romeon-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Katharina Riedel ist eine Mutter. Aber keine alltägliche, sondern eine besondere: Eine Mami auf Rädern. Davon gibt es in Deutschland immer noch ziemlich wenige, vor allem solche, die von Kindesbeinen an auf den Rollstuhl angewiesen sind. Offen, ehrlich, manchmal kritisch, aber auch mit einer Prise Humor beschreibt sie ihre Herausforderungen und schönen Momente im Alltag mit Kind. Ihr Buch ist ein Plädoyer für den Abbau von Barrieren im Kopf und den Mut, die eigenen Träume gegen alle Widerstände zu verwirklichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mami auf Rädern
1. Auflage, erschienen 1-2022
Umschlaggestaltung: Romeon Verlag
Text: Katharina-Franziska Riedel
Layout: Romeon Verlag
ISBN (E-Book): 978-3-96229-750-3
www.romeon-verlag.de
Copyright © Romeon Verlag, Jüchen
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Gewissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
KATHARINA-FRANZISKA RIEDEL
Mami
auf Rädern
Den größten Schätzen meines Lebens und allen,die den Mut haben, ihre Träume zu leben.
Die Namen der handelnden Personen wurden geändert, um sie zu schützen.
Die beschriebenen Charaktere und Handlungen sind jedoch real.
Inhalt
Prolog: Die Idee zu diesem Buch
Teil I: Mein Leben und ich
Meine Behinderung
Meine Kindheit
Meine Jugend
Mein Studium und die Zeit danach
Teil II: Kinderwunsch und Schwangerschaft
Der Kinderwunsch
Die Vorbereitungen
Beginn des Projekts
Endlich schwanger
Die Reaktionen der anderen
Erstes Trimester
Zweites Trimester
Drittes Trimester
Zweifel und Ängste
Teil III: Das Abenteuer Familie beginnt
Der große Tag
Die Zeit im Krankenhaus
Das Stillen
Die erste Zeit als Familie
Die Hebamme
Das Leben zu dritt
Spaziergänge
Auto fahren
Beikost
Meilensteine der Entwicklung
Der Umzug
Der erste Urlaub
Herausforderungen und schöne Momente
Vorsätze
Epilog: was ich noch sagen wollte …
Dank
Prolog: Die Idee zu diesem Buch
Auf den ersten Blick bin ich eigentlich ziemlich gewöhnlich. Ich heiße Katharina Riedel, bin 30 Jahre alt, verheiratet, habe einen wundervollen kleinen Sohn, wohne in einer großen Stadt im Norden Deutschlands und verdiene meine Brötchen als Diplomtheologin. Für viele mag dieser Umstand schon etwas besonders sein, gerade in einer Zeit, in der die Wissenschaft uns glauben lassen möchte, dass sie alles erklären und vorhersagen kann. Mein Vater hat Theologen mit Vorliebe als Himmelskomiker bezeichnet und damit hatte er in gewisser Hinsicht sicher auch recht, denn ich versuche das Leben mit Humor zu nehmen und bin überzeugt, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die man nicht berechnen, erklären oder vorhersagen kann; auch nicht der intelligenteste und fleißigste Wissenschaftler der Welt.
Warum ich das alles erzähle? Nun, es gibt eine Kleinigkeit, die zwar im Zeitalter der immer wieder gern von Politik und Gesellschaft postulierten Gleichberechtigung keine allzu große Rolle mehr spielen sollte, die mich aber doch zu einem - wie man so schön sagt - „Menschen mit besonderen Herausforderungen“ macht und damit die ganze weitere Geschichte, die ich in diesem Buch erzählen möchte, in ein etwas anderes Licht rückt: ich sitze seit meiner Geburt im Rollstuhl. Für die Behörden bedeutet das nur einige Buchstaben und Zahlen auf einem sogenannten Schwerbehindertenausweis. In meinem Fall 100 %, aG; G; H: außergewöhnliche Gehbehinderung; Gehbehinderung; hilflos.
Für die Behörden bin ich also nichts weiter als eine Akte, für die Gesellschaft eine von vielen im Rollstuhl, wie man sie häufig sieht. Für die Menschheit ist mein Rollstuhl also nichts Besonderes. Für mich und meine Familie bestimmt er jedoch nahezu alles, da ich bei jeglichen Dingen des täglichen Lebens Hilfe benötige.
Jetzt werden sicher viele denken: Wenn Katharina im Rollstuhl sitzt und ständig auf Hilfe angewiesen ist, wie kann sie dann von sich behaupten, gewöhnlich zu sein?
Die Antwort ist einfach: Ich sitze zwar im Rollstuhl, was mich in gewisser Weise ungewöhnlich macht. Was meine Wünsche und Träume angeht, bin ich jedoch ziemlich gewöhnlich, einige würden sicher sagen sogar spießig. Ich habe immer davon geträumt, einen Beruf zu haben, am liebsten Ärztin; ich habe mir immer gewünscht, einen netten Mann kennen zu lernen, ihn zu heiraten und mit ihm eine Familie zu gründen; vielleicht sogar irgendwann eine eigene Immobilie zu besitzen. Wenn man das Ganze einmal nüchtern betrachtet, sind diese Träume eher klassisch, beinahe etwas langweilig. Die vier Räder, die ich Tag für Tag unter meinem Po trage, um mehr oder weniger einfach von A nach B zu gelangen, machen die Verwirklichung dieser Träume um einiges schwieriger und plötzlich wird aus der Langeweile ein tagtägliches Abenteuer, in dem man so manchen Kampf überstehen muss.
Bevor mein Mann und ich die wunderbare Entscheidung getroffen haben, dass wir das Abenteuer „Kind“ wagen wollen, habe ich lange und intensiv recherchiert, um Anhaltspunkte zu finden, was uns in der Schwangerschaft und im späteren Leben als Familie erwartet, mit welchen Herausforderungen wir rechnen müssen. Dazu habe ich unzählige Foren durchforstet, nach Videos und Literatur Ausschau gehalten. Aber trotz intensiver Suche habe ich weder Fachliteratur noch authentische Erfahrungsberichte einer Mutter gefunden, die wie ich an einer infantilen Zerebralparese, auch Tetraspastik genannt, leidet und ihre Erfahrungen mit anderen teilt, sofern sie dieses Abenteuer gewagt hat.
Also konnte unsere Entscheidung nur auf der Meinung der konsultierten Ärzte und unserem eigenen Bauchgefühl bzw. Vertrauen in unsere Fähigkeiten als Paar basieren. Vorweg sei gesagt, es war die beste Entscheidung unseres Lebens.
Diese Tatsache war für mich der Anstoß, dieses Buch zu schreiben. Ich werde offen, ehrlich und ungeschminkt meine Erfahrungen teilen, so wie ich auch mein Leben zu gestalten versuche. Damit möchte ich einerseits anderen Betroffenen Mut machen und ihnen gleichzeitig eine Entscheidungshilfe bieten, wenn sie selbst vor der Frage stehen, ob sie das Abenteuer „Kind“ wagen möchten. Andererseits möchte ich auch alle anderen interessierten Leser an diesem großartigen Abenteuer teilhaben lassen und gleichzeitig einen Einblick gewähren, was es bedeutet, an die eigenen Fähigkeiten zu glauben und bedingungslos für die eigenen Ziele zu kämpfen. Auch und manchmal gerade gegen alle Prognosen der Wissenschaft und gesellschaftliche Normen. Nur so konnte ich gemeinsam mit meinem Mann Georg das werden, was ich heute mit Leib und Seele bin: eine stolze Mami auf Rädern.
Teil I: Mein Lebenund ich
Meine Behinderung
Um die Tragweite der Entscheidung für oder gegen ein Kind in ihrer ganzen Komplexität und Schwere verstehen zu können, möchte und muss ich zunächst etwas über die Art meiner Behinderung und das Leben damit erzählen. Sie ist sozusagen das Vorzeichen unter dem jede Entscheidung, mag sie auch noch so unscheinbar sein, steht.
Landläufig meint man, jeder Mensch, der im Rollstuhl sitzt, hat dasselbe Problem, welches auf den ersten Blick ersichtlich zu sein scheint und keiner weiteren Erklärung bedarf: Er oder sie kann nicht selbstständig laufen. Diese Feststellung trifft in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zu, aber auch hier gibt es Ausnahmen, denn es gibt durchaus Krankheitsbilder, bei denen die Betroffenen in der Lage sind, kurze Strecken zu Fuß, ohne oder mit wenig Unterstützung zu bewältigen.
Wenn sich nun aber herausstellt, dass die betreffende Person tatsächlich nicht in der Lage ist, zu laufen, dann gibt es immer noch eine ganze Reihe möglicher Ursachen und Krankheitsbilder und jedes davon bringt seine ganz eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich. Jemand, der einen Querschnitt erlitten hat, ist je nach Höhe des Querschnitts beweglich im Oberkörper und kann vieles in seinem Alltag selbstständig meistern oder er kann alles um sich herum nur noch mit Augenbewegungen steuern. Zudem gibt es auch noch eine ganze Reihe von Erkrankungen und Behinderungen, die sich im Laufe der Zeit verschlechtern und das Leben dadurch erheblich beeinflussen. Keine Beeinträchtigung gleicht also der anderen und selbst wenn zwei Menschen laut ihrer Akte dieselbe Diagnose haben, sind ihre Symptome zwar ähnlich, aber ihre Fähigkeiten und damit verbunden auch die zu meisternden Herausforderungen können je nach Schwere der Behinderung sehr unterschiedlich sein. Beeinträchtigungen jeglicher Art sind wahre Chamäleons. Man könnte auch sagen: Der Teufel steckt im Detail.
Jetzt möchte ich etwas von den Teufeln erzählen, die in meiner Behinderung stecken.
Wie eingangs erwähnt, trägt meine Behinderung den klangvollen Namen „infantile Zerebralparese“ auch bekannt unter dem Namen „Tetraspastik“. Infantil bedeutet dabei, dass diese Beeinträchtigung bereits im Kindesalter, in meinem Fall bei der Geburt, erworben wurde. Sie begleitet mich also von Anfang an, sie ist ein Teil meines Lebens seitdem ich denken kann. Zerebralparese heißt, dass eine Lähmung vorliegt, die durch eine Schädigung des zentralen Nervensystems hervorgerufen wurde. Diese Schädigung kann viele unterschiedliche Ursachen haben. Bei mir war der Auslöser ein Sauerstoffmangel im Gehirn vor oder während der Geburt. Durch diese Unterversorgung sind vor allem Areale im Gehirn geschädigt worden, die für das Gleichgewicht und die Motorik zuständig sind. Mein Gehirn ist nicht in der Lage derartige Befehle so an die Nervenzellen und damit an die Muskeln weiterzuleiten, dass eine komplexe Bewegung wie zum Beispiel Laufen möglich ist. Stattdessen kommt es durch Fehlsteuerungen der Nerven häufiger zu unkontrollierten Bewegungen und Verkrampfungen der Muskeln, sogenannten Spastiken. Davon ist der gesamte Bewegungsapparat betroffen, alle vier Extremitäten, d. h. beide Arme und beide Beine - daher der Name Tetraspastik. Zu dieser Grunderkrankung kommen häufig eine Reihe von Begleiterkrankungen, häufig orthopädischer, aber nicht selten auch geistiger Natur. So habe ich zum Beispiel auch eine Fehlstellung der Hüfte, eine so genannte Dysplasie, bedingt dadurch, dass einige Muskeln zu stark und andere zu schwach sind.
Gleiches gilt für die Wirbelsäule. Ich habe eine Fehlstellung, die Skoliose genannt wird, auch bedingt durch eine schwächere Rückenmuskulatur, die zu Haltungsschwierigkeiten führt. Ebenfalls durch den Sauerstoffmangel bedingt ist auf einem Auge meine Sehkraft deutlich vermindert. Zudem bin ich sehr geräuschempfindlich, zum Beispiel, wenn es sich um sehr hohe Töne handelt, sich Geräusche unerwartet verändern oder plötzlich auftreten. Körperlich verdiene ich den Stempel „Schwerbehinderte“ also allemal. Ich brauche Unterstützung bei fast allem, auch den banalsten physischen Aktivitäten. Dazu gehören zum Beispiel: Ankleiden, Kochen, Nahrungsaufnahme, Begleitung bei Freizeitaktivitäten oder zu Ämtern, Lagerung im Bett, Hygiene, Toilettengang, ja sogar, um ein Buch aus dem Regal zu nehmen oder eine CD zu wechseln. Dieses sind nur einige von zahllosen möglichen Beispielen. Im Prinzip brauche ich 24 Stunden jemanden, der bereit ist, mir zu helfen, wenn ich darauf angewiesen bin. Nur kurze Strecken, vor allem in der Wohnung, kann ich mit dem Rollstuhl allein bewältigen. Alle Dinge, die für die allermeisten selbstverständlich sind, kosten mich ohne Hilfestellung große Anstrengung oder sind schlichtweg unmöglich zu bewältigen. Das ist die negative Seite der Medaille.
Ich habe jedoch das große Glück, dass ich sowohl organisch als auch geistig vollkommen gesund bin. Ein Umstand, der nicht vielen Menschen, mit denen ich die Diagnose „Zerebralparese“ teile, vergönnt ist und für den ich sehr dankbar bin. Diese geistige Fitness, die es mir ermöglicht hat, zu studieren und einem Beruf nachzugehen, ist sicher eines meiner größten Privilegien, aber wie sich im Verlauf des Buches zeigen wird, bringt sie häufig auch emotionale Herausforderungen mit sich. Kurz lässt sich meine Behinderung so zusammenfassen: Ich brauche Unterstützung bei fast allem, was physischer Natur ist, nur mein Geist funktioniert prima von selbst. In den nächsten Kapiteln möchte ich näher darauf eingehen, was diese Einschränkungen konkret im Alltag sowohl in der Kindheit als auch in der Jugend und später im Erwachsenenalter bedeuten und mit welchen Herausforderungen und inneren Konflikten man konfrontiert wird.
Meine Kindheit
Ich möchte eines vorwegschicken: Trotz aller Schwierigkeiten, von denen in diesem Kapitel die Rede sein wird, hatte ich alles in allem eine glückliche Kindheit. Viele andere Kinder ohne jegliche Einschränkung hätten sicher von einer solchen Kindheit geträumt, wie ich sie erleben durfte.
Die Diagnose „Zerebralparese“ bekam ich aus heutiger Sicht relativ spät, sie wurde erst gestellt als ich bereits fast zwei Jahre alt war. Bis zu diesem Zeitpunkt galt ich lediglich als entwicklungsverzögert. Einiges an eventuell möglicher Frühförderung ist mir damit verwehrt geblieben. Die Ärzte stellten meinen Eltern eine eher düstere Prognose in Aussicht: Ich würde wahrscheinlich auf eine Sonderschule gehen müssen und würde nie selbstständig essen oder schreiben können; Letzteres, wenn überhaupt, dann nur mithilfe einer Computertastatur. Im Gegensatz dazu habe ich später mit viel Anstrengung handschriftlich zu Schreiben gelernt, weil es meiner Mutter immer wichtig war, dass ich zumindest in der Lage bin, wichtige Dokumente selbst zu unterzeichnen. Ebenso habe ich mit Löffel und Gabel essen gelernt und wie aus dem Prolog ersichtlich ist, habe ich keine Sonderschule besucht, sondern ein Gymnasium und sogar eine Universität, wo ich erfolgreich ein Studium absolviert habe. Mit all dem hat die Medizin nicht gerechnet, man ging davon aus, dass zu meiner starken körperlichen Beeinträchtigung auch eine geistige dazugehört, was sich nicht bestätigt hat und auch im körperlichen Bereich konnte ich mit viel Fleiß und Unterstützung zahlreicher Menschen einiges erlernen. Aus diesem Grund habe ich eingangs gesagt, manchmal müsse man seine Träume auch gegen alle Prognosen der Wissenschaft, in meinem konkreten Fall der Medizin, verwirklichen. Das bedeutet unzählige Kämpfe, mit Behörden, mit Ärzten, mit der Gesellschaft, aber auch und vor allem mit sich selbst. Man kommt dabei immer wieder an seine Grenzen und muss so manches Opfer bringen, was gerade in der Kindheit und Jugend sehr schwierig sein kann. Aber wie man sieht, hat es sich gelohnt.
Diese Kämpfe haben schon früh begonnen und ohne den unermüdlichen Einsatz meiner Familie wäre ich bei weitem nicht dort, wo ich heute bin.
Die jahrelange Odyssee nahm mit regelmäßiger Krankengymnastik ihren Anfang. Den echten Durchbruch, was meine Motorik und meine Gesamtkonstitution anbelangt, brachte jedoch eine in Ungarn entwickelte und bei Zerebralparese häufig angewandte Therapie, von der meine Familie im Fernsehen hörte. Meine Eltern waren sofort begeistert und wollten diesen Ansatz gern ausprobieren. Mein Vater arbeitete damals als Geschäftsführer eines großen Konzerns, der glücklicherweise auch einen Standort in Ungarn hatte. Er nahm Kontakt zu einem dortigen Kollegen auf, mit dessen Hilfe ich zügig einen Therapieplatz bekam. Also flog ich gemeinsam mit meiner Mutter nach Budapest, wo ich das Petö-Institut besuchte. Die Petö-Therapie ist ein ganzheitlicher Ansatz, der davon ausgeht, dass das Gehirn viele ungenutzte Ressourcen aufweist. Das bedeutet, dass jeder Mensch Gehirnzellen besitzt, die keine konkrete Aufgabe haben und deshalb Aufgaben geschädigter Gehirnzellen durch Lernprozesse übernehmen können. Es wird also versucht, durch intensives Üben möglichst viel an Motorik, Bewegung und damit auch Selbstständigkeit zu ermöglichen. Andreas Petö, der Erfinder dieses Ansatzes hat es einmal so formuliert: „man hilft einem hungrigen Menschen viel, wenn man ihm Fische zu essen gibt. Man hilft ihm aber noch viel mehr, wenn man ihm das Angeln beibringt.“
Die Therapie dort dauerte von morgens um 8:30 Uhr bis nachmittags um 16:00 Uhr. Der Tagesablauf war sehr streng getaktet, fast so wie bei Militär. Es wurde geturnt, anschließend gab es ein gemeinsames Frühstück, was in der Regel ziemlich lange dauerte, da erwartet wurde, dass man versucht, sich sein Brot selbst zu schmieren und anschließend auch zu essen. Wie die meisten, war ich am Anfang jedoch nicht dazu in der Lage und musste mir das ganze erst mühsam erarbeiten. Nach dem Frühstück wurde weiter geturnt bis zum Mittagessen. Dort war es das gleiche Spiel, man war angehalten, es selbst zu versuchen und wenn es eine gefühlte Ewigkeit und Tränenbäche dauerte, dann war das eben so. Nach dem Mittagessen gab es endlich Spielzeit, in der ausnahmsweise einmal nicht auf die Körperhaltung o. ä. geachtet wurde, in dieser halben bis dreiviertel Stunde durfte man einfach Kind sein, das war jeden Tag das Highlight. Zum Schluss gab es noch eine Übungseinheit, bevor dann endlich um vier die Türen geöffnet wurden und unsere Mütter oder Väter uns aus dieser Hölle befreiten, bevor sie uns am nächsten Tag wieder dorthin zurückbrachten.
Das Schlimmste an dem ganzen war vielleicht die Tatsache, dass die Übungen um jeden Preis durchgeführt wurden, egal ob man vor Erschöpfung oder Schmerzen weinte oder nicht. Wenn die Therapeuten, die dort Konduktoren genannt wurden, der Ansicht waren, man müsse das noch aushalten, dann wurde weiter gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste. Das hört sich jetzt sicher für den außenstehenden Betrachter sehr hart an und für mich als Kind war es das auch. Dennoch war es die beste Entscheidung, die meine Eltern für mich und meine weitere Entwicklung getroffen haben. Als ich mit der Therapie begann, konnte ich weder frei sitzen noch selbständig essen und trinken oder einige Schritte gehen. Von nun an kamen meine Mutter und ich zweimal jährlich für acht Wochen zur Therapie und ich entwickelte mich kontinuierlich weiter. Eine Besonderheit war noch, dass mit den internationalen Kindern, sprich mit denen, die kein Ungarisch konnten, Englisch gesprochen wurde. Das verstanden wir zwar auch nicht, aber es wurde einfach so lange mit Händen und Füßen auf uns eingeredet, bis wir verstanden, was von uns erwartet wurde.
Ich lernte dort also nicht nur mit der Zeit frei zu sitzen, mit Stöcken einige Meter zurückzulegen und zerkleinertes Essen mit Löffel und Gabel selbstständig zu mir zu nehmen, sondern konnte im Alter von fünf Jahren schon ziemlich gut Englisch sprechen. Zudem habe ich auch gelernt, was Disziplin und Ausdauer bedeutet; ohne diese Eigenschaften hätte ich das alles nicht erreicht. Die Therapeuten und auch meine Eltern machten mir immer wieder deutlich, dass ich oft 200 % zeigen muss, um einerseits meine Ziele zu verwirklichen und andererseits die Anerkennung der Gesellschaft zu bekommen.
Sie alle sollten damit Recht behalten. Im Alter von fünf Jahren wurde meinen Eltern empfohlen, ich sollte doch einmal ein Jahr kontinuierlich in Ungarn sein, um den Therapieerfolg zu erhöhen. Meine Eltern folgten dem Rat und so zog ich mit meiner Mutter nach Budapest. Aus diesem angestrebten einen Jahr sind schließlich vier geworden. Ich besuchte dort neben der Therapie den deutschen Kindergarten und später auch die deutsche Schule, wo ich die ersten zwei Schuljahre erfolgreich absolvierte. Wohlgemerkt handelte es sich hierbei um eine normale Schule, und auch der Kindergarten war kein Förderkindergarten. Meine Mutter war stets bestrebt, dass ich viel Kontakt zu Kindern ohne Einschränkung und gerade auch ungarischen Kindern hatte. Dadurch fühlte ich mich eigentlich immer normal und nie besonders, was im Nachhinein vielleicht nicht immer zu meinem Vorteil sein sollte. Ich fand es zudem in diesem Alter eher schön, dass ich auf die Hilfe der Erwachsenen angewiesen war, denn das bedeutete auch, dass ich oft bis spät abends mit meiner Mutter gemeinsam aufbleiben durfte und so die interessanten Gespräche mitbekam. Oft war ich auch der Star in der Runde, da ich schon Englisch konnte und auch sonst ziemlich klug für mein Alter war. Zu dieser Zeit waren mir das Ausmaß und die Tragweite meiner Behinderung nicht bewusst, ich lebte bis auf die vielen Therapien ein ziemlich unbeschwertes Leben, was ich auch den finanziellen Möglichkeiten meiner Familie zu verdanken habe.
Meine Eltern mussten die gesamte Therapie selbst finanzieren, da diese von den deutschen Krankenkassen nicht anerkannt wurde. Ebenso war es mit dem Kindergarten und der Schule, da beide in privater Hand waren. Ihr Engagement hat sich sehr gelohnt, denn ich hatte eine glückliche Kindheit und auch die Therapie zeigte, wie schon erwähnt, Erfolge.
Für die Aufnahme in die Schule mussten meine Eltern und ich allerdings kämpfen, da ein körperbehindertes Kind nicht zu dem Image einer privaten Schule passte. Beim Aufnahmegespräch konnte ich jedoch auf alle Fragen des Grundschulleiters antworten und habe ihm zum Abschied sehr deutlich gesagt, dass ich auf diese und keine andere Schule gehen würde. Schließlich wurde ich aufgenommen und mit meinen Eltern wurde eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart, danach sollte entschieden werden, ob ich auf der Schule verbleiben darf oder nicht. Nach Ablauf dieser Zeit sprach allerdings niemand mehr von diesem Ultimatum, ich hatte mich gut in der Klasse integriert, fand einige Freunde und gehörte zu den besten Schülerinnen. Ich lernte sogar mit viel Mühe handschriftlich in Druckbuchstaben und in der zweiten Klasse auch in Schreibschrift zu schreiben, obwohl man mir davon abriet. Aber auch hier kämpfte ich mich durch, ich wollte sein, wie alle anderen Kinder und keine Extrawurst bekommen.
Meine Nachmittage verbrachte ich größtenteils mit Hausaufgaben, da ich sehr lange brauchte, um alles halbwegs lesbar aufzuschreiben. Das kostete sehr viel Kraft und Ausdauer. Hinzu kamen täglich 2 Stunden Therapie zu Hause, den Rest der sehr begrenzten Zeit durfte ich mit Spielen verbringen. Trotz aller Schwierigkeiten war ich glücklich und fühlte mich in meiner Umgebung sehr wohl. Mittlerweile hatte ich auch ein bisschen Ungarisch gelernt, da man natürlich immer etwas von der Sprache mitbekommt, wenn man in einem fremden Land lebt. Zudem hatte ich das große Glück, sehr sprachbegabt zu sein. Neben meiner Sprachbegabung hatte ich schon seit früher Kindheit den großen Traum Ärztin zu werden. Ich interessierte mich für alles, was mit dem Körper und der Gesundheit zu tun hatte. Vielleicht spielten dabei auch meine eigenen häufigen Arztbesuche eine Rolle, denen ich statt mit Angst viel mehr mit Neugier begegnet bin. So spielte ich in meiner Freizeit mit meinen Freunden auch oft Arzt.
Nach vier schönen Jahren in Ungarn entschieden meine Eltern schließlich, dass meine Mutter und ich wieder nach Deutschland ziehen sollten. Einerseits aus finanziellen, hauptsächlich aber aus familiären Gründen. Mein Vater kam uns nämlich nur alle zwei Wochen für ein verlängertes Wochenende besuchen, sodass ein Familienleben nur sehr eingeschränkt möglich war. Das sollte sich mit unserer Rückkehr nach Deutschland ändern.
In Deutschland angekommen, war ich allerdings eher unglücklich; meine Freunde und auch die Schule fehlten mir. Ich wurde das erste Mal in meinem Leben mit Mobbing und Ausgrenzung konfrontiert, was sich in den nächsten Jahren noch deutlich verstärken sollte. Das lag wohl einerseits daran, dass ich anders war und viele Dinge nicht mitmachen konnte andererseits aber auch daran, dass ich durch meinen Ehrgeiz, meinen Fleiß und meine guten Leistungen schnell als Streber abgestempelt wurde. Streber und behindert war dann wohl zu viel des Guten. Diese Probleme sollten mich ab sofort immer wieder begleiten, mal mehr, mal weniger. Ich brauchte fast ein Jahr, um mich wieder einzugewöhnen und mich etwas zu integrieren. Manchmal hätte ich mir hier dann eine Schwester oder einen Bruder zum Spielen gewünscht, weil ich nicht viele Freunde hatte. Weil mein Leidensdruck sehr groß war, zogen meine Eltern ernsthaft in Erwägung, dass meine Mutter wieder mit mir nach Ungarn zieht. Letztlich haben wir uns aber dagegen entschieden, was sich später als die nicht unbedingt beste Entscheidung herausstellen sollte. Was mir allerdings gefiel, war die Tatsache, dass ich lange Zeit ungarische Betreuer zu Hause hatte, die es mir ermöglichten, meine Sprachkenntnisse weiter auszubauen. Zudem ist der Kontakt nach Ungarn nie abgerissen und Budapest ist bis heute mein zweites Zuhause. Ich habe viele Freunde und Bekannte und dank meines Mannes mittlerweile auch Familie dort.
Meine Jugend
Nach erfolgreichem Absolvieren der Grundschule stand der Schulwechsel an. Ich bekam eine Empfehlung für das Gymnasium. In diesem Punkt hatte sich die Prognose der Ärzte nicht bewahrheitet, die mir eine Zukunft auf der Förderschule prophezeit hatten. Da wir in einem Dorf wohnten und es in der nächstgelegenen Stadt nur ein Gymnasium mit Fahrstuhl gab, waren die Würfel schnell gefallen. Ich wurde angenommen und meine Eltern schafften es, dass der Kreis mir eine Schulbegleitung finanzierte, sodass sie die Kosten dafür nicht mehr selbst tragen mussten wie bisher. Das war zwar einerseits eine Erleichterung für mich, da die Begleitung für mich alles von der Tafel notierte, mir die Bücher gab und mich in die entsprechenden Unterrichtsräume brachte, aber andererseits zeigte es wieder einmal deutlich, dass ich anders war als die anderen, denn ich war immer in Begleitung eines Erwachsenen. Was mir in der Kindheit eher gefiel, wurde jetzt immer lästiger.