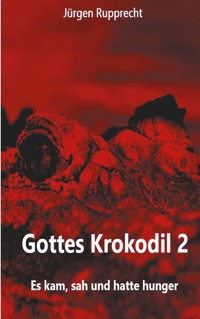Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als bei Bauarbeiten eine Kinderleiche gefunden wird, besteht kein Zweifel, dass es sich um die sterblichen Überreste der vor zwanzig Jahren von ihrem Vater ermordeten Marie handelt. Zeitgleich wird in einem Heidelberger Vorort ein namhafter Historiker tot in seiner Villa aufgefunden. Bei der Durchsuchung des Anwesens entdecken die Beamten Hinweise, dass dieser Marie kannte. Haben die beiden Ereignisse miteinander zu tun?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Rupprecht
Marie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
Epilog
Impressum neobooks
1
Marie
Jürgen Rupprecht
Impressum
Texte: © Copyright by Jürgen RupprechtUmschlag: © Copyright by Jürgen RupprechtLektor: Simona Turini
Druck: epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Printed in German
Hermann Oswald zitterte im zugigen Führerstand seiner Baumaschine. Er hatte schon einige Jahre auf seinem Bagger verbracht, aber so kalt wie dieser gottverdammte Winter 2015 war noch keiner gewesen. Egal, er war fast fertig hier. Nur noch zwei Meter musste er den Hang abgraben, dann hatte er dem Berg genug Fläche abgetrotzt, damit hier an der Heidelberger Uferstraße eine neue Villa gebaut werden konnte. Danach war endlich Feierabend, Zeit für ein warmes Bad und kühle Biere.
Ein sehr lautes Hupen riss ihn aus seinen Gedanken. Das war unvermeidlich, wenn man der viel befahrenen Uferstraße mitten im Feierabendverkehr eine Spur raubte. Sein Blick streifte über die Unzahl an Fahrzeugen, die wie an einer Perlenschnur aufgereiht darauf warteten, an diesem Nadelöhr vorbeizukommen. Genauso unvermeidlich waren die Asiaten, die das Spektakel mit ihren Smartphones filmten. Hermann fragte sich, ob es in China keine Baustellen gab, aber schon lenkte ein Geräusch seine Aufmerksamkeit wieder auf seine Arbeit. Auf der gesamten Breite rutschte lawinenartig Erde nach.
„Scheiße, verdammte Scheiße!“, brüllte er und hielt mit der Schaufel inne. Damit wanderten seine Feierabendbiere noch eine gute weitere Stunde in die Ferne.
Scheiß drauf, dachte er sich, er musste hier fertig werden. Seit seiner Scheidung trank er eh viel zu viel. Wieder und wieder grub er seine Schaufel in den Hang, dann der Schock, eine Wasserfontäne spritzte in den Abendhimmel. Wollte auf dieser verdammten Baustelle denn nichts klappen? Er schaute auf sein Plan: Da war kein Rohr verzeichnet. Er musste eine Wasserblase getroffen haben. Die Brühe umspülte die Ketten von Hermanns Bagger und lief über die Straße, um ihre Reise im Neckar zu beenden. Schon wieder hektisches Hupen aus der Richtung, wo die Flüssigkeit hinlief. Diesmal hatte er keine Zeit, hinzuschauen. Stattdessen fuhr er die Schaufel hoch, um zu sehen, was er da getroffen hatte.
Die Strömung ließ nach, was seine Vermutung bestätigte; ein Wasserrohr war es wirklich nicht. Er stieg vom Bagger, um es sich genauer anzusehen.
Schon hörte er aus einiger Entfernung seinen Vorarbeiter brüllen: „Was sollen die Wasserspiele? Wir müssen fertig werden!“
„Ich seh mir das kurz an, Chef, dann geht’s weiter“, brüllte Hermann nicht minder laut zurück und dachte bei sich, fick dich, blödes Arschloch.
Vor seinem Baugerät hatte sich ein Loch so groß wie die Baggerschaufel aufgetan. Hermann nahm seine Taschenlampe aus der Werkzeugkiste und trat näher. Die Sonnenstrahlen, die in das Loch fielen, konnten die fast völlige Finsternis in dem Hohlraum hinter der Öffnung nicht durchdringen. Hermann strahlte mit der Lampe in den Hohlraum. Der Lichtkegel glitt über den Boden der Grube. Kurz streifte das Licht etwas, das er so schnell nicht erkennen konnte. Er führte den Lichtstrahl zurück zu der Stelle.
Was er sah, ließ das Blut in seinen Adern gefrieren. Die Taschenlampe rutschte ihm aus der Hand. Das letzte, was er wahrnahm, bevor wieder die Finsternis den Raum einnahm, war eine fast völlig skelettierte Kinderleiche, wohl ein Mädchen, wenn man das an dem geblümten Kleid festmachen konnte. Zitternd nahm Hermann sein Handy und wählte die 110. Als sich eine Frauenstimme meldete, fanden Hermanns Frühstück und Mittagessen den falschen Ausgang, er übergab sich.
Eine Stunde später wimmelte es auf der Baustelle von Beamten.
Heidelberg ist eine beschauliche Kleinstadt und so standen hinter der notdürftig aufgestellten Absperrung brav zwei Reporter der beiden regionalen Tageszeitungen mit ihren Kameras und warteten, bis einer der Ermittler zu ihnen kommen würde, um sie zu informieren. Es war lustig anzusehen, wie die beiden inmitten von Touristen standen, die das Geschehen filmten und das Ergebnis via Facebook und YouTube in die ganze Welt schickten. Als immer mehr auf ein Tötungsdelikt hinwies, kam sogar ein Kamerateam vom Regionalfernsehen und filmte die Szene gelangweilt.
Manfred Bohrmann, ein durchtrainierter Enddreißiger mit dichtem schwarzen Haar, betrat wie ein Filmstar den Tatort. Der schwarze Anzug war billig von der Stange, kleidete ihn aber trotzdem recht gut. Ihm folgte Gabriele Hauf, eine Frau mit 40 Jahren Kickboxerfahrung, die mit ihren 54 Jahren immer noch ein echter Hingucker war. Prompt filmte das Regionalfernsehen nur noch die rassige Beamtin. Erwin Tillmann, Leiter der Mordkommission, hatte die beiden auserkoren, sich der Kinderleiche anzunehmen.
Manfred war nicht die hellste Leuchte im Halter, zugegeben, aber sein Onkel war ein hohes Tier im Innenministerium, und zu so jemandem sagt man nicht allzu oft nein, wenn er um einen Posten für seinen Neffen bittet. Nun hatte Gabriele ihn als Partner zugewiesen bekommen. Sie konnte ihr Glück kaum fassen, jedes einzelne Mal, wenn er den Mund aufmachte.
Gabriele glaubte ihrem Exfreund Erwin Tillmann keinen Moment, dass es nichts damit zu tun hatte, dass sie ihn gegen ein 20 Jahre jüngeres und mindestens genauso viele Kilo leichteres Model der Gattung Mann ausgetauscht hatte. Das musste ihren Vorgesetzten schwer getroffen haben. Zumindest war Tillmann danach in einen Box-Club eingetreten, um fit zu werden. Gabriele hätte nur zu gern mal mit ihm Sparring geboxt, aber leider war er in einem anderen Verein. Außerdem behauptete ihr Trainer, es wäre Mord, wenn sie mit ihm in den Ring steigen würde, selbst wenn es nur zur Übung war. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit dem Fundort zu.
„Was haben wir da?“, fragte Manfred. Das war bei weitem nicht die dümmste Frage in seinem Repertoire, Gabriele war angenehm überrascht.
„Weibliche Leiche, zum Zeitpunkt des Todes ungefähr zehn Jahre alt“, antwortete der Gerichtsmediziner.
„Und wurde sie vergewaltigt?“, fragte Manfred weiter.
Da war es wieder. Gabriele schaute auf die Knochen vor ihren Füßen und fragte sich, warum sie ihm nicht für jede dumme Frage eine reintreten durfte. Wozu hatte sie so viele Jahre trainiert, wenn sie dann nicht mal Spaß haben durfte?
„Ich bin Mediziner, kein Hellseher. Aber Sperma werden wir an den Knochen kaum noch nachweisen können“, antwortete der Arzt angriffslustig.
Gabriele übernahm: „Lässt sich feststellen, wie das Kind zu Tode kam?“
„Das ist schwer zu sagen, nach der Autopsie weiß ich mehr“, gab der Mediziner zurück.
„Kann man etwas dazu sagen, wie lange das Opfer schon tot ist?“, fragte Gabriele.
„Ich würde sagen, mindestens ein Jahr. Aber genau weiß ich das erst nach den Untersuchungen.“
Gabrieles Blick fiel auf eine auffällige Halskette mit einem bemerkenswert großen gelben Stein. War das überhaupt ein Stein? Die Beamtin war sich beim zweiten Blick nicht mehr sicher.
„Ungewöhnliche Kette; die gibt es bestimmt nicht oft. Können wir sie damit identifizieren?“, fragte sie und rief direkt einen Kollegen von der Spurensicherung herbei. „Ich will, dass ihr die Kette fotografiert. Und dann soll sie in die Fahndung gehen. Mit etwas Glück erfahren wir, wer das Mädchen war.“
Der junge Beamte machte sich sofort an die Arbeit. Zufrieden drehte sich Gabriele zu ihrem Partner um und hörte nur noch, wie er den Baggerfahrer fragte, was sein Alibi für die letzte Nacht sei. Das Zucken in ihrem Trittbein war kaum zu bändigen. Mit leicht genervtem Unterton wies sie ihren Kollegen darauf hin, dass dieses kleine Mädchen schon mindestens ein Jahr tot sei, vermied es aber, darauf hinzuweisen, dass er dies durch Zuhören bei den Ausführungen des Gerichtsmediziners selbst hätte herausfinden können.
Manfred nickte langsam, als hätte er das eben Gehörte verstanden und müsse es jetzt verarbeiten. „Wo waren Sie vor ungefähr einem Jahr?“, fragte er dann den Baggerfahrer.
Gut, sie hatte ihrem Boss Hörner aufgesetzt, aber das hatte sie wirklich nicht verdient.
2
Februar 1992
Heinz März war extrem genervt. Warum mussten sie sich ausgerechnet bei dem Dreckswetter treffen, und wenn schon, warum nicht in einem Café in der Stadt? Die Sache war nun acht Jahre her, selbst wenn jemand damals dabei gewesen sein sollte, würde er nach so langer Zeit keinen Verdacht mehr schöpfen.
Und dann bekam Hilde, seine Frau, auch noch wegen des dauernden Regens nicht frei. Warum muss man als Krankenschwester bei Dauerregen durcharbeiten? Erwarteten sie in Heidelberg und Umgebung eine Katastrophe mit Hunderten von Ertrinkenden? Wahrscheinlich hatte sie sich nicht mal ernsthaft bemüht, Marie war schließlich nicht ihre leibliche Tochter.
Marie war keine normale Neunjährige, sie hatte schon mehr mit ansehen müssen als ein normales Mädchen in ihrem Alter. Seit dem Tag des Unfalls, als sie dabei gewesen war, als ihre Mutter starb, war sie anhänglich wie ein Kleinkind und völlig auf ihn, ihren Papa, fixiert.
Hilde hatte das vom ersten Tag an gestört. Warum hatte sie ihn überhaupt geheiratet? Sie wusste doch, dass es ihn nur im Doppelpack gab. Er musste aber auch zugeben, dass Marie es ihr nicht gerade leicht machte.
Jedenfalls führte das jetzt dazu, dass er Marie mitnehmen musste.
Eigentlich waren sie gerne hier, fast jeden Sonntag, aber bei dem Regen hatte die Kleine auch keine Lust. Wer wollte es ihr verübeln? Inzwischen war Heinz nass bis auf die Unterhosen, er wusste nicht, warum er seinen alten gelben Regenmantel angezogen hatte. Vielleicht hätte er sich auch so ein neumodisches Plastikteil überziehen sollen wie es seine Tochter anhatte, selbst ihr neues Kleid war noch trocken.
Er konnte sich noch genau erinnern, wie er mit Hilde im letzten Dezember auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken gewesen war. Sie hatten schon alles, auch dieses sündhaft teure rosa Kinderfahrrad, das Marie gleich im Schnee ausprobieren wollte – egal, er verdiente in der Bank nicht schlecht. Noch ein Weihnachtsgeschenk war dieser süße Elefant gewesen, den Marie seit drei Monaten überall mit hinnahm. Der war seine Idee gewesen, obwohl Hilde Marie schon für zu alt für Kuscheltiere hielt. Er wusste eben am besten, was sein kleines Mädchen wollte.
Sie waren fast schon aus der Einkaufspassage draußen gewesen, da hatte Hilde dieses geblümte Kleid gesehen. Kaum zu glauben, dass Marie es schon knapp zwei Monate später anziehen konnte. So warm wie in dieser Woche war es im Februar noch nie gewesen. Der Schnee in den Alpen und im Schwarzwald war innerhalb von Tagen geschmolzen. Das – und nicht dieser verdammte Dauerregen – würde bald zu einem gewaltigen Hochwasser führen, da war sich Heinz sicher.
Gerade kam er wieder an einer Prachtvilla vorbei. Die Alte, die dort wohnte, hatte auch den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als aus dem Fenster zu starren. Heinz schielte zu dem Haus, ohne den Kopf zu drehen und siehe da, er hatte recht, sie stand hinterm Fenster. Jetzt winkte sie auch noch. Er beschleunigte seine Schritte, nur schnell vorbei. Und schon beschwerte sich Marie. Sie konnte quengeln wie ein kleines Kind, wenn sie wollte. Er hätte sie nicht mitnehmen sollen. Immerhin war es nun nicht mehr weit, nur noch zwei Kilometer. Wie kam der Typ nur auf diesen Treffpunkt, und warum war er überhaupt schon wieder aus dem Gefängnis draußen? Hatte er nicht zwölf Jahre bekommen? Ihm war fast das Herz stehen geblieben, als er am Montag eine anonyme Nachricht in seinem Briefkasten gefunden hatte. Kein Name, nur die Anweisung, hierher zu kommen und seine Kohle mitzubringen. Woher wusste der Kerl überhaupt, wo er jetzt wohnte? Er hatte sich nicht mal ins Telefonbuch eintragen lassen.
Als sie fast am Treffpunkt angekommen waren, fasste er Marie an der Schulter. „Marie, du musst hierbleiben, Papa ist gleich wieder da. Verstehst du, du musst nur kurz hierbleiben.“
Er hatte Marie noch nie allein im Wald zurückgelassen, aber sie nickte tapfer. Sie hatte Angst und war nervös, das merkte er daran, wie sie den Anhänger ihrer Kette drückte. Das hatte sie auch getan, als er sie mit in die Geisterbahn genommen hatte. Klar, das hätte er nicht gedurft. Nach dem Unfall war Marie so schreckhaft geworden, dass es kaum auszuhalten war. Eben nicht wie eine normale Neunjährige.
Er hatte gehofft, die Geisterbahn würde sie weniger ängstlich machen, eine Schocktherapie quasi. Ein schwerer Fehler. Marie war so verängstigt gewesen, dass sie vier Wochen nicht alleine hatte schlafen wollen. Und Hilde war so sauer auf ihn gewesen, dass sie fast eine Woche kein Wort mit ihm gesprochen hatte. In diesem Wagen in der Geisterbahn hatte Marie auch die ganze Zeit mit dem gelben Glasanhänger gespielt.
Heinz strich ihr übers Haar: „Nur fünf Minuten.“
Seine Tochter nickte tapfer, dann ging er ohne sie weiter. Nach wenigen Metern warf er einen kurzen Kontrollblick nach hinten, ob sie auch wirklich zurückblieb.
Ein paar hundert Meter weiter saß der Kerl auf einer Bank und blickte ins Tal.
„Ich hab geschrieben, du sollst alleine kommen! Aber wenn das Mädchen dein einziger Begleiter ist, wollen wir mal darüber hinwegsehen.“
„Ja, ist sie.“ Heinz’ Mund war trocken, er schwitzte.
Verzweifelt versuchte er, das Zittern seiner Hände zu unterdrücken, aber es gelang ihm nicht. Er wollte souverän und selbstsicher auftreten, doch das ging gründlich in die Hose. Am liebsten wäre er weggelaufen und das konnte er nicht mal ansatzweise verbergen.
„Du siehst nicht glücklich aus, mein Freund, freust du dich nicht, dass sie mich früher rausgelassen haben? Setz dich, wir müssen reden.“
Der Mann hatte sich nicht umgedreht, saß fast reglos da, nur sein Arm zeigte neben ihm auf die Bank. Heinz fühlte sich wie ein Schwein auf dem Weg zur Schlachtbank.
Sie saßen schweigend nebeneinander auf der Bank und blickten ins Tal. Heinz schwitzte, als hätte es 40 Grad. Dann sprach sein Gastgeber, ohne seinen Blick vom Tal abzuwenden.
„Wunderschön, der Ausblick. Da merkt man erst, was man in den letzten Jahren alles entbehren musste.“
„Ja“, krächzte Heinz.
„Aber die Zeit hat sich ja gelohnt, du hast sicher wahre Wunder an der Börse vollbracht. Wie viel hast du aus meinem Geld gemacht?“
„Nun ja, der Finanzmarkt, du musst verstehen …“, stammelte Heinz.
Der andere stand auf. Er war fast einen Kopf größer als Heinz. Seine Glatze zierte eine Narbe, die von einer Weinflasche herrührte, die ein Angreifer auf seinem Schädel zertrümmert hatte. In seinem Gesicht waren noch einige übel aussehende Narben hinzugekommen, seit Heinz ihn zuletzt gesehen hatte. Der Mann bemerkte, wohin Heinz’ Blick gewandert war. Er grinste.
„Auch im Knast wissen einige nicht, wo in der Nahrungskette sie hingehören. Ich kann dich echt gut leiden, Kleiner, gib mir keinen Grund, dass sich das ändert. Wo ist mein Geld?“, sagte er.
„Aber, du musst verstehen, die Börse ist eingebrochen …“, versuchte Heinz, nun der Panik nahe, sich zu rechtfertigen.
Es war wirklich ein Fehler gewesen, Marie hierher zu schleppen. Plötzlich geriet alles außer Kontrolle. Heinz fing sich einen üblen Schlag in die Magengrube ein, er sackte in sich zusammen. Im Bruchteil einer Sekunde entschied er sich und zog seine Waffe. Seine Lebensversicherung, er hatte sie am Vortag am Bahnhof gekauft. Er war der Meinung, es reiche aus, das Ding zu besitzen. Wie sie funktionierte, wusste er aus dem Fernsehen, man musste nur abdrücken. Er hatte sich den Revolver sogar laden lassen.
Als er sich aufrichtete, hielt er das Ding zitternd in beiden Händen und zielte sogar grob in die Richtung des Angreifers. Er hörte Marie aus der Ferne schreien und drehte sich zu ihr um. Im selben Moment schlug etwas an seiner Schläfe ein, Schmerz explodierte, er drückte ab. Das Letzte, was er sah, war, wie seine Tochter neben der Bank zusammenbrach.
3
Juli 1985
Es war ein warmer Sommertag, hunderte Menschen bevölkerten die Heidelberger Fußgängerzone. Vanessa und Maria saßen auf einer der grünen Drahtbänke, die seit Neustem überall in der Stadt aufgestellt waren, und rauchten.
Vanessa hatte im Kaufhaus ein schwarzes Kleid gesehen, das sie unbedingt haben musste. Leider sagte ihr Kontostand etwas anderes.
„Ich kann dir die hundert Mark leihen, aber ich brauch sie zurück“, sagte Maria, um gleich darauf unter ihrer vor Freude jubelnden Freundin begraben zu werden. „Okay, aber dann müssen wir uns beeilen, die Bank macht um zwölf Uhr zu“, erklärte Maria lachend, als sie sich unter Vanessa herausgewunden hatte.
Wenige Meter vor der Glastür der Bank eilten drei Männer in langen Mänteln an ihnen vorbei. Der Letzte wollte gerade die Tür zumachen, Vanessa konnte ihn gerade noch daran hindern.
„Halt, wir müssen auch noch rein“, rief sie.
Was nun passierte, konnte Maria nicht sehen. Der Knall war ohrenbetäubend, dann sank ihre Freundin zu Boden. Das Shirt des Mädchens färbte sich rot, dann zog der Typ die Tür zu. Die Menschen um sie herum rannten in alle Richtungen. Maria bekam davon kaum was davon mit, sie kniete sich zu Vanessa.
An diesem Montag waren zwei Kassierer ausgefallen und so war ein Mitarbeiter aus Mannheim gekommen. Der Anführer der Räuber konnte sich nicht an den pickligen Jungen mit der lächerlichen Brille auf der Nase erinnern, der hingegen wusste genau, wer da maskiert vor ihm stand. In der Grundschule war er mit einem der Räuber in dieselbe Klasse gegangen. Der jedoch konnte sich wohl nicht erinnern, wen er in der Pause zum Spaß verprügelt hatte, aber der Bankangestellte wusste ganz genau, auf wen seine zerbrochenen Brillen aus dieser Zeit gingen.
Die drei waren kaum aus der Bank geflohen, da kannte die Polizei schon den Namen des Anführers der Gruppe.
Vielleicht hätten die drei eine Chance gehabt, unbehelligt zu entkommen, hätte da nicht ein schwer verletztes Mädchen vor dem Eingang der Bank gelegen. Außerdem waren gut ein Dutzend Anrufe bei der Polizei eingegangen, dass vor der Sparkasse geschossen worden war. So kam es, dass das Gebäude rasch umstellt war und die Verbrecher bei ihrer Flucht aus dem Gebäude sofort unter Beschuss gerieten. Sie rannten in Richtung der Heiliggeistkirche und schafften es, in das Gotteshaus zu fliehen.
Die Polizei war einfach zu schnell für die drei und schon zu diesem Zeitpunkt war die Altstadt abgeriegelt, alle Brücken gesperrt und der Bahnhof geschlossen.
Um 13 Uhr stürmte die Polizei die Heiliggeistkirche und im Feuergefecht starben zwei der Räuber. Karl Schulz jedoch, der Boss der Bande, war spurlos verschwunden. Es war ein Rätsel, das noch geheimnisvoller wurde, als Karl auf der anderen Neckarseite mit seinen Käfer von der Polizei gestoppt wurde und sich – obwohl bis unter die Zähne bewaffnet – von einem 60-jährigen Streifenpolizisten widerstandslos festnehmen ließ.
Wo das Geld abgeblieben war, blieb ungeklärt, wie auch die Frage, wie Karl Schulz es über den Fluss geschafft hatte. Der Beamte, der den Käfer in Ziegelhausen angehalten hatte, gab an, dass er den Eindruck hatte, Herr Schulz habe es drauf angelegt, gefasst zu werden.
Schulz wurde zu zwölf Jahren verurteilt. Er saß regungslos die ganzen vier Prozesstage neben seinem Pflichtverteidiger und sagte kein einziges Wort.
4
Gabriele war mit Martina Sommer, einer jungen Kollegin der Spurensicherung, über die Straße ans Neckarufer getreten. Sie hielt die Dummheit ihres Partners keine Minute länger aus. Gegen die aufkommenden Gewaltfantasien zündete sie sich eine Zigarette an, die sie von Martina geschnorrt hatte. Eigentlich rauchte sie als Sportlerin nicht. Dieser Typ würde sie noch ins Grab bringen.
Martina zog an ihrem Glimmstängel und blickte schmachtend über die Straße: „Dass du auch immer so ein Glück hast!“
„Was meinst du?“, fragte Gabriele, die nicht verstand, was Martina meinte.
Die grinste zu Manfred hinüber. „Ach komm, du darfst mit dem süßesten Mann der ganzen Mordkommission zusammenarbeiten. Wenn das kein Glück ist!“
„Ja, ich könnte kotzen“, antwortete Gabriele knapp.
„Weißt du, ob er noch Single ist?“, bohrte Martina weiter.
Gabriele nahm ihr Smartphone aus der Tasche und ließ ihre immer noch entzückt schwärmende Kollegin alleine zurück. Als sie außer Hörweite von Martina war, wählte Gabriele die erste Telefonnummer im Telefonbuch. Erwin nahm das Gespräch sofort an.
„Und? Was habt ihr?“, meldete er sich ohne Gruß und Vorgeplänkel.
„Du besorgst mir einen anderen Partner oder du verlierst deine beste Ermittlerin an die Staatsanwaltschaft, weil ich ihn töten werde!“
„Langsam, langsam. Er ist noch neu, er arbeitet sich erst ein“, beschwichtigte Erwin seine Mitarbeiterin. „Aber was habt ihr nun?“
„Nichts Aktuelles. Ein totes Mädchen, muss schon länger tot sein, hatte ein geblümtes Kleid an“, erzählte Gabriele.
Erwin schwieg. Sie wollte schon das Gespräch beenden, als sie eine leicht gequälte Stimme hörte: „Geblümt? Grundfarbe blau?“
„Ja, glaube schon“, bestätigte sie verwundert.
„Ich komme zu euch!“, sagte ihr Chef und beendete das Gespräch.
Sie schaute ungläubig auf das Telefon. Er bewegte sich aus seinem Büro? Das hatte er schon seit seiner vorletzten Beförderung nicht mehr getan. Verdammt, er hatte sich schon im Bett kaum bewegt, was der wahre Grund für das Ende ihrer Beziehung gewesen war.
Verwirrt und in ihre Gedanken versunken ging sie zurück zum Fundort der Kinderleiche. Auf halben Weg kam ihr Manfred entgegen und verkündete, vollkommen von seinem Urteil überzeugt: „Ich würde sagen, der Baggerfahrer war es nicht! Aber zu hundert Prozent ausschließen kann man es nicht. Ich habe ihm gesagt, er kann gehen, soll aber Heidelberg nicht verlassen.“
„Ich fasse es nicht“, murmelte Gabriele vor sich hin.
„Was meinst du?“, fragte Manfred, der sie offenbar nicht verstanden hatte.
„Hast du gut gemacht, hab ich gesagt“, sagte sie laut und fügte dann noch hinzu: „Erwin kommt her, er will sich selbst ein Bild machen.“
Die Zeit, in der sie auf ihren Vorgesetzten warteten, verbrachten die beiden unterschiedlich. Während Gabriele versuchte, die Umgebung auf sich einwirken zu lassen, hatte Martina ihre Scheu überwunden und nun erste Tuchfühlung zum Objekt ihrer Begierde aufgenommen. Gabriele wünschte ihr von ganzem Herzen viel Erfolg, vielleicht würde er ja zur Spurensicherung wechseln und sie war ihn los.
So in Gedanken versunken fiel Gabrieles Blick auf einen Erdriss, der sich gut einen Meter über dem Erdloch, in dem sie das Opfer gefunden hatten, auf einer Länge von gut fünf Metern von Ost nach West erstreckte. Sie ging hin und schaute hinein. Der Riss schien tief zu sein.
„Hat jemand eine Taschenlampe?“, fragte sie an ihre Kollegen gewandt.
Zu ihrer Überraschung griff Manfred in seine Hosentasche und zog eine kleine Stablampe hervor. Sie leuchtete in den Spalt, konnte aber nichts erkennen, also versuchte sie, mit bloßen Händen etwas Erde zu entfernen.
Dann hörte sie die Stimme des Baggerfahrers: „Geh mal weg Mädchen!“, und schon hieb er kraftvoll mit einem Spaten ins Erdreich.
„Was die alles auf ihrem Bagger haben …“, bemerkte Manfred anerkennend.
Schnell war der Spalt so ausgedehnt, dass Gabriele den Kopf hineinstecken konnte. Was sie im schwachen Licht der Taschenlampe erblickte, ließ ihr den Atem stocken. Mit etwas Schwindel hörte sie ihre eigene, heisere Stimme.
„Ruf den Gerichtsmediziner zurück! Und er soll Verstärkung mitbringen, viel Verstärkung!“
Inzwischen hatte Gabriele die ungeteilte Aufmerksamkeit aller vor Ort befindlicher Beamten. So bemerkte niemand, wie ein kleiner, rundlicher Mann mit nur noch sehr spärlichem Haarwuchs sich der Leiche des Kindes näherte. Der Anzug spannte über dem Bauch und sein Atem war schwer, als er sich nach unten beugte. Der Mann nahm ein Polaroid-Foto aus der Tasche und verglich das von den Jahren sehr mitgenommene Kleidungsstück mit dem auf dem Foto abgebildeten. Er nickte. Er hatte gesehen, was er sehen musste. Er wusste nur nicht, ob er sich über die Erkenntnis freuen sollte.
Inzwischen waren auch die Kollegen, die bisher auf das Erdloch gestarrt hatten, auf den Mann aufmerksam geworden. Ein halblautes Murmeln kam auf: „Er kann laufen? Er hat sein Büro verlassen! Ist das Präsidium abgebrannt?“
Gabriele sprach den Neuankömmling an. „Erwin, was ist los? Ist dir nicht gut? Du bist so blass.“
„Ich kenne das Opfer“, erklärte Erwin.
Alle erwarteten, dass er den Worten noch etwas Erklärendes hinzufügen würde. Als er schwieg, fasste sich Gabriele ein Herz.
„Woher?“, fragte sie. „Wer ist sie?“
„Marie März, sie war mein erster Fall. War schlimm damals. Ihr Vater ist in einem Indizienprozess verurteilt worden. Die Beweislast war erdrückend, aber er hat nie gestanden und er behauptet bis heute, sie wäre entführt worden und noch am Leben. Wohl der Grund, weswegen er nach über 20 Jahren noch immer keine Bewährung bekommen hat.“
5
Januar 1988
Fast drei Jahre hatte Professor Bauer gekämpft und mit den wichtigsten Museen in Europa verhandelt, aber heute war es soweit, die größte Ausstellung über Florenz im Mittelalter, die es je in Deutschland gegeben hatte, wurde eröffnet. Das wurde sie nicht irgendwo in der Bundesrepublik, nein, in seiner Heimatstadt, dort, wo er seinen Lehrstuhl hatte, in Heidelberg.
Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie er im Februar 1985 in Florenz gewesen war, die wichtigste Reise seiner beruflichen Laufbahn. Damals war er sehr nervös gewesen und hatte viel zu viel geraucht.
Sein Erste-Klasse-Flug war pünktlich auf dem winzigen Flughafen gelandet. Gerne erinnerte er sich an den Landeanflug durch die sanften, grasbewachsenen und zum Teil bewaldeten Hügel der Toskana. Der Flug in nur sehr geringer Höhe über Florenz gehörte zu dem Schönsten, was er in seinem nicht gerade kurzen oder ereignisarmen Leben gesehen hatte.
Es war Februar gewesen, doch die Bäume waren grün, das Thermometer zeigte angenehme 20 Grad und die Sonne stand am wolkenlosen Himmel. So ungefähr stellte sich Alfred das Paradies vor. Kein Wunder, dass es die mächtigsten, die talentiertesten Personen des Mittelalters genau hierher gezogen hatte.
Der Professor hatte ein Zimmer in einem Fünfsternehotel inmitten der Altstadt gehabt, direkt am Ufer des Arno. Das Zimmer war an Prunk und Luxus nicht zu überbieten: Kronleuchter, rote Samtvorhänge, Perserteppiche; bis hin zu den Gemälden an den Wänden war hier alles vom Feinsten. Der Zimmer-Butler hatte seine Kleidung vom Koffer in den begehbaren Kleiderschrank geräumt.
An diesem Abend hatte er Luca Skalletti getroffen, den Kurator der Villa Medici. Eine Begegnung, die sein Leben verändert hatte. Das Wichtigste war schon von ihren Assistenten ausgehandelt und besprochen worden, doch der Professor fand an diesem Abend einen Seelenverwandten, einen Freund.
Seit Wochen schon wurde die Heiliggeistkirche, der Ort der Ausstellung und selbst Motiv einer Zeichnung eines wenig bekannten Verwandten der Medici, zu einer Festung umgebaut. Die Ausstellung galt mit ihren unbezahlbaren Werken von Dante Alighieri, Leonardo da Vinci und den Medici als nicht versicherbar. Die größte deutsche Versicherung hatte schriftlich und nicht ohne Sarkasmus auf seine Anfrage geantwortet, dass sie vielleicht ein Haus gegen Hochwasser im Überflutungsraum eines Flusses abschließen würden, zumindest könnte man mit ihnen über dieses Ansinnen reden, über sein konkretes Problem jedoch keinesfalls.
Die Auflagen, welche die anderen Versicherungen forderten, waren nicht erfüllbar, unter anderem bewaffnete Wachen rund um die Uhr, und auch die Anforderungen an den Ausstellungsraum waren in einer Kirche nicht umzusetzen. Letztlich konnte Alfred doch den Deckungsschutz sicherstellen und war daher besonders stolz auf seinen Deal mit einer lokalen Versicherung.
6
Wieblingen, einer der besseren Vororte Heidelbergs. Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und heulendem Martinshorn raste durch das Neubaugebiet.
„Verdammt, Hans, musst du so schnell fahren? Gib meinem Kaffee doch wenigstens eine kleine Chance, dort hinzukommen, wo er hin soll!“, beschwerte sich Claudio bei seinem Kollegen, der mit Vollgas die Bodenwellen im verkehrsberuhigten Bereich des Ortes nahm und mit jeder Welle einen weiteren Schluck der heißen schwarzen Flüssigkeit erst in Richtung Wagenhimmel und dann auf Claudios Diensthose beförderte, was zunehmend schmerzhaft wurde.
Die beiden Beamten waren gerade in einer Bäckerei gewesen, um sich ihr Abendessen zu besorgen. Sie hatten eine Zwölf-Stunden-Nachtschicht vor sich und eigentlich erst um 18 Uhr Dienstbeginn, als über Funk der Ruf von der Zentrale kam.
„Das war ein stiller Alarm!“, rechtfertigte sich der Ältere der beiden, der gerade den Streifenwagen über eine weitere Bodenwelle springen ließ. „Wenn wir den kriegen, ist es fast immer ernst.“
Seltsam war jedoch, dass, als sie nur wenige Minuten nach Eingang des Alarms bei dem Anwesen ankamen, die Gartentür und die Einfahrt fest verschlossen waren. Nichts deutete darauf hin, dass jemand gewaltsam eingedrungen war. Der Zaun war massiv, gut zwei Meter hoch und alarmgesichert und an jeder Ecke des Grundstücks hingen Kameras. Hans betätigte die Sendetaste am Funkgerät.
„Zentrale für Wagen 15“, sagte er.
„Wagen 15, hier spricht die Zentrale.“
„Wir sind vor Ort. Gab es weitere Alarme von diesem Objekt oder Kontakt zum Besitzer?“
„Negativ, Wagen 15. Kein weiterer Alarm, Besitzer nicht erreichbar“, antwortete die Zentrale.
„Okay, over and out!“ Er wartete die Erwiderung nicht mehr ab.
In diesem Moment kam ein winziger Wagen eines ortsansässigen Sicherheitsdienstes um die Ecke. Dem Auto entstieg ein Wachmann, der im Gewicht dem seines Fahrzeuges sehr nahekam. Die Beamten konnten hören, wie die Stoßdämpfer sich deutlich entspannten, als der Koloss sich aus den Wagen gewuchtet hatte.
„Moin“, grüßte der Dicke knapp und bemerkte dann, schon etwas außer Atem aufgrund der gewaltigen sportlichen Anstrengung: „Muss nur den Schlüssel holen.“
Mit diesen Worten als Erklärung watschelte er zum Kofferraum seines Kleinwagens, öffnete ihn und beugte sich hinein, wobei er den Blick auf ein beeindruckendes Maurerdekolleté freigab.
Claudio wandte sich entsetzt ab. „Für so was verdiene ich eindeutig zu wenig Geld!“
Hans stimmte ihm mit einem Nicken zu.
Nach einer halben Ewigkeit zog der Revierfahrer einen riesigen Schlüsselbund aus dem Kofferraum und gab ihn den Beamten mit den Worten: „Einer von denen ist es.“
„Etwas genauer geht’s auch?“, fragte Hans mit deutlich genervtem Unterton.
„Ja, wartet, ich hab vorne im Wagen einen Ordner, in dem alle Schlüssel aufgelistet sind.“ Und schon watschelte er wieder los, diesmal in Richtung Beifahrertür.