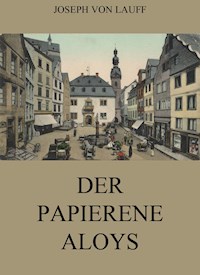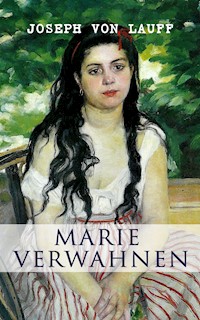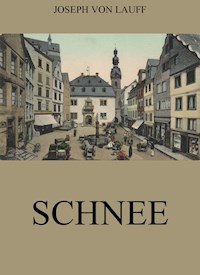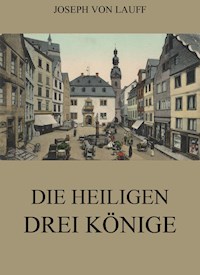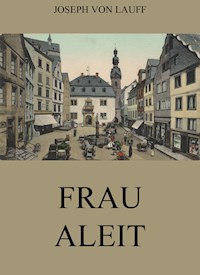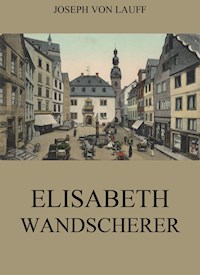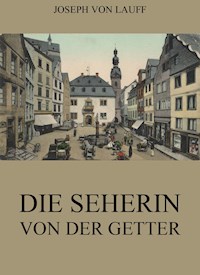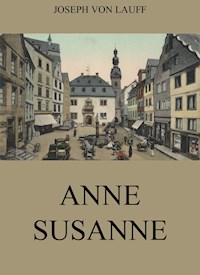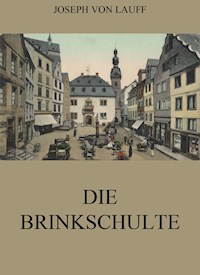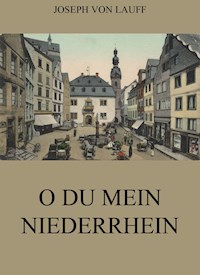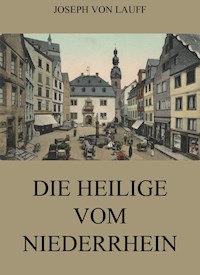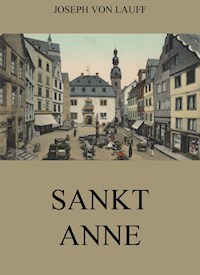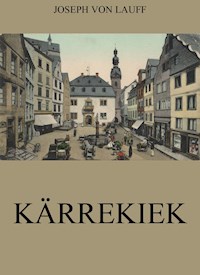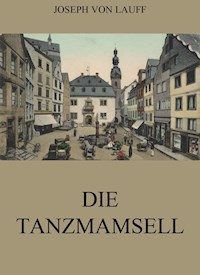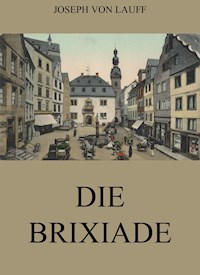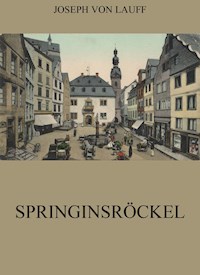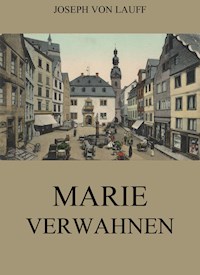
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Marie Verwahnen" zeigt die Vorzüge der Lauffschen Schreibweise, die schöne Schilderung der niederrheinischen Landschaft und des Volkslebens der niederrheinischen Region.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie Verwahnen
Joseph von Lauff
Inhalt:
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Marie Verwahnen
I. Johannes van Melle
II. Im Roten Häuschen
III. Zwischen Vater und Sohn
IV. Die Wachsmarie
V. Ich beschwöre Dich, Wasser!
VI. Du bist heilig – heilig – heilig ...!
VII. Rudibumbumbum
VIII. Bonaventura
IX. Intermezzo
X. Karfreitag
XI. Herr, erbarme Dich meiner!
XII. Und der Todesengel stand bei ihm
XIII. Das Stigma
XIV. Herr Doktor Barthes Terwelp
XV. Kommen sollst Du, auf daß er genese
XVI. Nicht heilig
XVII. Die Wachshand
XVIII. Der Morgen graut
XIX. Keine Glocke wurde geläutet
XX. Teichrose
Marie Verwahnen, J. von Lauff
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638764
www.jazzybee-verlag.de
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Dichter, geb. 16. Nov. 1855 in Köln als Sohn eines Juristen, besuchte die Schule in Kalkar und Münster, wo er das Abiturientenexamen bestand, trat 1877 als Artillerist in die Armee ein, wurde 1878 zum Leutnant, 1890 zum Hauptmann befördert und wirkte, einer persönlichen Aufforderung des Kaisers folgend, 1898–1903 als Dramaturg am königlichen Theater in Wiesbaden, wo er noch jetzt lebt; gleichzeitig wurde ihm der Charakter eines Majors verliehen. L. begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit den epischen Dichtungen: »Jan van Calker, ein Malerlied vom Niederrhein« (Köln 1887, 3. Aufl. 1892) und »Der Helfensteiner, ein Sang aus dem Bauernkriege« (das. 1889, 3. Aufl. 1896), denen später folgten: »Die Overstolzin« (das. 1891, 5. Aufl. 1900); »Klaus Störtebecker«, ein Norderlied (das. 1893, 3. Aufl. 1895), »Herodias« (illustriert von O. Eckmann, das. 1897, 2. Aufl. 1898), »Advent«, drei Weihnachtsgeschichten (das. 1898, 4. Aufl. 1901), »Die Geißlerin«, epische Dichtung (das. 1900, 4. Aufl. 1902); er schrieb fernerhin die Romane: »Die Hexe«, eine Regensburger Geschichte (das. 1892, 6. Aufl. 1900), »Regina coeli. Eine Geschichte aus dem Abfall der Niederlande« (das. 1894, 2 Bde.; 7. Aufl. 1904), »Die Hauptmannsfrau«, ein Totentanz (das. 1895, 8. Aufl. 1903), »Der Mönch von Sankt Sebald«, eine Nürnberger Geschichte aus der Reformationszeit (das. 1896, 5. Aufl. 1899), »Im Rosenhag«, eine Stadtgeschichte aus dem alten Köln (das. 1898, 4. Aufl. 1899), »Kärrekiek« (das. 1902, 8. Aufl. 1903), »Marie Verwahnen« (das., 1.–6. Aufl. 1903), »Pittje Pittjewitt« (Berl. 1903) sowie die Lieder »Lauf ins Land« (Köln 1897, 4. Aufl. 1902). Als Dramatiker trat er zuerst hervor mit dem Trauerspiel »Inez de Castro« (Köln 1894, 3. Aufl. 1895). Von einer Hohenzollern-Tetralogie sind bisher erschienen und wiederholt ausgeführt »Der Burggraf« (Köln 1897, 6. Aufl. 1900) und »Der Eisenzahn« (das. 1899); ihnen sollen »Der Große Kurfürst« und »Friedrich der Große« folgen. Lauffs neueste Dramen sind das Nachtstück »Rüschhaus«, das vaterländische Spiel »Vorwärts« (beide das. 1900) und das nach dem Roman »Kärrekiek« verfaßte Trauerspiel »Der Heerohme« (das. 1902, 2. Aufl. 1903). Während L. in seinen Romanen echtes Volksleben des Niederrheins poetisch festhält und in seinen epischen und lyrischen Dichtungen trotz wortreicher Diktion ein starkes Talent verrät, greift er in seinen Dramen, namentlich in den höfisch beeinflußten Hohenzollern-Stücken, oft zu unkünstlerischen Mitteln und erweckte entschiedenen Widerspruch. Vgl. A. Schroeter, Joseph L., ein literarisches Zeitbild (Wiesbad. 1899); B. Sturm, Joseph L. (Wien 1903).
Marie Verwahnen
I. Johannes van Melle
Die anbrechende Nacht kroch grau in grau über die Landschaft. Über der Weidenkoppel jenseits des Rheines lag ein schmaler, langgestreckter Streifen wächsernen Lichtes, der allmählich zusammenschrumpfte und an Helligkeit abnahm. Wie abgezirkelte Bälle standen die Schattenrisse der Kopfweiden am jenseitigen Ufer und ließen ihre Spiegelbilder von dem fahlbeleuchteten Rheinwasser verschlucken, das langsam und breit in seinem flachen Strombett vorübergurgelte. Scharfumgrenzte Lichter standen unbeweglich über der ziehenden Fläche. –
Es war ein warmer Sommerabend. Knarrend holperte mein Gefährt über den mächtigen Stromdeich, dessen weitausgelegte Flanken das Wiesentief des Binnenlandes bei Überschwemmungsgefahr zu sichern hatten. Wie ein langgestrecktes Ungetüm und fast in schnurgerader Richtung lief diese massige Schutzwehr das Ufer entlang, um in eine kleine niederrheinische Stadt zu münden, deren verschwommene Turmsilhouette sich schon geraume Zeit vor meinen Blicken emporhob. Trotz der werdenden Nacht schwebte eine eigentümliche Dämmerhelle über Rhein und Flachland, die auch die ferner gelegenen Gegenstände deutlich vor Augen führte. Ab und zu tönte Hundegebell. Die große Stille verschlang es. –
Eine nicht zu beherrschende Sehnsucht hatte mich in diese Gegend getrieben. Hier war heimischer Boden. Weiter stromaufwärts und in der Nähe der kleinen Stadt, die sich mittlerweile in ein undurchdringliches Düster gehüllt hatte, lag meine engere Heimat. Ich kam von dorther und stand nunmehr im Begriff, einen Jugendfreund aufzusuchen, der, seiner väterlichen Scholle getreu, als Arzt in dem verlorenen Rheinnest praktizierte, dem ich seit einer Stunde in meinem schwankenden Halbverdeck entgegenrüttelte. Gemeinsam hatten wir unseren humanistischen Studien obgelegen, gemeinsam die Miseren des Abiturientenexamens durchkostet und dann uns geschieden. Jahre waren dahingegangen. Sechzehn Jahre, reich an Freuden und Hoffnungen, lagen hinter mir und ließen mich in Ungewißheit über die ferneren Schicksale des in sich gekehrten und eigentümlichen Freundes und Menschen aus verklungenen Tagen. Daß er die Universitäten Würzburg und München bezogen und an letzterer sein Staatsexamen magna cum laude bestanden hatte, war mir zufällig zu Ohren gekommen; daß das Wesen des Absonderlichen sein späteres Dasein umhüllte, konnte ich mir zusammenreimen – dann aber war die große Leere, das tiefe Schweigen über uns hereingebrochen, bis etwa vor Monatsfrist die bedeutendsten Tagesblätter des In- und Auslandes den Namen Johannes van Melle mit einer Entdeckung in Verbindung brachten, die auf medizinischem Gebiet als epochemachend anzusehen war. Ohne Reklame, still und geräuschlos, aber siegesgewiß hatte das glücklich gezeitigte Produkt eines emsig schaffenden Geistes es zuwege gebracht, die für mich und alle Welt so gut wie verschollene Persönlichkeit eines merkwürdigen und vereinsamten Menschen in die grelle Beleuchtung eines elektrischen Scheinwerfers zu stellen – und da solches geschah, begannen in meiner Seele leise Saiten zu klingen. –
Der Turmkoloß kam wieder in Sicht. Hinter seiner massigen Profilierung schob sich ein intensives Licht vor, auf dessen Fläche die Zacken und Schrägen des klobigen Bauwerks wie aufgenagelt erschienen. Es lag etwas Ungefüges, Trotziges, Herausforderndes in der ganzen Erscheinung, in welcher ich das Harte und Unbeugsame im Charakter der dortigen Menschen wiederzuerkennen glaubte, eine Erkenntnis, die verstärkt wurde beim Anblick des ruhig ziehenden Stromes und der majestätischen Öde des Tieflandes, die jetzt unter dem Mond lagen wie Giganten in schwerfälliger Eigenart.
Mit stoischem Gleichmut paffte der Kutscher seinen Rippchentabak aus der irdenen Pfeife. Es war heimisch Gewächs, was da in blauen Wölkchen hinauszog und meine Stirne umnebelte.
Ein großer Nachtfalter taumelte vorüber. Er querte den Deich und schwebte geraume Zeit über einer schwarzen Wasserlache, die, an der Binnenseite des Dammes gelegen, wie ein dunkles und geheimnisvolles Auge nach oben stierte. Stumm, gespenstisch und die Phantasie zauberisch umstrickend, ein sammetglänzender Heliotrop, ruhte der Kolk unter der nächtlichen Helle und nahm die Sinne gefangen. Inmitten der Fläche stieg ein grelleuchtender Punkt auf. Weiß, keusch und rein, wie die Farbe des Kleides, das die kleinen Mädchen am Fronleichnamstage tragen, schwamm sein Licht auf der unbeweglichen Tiefe, die die Blätterfülle des hellen Punktes schauernd zu tragen schien. Es war der vollentfaltete Kelch einer Wasserrose – und mir war es so, als wenn aus dieser Blume das Mysterium eines Menschenherzens sich löste, als müßte eine Stimme ertönen, die da spräche: »Ziehe die Schuhe von Deinen Füßen, denn die Stelle, wo Du stehst, ist heilig.«
»Heilig!« klang es um mich her.
Ich hatte selber gesprochen.
Teich und Wasserrose verschwanden. Sie tauchten in die flüssige, silberlichte Folie des Geländes. –
Zwei dunstige Feueraugen lagen fern auf der Mitte des Deiches. Bei unserem Näherkommen nahmen sie eine scharfe Umgrenzung an und wurden wie auf Stielen höher gehoben. Jetzt konnte ich sie deutlich erkennen. Es waren zwei Straßenlaternen mit mattleuchtendem Öldocht, die den Eingang zum Städtchen flankierten. Stoßend ging jetzt das alte Gefährt über das holperige Pflaster, aber noch immer mußte ich der geheimnisvollen Blume gedenken da draußen im Flachland. Die Straßen lagen fast menschenleer; nur vereinzelte Leute saßen hemdärmelig vor den niedrigen Häusern und genossen die angenehme Luft des laulichen Sommerabends. Wäscheblau-weiß und krapprot angekalkte Giebelfronten zogen langsam vorüber. Nirgendwo ein auffallendes und unliebsames Geräusch. Nur in der Wirtschaft ›Zum goldenen Anker‹ machte sich das scharfe Ketschen von Billardkugeln bemerkbar. Das war alles! – Wir hatten die Hauptstraße passiert.
»Na, nu weiter!« klang es vom Bock her.
Behäbig drehte sich der Kutscher um seine schwerfällige Achse, wobei er an der Schirmmütze rückte und den tönernen Pfeifenstummel stumpfen Blickes in den linken Mundwinkel beförderte.
»Heda!«
Im Türrahmen eines kleinen Hauses stand ein verhutzelter Mann in Zipfelmütze und Holzschuhen.
»Wo wohnt hier der Doktor Johannes van Melle?«
»Großer Markt Nummer fünf, neben der katholischen Kirche.«
»Danke.«
»Har – üh!«
Die Schatten der wiederanziehenden Pferde haspelten weiter und bewegten sich auf dem beleuchteten Pflaster wie gigantische Spinnen mit zappelnden Stelzbeinen.
»Prr!«
Wir waren zur Stelle. Ein stattliches Haus im Mansardenstil, mit Freitreppe und grünen Jalousien lag vor mir. Nachdem ich den Kutscher abgelohnt hatte, zog ich die Klingel. Unangenehm und grell, wie die keifende Stimme eines Frauenzimmers, zitterte und kreischte der langgezogene Ton durch die weiten Korridore der geräumigen Wohnung. Von allen Ecken und Enden kam das Echo zurück. Selbst von den Gängen des oberen Stockwerks hallte das Geklingel wie unter dem Einfluß eines geheimnisvollen Resonanzbodens wider. Dann verstummte es plötzlich.
Ein peinliches Gefühl ergriff mich, eine Art von Beklemmung, die sich bis zu einem physischen Schmerz in der Herzgegend steigerte, als die Tür sich öffnete und der weiche, sehnsüchtige Klang einer sanftgestrichenen Geige aus dem Innern hervordrang.
Eine kleine Frau mit stechenden Augen, gefälteter Spitzenhaube und ganz in Schwarz gekleidet stand vor mir. Fast gleichzeitig hob sie einen Messingleuchter in die Höhe, dessen Unschlittkerze mir einen unliebsamen und grellen Schein ins Gesicht warf. Der Blick der Alten war scharf und fixierend. Er hatte etwas Unheimliches an sich – aber äußerst besänftigend tönten die schmelzenden Kantilenen aus dem rechts gelegenen Zimmer herüber.
»Ist vielleicht der Herr Doktor Johannes van Melle ...«
»Ach, du Herr Jeses! – die Landpraxis ...«
»Ich stelle keine Anforderungen an seine Kunst,« fiel ich erläuternd ein, »ich möchte ihm nur die Hand schütteln; ein alter Bekannter ...«
»Hm!« machte die Alte, »dann muß ich leider bedauern. Der Herr Doktor haben Befehl gegeben ... Wissen Sie nämlich ... Ach, so! – was ich sagen wollte ... Sie sind ja ein guter Bekannter, aber der Herr Doktor hat wieder seinen heiligen Abend.«
»Was heißt das?«
Mit halbgeschlossenen Lidern betrachtete mich das verschrobene Weibchen. An Stelle des Stechenden in den Blicken war eine melancholische Weichheit getreten. Und wieder die sanfte Kantilene von eben, die allmählich den Charakter des Heiteren verlor und sich in eine ergreifende Klage verwandelte. Die Geige flehte, weinte, schluchzte.
Ich stand wie gebannt.
»Hören Sie das, mein Herr,« sagte die nunmehr geschwätzig werdende Alte, »hören Sie das, mein Herr? Das drückt einem das Herz ab, wenn man so etwas vernimmt in den heiligen Nächten. Nun begreifen Sie doch ...?«
»Nicht ganz, werte Frau.«
»Nicht? – Ach, so! – Sie können's ja auch gar nicht begreifen. Die Sache hat nämlich folgende Bewandtnis. Alljährlich, wenn die Zeit der Wasserrosen ist, wenn sie da draußen schwimmen und so eigentümlich gen Himmel blicken, dann sind für den Herrn Doktor die heiligen Nächte gekommen. Dann geigt er den ganzen Abend. Dann muß er spielen – kann nicht anders – dann drückt ihm eine fremde Gewalt die Geige in die Hand, dann muß er spielen, der Aermste, immer nur spielen – spielen, spielen ... Ach, du Herr Jeses ...!«
Sie glaubte schon zu viel gesagt zu haben, denn ihre Augen nahmen wieder den stechenden Blick an, krochen in ihre Höhlen zurück und musterten mich von Kopf bis zu Füßen.
»Nun werden Sie doch begriffen haben, mein Herr?«
»Ich habe verstanden.«
»Na, denn also!«
Ich war durch die kategorische Art der Abweisung etwas verdutzt, faßte mich aber und stand gerade im Begriff, mit energischen Gegenvorstellungen zu dienen, als das Weibchen sich aufreckte, ein kaum merkliches Zeichen machte, die Augen aufriß und langsam die Worte hersagte: »Jetzt kommt es, mein Herr.«
Der dumpfe Ton, in dem sie das sagte, hatte etwas Feierliches, Gespenstisches, Niedagewesenes, so daß es mir fröstelnd und kalt durch alle Glieder rieselte. Gleichzeitig erschallte ein dämonisches Gelächter aus dem Zimmer zur Rechten. Mit einer schneidenden Dissonanz brach das Spiel ab.
»Was ist denn das?«
Die Tür rechts wurde aufgerissen. Ein hagerer, langaufgeschossener, nach vorn gebeugter Mann, die Geige in der Linken, den Fiedelbogen in der Rechten, salopp, aber tiefschwarz und vornehm gekleidet, mit niedrigen Vatermördern und geknotetem Halstuch trat in den Hausflur. Das Gesicht war bleich, ehern, bartlos. Mit gekniffenen Lippen, das Haar verwirrt, unter den buschigen Brauen verschleierte Blicke – so stand er etliche Schritte vor mir. Die neue Erscheinung übte einen faszinierenden Einfluß aus. Ein packendes Fluidum, eine magische Kraft schien von ihr auszugehen. Ich hatte das Gefühl eines elektrischen Schlages.
»Johannes ...!«
Der Angerufene prallte ordentlich zurück. Er mußte die Stimme erkannt haben.
Ich sah noch, wie er die Arme breitete, ich sah das blendende Weiß seiner durchgeistigten Hände und das zuckende Feuer, welches in der Tiefe seiner Augen brannte – dann ruhten wir Brust an Brust. Seine Seele, sein ganzes inneres Wesen durchströmte mich – und unbewußt, aber wie durch eine magische Kraft hervorgezaubert, trat mir wieder die bleiche Wasserrose vor Augen.
In dieser Umarmung wurden Jahre überbrückt. Wir verstanden uns und fühlten: wir waren die alten.
»Sechzehn Jahre!« flüsterte Johannes van Melle.
Eine große Stille entstand; nur die Alte räusperte sich und meinte: »Soll ich Licht bringen, Herr Doktor?«
Dieser sah sie lächelnd an: »Licht in der heiligen Nacht? – Nein, aber eine Flasche Forster-Traminer.«
Hierauf führte er mich in sein Arbeitszimmer und legte Geige und Fiedelbogen beiseite. Ich weiß nicht, wie es kam, aber auch hier drängte sich mir wieder etwas Beklemmendes auf, dessen ich nicht Herr werden konnte. Der Mond stand mit seiner vollen Scheibe mitten in der oberen Hälfte des Fensters. Kreidige Lichter, mit dem intensiven Schimmer von Kobaltbläue getempert, lagen auf Tisch und Bücherregalen und zitterten über schwerfällige Möbel von verjährter Pracht und düsterem Aussehen.
Johannes van Melle trat in diese grelle Beleuchtung. Er schien unter dem magischen Einfluß zu wachsen, und mir war es so, als wenn ihn ein kaum merkliches, aber dennoch auf- und niederzüngelndes magnetisches Licht umbüschelte, das stetig an Helligkeit zunahm. Ich gebe zu, daß mich Täuschung umfing; meine Nerven waren erregt, und dennoch lag kein besonderer Grund vor, die vorliegende Erscheinung mit skeptischen Augen zu betrachten. Schweigend wies Johannes van Melle auf einen altmodischen Sessel mit Rückenlehne. Die Bewegung seiner schneeweißen Hand hatte eine zwingende Kraft. Ich folgte willenlos. Er selbst blieb stehen.
Um mich über das Sonderliche und Peinliche in der ganzen Situation hinwegzusetzen, rieb ich meine fröstelnden Hände zusammen und meinte: »Du bist glücklich, Johannes.«
»Glücklich?! – Warum?«
Er sprach es mit einer schauerlichen Betonung.
»Nun, ich dächte,« wagte ich schüchtern einzuwerfen, »Deine Erfolge lassen es doch berechtigt erscheinen, einer derartigen Vermutung Raum zu geben. Deine Entdeckungen auf gynäkologischem Gebiet beherrschen die fachwissenschaftlichen Blätter, füllen die Spalten der Tagespresse, bilden den Gesprächsstoff in den medizinischen Kreisen, und, falls alle Zeichen nicht trügen, dürften sie geeignet sein, Dir in nicht allzu ferner Zeit einen akademischen Lehrstuhl zu sichern. Das ist eben die nackte Tatsache, die logische Folgerung Deiner Mühe und Arbeit, das nicht hinwegzuleugnende Fazit emsiger Forschung – und, Du magst wollen oder nicht, an dieser bestehenden Sachlage läßt sich nun einmal nicht rütteln und deuteln, mein Junge.«
Ich suchte einen jovialen Ton anzuschlagen, allein die erhoffte Wirkung blieb aus.
»Und wenn es so wäre,« keuchte Johannes van Melle, »was soll das, was beweist das hinsichtlich Deiner aufgestellten Prämisse?«
»Aber Johannes ...!« Eine gebieterische, unnachahmliche Handbewegung ließ mich verstummen. Die Augen meines Partners weiteten sich geisterhaft.
»Gut,« fuhr er fort, »durch mein ewiges Sinnen, Grübeln und Denken habe ich der leidenden Menschheit einen gewissen Dienst erwiesen – aber dieses Sinnen, Grübeln und Forschen entsprang nicht aus Liebe zur Sache, es war das gebieterische Muß einer krankhaften Psyche, die notwendige Folgerung eines verfehlten, vereinsamten Lebens und die krampfhafte Sucht, ein drohendes Etwas in meiner Brust, in meinem Fühlen und Denken niederzuschlagen und zu übertäuben, was mir nun schon seit Jahren das Dasein vergiftet. – Nein, nein, nein – und abermals nein! – Hier ist etwas zerrissen in mir, schon seit Jahren zerrissen ...«
Er tat den Rock auseinander und schlug mit der geballten Faust auf die Brust: »Hier sitzt das nun schon Monde um Monde, schon Jahre um Jahre und versucht, einem Gefäße und Nerven zu sprengen. Ich kann's nicht verwinden – und dabei glücklich sein?! – Hahahaha ..!«
Ein schauerliches Gelächter, das Gelächter von eben, durchhallte die Stube: »Nein, nein, nein! – Für mich sind die Rosen von Pästum verblüht, und Wasserrosen, kalte, bleiche Wasserrosen sind an ihre Stelle getreten. Sieh dorthin!«
Doktor Johannes van Melle wandte sich.
»Sieh dorthin!« gebot er noch einmal.
Wie unter dem Zwange einer Hypnose stehend, folgte ich mechanisch der gegebenen Anweisung.
Der Mond war weiter gerückt. Jetzt erst bemerkte ich ein niedriges, dreibeiniges Tischchen, auf dem ein langgezogenes, musivisches Glasgefäß stand. Es war von einer grünlich phosphoreszierenden Färbung. Geschlängelt und kraftstrotzend hing der saftige Stiel einer Wasserrose in einer leuchtenden Flüssigkeit, während der prächtig entfaltete Kelch der schneeweißen Blume den oberen Rand des Gefäßes bedeckte. Ueber Glas und Blütenkelch hing ein Pastellbild in düsterem Rahmen.
Ich trat näher.
Das taghelle Mondlicht ließ auch die subtilsten Dinge auf dem mittelgroßen Bildwerk erkennen. Ein wunderbarer Mädchenkopf in visionärer Verzückung, würdig der durchgeistigten Tiefe eines Gabriel Max, sah mich aus dem nachgedunkelten Rahmen an. In dem wachsbleichen Antlitz spiegelte sich die alle verschlungenen Fäden des Seelenlebens auflösende Kraft einer Hellseherin wider, gepaart mit dem unwiderstehlichen Zauber einer berückenden Schönheit. Ihre Augen waren nicht von dieser Welt, aber irgendwo waren sie mir schon begegnet im Leben.
Mit einem fragenden Blick wandte ich mich an Doktor Johannes – da: leise wurde an die Tür geklopft.
Er überhörte das Klopfen, aber sein Aussehen war grausig. Er hatte wieder Geige und Fiedelbogen ergriffen, und während ich sprachlos diesen Begebenheiten eine Deutung abzugewinnen suchte, zogen Töne von eigentümlicher Klangfarbe meinem horchenden Geiste vorüber. Schmerz, Haß, Liebe und Verachtung, Poesie und Entsagung – alles war in diesem schmelzenden, schreienden, weinenden Tongefüge vereinigt, und dabei raunte er hastig: »Das allein ist ein Mittel, wenn auch nur ein Palliativmittel, gegen den entsetzlichen Dämon. – Marie ...! – Marie ...!«
Unwillkürlich mußte ich wieder das Bild über der bleichen Wasserrose betrachten, und ich konnte den Zwangsgedanken nicht los werden, schon einmal diesem seltsamen Wesen begegnet zu sein. Da war es mir plötzlich, als ob sich die Nebel zerteilten ...
Ein Andante erklang: es war das zauberische Andante aus Mozarts Es-Dur-Sinfonie, und wie es leise verzitterte, da hatte ich auch die Lösung hinsichtlich des schönen Mädchens gefunden.
»Johannes – das ist ja ...«
Mit einem jähen, gellenden Riß brach das Spiel ab.
»Endlich verstehst Du!«
»Das ist ja dieselbe,« sprach ich mit abgerissenen Lauten, »dieselbe wie auf der unscheinbaren Photographie, die Du mir vor Jahren zeigtest, als wir nach Beendigung unserer Gymnasialstudien uns trennten.«
»Dieselbe,« sagte Doktor Johannes van Melle.
Seine Stimme war heiser. »Dieselbe, dieselbe!« wiederholte er mit gräulicher Betonung, wobei er mit dem Bogen auf den Resonanzboden klopfte.
»Und die da?«
»Gabriel Max hat sie in Pastell übersetzt.«
»Und was ist aus ihr geworden?« fragte ich kleinlaut.
»Das ist es ja eben – das ist es ja eben!« schrie der Doktor mit häßlicher Stimme. »Sie ist ja tot!« und zum dritten Male ertönte das schauerliche Gelächter, das ich vorhin auf dem Hausflur vernommen hatte.
»Und was bedeutet die Wasserrose?«
»Das ist die Seele der Verstorbenen, die auf dem Wasser schwimmt,« sagte er ruhig.
Er atmete tief auf.
Ich entsetzte mich. Sollte hier der Wahnsinn seine Klauen eingeschlagen haben?
Er schien meine Gedanken zu erraten. Er lächelte und deutete auf den Sessel, den ich kurz zuvor innegehabt hatte.
»Willst Du hören?« fragte er nach einigem Schweigen.
»Ich höre.«
Es wurde zum anderen an die Tür geklopft.
»Herein!«
Der Forster-Traminer kam. Die erste Flasche.
Doktor Johannes van Melle richtete sich hoch auf. Die gefalteten Hände ließ er herabhängen. Sie hatten im Mondlicht einen Schimmer, der an Marmor erinnerte. Mit einem tiefen Seufzer ließ er sich dicht am Fenster nieder, dann sprach er: »So höre.«
II. Im Roten Häuschen
»Hörst Du, hörst Du ...!« – – – – – – – –
Der Sturm setzte mit gewaltigem Stöhnen über den Rheindeich. Zerfetzte Wolken trieben vorüber; ihre Schatten gaben dem breiten Wasser eine bleigraue Färbung. Die noch kahlen Pappelkronen sausten im Wind, Mensch und Vieh duckte sich vor dem mächtigen Odem, verdächtiger Schaum spritzte über Buhnen und Dämme, und auf allen Beobachtungswarten wurden die Sturmzeichen gehißt.
Es war im März. Die Tage der Karwoche waren nicht mehr fern. Märzschauer gingen über die Erde: bald Schneegestöber, bald Regen. Die weite Niederung hatte noch ein winterliches Aussehen, nur die Ruten der Kopfweiden bräunten sich, und hin und wieder sah das safrangelbe Auge einer Sumpfdotterblume aus dem grasigen Teppich. Unter dem Himmel war Krähengeschrei. In langen Geschwadern suchten die schwarzen Vögel ihre Kolonien auf. Trüb, lehmig und mit tückischen Wellen besetzt, rollte das angeschwollene Wasser vorüber. Bis in den März hinein hatte der Rhein gestanden. Dann war der Südwind gekommen. Die Fläche barst, und unter Poltern und Krachen, unter Stöhnen und Mahlen setzte sich das Eis in Bewegung. Stadt und Land atmeten auf. Die Gefahr schien vorüber zu sein, als sich die schwimmenden Massen unterhalb der kleinen Stadt abermals stauten und das Flußbett verrammten. Eine mächtige Eiswehr türmte sich auf, die das nachdrängende Wasser nur langsam fließen ließ. Alle Sprengversuche waren bis jetzt resultatlos verlaufen. Die Barriere regte und rührte sich nicht. Die Hochflut wuchs und bedrohte Dämme und Deiche und das gefährdete Binnenland. Die Stromwachen wurden verdoppelt. Bei Nacht brannten Feuersignale, Meldereiter waren an den wichtigsten Stellen postiert, und die Pulsanten standen in Bereitschaft, auf ein gegebenes Zeichen in die Kirche zu stürmen, die Glockentaue herunterzulangen und die ›Nothilfe‹ auszuläuten. –
Stromaufwärts, in Rufweite von den letzten Häusern des Städtchens, lag ein kleiner Ziegelbau. Er war unmittelbar an die Binnenseite des Paternosterdeiches gedrückt. Obgleich engbrüstig und langaufgeschossen, schaute er doch nur mit der äußersten Spitze der Giebelfront über den mächtigen Damm fort. Oberhalb der niedrigen Tür streckte sich ein breites, hellblau angestrichenes Schild, auf dem in stümperhaften Buchstaben geschrieben stand: ›Zum Roten Hüsken‹, mit der Unterbezeichnung: ›In Sinte Joris Estaminet‹. Hinter den viereckigen Scheiben des rechts von der Tür gelegenen Fensters standen allerlei Waren in weitbauchigen Glasgefäßen zum Kauf ausgeboten. Kandiszucker, Kaffeebohnen, Johannisbrotschoten, Süßholzstangen, Varinaskanaster mit dem obligaten Reiter in derber Holzschnittmanier auf der groben Papierdüte, Tonpfeifen und sonstige Nutz- und Gebrauchswaren wechselten in bunter Reihenfolge ab und führten ein beschauliches Dasein zwischen kleinen und großen Flaschen, aus denen gebrannte Flüssigkeiten in verschiedenen Farben und Schattierungen hervorblitzten. In ›Sinte Joris Estaminet‹ verkehrten schlichte und geringere Leute. Schiffer, die in der kleinen Stadt ausfrachteten, Handwerker und Handelsleute, die mit Band und sonstigen Kurzwaren über Land gingen, Fuhrleute, deren schwermütige Pferde mit klingendem Dachsfellkummet vor der Wirtschaft Halt machten, gossen hier gern den hellen Genever hinter den Kittel oder ließen sich das dünne Weißbier schmecken, das in der Nachbarschaft gebraut wurde. Links von der Eingangstür lag die mit weißem Rheinsand bestreute Wirtsstube, wo Herr Cornelis Janßen das Szepter führte, während im Laden zur Rechten seine Frau unumschränkte Gewalt hatte. Wirtschaft und Laden erfreuten sich eines leidlichen Zuspruchs. –
»Pröstchen...!«
Hemdärmelig, in Velvethose und Weste, die Hände in den weiten Taschen vergraben, die Beine gespreizt und die kurzstielige Tonpfeife in den linken Mundwinkel geschoben, saß Herr Cornelis Janßen hinter dem blankgescheuerten Wirtstisch und sah ins Wetter hinaus. Er war ein kleiner, untersetzter Mann in den vierziger Jahren. Fett und glatt, wie die pralle Haut einer gemästeten Gartenschnecke, frisch vom Rasiermesser gekommen und mit kurzgeschorenem Haarwuchs ruhte der breite Kopf auf dem putzigen Untergestell, das mit Holzschuhen und Lammwollsocken seinen Beschluß fand. Blank und vergißmeinnichtblau leuchteten die etwas schnapsseligen und fidelen Aeugelchen aus den verschwollenen Backen hervor, die ihrerseits wieder an das Knallrot der Pfingstrose erinnerten. Der ganze Kerl offenbarte eine brutale Gesundheit.
»Öh ...!«
Er gähnte, streckte die Beine, daß der Binsenstuhl in all seinen Fugen ächzte und stöhnte, nahm mit der Linken den Pfeifenstummel, mit der Rechten das Schnapsglas und meinte, zu seinem Gegenüber gewendet: »Na, Pröstchen, Herr Perdje!«
Er wartete vergebens auf Bescheid.
»Denn nich,« sagte Cornelis Janßen und brachte die wässerige Flüssigkeit an die feuchten Lippen.
Die Beine unter den Stuhl gezogen, die Ellenbogen auf die Tischplatte und den zwerghaften Kopf in die Hände gestützt, saß ihm ein hagerer, ausgemergelter Mann gegenüber. Ein zwiebelgroßes Gewächs zierte den bereits völlig gelichteten Schädel. Nur eine Art von Haaroase, in Gestalt eines altmodisch gekräuselten Toupets, hatte auf der blanken Stirnfläche Wurzel geschlagen, während eine stark nach links verschobene Nase entenschnabelförmig über die zusammengekniffenen und schmalen Lippen hinwegsah. Auch nicht die geringste Andeutung eines Bartwuchses war auf dem lederfarbigen Gesicht bemerkbar. Stumpf und stier bohrten sich die verschleierten Blicke in ein klerikales Käseblättchen hinein, auf dem sich die Abdrücke einiger Geneverkringel befanden. Perdje Puhl hörte und sah nicht. Er war seines Zeichens Küster in der kleinen Gemeinde. Außerdem wirkte er als aktives Mitglied der Sankt Sebastiansbruderschaft, einer Schützengilde, die neben dem kirchlichen Banner auch bei Kirmessen und sonstigen weltlichen Lustbarkeiten die Fahne niederrheinischer Freude und Ausgelassenheiten emporhielt. In diesem Verein amtierte er als Kassenwart und hatte bei vorkommenden Anlässen, wie Vogelschießen, Begräbnis und Taufschmaus, die antiquierte Wirbeltrommel zu schlagen. Allmittags genehmigte er sich ein Schnäpschen in der Destille von Cornelis Janßen, eine Gepflogenheit, die er sich schon seit Jahren zur Lebensgewohnheit gemacht hatte.
Jetzt war Perdje Puhl bei der Lektüre an eine besonders interessante Stelle gekommen. Seine Lippen bewegten sich krampfhaft. Plötzlich schlug er mit der flachen Hand auf die Zeitung, daß das geleerte Glas emporsprang: »Donnerkiel ...!«
»Na. Perdje ...?«
»Na, Perdje – was, Perdje?! – Er kommt – der heilige Mann kommt, der Glaubensapostel, der in Engelszungen redet und predigt!«
Er sprach nicht weiter. Ein kleines Männchen im blauen Kittel, mit seidener Schirmmütze und rötlichen Haaren, dem man auf den ersten Blick die jüdische Abstammung ansah, drehte sich ins Gastzimmer: »Guten Tag – die Herrens!«
Lächelnd legte er ein Leinwandpäckchen beiseite und stellte seinen geschälten Hagedornstock, an dessen Griff sich ein Lederriemen befand, in die Ecke. Fröstelnd rieb er die Hände zusammen: »Püh! – was soll ich sagen, die Herrens?! – Draußen zieht's einem Rock un Stiefel vom Leibe. Dürfte ich bitten um ein gefälliges Schnäpschen, Herr Janßen? – aber ein süßes.«
Verschämt, nur die Kante des Stuhles benutzend, ließ er sich am Wirtstisch nieder.
»As't üh belieft,« sagte Cornelis Janßen und schenkte die kristallklare Flüssigkeit ein.
»Ein artiges Pröstchen, die Herrens!« lispelte Moses Herzlieb und prüfte von der belebenden Feuchte. »Aber was ich sagen wollte, die Herrens,« fuhr er fort, »räumen Sie bald hier die ganze Mischpoke, sonst kommt Ihnen der Rhein mit's große Wasser über dem Halse, 'ne ganze Rebellionierung is hinter dem Deiche. Die Ratten wittern Unrat un wandern aus. Nü, un wenn die Ratten ...«
Er blinzelte pfiffig mit den kleinen Augen und wippte das Gläschen hinter das knallrote Halstuch.
»Ich bitte noch um ein gefälliges Schnäpschen, Herr Janßen; aber was gesagt is, is gesagt: das große Wasser kommt uns über dem Halse. Bringen Sie Ihre Perdukte un Ihre liebwerte Frau Gemahlin auf 'ne andere Stelle. Besser is besser! Das Hochwasser steht über Pari, Herr Janßen.«
»Drecksprophet!« murrte der Küster. »Mit Ihrer günstigen Erlaubnis,« erwiderte Herzlieb, »Sie sind ein gelernter Studierter, Herr Perdje ...«
»Bin ich,« sagte der Küster.
»Gut,« bestätigte Moses, »aber die Gelernten machen öfters Pleite mit ihrem Studiertsein. Ich habe meine Meinung, Sie haben die Ihre. Dabei bleib' ich.«
»Aber, Moses, die Wachen stehn doch,« warf Cornelis Janßen dazwischen.
»Weuß ich.«
»Und der Deich hat seine reputierliche Stärke.«
»Weuß ich auch.«
»Na, und dann ist noch die Nothilfe da.«
»Weuß ich,« versetzte Moses Herzlieb mit unerschütterlichem Phlegma. »Aber besser is besser! Denken Sie an Ihre Frau Gemahlin, Herr Janßen. – Aus christlicher Barmherzigkeit, denken Sie an Ihre Frau Gemahlin un die feinen Ladenperdukte!«
»Donnerkiel noch mal!« fuhr Perdje Puhl auf, »bleiben Sie uns mit Ihren Prophezeiungen vom Leibe. Ein Jud und ein altes Weib prophezeien immer daneben.«
»Herr Perdje Puhl,« rief Moses, »ich bitte Ihnen um 'ne gewisse Mäßigung! Ein gelernter Studierter soll Mäßigung haben, Herr Perdje.«
»Ach, was!« suchte der Küster einzulenken, »Sie mit Ihren dämlichen Redensarten, Herzlieb! – Der Himmel sorgt schon dafür, daß Gottes Wasser nicht über Gottes Acker dahinläuft. Hier stehen wichtigere Dinge auf der Tagesordnung, wie unser Herr Abgeordneter zu sagen pflegt: große Dinge, übernatürliche Dinge, Dinge, von denen Sie keine Ahnung haben, Herr Herzlieb!«
Dabei sprang er auf, knallte mit der flachen Hand auf das Zeitungsblatt und hielt es dem verschüchterten Moses unter die Nase. Das Toupet sträubte sich, und die entenschnabelförmige Nase rückte in bedenklicher Weise näher und näher.
Moses Herzlieb wich einige Schritte zurück: »Bin ich meschugge?! – Was soll's denn, Herr Perdje?«
»Können Sie lesen, Moses?«
»Nü. ob!«
»Kennen Sie Bonaventura, den großen Pater Bonaventura?«
Moses setzte sich wieder.
»Gott, ob ich ihn kenne, den Herrn Pater Bonaventura! Is er doch ein frommer Herr, ein liberalisierter Herr un ein Herr, der's ehrlich meint mit Christenmenschen un Judenmenschen. Hab' ich ihn doch selber gehört in die Kirche von Calcar. Wahrhaftigen Gott, ßweimal hab' ich ihn gehört, un wie ließ er sich hören, der Pater Bonaventura! Er is ein ehrlicher Mann, ein wundertätiger Mann un ein beredter Mann; sprach er doch von die Nächstenliebe un die patriotische Gesinnung, daß man hätte bekommen können ßuviel von die schönen Gefühle, sprach er doch von David un die Propheten, un lamentierte er doch so ergreifend wie Jeremias mit die Gitarre zu Jeruschalaim. – Nü, was soll's mit dem Herrn Bonaventura?«
»Was soll's denn?« fragte nun Perdje seinerseits in höchster Erregung, wobei er abermals mit den Knöcheln der gewendeten Hand auf die Zeitung klatschte. »Schwarz auf Weiß steht's hier deutlich geschrieben. Freut Euch und jubilieret und singt ein Hosianna! – Der große Bonaventura kommt und hält Mission in hiesiger Kirchengemeinde.«
»Schön,« sagte Moses Herzlieb, »es soll mich freuen, ihn näher kennen ßu lernen – den Herrn Bonaventura. – Ich bitte noch um ein gefälliges Schnäpschen, Herr Janßen. – Er is ein bedeutender Mann, der Herr Bonaventura.«
»Was, nur bedeutend?« fuhr Perdje Puhl dazwischen. »Er ist mehr – der Mann ist heilig!«
Perdje Puhl reckte sich bei diesen Worten derart auf, daß sein Toupet fast die niedrige Balkendecke berührte.
»Bleiben Sie bei 'ner Mäßigung,« erwiderte Herzlieb. »Aber meinetwegen kann er sein auch heilig – der Herr Bonaventura.«
»Und wenn er dann so in die Stadt hineintriumphiert,« fuhr der Küster fort, »dann müssen wir alle dabei sein, auch Sie, Herzlieb, und unschuldsvolle Kinder müssen Kalmus streuen und Palm, und Marie Verwahnen muß ihr Bestes anziehen und den Herrn Bonaventura mit den Worten begrüßen: Öffnet euch, ihr Tore Sions ...! – denn auch die Marie Verwahnen ist heilig.«
»Bleiben Sie auch hier bei 'ner Besinnung,« lächelte Moses. »Aber meinetwegen kann sie sein auch heilig – das Freilein Maria Verwahnen.« »Ist sie, ist sie, ist sie!« schrie Perdje Puhl in Ekstase. »Aber das können Sie gar nicht begreifen, Herzlieb, gar nicht begreifen und fassen! Sie kennen ja kaum die Marie Verwahnen.«
»Kriegst du den Dalles, Herr Perdje!« trumpfte Herzlieb auf. »Gott, ob ich sie kenne – das Freilein! – Maimemmelochem! – wenn ich auch bin älter acht oder ßehn Jahre, sind wir doch Nachbarskinder gewesen – ich un die Maria Verwahnen un der Herr Studiosus van Melle! – Un denn die Maria nich kennen?! – Steh' ich doch mit ihrer Mutter in doppelte Buchführung: David und Kredo, Herr Perdje. Beßieh ich doch von Hille Verwahnen 's Leinenzeug, was sie macht selber ums tägliche Brot auf 'm Webstuhl – un denn die Tochter nich kennen?! – Belernt sie doch die kleinen Kinder mits Rechnen, mit Lesen un Schreiben – un lächelt sie doch immer so liebreich, wenn ich komm, ßu beßahlen auf 'n rechten Termin. Kann doch ihre Mutter, Frau Hille, nich rechnen – aber sie kann's, un denn machen wir's Fazit von David und Kredo un ßiehn 'nen Strich unters Konto. Un denn gibt sie mir ihre liebliche Hand, macht's Buch ßu un sagt denn: Es stimmt. – Ich danke Ihnen, Herr Herzlieb.«
Zur Bekräftigung dessen rückte Moses die Seidenmütze zurück, befeuchtete die Finger der rechten Hand und strich die leichtgekräuselten Schläfenhaare nach vorne. Moses Herzlieb hielt auf eine tadellose Spuck-Coiffüre.
»Lieber Freund,« bemerkte der Küster und legte ihm dabei salbungsvoll die Hand auf die Schulter, »und dennoch kennen Sie das innere Leben dieses Mädchens nicht, ich meine ihre Seele – die Physische, wie es die Lateiner benennen, Herr Herzlieb.«
»Wieso nich?« fragte Moses. »Aber was ich sagen wollte, Herr Perdje: wie benennt sich doch wieder die Seele der Maria Verwahnen?«
»Physische, wie die Lateiner sagen.«
»'ne komische Seele vons Mädchen,« lächelte Herzlieb, »aber man weiter – ich höre.«
»Sehen Sie,« fuhr der Küster mit unheimlicher Stimme fort, »das mögen nun an die drei Jahre gewesen sein, da brannte eines Tages den Webersleuten der Dachstuhl über dem Kopfe zusammen.«
»Weuß ich.«
»Aus christlicher Nächstenliebe, weil meine Stellung als Küster das so mit sich bringt, verstattete ich Mutter und Tochter Verwahnen einen eigenen Raum in meinem Hause, bis von seiten der Brandkasse ein neuer Dachstuhl hergerichtet war.«
»Weuß ich,« bemerkte Moses Herzlieb und machte sich wieder an seiner Spucklocke zu schaffen.
»Aber eins wissen Sie nicht!« zeterte der Küster und reckte sich dabei in seiner ganzen Länge auf.
»Gott der Gerechte, was soll's denn?« schreckte Herzlieb zusammen. »Was schreien Sie so?!«
Perdje Puhl schraubte seine Stimme um eine ganze Oktave tiefer: »Sie wissen nicht, was dabei unter meinem Dache passiert ist.«
»Nü, was soll denn unter dem Dache passiert sein?«
In nervöser Hast griff der Küster in die hintere Rocktasche, holte eine zinnerne Schnupftabaksdose hervor, schlug den Deckel auf und warf sich eine Prise in die Nase, dann schrie er los: »Was unter dem Dache passiert ist?! – Sonderbare Dinge, rätselhafte Dinge, heilige Dinge ...!«
Bei dem Worte heilig klappte er mit tollem Lachen die Dose zu und streckte beide Arme zur Decke, daß sich die Aermel bis zu den Ellenbogen zurückschoben.
»Bleiben Sie bei 'ner Besinnung, Herr Perdje!« stotterte Herzlieb, »man kriegt sonst ßu viel bei die Gewalttätigkeit.«
Ängstlich sah er sich nach seinem Stock um.
»Oh!« stöhnte der Küster und knickte wie ein Taschenmesser zusammen. »Wissen Sie, Herzlieb, da sitzen wir eines Abends beim Tischgebet, meine Frau und ich, als die Zimmertür leise aufging und dann wieder geräuschlos ins Schloß fiel. Gleichzeitig sprang meine Frau ans Fenster, das nach dem Kirchhof hinausgeht, weil es ihr deuchte, als ob jemand dort vorbeigekommen sei und durch die Scheibe geblickt habe. – Wer war es denn? fragte ich hastig. – Ich glaube, Marie Verwahnen, meinte meine verstörte Frau in großer Aufregung. – Jesus Christus! schrie ich auf und schlug die Hände zusammen – denn Sie müssen wissen, Herzlieb, daß unser Zimmer in der zweiten Etage liegt – und mit etlichen großen Sätzen war ich drunten und im inneren Hofraum. Draußen lag frischgefallener Schnee; eine bläuliche Mondhelle flirrte auf der zarten Decke und hatte fast Tagesbeleuchtung geschaffen. Keine Fußspuren waren zu sehen, nichts war bemerkbar, das auch nur im entferntesten den Schluß zuließ, als habe sich jemand vermittelst einer Leiter bis an das in der zweiten Etage gelegene Fenster begeben.«
»Donnerkiel!« brummte Cornelis Janßen.
»'s wird 'ne phantasmagoranische Erscheinung von Sie gewesen sein, Herr Perdje,« erwiderte Herzlieb und versuchte ein möglichst couragiertes Gesicht aufzusetzen. Aber es gelang ihm nur schlecht. Der Schrecken saß ihm in den Gliedern, zumal der Küster jetzt in gespensterhafter Weise die Augen aufriß und in einem mysteriösen Tone weiter erzählte: »Also ich wieder die Treppe hinauf – und wissen Sie, wer auf der Türschwelle stand, mit gefalteten Händen, fromm, wachsbleich wie eine Kirchenkerze, wobei die gelösten, braungoldigen Haare ihr über die Schultern fielen?«
Klatschend schlug Perdje Puhl auf den Tisch und sah fragend die beiden Zuhörer an. In seinen Blicken zuckte ein eigentümliches Feuer.
»Gott der Gerechte! – Perdje, wer war's denn?«
»Marie Verwahnen,« sagte der Küster mit entsetzlicher Ruhe. »Aber wie komisch! – über uns ließ sich ein sonderbares Geräusch vernehmen, das mit einem langsam getanzten Schleifer Ähnlichkeit hatte. Der Tanz zeichnete sich durch ein eigenartiges Tempo aus, war mit so sonderlichen Klangfiguren verknüpft, wie ich sie vorher nie im Leben gehört hatte. Das Tanzen, das rhythmische Treten und Schleifen fuhr unbehindert fort und wurde jetzt so deutlich, daß wir imstande waren, auch die feinsten und subtilsten Pas genau zu unterscheiden. Ein kaltes Gefühl rieselte uns über den Rücken. Dann wurde von draußen an die Scheiben geklopft.« »Perdje, schweigen Sie still,« rief Moses Herzlieb, »man geht ja kapores bei die Gespenstergefühle!«
»Und Marie stand vor uns,« erzählte der Küster ruhig und unbeirrt weiter, »sie stand vor uns, als schliefe sie mit offenen Augen. Mechanisch zeigte sie mit der linken Hand auf das Fenster, wo es soeben geklopft hatte; dann trat sie vollends ins Zimmer. Langsam ließ sie ihre wachsbleichen Hände über das Magdalenenhaar gleiten, dann sah sie uns mit kalten, toten Blicken an. – Haben Sie gehört? fragte sie mit verschleierter Stimme. – Ja, ja, ja! rief ich ihr zu, aber Sie haben soeben hier oben durchs Fenster gesehen. – Sie schüttelte leise den Kopf. – Nein, sagte sie. Unten, bei uns in der vorderen Stube, ist sie vorher gewesen – und das geheimnisvolle Wesen, das ins Zimmer sah, war die allerseligste Jungfrau Maria. – Mir standen die Haare zu Berge. – Nicht möglich! – Meine Frau jedoch lächelte mit unsagbarer Wehmut und sagte: »Ja, es war die Gottesmutter. Dieses Haus ist gesegnet. Betet, betet, betet! – Und dann diese Augen, diese Augen der Marie Verwahnen! – Ich konnte sie nicht ertragen. Alles um mich her war mir Traum und Ahnung geworden. – Als ich wieder aufblickte, war das Mädchen verschwunden – und dann, wie von einer unsichtbaren Hand geführt, schloß sich die Tür und fiel ins Schloß ein. Dagegen wurde ruhig weiter an die Fensterscheiben geklopft, und das Tanzen über uns wollte kein Ende nehmen. – Wir schliefen die ganze Nacht nicht. Erst gegen Morgen verstummte das sonderbare Geräusch und das deutliche Tanzen im Hause. Ich teilte unsere Erlebnisse dem Herrn Pastor mit. Der aber schwieg lange Zeit und ging unruhig in seinem Zimmer auf und nieder. Plötzlich hielt er den Fuß an. »Perdje,« sagte er in seiner feierlichen Weise, »denken Sie an Luise Lateau, an Katharina Emmerich – denken Sie an die wunderbaren Dinge, die sich im Leben der Heiligen abspielten, und Sie können als studierter und einsichtsvoller Mann, als studierter und einsichtsvoller Mann, meine Herren – die Spreu von dem Weizen sondern und das Für und Wider des nächtlichen Begebnisses in Erwägung ziehen. Beten Sie, beten Sie! – Mir scheint es, als sei Ihrem Hause Heil widerfahren.«