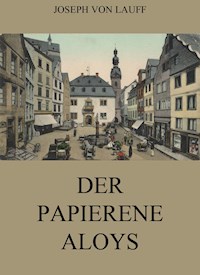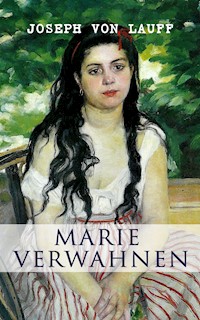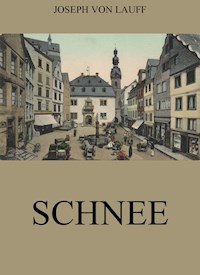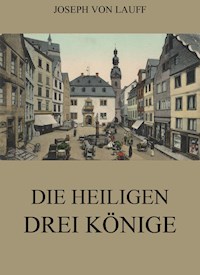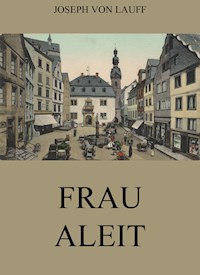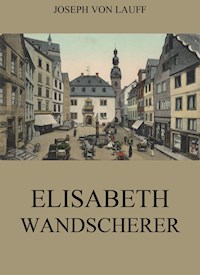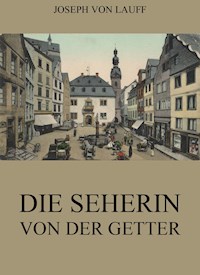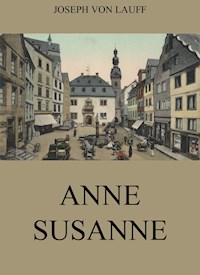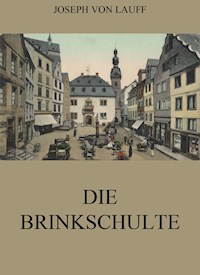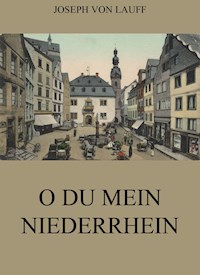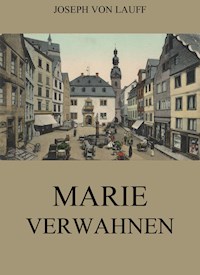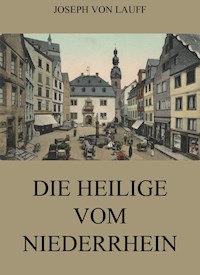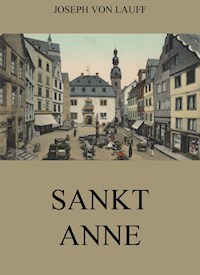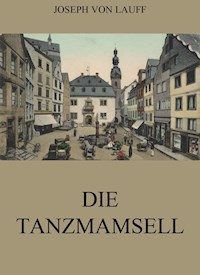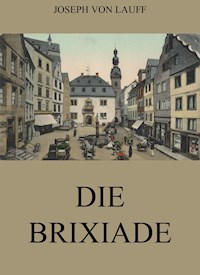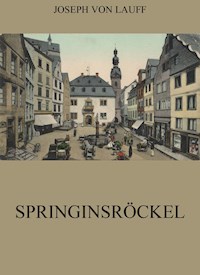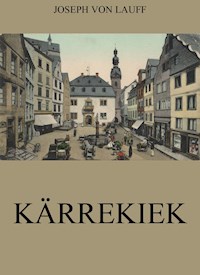
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Kärrekiek" ist der Ton der Schilfdrossel, den der Dichter hört als er nach langer Zeit nach Kalkar, seiner niederrheinischen Heimat, zurückkehrt. Er möchte Inspiration finden für einen neuen Roman und sein alter Freund Pittje Pittjewitt erzählt ihm von Deichbruch, Hochwasser, Theaterspielen, Schweineschlachten und vielem mehr ....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kärrekiek
Joseph von Lauff
Inhalt:
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Kärrekiek
Zum Eingang
I Als ich wiederkam
II Beim lateinischen Heinrich
III Pittje Pittjewitt
IV Hannecke
V Im Altmännerhaus
VI Sinter Klaas
VII Die Proben beginnen
VIII Komödie
IX Die Komödie geht weiter und wird zu Ende gespielt
X Die Wasser kommen
XII Wir stechen in See
XIII Ein Seydlitz zu Esel
XIV Kärrekiek
XV Wenn die Malven blühen
XVI Der Sturm bricht an
XVII Blätter fallen im Winde
XVIII Von der Kanzel
XIX Der Volksredner
XX Der Holzschuh
XXI Am Tage zuvor
XXII Die Sterbekerze
XXIII Unterm Abendstern
XXIV Stimmt's, Pittje? – Es stimmt.
Kärrekiek, J. von Lauff
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638870
www.jazzybee-verlag.de
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Dichter, geb. 16. Nov. 1855 in Köln als Sohn eines Juristen, besuchte die Schule in Kalkar und Münster, wo er das Abiturientenexamen bestand, trat 1877 als Artillerist in die Armee ein, wurde 1878 zum Leutnant, 1890 zum Hauptmann befördert und wirkte, einer persönlichen Aufforderung des Kaisers folgend, 1898–1903 als Dramaturg am königlichen Theater in Wiesbaden, wo er noch jetzt lebt; gleichzeitig wurde ihm der Charakter eines Majors verliehen. L. begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit den epischen Dichtungen: »Jan van Calker, ein Malerlied vom Niederrhein« (Köln 1887, 3. Aufl. 1892) und »Der Helfensteiner, ein Sang aus dem Bauernkriege« (das. 1889, 3. Aufl. 1896), denen später folgten: »Die Overstolzin« (das. 1891, 5. Aufl. 1900); »Klaus Störtebecker«, ein Norderlied (das. 1893, 3. Aufl. 1895), »Herodias« (illustriert von O. Eckmann, das. 1897, 2. Aufl. 1898), »Advent«, drei Weihnachtsgeschichten (das. 1898, 4. Aufl. 1901), »Die Geißlerin«, epische Dichtung (das. 1900, 4. Aufl. 1902); er schrieb fernerhin die Romane: »Die Hexe«, eine Regensburger Geschichte (das. 1892, 6. Aufl. 1900), »Regina coeli. Eine Geschichte aus dem Abfall der Niederlande« (das. 1894, 2 Bde.; 7. Aufl. 1904), »Die Hauptmannsfrau«, ein Totentanz (das. 1895, 8. Aufl. 1903), »Der Mönch von Sankt Sebald«, eine Nürnberger Geschichte aus der Reformationszeit (das. 1896, 5. Aufl. 1899), »Im Rosenhag«, eine Stadtgeschichte aus dem alten Köln (das. 1898, 4. Aufl. 1899), »Kärrekiek« (das. 1902, 8. Aufl. 1903), »Marie Verwahnen« (das., 1.–6. Aufl. 1903), »Pittje Pittjewitt« (Berl. 1903) sowie die Lieder »Lauf ins Land« (Köln 1897, 4. Aufl. 1902). Als Dramatiker trat er zuerst hervor mit dem Trauerspiel »Inez de Castro« (Köln 1894, 3. Aufl. 1895). Von einer Hohenzollern-Tetralogie sind bisher erschienen und wiederholt ausgeführt »Der Burggraf« (Köln 1897, 6. Aufl. 1900) und »Der Eisenzahn« (das. 1899); ihnen sollen »Der Große Kurfürst« und »Friedrich der Große« folgen. Lauffs neueste Dramen sind das Nachtstück »Rüschhaus«, das vaterländische Spiel »Vorwärts« (beide das. 1900) und das nach dem Roman »Kärrekiek« verfaßte Trauerspiel »Der Heerohme« (das. 1902, 2. Aufl. 1903). Während L. in seinen Romanen echtes Volksleben des Niederrheins poetisch festhält und in seinen epischen und lyrischen Dichtungen trotz wortreicher Diktion ein starkes Talent verrät, greift er in seinen Dramen, namentlich in den höfisch beeinflußten Hohenzollern-Stücken, oft zu unkünstlerischen Mitteln und erweckte entschiedenen Widerspruch. Vgl. A. Schroeter, Joseph L., ein literarisches Zeitbild (Wiesbad. 1899); B. Sturm, Joseph L. (Wien 1903).
Kärrekiek
Zum Eingang
Dahin so manches liebe Jahr, Dahin in Leid und Lust; Doch alles noch, wie einst es war, Da ich von hier gemußt. Wenn auch der Jugend bar und bloß, Ein längst gereifter Mann – Mit Märchenaugen still und groß Sieht mich die Heimat an.
Wie einst so heut die Mühlen gehn; Ein Wiegen ist im Rohr – Und was die Blicke nicht verstehn, Vernimmt beglückt das Ohr. Was einst dem Kindersinn vertraut, Noch immer weilt es hier: Mit ihrem wundersamen Laut Die Heimat spricht zu mir.
O Jugendzeit, o Wiegenlied! – Und ich so ganz allein; Verträumten Sanges lullt das Ried Die tiefen Wasser ein. Und Blumen ruhn in ihrem Schoß, In ihrem Zauberbann: Aus weißen Kelchen still und groß Sieht mich die Heimat an.
So friedlich rings, so still umher; So war es immer schon . . . Da – feierlich vom Mühlenwehr Grüßt mich der alte Ton. Ein Locken zieht den Grund entlang, Dann jubelt's im Revier: Im Amselruf vom Erlenhang Die Heimat spricht zu mir.
So lau die Luft, so weich der Wind, So träumend Bruch und Fließ; Hier sah ich noch, ein frommes Kind, In Gottes Paradies. Ums Vaterherz, ums Mutterherz Sich meine Liebe spann . . . Um sie, gleichwie im tiefen Schmerz, Sieht mich die Heimat an.
Du kleine Stadt am Niederrhein, So nah' und doch so fern . . . Der Dämmer hüllt die Wiesen ein Und weckt den Abendstern. Die Glocke ruft wie einst so heut; Mein Sehnen ist bei ihr . . . Aus ihrem Feiertagsgeläut Die Heimat spricht zu mir.
Und ist mein Tagewerk getan, Wird mir die Hand zu schwer, Weist mir ein stiller Geist die Bahn, Die ohne Wiederkehr – O Heimat! – eine Bitte bloß Sei mir gewährt alsdann. Mit Deinen Augen, still und groß, Sieh mich noch einmal an.
I Als ich wiederkam
Bestäubte Schuhe! – und vor mir lag die kleine niederrheinische Stadt mit ihren kanadischen Pappeln und der Sankt Nikolaikirche. Es war alles wie früher. – Die roten Giebeldächer schimmerten durch das saftige Grün gerade wie damals, und die Heupferdchen geigten zwischen Kuckucksblumen und Wiesenschaumkraut genau in denselben Tönen und Intervallen, wie sie es vor dreißig Jahren getan, als ich mich als halbwüchsiger Junge zwischen Rispen und Dolden gestreckt hatte, um nach den Dohlen zu schauen, die langsamen Fluges die Spitze des Nikolaiturmes umkreisten. – Auch heute war es auf dem Turme lebendig, dessen von der Abendsonne vergoldeter Knauf weit in die niederrheinischen Lande hineinsah. – Von den Pappeln, die sich scharfumgrenzt vom Abendhimmel abhoben, wehte ein geheimnisvolles Säuseln herüber. – Harfenklänge aus früher Jugendzeit umzitterten mich und stimmten die Seele harmonisch und weich. Aber gleichzeitig war es mir, als wenn mich eine unsichtbare Hand leise berührte; sie glitt sanft über mein Antlitz und blieb über der Herzgrube liegen. – Ein feiner körperlicher Schmerz durchfuhr mich. – Ich hatte keine Erklärung dafür . . . aber eine Schwalbe huschte vorüber, und mir klang es wie aus weiter Ferne: »Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit . . .!«
Noch hielt mich ein unbestimmtes Gefühl ab, geradeswegs die Stadt zu betreten. Ich wandte mich seitwärts. Binsen und Schachtelhalme durchsetzten den üppigen Wieswuchs. Ein breites, ruhiges Wasser legte sich hier um eine Art von Bollwerk, das in früheren Zeiten als Brückenkopf gedient haben mochte. Wir Jungens nannten es ›Ravelin‹, und ein eigentümlicher Zauber war mit diesem Orte verbunden. Hier wohnte das Bläßhuhn, hier tackte das Müllerchen im Brombeergestrüpp, die rotbraunen, silberglänzenden Rispen des Schilfrohrs sprachen hier mit säuselnden Stimmen, und die Wasserlinsen spannten ihren smaragdnen Teppich über das stille Wasser, auf dem später die bleichen Teichrosen schwammen wie verwunschene Sterne.
Ich war näher getreten. – In demselben Augenblick hub die Schilfdrossel an, und ihr ›Kärrekärrekiek‹ zog in scharfen, aber langgezogenen Tönen über die ruhige Fläche. Ich kannte den Ruf, ich hatte ihn vor Jahren unter eigentümlichen Umständen vernommen; er hatte eine seltsame Bedeutung für mich – das ›Kärrekärrekiek‹ der Schilfdrossel durchschnitt mir die Seele. Das Gegenwärtige war tot für mich – die Vergangenheit war lebendig geworden.
Hier hatte ihr Fuß gestanden, von hier aus war sie aufs Bollwerk hinübergerudert; dann war sie auf demselben Wege zurückgekehrt, bleich und mit geröteten Augen, und ihre Lippen waren zusammengekniffen . . . und der Mond stand über dem Ravelin, und er tauchte seine silberlichte Scheibe in die kühle Flut des ruhigen Wassers.
›Kärrekärre-kärrekärrekiek!‹
Noch lange verfolgte mich das sonderbare Schilflied des eigentümlichen Vogels; ich hörte es noch, als mir schon längst die Stein- und Holzkreuze des Friedhofs winkten, die mit einer gewissen Wehmut über die geschorenen Liguster- und Hagedornhecken hinwegsahen. Der alte Spillbaum, der im Herbst sich mit roten Korallen schmückt, begrüßte mich beim Eintritt zuerst. Er war ein guter, lieber Freund aus den Tagen der Kindheit. Jenseit des Tores ruhten so viele, die ich gekannt hatte und die mir teuer gewesen, als sie noch unter den Lebenden weilten. Gleich zur Linken befand sich ein niedriger Hügel. Unter ihm schlummerte meine kleine Schwester, die sich stets fürchtete und ängstliche Augen machte, wenn sie an einer Stiefmütterchenrabatte vorbeikam. Ein Holunderstrauch hatte seine Scheindolden über das Grab gebreitet, und ein Rotbrüstchen saß in seinen Zweigen und dämmerte sein anspruchsloses Lied in den Abend hinein. – Liebeseelchen und Stiefmütterchen . . .! – Bewegten Herzens irrte ich weiter.
Ein windschiefes Holzkreuz ragte aus dem Rasen empor. Aus den verwaschenen Lettern entzifferte ich einen Namen, der mir bekannt war: Heinrich Hübbers. – Also hier hatte der große Heinrich Hübbers seine letzte Ruhestätte gefunden?! – Sein alles umfassender Geist hatte es ihm möglich gemacht, dreien Herren während seiner irdischen Laufbahn zu dienen. Tagsüber zog er den Pechdraht, während der Nacht tutete er die kleine Stadt in Sicherheit, und an Sonn- und Feiertagen führte er seine mächtige Otterfellmütze und den blauen, fünfundzwanzigpfündigen Leibrock spazieren. Bei dieser Gelegenheit trug er zudem einen prächtigen Krückstock, über dessen Herkunft kein Zweifel obwalten konnte. Zwinge und Schnepper, die etliche Zoll unter dem Messinggriff hervorsahen, kündeten zur Genüge seine einstmalige Bestimmung an; er war der gewichtige Träger eines Regenschirmes gewesen. Mit diesem Spazierstock ging er auf die Jagd und schoß mir nichts dir nichts Dohlen und Krähen vom Nest – wenigstens stellte er uns Jungens gegenüber diese Behauptung auf, und wir glaubten es ihm, denn wenn er so dastand, das linke Auge zukniff, zielte und mit dem Schnepper knallte, dann wurden auch die leisesten Bedenken zu Boden geschlagen. Selbstverständlich kam nie eine Krähe herunter. Entweder sie war direkt ins Nest gefallen, oder sie hatte sich im Gezweige verhäkelt – aber wir glaubten, denn Heinrich Hübbers hatte gesprochen. Jetzt schießt er Krähen und Hasen auf der überirdischen Flur, denn das ewige Licht leuchtet ihm.
Requiescat in pace sancta!– Neben ihm ruhte Jakob Verhage, der Achtzigjährige aus dem Altmännerhaus, wo er die letzten Jahre hinter Fuchsien- und Geranienstöcken verbracht hatte. Der Mann war vogelsprachkundig wie Salomo gewesen. Er wußte genau, was die Drossel sang und die Elster geckerte, wenn sie aufbäumte und den schillernden Schwanz rechtwinklig emporstelzte; er kannte die feinen Stimmchen der Goldhähnchen, die eigentümliche Knarre des Wachtelkönigs, den leierartigen Singsang des Rotkehlchens, dem er stundenlang zuhören konnte, wenn draußen der Wind pfiff und die Schneekristalle um das Fensterkreuz seiner bläulich gekalkten Stube ihren Ringelreihen tanzten. Aber auch mit den Nagern lebte er auf freundschaftlichem Fuße. Fette, braunrot- und schwarzgefleckte Meerschweinchen durchhuschten das Zimmer, quieksten und murksten, und weiße Mäuse trieben ihr artiges Spiel zwischen den Fuchsien- und Geranientöpfen. Wie er inmitten seiner Tiere gelebt hatte, so war er auch inmitten seiner Tiere gestorben. Eines frühen Morgens fanden die Altmännerleute ihren betagten Genossen ruhig im Lehnstuhl sitzen. Das Haupt des grobknochigen Mannes war nach vorwärts geneigt; sein Lederkäppchen hielt er zwischen den gefalteten Händen, genau als spräche er sein Frühgebet, denn die Morgenglocke hallte just in diesem Augenblicke von Sankt Nikolai herüber. Aber die sieben Meerschweinchen hatten schweigend einen Kreis um ihn gebildet. Das Keckste von ihnen stand mit seinen Vorderpfötchen auf den Filzpantoffeln des einsamen Mannes und blinzelte in das stille Gesicht seines Wohltäters, als ob es sagen wollte: Na, Jakob Verhage, wo bleiben die Mohrrüben und die saftigen Kohlblätter? – aber Jakob Verhage weilte nicht mehr unter seinen Meerschweinchen und Mäusen, unter seinen Distelfinken und Rotkehlchen; das herbe Leid, das ihm sein einziger Sohn angetan hatte, als er sich weigerte, Geistlicher oder, wie die Leute dort sagen, ›Heerohme‹ zu werden, hatte genügt, ihm das Herz abzustoßen. – »Er ist ›RIPS‹, sagte der Pförtner des Altmännerhauses, und drei Tage nach diesem Geschehnis wurde Jakob Verhage begraben.
Ich näherte mich dem Kalvarienberge. Zur Linken hob sich ein schlanker Lilienschaft von einem wohlgepflegten Grabhügel. Die anspruchslose Ruhestätte war mit einem schmalen Kranze von Nelken und Sommerlevkojen umfriedet. An ihrem Kopfende befand sich ein niedriges, gußeisernes Kreuz, dessen Mittelschild von ungeschickter Hand bemalt und beschrieben war. Als ich mich niederbeugte, durchfuhr mich derselbe körperliche Schmerz wie vorhin, und es war mir, als zitterten von weither die Klänge der Schilfdrossel über die Gräber und die Grashalme der friedlichen Stätte . . .
Ich wollte die Ruhe nicht stören; gesenkten Hauptes schritt ich der Stadt zu. Eine sonntägliche Feier lag über der niederrheinischen Landschaft gebreitet. Rechts und links von der breiten Heerstraße weideten etliche buntscheckige Kühe in den saftigen Wiesen oder ruhten wiederkäuend im Grase. Das eintönige Blütenmeer des Wiesenschaumkrautes hatte eine weißliche Kobaltbläue über die Niederung gesponnen, die, allmählich in ein zartes Silbergrau übergehend, sich hinter den gekappten Weidenstämmen verlor.
Rings war abendliche Stille. Der Wind hatte sich gelegt, nur die Pappelblätter waren in steter Bewegung. Bald zeigten sie ihre lichte, bald ihre dunkle Seite und quirlten dabei wie in nervöser Unruhe um die Achse ihrer langen Stiele, wobei ein Lispeln entstand wie das ständige Geplauder eines Rinnsals mit steinigem Untergrund.
Ich hatte mich inzwischen dem Tore genähert. – Etliche Mädchen und Burschen schritten lachend vorüber; sie grüßten, aber ich kannte sie nicht mehr. Jetzt gewahrte ich eine kleine Gestalt, die behäbigen Ganges mir entgegenkam. Um ein verhutzeltes Männchen schlug ein altmodischer, brauner Überrock seine langen Falten. Die kurzen Beine waren in großkarrierte Hosen gesteckt, und auf dem Kopfe trug er einen anscheinend nicht passenden Zylinder, denn ich bemerkte deutlich, wie der Hut bei jedem Schritt ziemlich bedenklichen Schwankungen unterworfen war. Trotz des prächtigen Wetters war der Alte mit einem unförmlichen, baumwollenen Paraplü versehen, dessen brennendes Zinnoberrot wie ein disharmonierender Farbenklex in die sanften Töne der feinabgestimmten Landschaft hineinknallte. In das friedliche Gesicht hatte er eine lange Pfeife mit Troddeln gesteckt, aus deren Porzellankopf und Pfefferrohr er blaue Wölkchen in den Abendhimmel hinausblies.
Inzwischen waren wir näher gekommen. Still und selbstbewußt ruhte das glattrasierte Gesicht des Paraplümännchens zwischen den niedrigen Vatermördern. Noch einmal paffte er zierliche Ringel in die ruhige Luft, spuckte in vollendeter Weise aus seinem linken Mundwinkel zur Seite und blieb dann stehen.
Ein unbestimmtes Etwas hielt uns gegenseitig gefesselt. Irgendwo war mir dieser Mann schon begegnet. Dieser gutmütige Ausdruck, diese wasserblauen Augen, dieses eigenartige Kringel- und Ringelblasen und das haarscharfe Spucken . . . natürlich – er war es!
»Pittje Pittjewitt . . .!«
»Jesses, Maria!« stieß das kleine Männchen heraus und reichte mir seine verwitterte Hand hin. »Gottdomie! – Jupp . . .?!«
»Bin ich noch immer,« lachte ich herzlich und schlug in die dargebotene Rechte.
»Dreißig Jahre – und Ihr seid ein Schreibersmann geworden?«
»Bin ich.«
»Na – und?!«
»Ja, Pittjewitt – nun bin ich hergekommen, um einen neuen Roman auszugraben, und Ihr sollt die Hauptrolle drin spielen.«
»Verflucht noch mal,« meinte Pittje, wobei er seinen Zylinder, der sich wie ein Zuckerhut nach oben verjüngte, gravitätisch vom Kopf zog und sich alsdann wieder bedeckelte, »verflucht noch mal, das wird 'ne feine Geschichte. – Und die anderen Spieler?«
»Alles Bekannte, Pittjewitt. – Jakob Verhage, der lange Dores, Hübbers, der junge Heerohme, der lateinische Heinrich – und die da bei dem Kalvarienberg, Pittje.«
»Hannecke Mesdag,« ergänzte Pittjewitt mit umflorter Stimme, wobei er wiederum, gleichsam um das Andenken der Verstorbenen zu ehren, mit einer unbeschreiblichen Feierlichkeit den Zuckerhut lüftete und dann wieder aufsetzte.
»Ja, Pittje,« warf ich leichthin dazwischen, »und da hab' ich mir denn gedacht, daß Ihr sozusagen Mitarbeiter an der Geschichte werden sollt und mir Aufschlüsse über gewisse Begebenheiten macht, die ich selbst in damaliger Zeit, als sie passierten, nicht wußte und auch nicht wissen konnte – mit anderen Worten: Ihr knotet die Fadenenden zusammen, die zusammen gehören, und über die ganze Geschichte streiche ich dann selber den poetischen Firnis.«
»Verflucht noch mal,« meinte der Alte und kniff dabei nachdenklich die Augen zusammen. »Kann ich,« fügte er nach einer Weile hinzu und schlug zur Bekräftigung dessen so selbstbewußt auf seine linke Brusttasche, als ob sich dort das Manuskript des von mir geplanten Romans schon längst fix und fertig vorfände. »Kann ich . . .« bekräftigte Pittje noch einmal und gab mir durch eine gravitätische Handbewegung zu verstehen, daß ich in seinem Hause ein willkommener Gast sei.
Pittje Pittjewitt, der baumwollene Regenschirm, dessen Knallrot im werdenden Abend noch nichts an seiner Leuchtkraft verloren hatte, der altmodische Zylinder und ich hielten nunmehr unseren Einzug in das niederrheinische Städtchen. – Vor ihren Hausschwellen saßen schon die Leute auf hochlehnigen Binsenstühlen, um die wohlige Kühle einzuatmen, die von den nahen und taufrischen Weiden herüberwehte. – Um die spanischen Giebel der engen Straßenzeilen begannen schon die Dämmer zu weben. In vereinzelten Kramläden wurden die Lichter angezündet. Die alte Linde auf dem Marktplatz schien sich langsam und ganz behaglich auf das Einschlafen vorzubereiten. Ihr eigener Duft mußte sie betäuben, denn sie war über und über mit Blüten verschneit, die durch ihre Isabellfärbung den Anschein erweckten, als wären um die Zweige des stattlichen Baumes die feinsten Brabanter Spitzen geklöppelt. Trotz der vorgerückten Stunde tönte noch ein leises Bienengesumme aus den blühenden Ästen.
Als wir die Linde passierten, stieß mich Pittje Pittjewitt mit der Hornspitze seines Pfeifenrohres wiederholt in die Seite.
»S–t!« machte der Alte.
Wir blieben stehen. – Auf der Steinbank, die im weiten Kreise die Linde einhegte, saß eine Gestalt, die etwas Unheimliches an sich hatte. Ganz in Schwarz gekleidet, den hageren Oberkörper vorwärts geneigt, ließ sie ihre langen Arme wie leblos zwischen den Knieen zu Boden hängen.
»So sitzt der jeden Abend,‹‹ meinte Pittje Pittjewitt.
»Wer ist es denn?«
»Der Heerohme.«
»Der junge Verhage?«
»Ja. – Er war mal jung, jetzt hat er die Fünfziger überschritten.«
Mir war's, als würde eine schrille Saite angeschlagen. Sie tönte wie aus fernen Zeiten herüber.
»Und jetzt?«
Pittje Pittjewitt sah mich mit großen Augen an, rückte den Zylinder durch eine geschickte Bewegung des Kopfes bis in die Höhe der linken Ohrmuschel, so daß das lange Gehäuse sich bedenklich zur Seite neigte, und führte die Pfeifenspitze ganz bedächtig an die nun freigelegte Stirne. Hier zog er etliche konzentrische Kreise. »Versimpelt, total versimpelt,« meinte Pittje Pittjewitt.
Eine Pause entstand; in Erinnerungen verloren, sah ich bewegten Herzens auf den einsamen Mann, dessen umnachteter Geist, fern der Außenwelt und ihren Eindrücken stehend, nur noch ein Traumleben führte. Jetzt hob er den Kopf. Ein schmalrandiger Filz saß auf dem graugesprenkelten Haar. Die Blicke hatten einen wirren, verwehten Ausdruck. Um den Mund huschte ein groteskes Mienenspiel, das die ganze Trostlosigkeit seiner geistigen Verfassung offenbarte.
»Heerohme!« sagte Pittje Pittjewitt.
Über die Züge des Angeredeten lief ein breites Grinsen. Langsam erhob er sich, vergrub beide Hände tief in die Hosentaschen und gab deutlich zu verstehen, daß er nicht behelligt sein wollte. Ohne sich weiter an uns zu stören, stakelte er mit seinen langen Beinen und Holzschuhen durch die friedliche Stille des Marktes. Noch einmal wandte er sich und fixierte mich mit stechenden Blicken. Ob er mich erkannt haben mochte?!
»Jetzt genehmigt er sich einen Korn in der Destille von Hendrik Pastores,« konstatierte Pittje Pittjewitt, »aber er ist ungefährlich,« fügte er ergänzend hinzu.
»Wer kümmert sich um den Ärmsten?« fragte ich teilnehmend.
»Die Gemeinde.«
»Und wo hat er Unterkunft gefunden?«
»Im Altmännerhaus. Er bewohnt dieselbe Stube wie sein seliger Vater Jakob Verhage.«
»Und sein Leben ist trostlos?«
»Trostlos,« versetzte Pittje Pittjewitt, zog ein silbernes Uhrgehäuse, das einer stattlichen Wasserrübe nicht unähnlich war, aus seiner rotgepunkteten Weste, drückte mit dem Daumen auf einen unscheinbaren Knopf und entlockte der silbernen Knolle ein mehrmaliges Tinken.
»Neun,« sagte Pittje Pittjewitt. In demselben Augenblick wurde seine Angabe vom Rathausturm bestätigt. In langen Pausen zitterten die einzelnen Schläge über die Linde und die eigenartigen Giebel, die jetzt nur noch in fahlbläulichen Schattenrissen den breiten Marktplatz begrenzten. Vereinzelte Lichtflecke standen auf den Häusersilhouetten.
»Neun Uhr,« wiederholte Pittje Pittjewitt. »Kommen wir.«
Wir gingen. – In der Kesselstraße, in die wir jetzt einbogen, schienen im Laufe der Jahre keine einschneidenden Umwälzungen vor sich gegangen zu sein. Wie früher so wuchs auch heute noch das kurzhalmige Gras zwischen den Pflastersteinen, die sauber geputzten Messingknöpfe der Türen glänzten wie sonst, genau wie früher standen die gehäkelten Fenstervorsetzer hinter den Scheiben, und ab und zu tönte die gedämpfte Rolle eines Kanarienvogels durch die verschlafene Stille – und hier der niedrige, lachsfarbig gekalkte Giebel mit den hellgrünen Läden, dem viereckigen Rutenfenster über der Tür und den Barbierbecken von Messing . . .! – Wir sind bei Pittje Pittjewitt. –
Alles wie früher!
Es war so recht behaglich im Zimmer. Zwei Kerzen in Metalleuchtern standen auf der weißgescheuerten Lindenplatte des runden Tisches und warfen Licht und Schatten auf die mit Sand bestreuten Dielen des einfachen Raumes. Zwei lange Tonpfeifen hatte Pittje dem Eckbrett entnommen und sie mit dem feinsten holländer Krülltabak ›Admiral de Ruiter‹ gestopft. Flackernde Holzspäne setzten den Tabak in Brand – und nachdem wir's uns recht bequem in den breiten Strohsesseln gemacht hatten, nachdem die ersten blauen Wölkchen gegen die Decke geblasen waren, wurde die große Heerschau abgehalten.
Längstverhallte Töne begannen wieder leise zu klingen; verschwommene nebelhafte Gestalten nahmen die alte Fassung und Form an, durch die Wirrnis der Jugendzeit wurden neue Wege gebahnt und geebnet, so daß ich allmählich Einblick gewann in seltsame Begebenheiten und Menschenschicksale, die ich vor dreißig Jahren zum großen Teil miterlebt hatte, für deren Lösung mir aber damals das Verständnis noch fehlte. Pittje Pittjewitt wußte geschickt zu erzählen. Alles stand mir in lebhaften Farben klar und deutlich vor Augen. Die schöne Mär von der dürren Jerichorose wurde hier in die Tat übersetzt. Die alte Zeit, die ich vor Jahren durchlebte, ähnelte dieser geheimnisvollen Blume. Sie blühte schöner denn je, und ihr wohliger Duft regte die Phantasie an, durch deren Kraft ich in die Lage versetzt wurde, die nachstehenden Blätter später niederzuschreiben. –
Pittje Pittjewitt hatte sich gerade eine zweite Tonpfeife angebrannt und die ersten Kringel über die weiße Tischplatte geblasen, als es von draußen mit scharfem Knöchel gegen die Scheiben klopfte. Unwillkürlich schreckten wir beide zusammen.
»Gottdomie!« sagte Pittje Pittjewitt. Er wollte noch weiter reden und fluchen, aber ein schauerliches Gelächter, das vor dem Fensterrahmen ertönte und sich unliebsam in unsere Behaglichkeit hineindrängte, ließ ihn jählings verstummen. Wir wandten uns gleichzeitig um und sahen ein bleiches, verzerrtes Gesicht hinter den Scheiben, das aber plötzlich verschwand.
»Der Heerohme!« rief Pittje Pittjewitt und fuhr aus seinem Sessel empor. Gleichzeitig torkelte der erbarmungswerte Mensch mit seinen großen Holzschuhen ins Zimmer.
»Aber, Heerohme . . .!«
»Was, Heerohme . . .?!« schrie Wilm Verhage und schlug dabei auf die Platte des Tisches, daß das ›Admiral de Ruiter‹-Päckchen lustig emporsprang. »Was, Heerohme . . .?! – Hannecke Mesdag ist tot – Grades Mesdag ist tot – und hier steht der gewesene Cölibatär, dem sie . . .«
»Heerohme, das sind alte Geschichten!« suchte Pittje Pittjewitt den späten Eindringling zu begütigen.
»Was, alte Geschichten?!« wiederholte der Irre. »In dieser Nacht hat sich der weiße Kelch aufgetan – und wenn die Lilien blühen, dann wird auch Hannecke Mesdag wieder lebendig . . .! – Und Hendrik Pastores hat mir gesagt, daß Jupp in der Stadt sei – und Jupp kann schreiben und soll alles niederlegen, wie die Sache gekommen ist, und wie sie mir den Schädel eingeschlagen haben. – Die Geschichte muß klar gestellt werden, sonst hole der Teufel . . .«
»Das soll sie auch.« Ich war aufgestanden und hatte die Hand von Wilm Verhage ergriffen. Aber der Heerohme entzog sie mir. Er kannte mich nicht.
»Niederlegen soll er die ganze Passion von Hannecke Mesdag und mir,« verlangte er noch einmal mit erhobener Stimme, dann wandte er sich an meinen Nachbar: »Pittje, 'nen Schiedam.«
»Morgen,« erwiderte Pittje Pittjewitt.
»Gut,« versetzte der Heerohme mit stoischem Gleichmut, vergrub die Hände wieder tief in sein Hosenwerk und ging.
Pittje Pittjewitt und ich saßen noch lange zusammen. Die Kerzen waren längst niedergebrannt, als wir schieden. – – –
Anderen Tags trat ich die Heimreise an. Im Eilwagen ging es der zwei Stunden entfernten Bahnstation zu. In der Ebene standen die Roggen- und Weizenfelder in Blüte. Über die resedagrünen Halme wallte und zog der Ährenrauch. Etliche blaue Libellen blitzten durch die Luft, und die Goldammer saß am Straßenrain und schrillerte ihre anspruchslose Strophe unverdrossen in den Junimorgen hinaus.
Noch einmal wandte ich mich. – Die ziegelroten Dächer der kleinen Stadt standen wie leuchtende Punkte am tiefen Horizont. Hinter den Pappelreihen sank der Schieferhelm der Sankt Nikolaikirche immer tiefer und tiefer; jetzt war er verschwunden. – Aber durch die ruhige Luft setzten die Schwalben in zierlichen Kreisen und Wenden. Ihr Gezwitscher und Singsang verfolgte mich, und es klang mir wie mit geheimnisvollen und seligen Stimmen: »Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit . . .!«
II Beim lateinischen Heinrich
Vor dreißig Jahren! – – – – – – – – –
Ruhig und stetig fielen die kleinen Schneeflocken vom grauen Novemberhimmel, der sich wie eine bleifarbene Decke über die klevischen Lande spannte. Die ersten Tage des Advent waren nicht mehr fern.
Mein Freund, der lateinische Heinrich, und ich saßen hinter den warmen Scheiben seines elterlichen Hauses am Markt und stierten in das weiße Geflimmer hinaus, das immer dichter und lebhafter wurde. Draußen herrschte eine bittere und schneidende Kälte. Die Leute, die in ihren mit Stroh ausgestopften Holzschuhen an unserem Fenster vorbeihasteten, schlugen die Arme über der Brust zusammen und gaben einen Atem von sich, der in Gestalt von dichten Nebelwölkchen die verfrorenen und geröteten Ohren umspielte. Unter ihren Füßen krachte und knirschte der Schnee. Immer enger schoben sich die fallenden Flocken zusammen. Die mächtigen Risse des gegenüberliegenden Rathauses, die historische Linde und das Standbild des Reitergenerals von Seydlitz schienen kaum noch vorhanden zu sein. Alles war in tanzender und flimmernder Bewegung. Wir glaubten durch ein Netzwerk zu sehen, das mit einem engmaschigen, weißen Straminrahmen Ähnlichkeit hatte. Und dabei die krachende Kälte! – Der Schnee ballte sich nicht. Daunenweich haftete er auf dem Fenstersims; der leiseste Windhauch stöberte die feinen Kristalle auseinander und trieb sie von dannen.
»Prrr!« machte der lateinische Heinrich.
Grimmige Kälte! – aber hier zwischen den grünaustapezierten Wänden, umgeben von dem altfränkischen Hausrat, ließ es sich bequem und ganz behaglich sitzen und in das wirre Schneetreiben hinausstieren. Der mit Pottlot gewichste Kanonenofen strahlte aus seiner Dämmerecke eine wohltuende Wärme aus. Mit rotglühenden Backen, ein kohlenverschlingender Moloch, ließ der schwarze Gesell von Zeit zu Zeit helleuchtende Partikelchen vom Rost in den Aschenkasten fallen. Wie silberlichte Sterne huschten sie durch die rote Glut, die geheimnisvoll aus der unteren Öffnung des Ofens hervorsah. Unmittelbar über der schmiedeeisernen Klappe entfaltete sich ein ständiges Quietschen und Knacken, das von einem eigentümlichen Singen begleitet wurde. Einige rotwangige Äpfel brieten und pufften dort in ihrem eigenen Schmalz. Indem sie sich auf dem weißen Porzellanteller allmählich bräunten und überzuckerten, harrten sie geduldig, aber unter stetigem Bräteln, ihres späteren Loses. Krachende Kälte, duftende Bratäpfel und ein glühender Kanonenofen – das war für uns Jungens so recht wie gepfiffen. Während es draußen schneite und flimmerte, die Leute frierend vorbeitrabten, die Spatzen ihren braunen Leibrock plusterten und gottserbärmlich von den zugefrorenen Dachrinnen schilpten, ging für uns die Poesie des Winters auf mit ihrem kommenden Advent- und Sankt Nikolaszauber.
Gravitätisch saß der lateinische Heinrich auf dem großblumigen Kanapee, das dicht ans Fenster gerückt war. Vor ihm auf der zerkratzten und zerschnittenen Tischplatte lag eine kleine Druckschrift und ein von meiner Hand verfaßtes Manuskript. In der Rechten zwirbelte er das Fragment eines abgeknäuten Bleistiftes. Der lateinische Heinrich, drei Jahre älter als ich, frühgereift, aber durch unvorhergesehene Vorfälle ein Spätling auf der höheren Schule, war ein pedantischer, pflichtgetreuer Tertianer, ein scharfer Cornelius Nepos-Übersetzer, ein gegen sich und andere strenger Asket, der bei Abfassung der lateinischen und griechischen Extemporalien es als eine Sünde wider den heiligen Geist ansah, wenn er auch nur den geringsten Schein des Mogelns auf sich geladen hätte – aber auch unerbittlich zog er gegen die Mogelanten zu Felde. Sein allezeit vorgeschobener linker Ellenbogen war selbst für den argusäugigen Franz Dewers, der gemächlich über drei Bänke hin in die Hefte seiner Mitschüler zu vigilieren vermochte, ein unüberwindliches Hindernis gewesen, das erst verschwand, wenn der giftige Schultyrann in seiner langen, schwarzen Soutane die Arbeiten einzog, um sie später mit seinem Rotstift unbarmherzig zu illuminieren. Insbesondere war aber der Lateiner ein strenggläubiger Christ, ein fanatischer Katholik, der in früheren Zeitläuften und zum Manne gereift einen zweiten Peter Arbues und einen anderen Konrad von Marburg abgegeben hätte, eine Eigenschaft, die sich mit einem gewissen kaufmännischen Denken und Fühlen vereinigte, wodurch seine Finanzwirtschaft sich stets in einer geordneten Verfassung befand, die natürlich bei besonderen Umständen, vornehmlich zur Kirmeszeit, unseren Neid erwecken mußte. Der lateinische Heinrich war ein Finanzgenie – er wußte zu rechnen. Auch in betreff des äußeren Menschen hatte er seinen eigenen Geschmack und seine besonderen Grundsätze. Hals, Arme und Beine steckte er stets zu weit durch Rock und Behosung, infolgedessen seine salmfarbigen Baumwollstrümpfe und die schweinfurtergrünen Plüschpantoffeln in eine allzu grelle Beleuchtung gerückt wurden, obgleich nicht in Abrede gestellt werden soll, daß es gerade die Plüschpantoffeln waren, die dem glücklichen Inhaber in unseren Augen eine höhere Würde und Weihe verliehen. Ohne die Plüschenen wäre mein Freund überhaupt ein Nichts, ein Nonsens gewesen – eine Krähe, die man ihres schönsten Schmuckes, des Schwanzes, beraubt hätte.
Den Kopf in die linke Hand gestützt, saß ich dem lateinischen Heinrich gegenüber, sah ins Wetter hinaus, versuchte die Schneeflocken zu zählen, die an den Scheiben haften blieben und ließ von dem Duft der immer lauter zischenden Bratäpfel meine Nase umspielen.
»Jakob . . .!«
Schwerenot! – an den hätte ich kaum mehr gedacht. Hinter mir auf der Stuhllehne hockte eine prächtige Dohle. Den Kopf zur Seite geneigt, blinzelte sie mit ihren vergißmeinnichtblauen Augen zu ihrem Herrn und Besitzer hinüber, der sich in diesem Augenblicke auf seinem Sitze rekelte, daß das großblumige Kanapee in all seinen Fugen und Ecken seufzte und stöhnte.
»Wir können nicht lange mehr warten,« meinte er. »Wer kommt noch?«
»Der lange Dores, Jan Höfkens und Dewers.«
»Immer zu spät,« murrte es von der Sofaecke her. »Aber jetzt werden die Rollen verteilt,« setzte er kategorisch hinzu, rückte den Tisch näher und bespeichelte, zum Zeichen, daß es jetzt unbedingt losginge, die Graphitspitze des abgeknabbelten Bleistiftes. »Zur Sache . . .«
»Halt!« erwiderte ich und bedeckte mit beiden Händen die aufgeschlagenen Blätter der Komödie.
»Jetzt kommt wieder die verfluchte Dohlengeschichte,« meinte der lateinische Heinrich.
»Ja, das von wegen der Dohle . . .«
Aber der Sofamann ließ mich nicht zu Wort kommen. In seiner ganzen Länge und mit einer unbeschreiblichen Würde erhob er sich aus seiner warmen Ecke, legte mit einer salbungsvollen Gebärde seine Hand auf meinen Semmelkopf, ließ die Augendeckel fallen und sagte: »Quousque tandem, Josephe, abutere patientia nostra?!«
Obgleich mir die lateinische Sentenz ungemein imponierte, rutschte ich dennoch angeärgert zur Seite, sprang ebenfalls auf und suchte die schon seit mehreren Monaten schwebende merkantile Angelegenheit wieder in Fluß zu bringen. »Du wolltest mir doch die Dohle verkaufen,« hielt ich meinem Partner entgegen, als er noch immer keine Miene machte, auf den Handel einzugehen.
»Nur gegen bar,« versetzte der lateinische Heinrich mit unerschütterlicher Ruhe, »sonst nicht.«
Ich griff in die Tasche, holte ein allmächtiges Portemonnaie heraus, schlug die Stahlbügel zurück und legte nach einigem Suchen ein rotbäckiges, abgeschliffenes Kastemännchen auf den Tisch des Hauses nieder.
»Das ist ja noch immer dasselbe Kastemännchen von früher,« versetzte er geringschätzend, wobei er die Augen fast mitleidig verschleierte. »Vier gute Groschen – unter dem nicht,« fügte er ergänzend hinzu.
Seine Forderung war niederschmetternd für mich. Seit Pfingsten hatte ich Pfennig um Pfennig gespart, hatte mir alle Genüsse verkniffen – und nun?! – Es war doch ein hartgesottener Kaufmann, der lateinische Heinrich! Noch einmal führte ich meine ganze Beredsamkeit ins Feuer, suchte ihm klar zu machen, was so eine Dohle für ein minderwertiger Vogel sei, hielt ihm die reelle Bedeutung eines Kastemännchens vor Augen – aber alles und jedes war so gut wie in den Wind gesprochen. Mein Dohlenbesitzer schüttelte mitleidig lächelnd und überlegen den Kopf, ließ die müden Augendeckel wieder niederfallen und wackelte in geradezu unnachahmlicher Weise mit seinem Zeigefinger an meiner Nase vorüber, wobei er mit großem Selbstgenügen die klassischen Worte zitierte: »Quidquid agis, prudenter agas et respice finem!«
Das mußte mich natürlich ärgern. Ich wollte aus der Haut fahren. Am liebsten wäre ich hinter den Ofen gesprungen und hätte von dort aus dem selbstgefälligen Lateiner einen heißen Bratapfel hinter die Ohren gepfeffert, wenn nicht in diesem Augenblick mein Bruder, dem wir den Beinamen ›der lange Dores‹ zugelegt hatten, mit seinen Kumpanen über den Marktplatz hergetrabt wäre. Bevor sie eintraten, schlugen und schliffen sie aber, zum nicht geringen Ärger des Lateiners, noch etliche Male auf der zugefrorenen Straßenrinne die Bahn und zwar in so lustiger Weise, daß die Enden und Zipfel ihrer grobgehäkelten Schals, die sie wie Türkenbunde um Hals und Kopf gewunden hatten, fast herausfordernd durch das dichte Schneegestöber agierten. Dann stürmte das frierende Kleeblatt mit geröteten Nasenspitzen ins Zimmer. – Allein, wie durch ein elementares Ereignis aus ihrer Fassung gebracht, blieben sie wie angewurzelt stehen.
»Ha!« sagte der lange Dores.
»Fein!« bemerkte Franz Dewers, der lediglich in seiner Eigenschaft als Sohn des Dachdeckermeisters von der Sankt Nikolaikirche als würdig befunden wurde, unserem Kreise anzugehören. »Fein!« wiederholte er schnüffelnd, wobei ihm ein wasserheller Tropfen von der Nase herabfiel.
»Bratäppel!« meditierte Jan Höfkens, dessen verstäubtes Müllerjungengesicht sich mit einer gewissen sachgemäßen Erkenntnis in Richtung des Kanonenofens wendete, wo es in verstärkter Weise puffte und zischte.
Aber der lateinische Heinrich riß die drei unliebsam aus ihren Bratäpfelträumen empor. »Quos ego!« fuhr er sie an. »Während hier die Präliminarien für die große Komödie tagen und die Rollen zur Verteilung gelangen, macht Ihr gewissenlosen Kerls Wind vor der Haustür! – Na – denn also . . .!« und mit dem gewendeten Bleistift klopfte er zu wiederholten Malen auf die Platte des Tisches. »Hier – ›Jan Klaas als Porträtmaler‹. – Wer kann den Porträtmaler spielen?«
Ich getraute mich das Wagnis zu übernehmen, und durch eine äußerst gnädige Kopfbewegung des Lateiners wurde mir diese Rolle zugesprochen, während er selbst in Kraft eigener Machtvollkommenheit die Rolle des Kommerzienrates für sich in Anspruch nahm. – »Na – jetzt noch den Polizeidiener Brill?«
»Ich!« meldete sich Franz Dewers, wobei ihm der zweite wasserhelle Tropfen von der geröteten Nasenspitze herabfiel.
»Genehmigt,« bemerkte der lateinische Heinrich und notierte den Vorfall.
»Und ich – was täte ich denn spielen?« warf Jan Höfkens etwas patzig dazwischen.
»Du?« fragte der Rollenverteiler so von oben herab. »Johannes, Du wartest. Du bist nicht auf Komödiespielen gebaut – aber Du könntest Dich anderweitig nützlich machen und willfährig zeigen. Johannes, Du hast einen Bruder, der bei den Düsseldorfer Husaren gedient hat?«
»Das hätte ich,« erwiderte Jan.
»Und der hat aus seiner Militärzeit noch eine Husarenjacke zu Hause?«
»Die hätte er,« kam es langnäsig zurück.
»Sieh mal, Johannes,« salbaderte der Fragesteller weiter, »da uns der Rock für den Polizeidiener Brill fehlt, so könntest Du Deinen Bruder veranlassen, daß er uns die Husarenjacke leihweise überließe, damit sie gewissermaßen die Rolle der Polizeimontierung verträte.«
»Das könnte ich wohl,« trumpfte Jan Höfkens ganz dickfellig auf, »aber das täte ich nich.«
Der lateinische Heinrich prallte zurück. Die Husarenjacke, auf der vielleicht der ganze Effekt des Abends beruhen konnte, schien sich für uns in blauen Dunst auflösen zu wollen. Hier mußte eingegriffen werden, zumal der Lateiner schon wieder einen neuen Spruch auf der Pfanne hatte, und Jan Höfkens gestikulierend im Zimmer auf und ab stolperte und stetig dabei den patzigen Satz wiederholte: »Das könnte ich wohl, aber das täte ich nich!« obgleich ihm niemand sagte, daß er es doch tun solle. »Und das täte ich nich und das täte ich nich . . .«
Ich trat dem Lateiner auf die grünen Plüschpantoffeln und gab dem wütigen Jan zu verstehen, daß er umschichtig mit Franz Dewers den Polizeidiener Brill und zwar in der Husarenjacke spielen dürfe. Dieses salomonische Urteil fand ungeteilten Beifall. Die Husarenjacke wurde bewilligt, und es konnte somit zur Rollenverteilung des zweiten Stückes geschritten werden.
›Don Juan oder der steinerne Gast‹, hieß der Titel der anderen Komödie. In Anbetracht des denkwürdigen Umstandes, daß ich mich als der glückliche Besitzer eines hannöverschen Füsiliersäbels ausweisen konnte, der nach der Schlacht von Langensalza durch irgend einen Zufall in mein elterliches Haus gekommen war, wurde mir ohne Einwand und Gegenrede die Titelrolle zugestanden.
»Donna Elvira! – Wer kann die Donna Elvira spielen?« fragte der lateinische Heinrich. »Entgegen der Historie,« fuhr er fort, »wurde von mir die Tochter des Gouverneurs, die geschichtlich den Namen Donna Anna führt, des Wohlklanges halber mit Donna Elvira bezeichnet, während die eigentliche Donna Elvira sich bei mir mit dem schlichteren Namen zu begnügen hat. Es ist eine wesentliche Verbesserung. Verstanden?! – Also wer vermag die Donna Elvira zu spielen?«
Jan Höfkens stand auf.
»Weißt Du, wer Donna Elvira ist?« donnerte ihn der Lateiner an.
»Das wüßte ich nich,« versetzte Jan Höfkens.
»Quod licet Jovi, non licet bovi!– Donna Elvira war eine spanische Jungfrau. Bist Du eine spanische Jungfrau, Johannes?«
»Das wäre ich nich,« versetzte der Angeredete und drückte sich kleinlaut auf seinen Binsensessel zurück.
Der pedantische Fragesteller blickte im Kreise umher. »Getraut sich keiner von Euch die Donna Elvira zu spielen?«
Keiner meldete sich.
»Da sich keiner meldet,« dekretierte der lateinische Heinrich, »so wird die Donna Elvira vom langen Dores verkörpert.«
»Was der könnte . . . der lange Dores wäre doch auch keine spanische Jungfrau,« warf Jan Höfkens murrend dazwischen.
Aber da kam er an den Unrichtigen. Durch die halbgeschlossenen Augenlider blitzte ihn der Lateiner vernichtend an. »Schweige, Johannes! – Bist Du so dünndarmig und so schlank wie der lange Dores gewachsen?«
»Das wäre ich nich.«
»Kann Dein Stiftekopf mit dem feinen Scheitel von Dores sich messen?«
»Das könnte er nich.«
»Knabberst Du nicht immer bei den Extemporalien und den unregelmäßigen Verben vor Angst an den Fingernägeln, Johannes – und da willst Du die Donna Elvira spielen? Schweige, Johannes.«
Diese Gründe schlugen nun durch. Der sommersprossige Stiftekopf ließ seine etwas unverschämten Ansprüche fallen, und der lange Dores erklärte sich nach einigem Zögern bereit, den Gang als Donna Elvira zu wagen. Auch die übrigen Rollen wurden alsbald unter Hinzuziehung nicht anwesender Kräfte an den Mann gebracht, während diejenige des Leporello noch ein offenes Fragezeichen blieb. Ein Königreich für einen Leporello!
Während wir noch beratschlagten, erhob sich plötzlich der lateinische Heinrich mit einer Feierlichkeit von seinem großblumigen Kanapee, als schickte er sich an, einen Choral unter Orgelbegleitung zu singen. Aber er dachte nicht an einen Choral mit Orgelbegleitung, sondern erklärte kurzweg, daß er sich für den geborenen Leporello halte.
Für einen Augenblick wurde es Nacht vor meinen Augen. Ich glaubte, der Lateiner wäre der Zwangsjacke entsprungen. Ebenso gut hätte er sich für einen Ballettmeister oder Seiltänzer ausgeben können.
»Um Gottes willen!« fuhr ich auf ihn los, »Heinrich, kannst Du verstehen, daß die Spatzen Schritt gehen, kannst Du verstehen, daß der Bulle Klavier spielt, der Hahn meckert und der Elefant mit dem Schwanz frißt?«
»Nein,« sagte mein Freund.
»Dann mache Deinen Vers auf die obigen Gleichnisse.«
»Jupp,« trumpfte der Abgefertigte auf, »Du willst mir nicht den Leporello vergönnen?«
»Ich protestiere.«
»Wir protestieren!« riefen die anderen dazwischen.
»Gut,« sagte der Lateiner mit unsäglicher Wehmut, klappte sein Buch zu und legte den Bleistift beiseite, gleichsam um anzudeuten, daß er sein Amt als Vorsitzender des Theaterausschusses niederlege.
Eine tiefe Stille machte sich geltend. In diesem Augenblick fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf, der allerdings mit meinem künstlerischen Gewissen im direkten Widerspruche stand.
»Holt mal die Bratäpfel 'ran,« gebot ich den andern Mitkomparenten, und während diese sich am Ofen und dem heißen Porzellanteller zu schaffen machten, legte ich zum zweiten Male das Kastemännchen auf den Tisch des Hauses.
»Für das Kastemännchen die Dohle,« flüsterte ich ihm zu, »und Du bist der geborene Leporello.«
Eine erwartungsvolle Pause entstand. Noch einmal wollte sich mein künstlerisches Gewissen regen; ich dachte daran, den Antrag zurückzuziehen, allein die Aussicht, beneidenswerter und rechtlicher Inhaber der Dohle zu werden, schlug alle Bedenken zu Boden.
Noch war der Lateiner in Zweifeln befangen. Sein kaufmännisches Empfinden kämpfte auf Leben und Tod mit der verlockenden Aussicht. Endlich siegte der Idealist über den Materialisten – er schlug ein. Ich hatte die Dohle und er das Kastemännchen und die Leporellorolle.
Aber ich machte ein Kodizill zu dem abgeschlossenen Handel. »Jakob Verhage muß noch feststellen, daß der Vogel ein Männchen ist,« verlangte ich.
»Gut,« sagte der lateinische Heinrich. – Wir waren einig. Auch die übrigen Komödianten und Komparsen stimmten zu, nachdem ihnen der neue Leporello noch ein weiteres Deputat an Bratäpfeln zugestanden hatte. So waren denn die ersten Theaterverhandlungen glücklich verlaufen. Der denkwürdige Tag neigte sich seinem Ende entgegen.
Während wir den Bratäpfeln zusprachen, spannten sich geheimnisvolle Dämmer durch die behagliche Stube. Alles hüllte sich in ein dunkelndes Zwielicht. Die großen Muster der schlichten Tapeten waren kaum noch zu unterscheiden. Der Kanonenofen hatte sich im Düster aufgelöst. Seine mächtigen Umrisse waren nicht mehr erkennbar, nur das untere Zugloch erstrahlte in feuriger Glut und warf ein scharfumgrenztes Licht auf die Dielen. Immer heller und weißer fielen und zischten die glühenden Kohlenstückchen in den Aschenkasten, während draußen die Laternenanzünder umhergingen und den muffligen Öldocht entfachten. Wie matterleuchtete Nebelflecke dunsteten die Straßenlaternen von allen Enden des Marktes herüber. Der Ofen pochte und fauchte in allen Tonarten aus seiner Dämmerecke; sonst herrschte eine einlullende Stille im Zimmer.
Die Bratäpfel waren verzehrt.
»Morgen ist Schweinestechen,« sagte Franz Dewers.
»Wo?« fragte der lange Dores.
»Schnüffelt, hat Pittje Pittjewitt gesagt, und ihr werdet finden.«
»Frische Würste!« triumphierte Jan Höfkens.
»Fein! – Wir schnüffeln,« ergänzte Franz Dewers, und mit diesem Ausspruch nahmen wir für heute Abschied vom lateinischen Heinrich.
Vom Rathausturm schlug die fünfte Abendstunde; aber der Ton war matt und dumpf, und es hatte den Anschein, als wären Glockenhammer und Glocke mit Wolle umsponnen.
»Jakob!« sagte die Dohle.
III Pittje Pittjewitt
Anderen Tages klapperten zwei blankgescheuerte Barbierbecken im Wind, der nadelscharf und eisig die Kesselstraße durchfegte. Das Gestöber hatte sich gelegt, aber ein schneidender Nordost setzte über die Dächer und Giebel dahin, daß man glauben mochte, staubige Müllerjacken und Mehlsäcke würden dort oben mit einem Rohrstock bearbeitet. Die Türschwellen lagen verweht, und die gefrorenen Fensterscheiben wollten nicht auftauen. Durch alle Fensterritzen und Schlüssellöcher pfiff und zirpte es wie mit eisigen Stimmen. Immer lustiger tanzten die beiden Messingbecken von einem schmiedeeisernen Galgen, der neben einer niedrigen Tür in die Straße hinausragte. Unterhalb des Klingelzuges stand auf einer schmalen Metallplatte zu lesen: Peter Pittjewitt, Barbier, Leichenbitter und Schweinestecher. Der Leichenbitter war aber mit einem ›p‹ und der Schweinestecher mit einem ›g‹ auf dem Schilde verzeichnet, ein orthographischer Verstoß, dessen Vorhandensein jedoch die anerkannte Tüchtigkeit Pittjewitts in genannten Erwerbszweigen nicht um Haaresbreite tangierte. Sein Ruf stand auf so sicheren Füßen, war so lauter und unantastbar wie das fette Amen des Pastors und Dechanten van Bebber.
Eine große Standuhr, deren Zifferblatt mit schablonierten krapproten Rosen geschmückt war, tickte und tackte in der vorderen Stube, wo Pittje Pittjewitt soeben sein geräuchertes Schweinerippchen mit Sauerkohl verzehrt hatte. Jetzt saß er am Fenster, hatte die Beine übereinander geschlagen und studierte eifrig einen politischen Leitartikel im Niederrheinischen Kreisblatt.