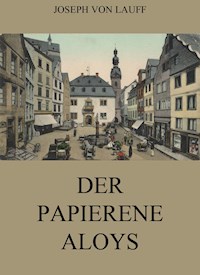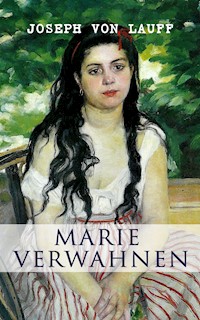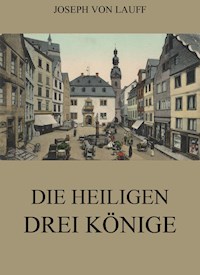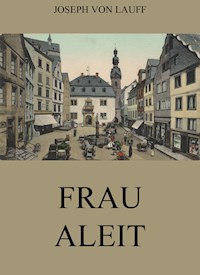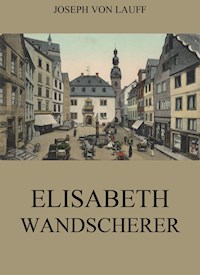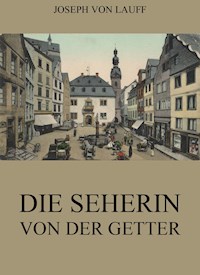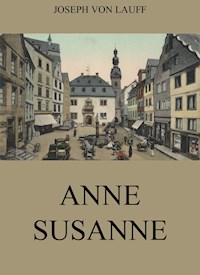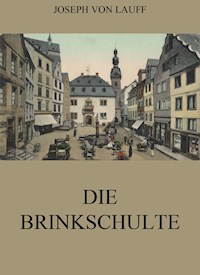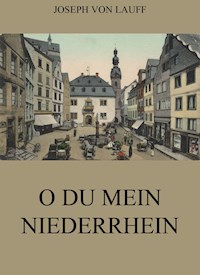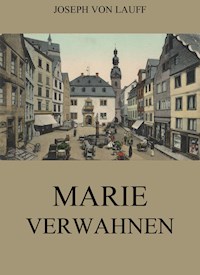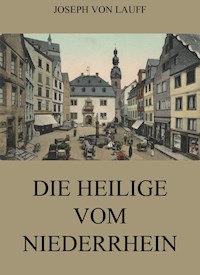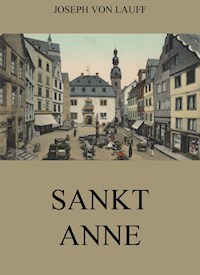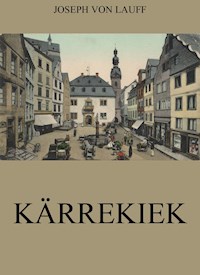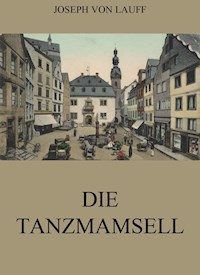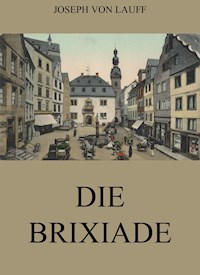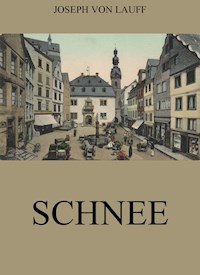
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman aus der niederrheinischen Heimat des Schriftstellers. Lauffs umfangreiches literarisches Werk besteht vorwiegend aus Romanen, Erzählungen und Theaterstücken. In seinen Prosawerken behandelt er meist Themen aus seiner niederrheinischen Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schnee
Joseph von Lauff
Inhalt:
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Schnee
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Schnee, J. von Lauff
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638801
www.jazzybee-verlag.de
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Dichter, geb. 16. Nov. 1855 in Köln als Sohn eines Juristen, besuchte die Schule in Kalkar und Münster, wo er das Abiturientenexamen bestand, trat 1877 als Artillerist in die Armee ein, wurde 1878 zum Leutnant, 1890 zum Hauptmann befördert und wirkte, einer persönlichen Aufforderung des Kaisers folgend, 1898–1903 als Dramaturg am königlichen Theater in Wiesbaden, wo er noch jetzt lebt; gleichzeitig wurde ihm der Charakter eines Majors verliehen. L. begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit den epischen Dichtungen: »Jan van Calker, ein Malerlied vom Niederrhein« (Köln 1887, 3. Aufl. 1892) und »Der Helfensteiner, ein Sang aus dem Bauernkriege« (das. 1889, 3. Aufl. 1896), denen später folgten: »Die Overstolzin« (das. 1891, 5. Aufl. 1900); »Klaus Störtebecker«, ein Norderlied (das. 1893, 3. Aufl. 1895), »Herodias« (illustriert von O. Eckmann, das. 1897, 2. Aufl. 1898), »Advent«, drei Weihnachtsgeschichten (das. 1898, 4. Aufl. 1901), »Die Geißlerin«, epische Dichtung (das. 1900, 4. Aufl. 1902); er schrieb fernerhin die Romane: »Die Hexe«, eine Regensburger Geschichte (das. 1892, 6. Aufl. 1900), »Regina coeli. Eine Geschichte aus dem Abfall der Niederlande« (das. 1894, 2 Bde.; 7. Aufl. 1904), »Die Hauptmannsfrau«, ein Totentanz (das. 1895, 8. Aufl. 1903), »Der Mönch von Sankt Sebald«, eine Nürnberger Geschichte aus der Reformationszeit (das. 1896, 5. Aufl. 1899), »Im Rosenhag«, eine Stadtgeschichte aus dem alten Köln (das. 1898, 4. Aufl. 1899), »Kärrekiek« (das. 1902, 8. Aufl. 1903), »Marie Verwahnen« (das., 1.–6. Aufl. 1903), »Pittje Pittjewitt« (Berl. 1903) sowie die Lieder »Lauf ins Land« (Köln 1897, 4. Aufl. 1902). Als Dramatiker trat er zuerst hervor mit dem Trauerspiel »Inez de Castro« (Köln 1894, 3. Aufl. 1895). Von einer Hohenzollern-Tetralogie sind bisher erschienen und wiederholt ausgeführt »Der Burggraf« (Köln 1897, 6. Aufl. 1900) und »Der Eisenzahn« (das. 1899); ihnen sollen »Der Große Kurfürst« und »Friedrich der Große« folgen. Lauffs neueste Dramen sind das Nachtstück »Rüschhaus«, das vaterländische Spiel »Vorwärts« (beide das. 1900) und das nach dem Roman »Kärrekiek« verfaßte Trauerspiel »Der Heerohme« (das. 1902, 2. Aufl. 1903). Während L. in seinen Romanen echtes Volksleben des Niederrheins poetisch festhält und in seinen epischen und lyrischen Dichtungen trotz wortreicher Diktion ein starkes Talent verrät, greift er in seinen Dramen, namentlich in den höfisch beeinflußten Hohenzollern-Stücken, oft zu unkünstlerischen Mitteln und erweckte entschiedenen Widerspruch. Vgl. A. Schroeter, Joseph L., ein literarisches Zeitbild (Wiesbad. 1899); B. Sturm, Joseph L. (Wien 1903).
Schnee
1
Anno Domini ... ich glaube, es war achtzehnhundert und in den sechziger Jahren. Ja, so war es. Anno Domini 1862 und so anfangs November herum äugelte ein rotgedunsenes, aufgeschwemmtes und doch langgezogenes Antilopengesicht, in dem die kleinen Augen wie hineingeknallte Sauposten saßen, durch die blankgeputzten Scheiben der Wirtschaft ›Zur letzten Träne‹ auf den Kirchplatz hinaus, den die ersten Schneeflocken in einem getragenen Hin und Her und in einem geisterhaften Auf und Nieder umspielten.
Traumhaft sanken sie auf die flaumige Decke, die bereits die ganze Umgebung feierlichst eingeschneit hatte.
Die ›Letzte Träne‹ lag der alten Sankt Nikolaikirche schräg gegenüber. Es war ein landläufiger Bau mit hohen Schornsteinen und niedrigem Giebel, lavendelartig gekalkt und mit blauangestrichenen Läden versehen, die in kräftigen Inschriften alle Genüsse anpriesen, worüber die Schenke verfügte. Linker Hand von dem ausgetretenen Hausflur lag der eigentliche Wirtsraum, in dessen Tiefe neben der Anrichte ein mächtiger Kanonenofen eine wohlige Wärme ausstrahlte; denn die Quecksilbersäule im Thermometer hatte sich bemüßigt gefunden, am frühen Morgen fünf Strich unter den Nullpunkt zu gleiten. Dabei drängelte sich die Kälte mit grimmiger Bosheit durch die Schlüssellöcher und Ritzen hinein, kratzte an den Scheiben herum und versuchte, zierliche Eisblumen in die tiefer gelegenen Fensterecken zu pinseln. Napoleonische Bilder hingen an den Wänden: Napoleon in Saint Cloud, Napoleon bei Austerlitz, Napoleon auf den Elysäischen Feldern ... wohingegen die Anrichte mit allen möglichen Schnäpsen und Elixieren bestellt war.
Hier war das Reich einer behaglich aussehenden Frau, die sich damit beschäftigte, Gläser zu spülen, die Bouteillen zu richten und die buntilluminierten Etiketten in die beste Beleuchtung zu stellen.
Langsam und feierlich drehte der Mann mit dem aufgedunsenen Antilopengesicht seinen breiten Schädel, der nur mit einzelnen Sardellensträhnen belegt war, auf den mächtigen Schultern herum, sah mit seinen Saupostenaugen nach dem Schanktisch hin und sagte mit einer Stimme wie aus einer Gießkanne heraus: »Madam Kürlitz, ich ersuche noch um 'nen ›Blumesüte‹, aber 'nen heißen.«
»Aberst ich bitte Ihnen gehorsamst, mein hochverehrter Herr Präsidente,« entgegnete das pummelige Frauenzimmer, wobei es gar lieblich mit den Goldspiralen ihrer Knippmütze hofierte, »bei die schwere Kälte kann man schon 'nen zweiten vertragen,« mischte Pomeranzen, Kandiszucker und kochendes Wasser zu einem köstlichen Gemengsel, tat schön wie eine Pfauhenne und brachte das Hergerichtete zu dem würdigen Mann am Fenster, der ihr Kommen mit einem wohligen Grunzen apostrophierte.
»So, das wäre gemacht. Aberst dürfte ich mir 'ne Frage erlauben, Mynheer Türlütt?«
Der Angeredete nickte herablassend und nippte dabei etliche Tröpfchen von der dampfenden Feuchte.
»Ich meine, Mynheer: für gewöhnlich beehren Sie die ›Letzte Träne‹ so gegen zwölfe herum, und nu ist es erst dreiviertel auf zehne. Ich meine gehorsamst.«
Erwartungsvoll setzte sie ihre Arme in die stämmigen Hüften.
»Madam,« sagte Herr Türlütt, und seine Stimme klang voll und rund wie eine schöne Synodalposaune, »in erster Linie müssen Sie auf meine Position Rücksicht nehmen, Frau Kürliß. Und wenn Sie ferner bedenken, daß ich bereits seit fünfundzwanzig Jahren die Bruderschaft Unserer Lieben Frau als Präside vertrete, daß der von ihr seiner Zeit gestiftete Altar zu den Sieben Schmerzen Mariä schadhaft geworden, daß in einer halben Stunde die Kommission zusammentritt, um das Nötige in die Wege zu leiten, und der Herr Kirchenrendant Anatole Baron zu Klotz zu diesem Behufe mich hier abholen will, wenn Sie das alles bedenken, dann werden Sie auch begreiflich finden, Frau Kürliß, daß es nichts Ungewöhnliches ist, wenn ich bereits zu dieser Stunde mich zwischen Ihren vier Pfählen befinde. Außerdem muß ich feststellen: Ihr Pomeranzenlikör ist ein Kapitel für sich, ganz ohne Wettbewerb. Es gibt keinen bessern zwischen Xanten und Kleve.«
Damit hatte er die heiße Flüssigkeit mit einem schnalzenden Wohlbehagen hinter die schwarzseidene Binde gegossen.
»Ganz ausgezeichnet, über alles Erwarten; man kann dabei den Rosenkranz beten.«
»Aberst ich bitte. Meine schwächlichen Kräfte, Mynheer!«
»Keine Entschuldigung. Sie wissen ja selber: ich bin kein Freund von schnäpsernen Genüssen. Verdamme sie vielmehr in den tiefsten Abgrund der Hölle. Ich weise sie von mir, weil sie entnerven, die Sinnenlust fördern und gegen Sitte und Satzung der christkatholischen Kirche verstoßen. Besonders die Frauenzimmer sollten sie meiden. Sie machen heißes Blut und nach den Mannskerlen gelüstig. Wasser sollten sie trinken. Sie bleiben dabei kälter und enthaltsamer und verfallen nicht auf fleischliche Anfechtungen und ähnliche Sünden. O diese Schnäpse! Im vorliegenden Falle jedoch: noch ein Gläschen, Frau Kürliß. Nur möchte ich bitten, die Portion doppelt zu nehmen; denn ich vertrete den homöopathischen Standpunkt: Beelzebub ist nur durch Beelzebub aus dem Tempel des Herrn zu schlagen.«
»Immerst man feste,« meinte Frau Kürliß, holte das Verlangte und machte sich hierauf hinter der Anrichte bei ihren Gläsern und Bouteillen zu schaffen, während der ehrwürdige Herr mit dem Antilopengesicht sich teils mit dem gebrannten Wasser sinnig und zart amüsierte, teils auf den Kirchplatz hinaussah, auf dem Myriaden von Schneesternchen ihr artiges Ringelspiel immer lustiger trieben. Es war ein vergnügliches Zusehen, ein Dösen und Dämmern in den kalten Schneetag hinein, der sein bestes Wintergesicht aufgesetzt hatte und alles aufbot, das niederrheinische Land in ein weißes Leilach zu hüllen.
Herr Franz Türlütt, gewesener Guanomakler und Schnittwarenhändler, nunmehr Verwalter seines nicht unbeträchtlichen Vermögens und Präsident der Bruderschaft Unserer Lieben Frau, gehörte zu den Honoratioren der kleinen Stadt, die zwischen Dämmen und Deichen, Wiesen und fruchtbaren Ländereien gebettet, unter den kunstliebenden Herzögen von Jülich, Kleve und Berg eine gewisse Blütezeit durchgemacht hatte. Abgesehen von kleineren menschlichen Schwächen war Herr Franz Türlitt ein geradliniger, aufrechter Mann und strammer Katholik, eine biedere Haut und ein Patriot von lauterstem Wasser. Das heißt, alles unter einem gewissen Augenwinkel betrachtet. Er liebte sein angestammtes Königshaus; aber die Erinnerungen aus der napoleonischen Zeit standen ihm höher, ein Vermächtnis seines in Gott ruhenden Vaters, der etliche Feldzüge des kleinen Korporals mitgemacht und dabei als Armeelieferant manchen Taler beiseite gebracht hatte. Außerdem: Herr Türlitt war mäßig und behauptete stets, im allgemeinen nur von Kyrie-eleison-Semmeln und Halleluja-Würstchen zu leben, obgleich alle Welt ihm die größten monatlichen Fleischer- und Bäckerrechnungen nachweisen konnte. Mit gläubiger Einfalt hob er allmorgens die Hände gen Himmel und sagte: »Ich hänge nicht am Besitz, mein Leben ist ein offenes Buch, und meine Erwerbsquellen sind mir so bekömmlich wie kristallklares Brunnenwasser gewesen,« obgleich er noch heutiges Tages auf seinen straffen Geldsäcken saß wie ein feister Moppel auf dem Schoß einer geschminkten Halbweltlerin und mancher aus seinen Bekanntenkreisen herumlief wie ein geschundener und abgelederter Geißbock. Herr Türlütt verfluchte den Alkohol, das heißt öffentlich. Im geheimen jedoch waren ihm Pünsche und steife Grogs Sorgenbrecher und Lebenselixiere geworden. Dennoch hielt man ihn für einen braven und aufrechten Mann, für eine Säule der Kirche, und er wäre, falls er seine Ehefrau nicht vorzeitig hätte bestatten müssen, auch der biederste und treuste Hüter seines schweren Traurings gewesen. So aber ... Gott im hohen Himmel nochmal! – da purzelten im Kirchspiel etliche vaterlose Kerlchen herum, von denen man sagen konnte: »Die pausbäckigen Apfel sind nicht weit vom Birnbaum gefallen,« und die Türlüttschen Taler sorgten dafür, daß die Erzeugnisse einer verwitweten Laune trefflich gediehen und sich gütlich taten wie die Spatzen bei Rübsen und Schoten. Durch die verstorbene Frau Célestine, eine Schwester des pensionierten Steuerempfängers und nunmehrigen Kirchenrendanten Anatole von Klotz, war ein adeliger Abglanz über das Türlüttsche Anwesen gekommen, ein Abglanz, der den würdigen Mann bis heute noch wie eine sanfte Gloriole umglitzerte. Er war seinerzeit stolz auf die Heirat gewesen, konnte es auch sein; denn die Familie von Klotz, wenn auch verarmt und im Laufe der Jahre dünn und fadenscheinig geworden, trug von Rechts wegen die freiherrliche, siebenzackige Krone und hatte im Großvater der heimgegangenen Frau einen Helden erzeugt, der in der französischen Revolution, und zwar bei Gelegenheit der Komödie des Chaumette-Hébertismus, eine bedeutsame Rolle gespielt hatte, um schließlich im fahlen Morgengrauen und in den Armen der blutigen Tochter Guillotins den Kopf zu verlieren. Vive la république! Vive la montagne! Seit diesem Tage war der deutsche Edelmann und französische Citoyen Anacharsis von Klotz ein Märtyrer der Familie geworden. Sein Andenken lebte, lebte besonders in seinem bejahrten Enkel weiter, im Herzen des pensionierten Steuerempfängers, und trieb hier Blüten, als wenn sie aus einem bizarren Orchideenhaus stammten ... und von diesen Blüten sickerten blutrote Tropfen.
Huhu, diese blanken Messerchen!
»Servus, Servus!«
Mit diesen Worten drehte sich ein hochgewachsener Mann mit Vatermördern und fuchsrotem Zylinder in die Wirtsstube herein, klappte seinen Regenschirm, an dem verschiedene Fischbeinstangen durch die splissige Seide hindurchstießen, auf und zu und ließ ein kleines Gestöber von Schneeflocken lustig umhertanzen.
» Morgen, Madam – hier meinen Schirm – in die Ecke damit – und dann 'nen Grog, aber 'nen steifen!«
Anatole Baron zu Klotz reckte sich auf, kurz, abgehackt, wie aus der Pistole geschossen, etwa so, wie er auch gewohnt war, seine Worte zu setzen. Pielgeradeauf, eine dünne Pelerine über den schäbigen Überrock geworfen, aber sauber gestriegelt, halb Oberst a. D., halb Verkäufer in einem Sargmagazin, so stand er neben der Anrichte und stach mit seinen zirkelrunden, nußbraunen Äugelchen in die Stube hinein. In seiner verblichenen Eleganz schien er sich sichtlich zu fühlen. Der Marabukopf mit dem glattrasierten Gesicht und dem kurzverschnittenen Schnurrbärtchen à la Sergeant unter der spitzigen Nase erhob sich mit einer gewissen Selbstherrlichkeit auf dem ausgemergelten Gänserichhals, an dem sich der Adamsapfel globulusartig auf und nieder bewegte.
Anatole Baron zu Klotz war einzig. Der vielbewunderte Caballero de la Mancha konnte sich nicht köstlicher geben. Halb Theater, halb inneres Erleben – so trug er jetzt seine gewichtige Person über die mit Sand bestreuten Dielen der ›Letzten Träne‹. Als er seines Schwagers ansichtig wurde, hielt er den Fuß an und schnellte die rechte Hand an den schmalen Rand des sich nach oben verjüngenden Zylinders. Dabei rutschte die etwas stark mit Wäschebläue behandelte lose Manschette bis an die obersten Knöchel vor. Ein Trillern mit den Fingerspitzen verwies sie wieder in Ärmel und Schlupfloch. »Ah! – votre serviteur, monsieur François!«
Er hielt ihm die Hand hin.
»Tag, Schwager.«
Fixbeinig war Herr Türlütt bei dieser Begrüßung in die Höhe gefahren. Was – in die Höhe gefahren? Ja, in die Höhe gefahren! – und dennoch ... obgleich er vorhin saß und jetzt leibhaftig auf seinen zwei Beinen stand: Mynheer Türlütt war nicht größer als vorhin geworden. Er gehörte zum Geschlecht der Sitzriesen. In dem mächtigen, breitschulterigen Oberkörper steckte eben ein Untergestell, das selbst beim Aufstehen den äußern Menschen nicht nennenswert zu heben vermochte, und so blieb denn Herr Türlütt nach wie vor ein gnomischer Kerl, ein abgebrochener Gigant, ein launiges Spiel der Natur und wie aus einem Hohlspiegel auf die Erde gepurzelt.
»Was?!« sagte der Mann im Zylinder. »Du bist schon beim heißen Pomeranzenwasser angekommen und vertrittst doch die Ansicht: Agape, satana – Gift für Körper und Seele – Teufelswerk – nur geschaffen, den Sinnentaumel zu kitzeln?!«
Herr Türlütt seufzte tief aus seiner Samtweste heraus, schlug die Augen auf zur Decke, um gewissermaßen zu beweisen, daß er gewohnt sei, seine Hände in Unschuld zu waschen, und sagte: »Schon richtig, Schwager. Aber es gibt Ausnahmen. Beispielsmäßig, um dir Gesellschaft zu leisten ...«
Eine mahnende Stimme schlug ihm entgegen.
»François ...!« und Herr Anatole warf sich eine Prise Tabak à la mode de France in die Nase.
»Nur aus diesem puren Grunde allein,« bekräftigte der ehrwürdige Herr mit dem Schnapsgesicht, »so wahr mir Gott helfe, so wahr die Mutter Gottes von Kevelaer ...«
Seine Blicke umflorten sich und gingen zur Anrichte, wo das behagliche Frauenzimmer gerade dabei war, kochendes Wasser mit Rum und Zucker zu mischen: »Madam Kürliß, nur zum Beweise. Ich bitte um 'nen Grog wie mein Schwager, aber 'nen heißen,« und er wandte sich wieder an Anatole von Klotz, der sich mittlerweile niedergelassen und die langen Beine mit den engen Korkzieherhosen breitspurig ausgestreckt hatte: »Schwager, so wahr ich hier stehe, und dann noch aus einem andern Grunde. Ich meine: soll ich etwa in der Kirche erfrieren? Soll ich mir etwa wegen der Besichtigung des Altars zu den Sieben Schmerzen Mariä die Lungensucht holen? Soll ich mir etwa ... Prosit!« und er nahm eins von den dampfenden Gläsern, die Madam Kürliß just anpräsentierte. »Prosit, Anatole, auf daß es uns wohl ergehe und wir noch lange leben auf Erden. Gewiß, der Grog ist ein verbuhltes Getränk, aber solch tapfern und erprobten Männern, wie wir sind, kann er nicht schaden. Im Gegenteil: in gewissen Fällen ist er als heilsam und gottwohlgefällig anzusprechen; denn oftmals bedient sich der Herr satanischer Dinge, um seinen heiligen und großen Zweck zu erreichen. Beispielsmäßig in gegenwärtiger Stunde. Schwager, wir müssen zur Kirche, bei dieser hundsmäßigen Kälte unsere christkatholischen Pflichten erfüllen, wir müssen ... Und daher, Anatole, nur um unserm lieben Herrgott zu dienen, nur um dir Gesellschaft zu leisten ... sonst nicht rühr an die Sache, so wahr mir Gott helfe, so wahr die Mutter Gottes von Kevelaer ... Prosit, Schwager!«
Damit klingte er an und hob gleichzeitig die linke Hand wie beschwörend zum Himmel.
»Schön!« sagte Anatole, während er Bescheid tat und den Gänsehals gummiartig aus den steifen Vatermördern heraushob, »aber wie kommt der Herr Dechant darauf – gerade heute darauf, Altarbesichtigung anzusetzen? – so aus heiler Haut heraus – ganz unvermittelt – und das von heute auf morgen?! – Hm! – unbegreiflich die Sache!«
»Ich bemerkte schon, Schwager ...«
»Ach was, bemerken! – Eigentümliches Vorgehen – vollkommen unnötig – vollkommen! Konnte warten auf wärmere Tage; aber der Herr Dechant liebt es, uns Nüsse knacken zu lassen – Walnüsse und andere Nüsse. – Also knacken wir – die Kirche befiehlt es. – Nur meine übrigen Pflichten – sie leiden darunter. Außerdem: der zehnte November steht vor der Haustür. Der große, heilige zehnte November! – Der Tag, an dem die ›Déesse de la Raison‹ den Thron des dreieinigen Gottes beehrte. – François, es lebe die Republik, die rote Tochter des wackern Guillotin! – Liberé, égalité, fraternité ou la mort! – François, ich muß Vorkehrungen treffen. – Das weißt du. – Auch du bist geladen. – Dampfende Punschbowle und so. – Auch Madam wird erscheinen. – Selbstverständlich in großer Aufmachung – rote Robe – rote Samtschuhe – und mit bleichem Gesicht – bleich wie die Wand in 'ner Sterbekapelle. – Feine Sache! – Man muß doch seinen stolzen Agnaten ehren, den großen Citoyen aus dem freiherrlichen Hause derer von Klotz.Vive la république! Vive la montagne! ViveAnacharsis von Klotz!«
Bei der Erwähnung dieses Namens hatte der Enkel des bedeutenden Mannes sich plötzlich so energisch und straff erhoben, daß davon seine alten, aber noch sehnigen Gelenke in ein gelindes Knacken gerieten, hatte feierlichst den fuchsigen Zylinder gelüftet und sein dampfendes Grogglas mit dem seines Schwagers vereinigt. Dabei stachen seine nußbraunen, etwas rotunterlaufenen Äugelchen wie blutige Messerchen. Und in diesen Äugelchen stand eine ganze Geschichte geschrieben, eine Geschichte des Schreckens, durch die die geisterbleiche Anklägerhand Fouquier-Tinvilles sicher hindurch griff, um die Herren und Damen der Conciergerie zu dem ehrenwerten Citoyen Samson zu führen, dessen ›rasoir national‹ alles hinwegrasierte, was gesonnen war, sich der großen Idee des Konvents entgegenzustellen. Ja, Anatole von Klotz hatte sich zeit seines Lebens mit diesen furchtbaren Dingen beschäftigt. Sie sahen in seine Träume hinein, stiegen aus den Kirchenbüchern heraus, grinsten von seinen Wänden herunter. Er sah sie mit lebhaften Augen, wahrhaft und wirklich; nur – er sah sie verlähmt und verkrüppelt, wie durch einen feinmaschigen Straminrahmen hindurch, etwa so, wie nur ein vertrockneter Kirchenrendant und pensionierter Steuerbeamter sie zu sehen vermochte. Anders nicht. Sie waren Erscheinungen mit Kielkröpfen und purzelnden Beinchen, Fratzengebilde, Narrengesichter, die auf roten Karren heranrollten, Wirr- und Schwarbelköpfe mit Kokarden und Piken, die im Angesicht Seiner Majestät des Todes den Revolutionsplatz umtanzten und dann hingingen, um in Notre Dame der Freiheitsgöttin, Mademoiselle Maillard von der Großen Oper, die weißen Füße zu küssen. Karnevalpossen! – aber der gestrenge und zugeknöpfte Herr mit dem Marabukopf fühlte sich wohl in der grotesken Gesellschaft und hatte alljährlich die Freude, sie am zehnten November aus einer heißen, strammen, dampfenden und meisterlich hergerichteten Punschbowle steigen zu sehen.
Und dieses Fest sollte bald kommen.
»François, à votre santé! – Madam Kürliß, Stoff – mehr Stoff! – Man muß ein übriges leisten – die heutige Stimmung benutzen – benutzen ... François, man ist Rheinländer – gewiß; Preuße, waschechter Preuße – kein Zweifel; ein treuer Diener seines angestammten Herrn und Königs. Man lebt gut und gerecht unter dem preußischen Kuckuck, aber das hindert doch nicht, die Freiheitsgedanken eines Hébert, Momoro, Chaumette und Danton zu würdigen und die geistige Bedeutung eines Citoyen, wie ihn mein Großvater Anacharsis Baron von Klotz glorreich verkörperte, in die richtige Beleuchtung zu rücken.«
Erneut hob sich der abgegriffene Zylinder etliche Zoll von dem nur spärlich bewachsenen Schädel, während Madam Kürlitz in ihren abgetretenen Selfkantpantoffeln anschlurfte und frische Groggläser zubrachte.
»François,« und die Gläser klingten wieder zusammen, »gedenken wir seiner! Frankreich, das Bluttribunal, selbst die Guillotine hatten Respekt vor dem Manne. Allerdings, bei ihm hieß das schließlich: Kopf ab! – War nicht anders zu machen, absolut nicht anders zu machen. Indessen jedoch, nur lediglich ›Kopf ab‹ für 'ne gigantische Sache. Kein Wunder! Alle bedeutenden Männer sind eines unnatürlichen Todes gestorben, so Alexander, Cäsar, Savonarola, Jesus von Nazareth. Warum sollte Anacharsis von Klotz eine Ausnahme machen? In diesem Sinne gedenken wir seiner. – Er lebe ...!«
Die rechte Hand flog wieder nach oben und mit ihr die Manschette. »Halt!« Eine schnalzende Bewegung mit Daumen und Mittelfinger trieb sie sogleich in den Ärmel zurück.
»Er lebe...!«
Herr Türlütt tat ihm Bescheid.
»Und du beehrst mich am zehnten November?«
»So wahr mir Gott helfe! – ich komme,« beteuerte der Biedermann mit dem kurzen Untergestell und saugte den Rest des heißen Getränkes hinter seine rotgepunktete Weste, »aber,« fügte er mit gehobener Stimme hinzu, »das schließt keineswegs aus, daß wir auch dem Herrn Dechanten die ihm gebührende Ehre erweisen. Ich möchte dir daher zu bedenken geben ...«
»Was soll ich bedenken?«
»Beispielsmäßig, daß wir in ihm das Oberhaupt und den Hirten der hiesigen Gemeinde zu erblicken haben.«
»Tun wir.«
»Und daß du Kirchenrendant bist.«
»Bin ich.«
»Und ich die Bruderschaft Unserer Lieben Frau als Präsident vertrete.«
»Tust du.«
»Und daß der Altar zu den Sieben Schmerzen Maria schadhaft geworden« – hierbei seufzte der biedere Gottesmann tief aus der Weste heraus und verdrehte die Augen – »und wir als Kommission umgehend eingreifen müssen.«
»Wollen wir.«
»Und daß ... warte mal, Schwager ... ich meine ... wir dürfen die Zeit nicht verpassen ...«
Er griff in die Westentasche, brachte eine Uhr zum Vorschein, drückte den Stecher und weckte ein scharfes Tinken in dem silbernen Zwiebelgehäuse.
»Noch fünfzehn Minuten. Bitte, Frau Kürlitz ... nur zum Abgewöhnen und um meinem Schwager Gesellschaft zu leisten, nur aus diesem puren und alleinigen Grunde noch zwei Steife, Frau Kürliß,« und er wandte sich wieder an den Nachfahren des großen Anacharsis von Klotz, und seine Stimme klang erneut wie aus einer Gießkanne heraus, um schließlich zu einer schönen, tönenden und weihevollen Jerichotrompete zu werden: »Schwager, ich danke dir aus innigster Seele. Du gehörst auch zu den Großen im Lande. Ich meine: du bist ein würdiger Folger des stolzen Revoluzers ...«
Er wurde unterbrochen.
»Was – Revoluzer?!«
Anatole von Klotz fuhr auf, wie von einer Hornisse gestochen.
»Pardon, Schwager! Ich meine nur, Schwager!«
»Was meinst du? – Was denkst du? – Was sinnst du? – O du kleinliche Seele! Der Mann, der die › Déesse de la Raison‹ inthronisierte, den Samson auf das rote Gerüst komplimentierte und dem eine blutrote Dame das Genick abküssen durfte ... Schwager, ein Mann mit solchen Freiheitsideen, mit solchem Schafottheroismus, der ist unter die Märtyrer und Helden zu stellen, ist Citoyen, ist Welt- und Menschenbeglücker – und wer ihn als Revoluzer anspricht, den muß ich als Knollfink verschleißen. François, Knollfink!«
Der rechte Arm fuhr zur Decke und mit ihm die Manschette. Als weiße Taube kam sie wieder herunter, wurde fingerfertig eingefangen und flugs in den Ärmel zurückgeschoben.
»Sapristi! – das ist ja Mord an den höchsten Gefühlen der Menschheit, Verhöhnung des französischen Tribunals, Vergewaltigung des Freiheitsgedankens, das ist ja ...«
Herr Anatole von Klotz schnappte nach Atem. Die kleinen Äugelchen schossen Blitze und sahen aus wie Tollkirschenbeeren.
»Nicht so, nicht so!« wimmerte Herr Türlütt. Der überrumpelte Mann wollte rein auseinanderbrechen, mit Stumpf und Stiel in den Boden versinken. »Bei der Mutter Gottes von Kevelaer, ich bitte dich, Schwager ...«
Er hob flehend die Arme.
»Ach was, Schwager! Du gehst ja nur drauf aus, mir die Lorbeeren und Palmen vom Leibe zu reißen und den Ruhm des großen Reorganisators – ja Reorganisators – noch im Grabe zu schänden. So aber bist du immer gewesen. – Revoluzer! – Revoluzer! – Dieses entsetzliche Wort bringt mich um, würgt mich, schleppt mich unter den Galgen ...«
»Nein, nein und tausendmal nein!« hielt Herr Türlütt ihm flehend entgegen und schlug verzweifelt die Hände zusammen, wie hilflos vor solchem Ausbruch dickfelliger Leidenschaft. »Du verstehst mich nicht richtig. Du bist auf dem Holzwege. Ich meine, du mußt das Wort ›Revoluzer‹ nicht übel vermerken, nicht auf die Goldwage legen. Es war ehrlich gesprochen und wollte besagen: Revolutionsheld – Blutzeuge – Gigant – Träger der Freiheit – würdig neben Robespierre und Danton zu stehen ... und daher, ich bitte dich, Schwager, den ›Knollfink‹ streichen zu wollen.«
Der Marabukopf lenkte ein und nickte befriedigt.
»Wenn es denn so ist ...«
»So wahr mir Gott helfe, so wahr die Mutter Gottes von Kevelaer...«
Herr Türlütt war die verkörperte Wehleidigkeit, ein wirklicher Büßer, zerknirscht bis in die Zehenspitzen hinein, und mit schöner, seliger Ergebung suchte er ein gerechtes Urteil von den noch immer gekniffenen Lippen seines Schwagers zu lesen, fand aber dabei noch Muße, einen scheuen Blick auf Madam Kürliß zu werfen, die von einer dampfenden Grog- und Pomeranzenwolke umhüllt, eben dabei war, die neue Lage vor die Gesichter der beiden Herren zu schieben.
»Mynheers, die Grögchens sind fertig.«
»Schön!« sagte der wieder besänftigte Kirchenrendant und faßte mit der Linken das Glas, mit der Rechten die Hand des Bußfertigen, der gleichfalls zupackte und mit getragener Duldermiene das › Absolve te‹ des Gestrengen erwartete.
»François,« und die Stimme des Sprechers war wie mit Daunen umwickelt, »irren ist menschlich, und ich irrte mich wirklich. Warum man aber auch so aufbrausen konnte? Unerhört! – aber das steckt mir im Blut. Das ist Revolutionsblut, Freiheitsblut. Drum keine Feindschaft nicht. Der ›Knollfink‹ wird hiermit gestrichen. Zum Wohlsein!« und die beiden sahen sich tief in die Augen – das sanfte Antilopengesicht und der strenge Marabukopf. Sie verstanden sich, und Madam Kürliß nickte, wiegte sich wohlgefällig in ihren abgetretenen Selfkantpantoffeln und sah zu, wie die heiße, dampfende Flüssigkeit den Weg alles Irdischen ging, und zwar so glatt und gefällig, als wäre das gebrannte Wasser eine Limonade oder der Absud eines laulichen Kamillentees gewesen ... und das gebrannte Wasser war allversöhnend, war milde und brachte die Herzen zusammen.
»Anatole...!«
»François ...!«
Nein, diese Eintracht! – und die beiden rechtschaffen Herren stellten wie auf ein gegebenes Kommando die leeren Gläser beiseite, umarmten sich, drückten sich wechselseitig an die blaugestärkten Chemisettchen und gaben sich schließlich so treuherzig und biedermeiermäßig die Hände, als wäre dieser Händedruck dazu bestimmt, einen neuen Bund zu errichten, vierfach geknotet und doppelt gesiegelt – mit Gott für König und Vaterland, auf Leben und Sterben und so gütig leuchtend wie ein schönes, feierliches Licht von einem hohen Berge herunter.
Hierauf tupfte sich Herr Türlütt mit seinem rot und blau bedruckten Schnupftuch gegen die Augen, während die Schneeflocken immer dichter und eisiger fielen und der blankgewichste Kanonenofen seine schönsten und hellsten Glühwürmchen in den Aschenkästen hineinpretzelte.
»Anatole, du bist doch ein Faktotum von Mannbarkeit. Beispielsmäßig ein edler Charakter. Nu aber ...«
Wieder tönte das klingelnde Tinken aus der silbernen Zwiebel heraus.
»Abgemacht!« sagte der Kirchenrendant, »gehen wir. Indessen – es bleibt dabei: am zehnten November Punschbowle, Feier und so. Großartig! Nur schade, daß mein Junge absagen mußte.«
»Wollte André denn kommen?«
»Aber natürlich! Sein Nichterscheinen ist mir sehr gegen den Strich; aber Weihnachten kommt er.«
»So? Weihnachten schon! War doch im verflossenen Sommer erst hier, und Heidelberg ist doch kein Katzensprung nicht. So'n Privatdozent hat doch auch seine Arbeit! – und ich war beispielsmäßig der Ansicht, er wäre gerade dabei, 'ne frische Idee auf die Beine zu stellen.«
»Tut er, und trotzdem ...«
»I der Tausend, da wird sich aber Fräulein Douwermann freuen!«
»Wer wird sich freuen?«
»Nu, dem alten Lehrer die seine.«
»Wird sie, wird sie!« bestätigte Madam Kürliß, »denn was Fräulein Johanna bedeutet, die hat schon 'nen feinen Pli und ein richtig Benehmen. Die wischt man so den Erdenstaub von sich ab und will höher hinaus, weil sie die Ansicht vertritt: ich kann mehr beanspruchen als die gewöhnlichen Menschen.«
Der Kopf des alten Herrn drehte sich ratlos auf dem Gänsehals herum.
»Ich verstehe das alles nicht,« sagte er tonlos.
»Aber Herr Baron! – Die Spatzen priestern's ja schon von den Roßäpfeln herunter.«
»Was priestern die Spatzen?«
»Na, das mit Johanna! – und wenn sie auch schon so halber mit dem jungen Lehrer Vogels versprochen sein soll, wenn ich Johanna Douwermann wäre, ich täte auch lieber 'ne Frau Baronin als 'ne simple Frau Lehrerin werden; denn es sticht doch mehr Propertee in die Sache, von der Noblesse nu mal gar nicht zu reden, und wenn ich mir selber alles genau überlege, so bin ich der Meinung, daß bei 'ner Lehrerpartie einem das Essen lang wird zwischen den Zähnen, bei 'ner baronisierten hingegen ...«
»Und da glauben Sie ...?« warf der pensionierte Steuerempfänger energisch dazwischen.
»Immerst man feste,« sagte die pummelige Frau und ließ ihre Goldspiralen glitzen und blitzen. »Ich für meine Person machte keine langen Fisimatenten. Das Baronisteren gefiel mir, und wenn ich an Stelle von Fräulein Douwermann wäre, ich glaube, daß ich zugreifen würde.«
Die fuchsigen Haare auf dem altmodischen Zylinder des zugeknöpften Herrn sträubten sich merklich.
»Sie sind wohl aus 'nem Affenkasten gesprungen!«
»Gott soll mich bewahren im hohen Himmel da droben!«
»Schwager,« sagte Herr Türlütt, und die Synodalposaune kam wieder in ein sanftes Klingen und Tönen, »wenn ich auch nicht behaupten kann, daß die Ansicht unserer lieben Frau Kürliß so gut destilliert ist wie ihr Pomeranzenlikör, ich auch annehmen will, daß der junge Herr Vogels schon so halber verlobt ist, man kann immer nicht wissen, ob sich irgend 'ne andere Sache nicht anspinnt; denn ich habe immer sagen hören, von zwei Äppeln ist einem der Borsdorfer allweil der liebste. Beispielsmäßig im vorliegenden Fall ...«
»François ...!« warnte der Kirchenrendant. Seine braunen Pupillen hellten sich auf und stachen schon wieder wie scharfe Messerchen.
»Schwager, ich kann mir nicht helfen ...«
»Niemals!«
Das knatterte wie ein Flintenschuß.
Der niederrheinische Caballero streckte die Hand aus. Das steifgestärkte Röllchen schoß mit und wäre zweifellos der braven Frau Kürliß an den Kopf geflogen, hätte es ein scharfes Fingertrillern nicht in den Ärmel verwiesen. Dabei lachte der Inhaber so höhnisch und kurz auf wie ein Gespenst an der Kirchhofsmauer.
»Das sollte mir fehlen! Das wäre schon das richtige Wasser auf die vornehme Mühle derer von Klotz! – Hahaha! – Mein Sohn, mein einziger Sohn, das köstliche Überbleibsel meiner seligen Gattin, dieser Streber und Denker, dieser Forscher und Kunstmensch könnte es über sich bringen, derartige bürgerliche Ambitionen zu hegen?! Utopisch – lachhaft – wirklich rein lachhaft! – Schön!« – und über das ausgemergelte Gesicht des Erregten lief ein satanisches Lächeln – »genügt es ihm, dem Mädel lediglich eine Trommel über die bürgerliche Schürze zu hängen ...«
Madam Kürlitz machte das Zeichen des heiligen Kreuzes: »Um Gott, Herr Baron ...!«
»Mir soll es egal sein!« klang es ihr schartig entgegen. »Aber ehelichen – ein gemeinsames Bett mit ihr teilen – blaues Blut verwässern zu lassen ...?! Lieber 'nen handfesten Mühlstein an das Wappen derer von Klotz, um es in die Tiefe des Rheines zu senken. Niemals! – Das bin ich meinem Geschlecht und meinem großen Vorfahren schuldig.«
Er schwieg. Keine Bewegung mehr. Nur der große Vorfahre wurde geehrt durch eine Lüftung des Zylinders.
Madam Kürliß drückte sich verängstigt hinter die Anrichte. Herr Türlütt jedoch wagte die peinliche Stille zu brechen.
»Ich möchte bemerken,« sagte er ruhig, »die Douwermanns sind doch auch nicht so ohne.«
»Was heißt das: ›sind auch nicht so ohne‹?«
»Daß viele von ihnen zu den illustren Künstlern und Bilderschnitzern gehörten, und Fräulein Johanna diese Künstlerschaft als Erbe bekommen.«
»Künstler, Künstler ...!«
Der freiherrliche Kirchenrendant lachte verächtlich: »Mit solchem Speck werden keine Mäuse gefangen.«
»Schon richtig; aber was Heinrich Douwermann war, der hat vorzeiten schon mit dem hochseligen Herzog Johann von Kleve an ein und derselben Tafel gesessen, und das ist so gegen Anno fünfzehnhundert und so und so viel gewesen.«
»Als Künstler gesessen?«
»Als Künstler.«
»Wo steht das?«
»In den Regesten der Stadt.«
»Allerhand Achtung!«
»Und wenn nicht alles trügt, hat selbiger Heinrich auch den Schrein zu den Sieben Schmerzen Mariä verfertigt und solchen in Gegenwart desselbigen Herzogs der Stadt übergeben. Wenigstens wird solches vom Herrn Dechanten behauptet.«
»Vermutung!«
»Wenn auch Vermutung; aber der junge Herr Vogels ist barbarisch dabei, solches festzustellen und den Nachweis beispielsmäßig aus den städtischen Akten zu suchen. Gelingt's, dann fällt auch 'ne gewisse Nobilität auf die Familie Douwermann und damit auch auf das hiesige Kirchspiel.«
»Wenn auch,« hielt ihm der Alte entgegen. »Mir soll es egal sein! Sapristi! – ich pfeife auf alle Künstler und Künstlergenossen. Distanz, meine Herren! – Ist etwa ein Wappen vorhanden? – I prosit die Mahlzeit! – Hat einer von dieser Künstler- und Lehrergesellschaft die Revolution mitgemacht und die Göttin der Freiheit beschworen? – Nicht im entferntesten Traum. – Hat etwa die rote Madam irgendeinen Douwermann in den Nacken geküßt und ihm für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit den Kopf vor die Füße geworfen? – Na, François, ich bitte um Antwort.«
Herr Türlütt zuckte die Achseln.
»Dann sind hiermit die freiherrlich von Klotzschen Akten geschlossen. Wir gehen zur Tagesordnung über, um am zehnten November den großen Tag zu begehen. Der ist mächtig mit Genius und Erinnerung behaftet. Vive la république! Vive la montagne! – François, los denn dafür!«
Und da trieben die fetten und mageren Jahre in das lichte Schneegestöber hinaus und dem Portal der Sankt Nikolaikirche entgegen ... und in der Dämmerung der gegurteten Halle, da hob es sich auf, da stand es in seiner köstlichen Einheit, das Wunderwerk eines niederrheinischen Schnitzmessers: der Altar zu den Sieben Schmerzen Maria.
2
Der Dechant Petrikettenfeier ten Hampel, ein Mann in den siebziger Jahren, stand vor dem Altar der Sieben Schmerzen Maria und sah zu, wie etliche Zimmergesellen dabei waren, die Predella von dem Hauptschrein zu lösen.
Kopfschüttelnd verfolgte der geistliche Herr das geschäftige Treiben, ermahnte zur Vorsicht und schien ängstlich bemüht, jede Störung der Arbeit so fern wie möglich zu halten. Sein Herz blutete. Wie war diese Beschädigung am Stamme Jesse nur möglich gewesen? Jahrhunderte hindurch hatte die barmherzige Hand des Ewigen gesorgt und gewaltet, waren die Greuel und Wirren des spanisch-niederländischen Krieges an diesem Mirakel des Schnitzmessers spurlos vorübergegangen, hatten die Trommeln des Generals Rabenhaupt vergeblich gegen die Pforten der Sankt Nikolaikirche gepoltert, und da mit einem Male und so aus völlig heiterm Himmel herunter war ein Tölpel von Mesner gekommen, hatte zugepackt und einen der schweren, gotischen Messingleuchter, die das Tabernakel flankierten, unbarmherzig gegen das köstliche Maß- und Rankenwerk der Predella gestolpert ... und nun grinste das Unglück aus dem Altarschrein heraus und krampfte das kunstverständige Herz des ehrwürdigen Herrn schmerzlich zusammen. Hilfe tat not, und es bedurfte einer geschickten Hand, den Schaden zu heben und das Werk erneut in seiner jungfräulichen Makellosigkeit erstehen zu lassen. Herrgott, dieses Meistergebilde! – eine Pilgerschaft der Seele, ein Sehnen und Suchen und ein Verkörpern unsagbaren Leids aus spätgotischen Formen heraus ...! – Nie wohl hatte ein Sterblicher Tieferes und Sinnigeres geschaffen. In reizvollen Motiven, umrankt von Drei- und Vierpässen und architektonischem Maßwerk, reihte er die Legenden neben- und übereinander, hatte er es verstanden, seine Kunst in den Dienst der Schmerzensreichen und des Allerhöchsten zu stellen. Wunder neben Wunder! Wie ein weltverlorenes Harfenklingen, wie ein verhaltenes Schluchzen und Weinen tönte es aus dem feingegliederten Aufbau, wie ein Harfenspiel am See Genezareth, wo der Flachs rot blüht und weiße Lilien die sanftgewellten Hügellehnen bedecken, wie ein Jammern und Seufzen auf Golgatha, als der Welterlöser sein Haupt neigte und starb, der Himmel sich verfinsterte und der Vorhang im Tempel mitten entzweiriß.
Und der Dechant Petrikettenfeier ten Hompel, Ehrendomherr an der Kathedralkirche zu Münster, vernahm dieses Klingen und Schluchzen, schüttelte immer wieder den feinen, eisgrauen Kopf und wurde nicht müde, die subtile Arbeit zu fördern und mit seinem goldbeknopften Bambus vielsagende Zeichen zu geben.
Nachdem der schadhafte Untersatz auf die Mensa gerückt war und sich die Gesellen verschnauften, winkte der kleine, lebhafte Herr einen grobknochigen, ganz in tiefstes Schwarz gekleideten Mann herbei, der augenscheinlich die Arbeit geleitet hatte und so würdig und feierlich aussah wie der Tag des Herrn oder wie das Antlitz der heiligen Apollonia aus Alexandrien, wenn sie einen kranken Zahn besprach und durch Auflegung ihrer Hände die Schmerzen hinwegnahm.
Es war der Küster Jakob Bollig, ein Kerl, wie geschaffen, Bäume auszuheben, Dächer abzutragen und Steine zu wälzen. Unter seinen klobigen Fäusten, so schien es, mußten die heiligen Gefäße zerbrechen, und doch arbeiteten sie wie weiche, zierliche Frauenhände, und seine breiten Füße glitten dabei so sacht und geräuschlos über die harten Kirchenfliesen, als wenn sie über Samtdecken und Eiderdaunen gingen. Der Mann war in seiner äußern Erscheinung voller Gegensätze: ungelenk und doch voller Bewegung, ein kolleriger Puter und doch ein sanftmütiger Kapaun, und in dem brutal gesunden, jovialen und glattrasierten Gesicht lagen die verwaschenen Augen ohne Hoffnung und Sehnsucht und muteten an wie die trüben Unschlittlichtchen, die in einer Totenkapelle brennen. Die Stadt der heiligen Dreikönige und in ihr wieder die Gereonswallstraße konnten sich rühmen, ihn als den Erstgeborenen braver Schusterleute gesehen zu haben. Nebenan wohnte Ohm Jakob. Und dieser wurde sein Pate. Ohm Jakob trug gesteinte Ringe an den Weißwurstfingern und über dem soliden Bäuchlein eine schwergoldene Kette, stark genug, ein Mülheimer Bötchen vor Anker zu legen. Er war der Inhaber und Leiter eines vielbesuchten Hauses mit geblendeten Fenstern und einer roten Laterne, eines Hauses mit weißgespreiteten Betten, Marmortischen und hohen Spiegeln. Und in diesem Hause, das ein aufdringlicher Duft nach Heliotrop und Parmaveilchen durchwölkte, passierten eigentümliche Dinge, obgleich Ohm Jakob nie das Hochamt versäumte, klerikal wählte und dem Staate gab, was dem Staate gebührte ... eigentümliche Dinge! – und ein Herr im fettigen, abgelebten Frack, mit einer welken Nelke im Knopfloch, saß am Klavier und machte Musik und Stimmung dazu. Und der kleine Jakob war öfters auf Besuch bei seinem frommen Ohm und den vornehmen Damen, und sah das alles und durchlebte das alles; aber nach Kinderart und in schuldloser Weise. Und wenn er dann nach Hause kam, dann sagte die Mutter: »Jaköbche, nu halt aber freundlichst die Luff an, sons kümmt der Herr Kommissar hinter die fiese Geschichte, un dann könnte et, wie m'r eso sag, zu 'nem kleine Malörunglückelche komme. Un dat will m'r nich habe. Im übrige hat et nix ze bideute.« Und da hielt der kleine Jakob die Luft an, ließ sich von den jungen Damen mit Pralinés füttern und schloß eine schöne Freundschaft mit dem fettigen, abgelebten Frack und der welken Nelke im Knopfloch. Als er aber in die Jahre gekommen, las er in der Handpostille seines Vaters die Stelle: »Und Babel, die Unzucht, reitet auf einem rosinfarbigen Tier und ist lieblich und schön von Leibesgestalt und trägt einen goldenen Ring in der Nase. Von ihrem Munde jedoch geht ein giftiger Hauch aus, und er verpestet alle Geschlechter auf Erden.« Da gedachte Jakob ein Diener und Streiter des Herrn zu werden und mit flammendem Wort gegen das verlockende Weib auf dem rosinfarbenen Tiere zu Felde zu ziehen. Und der kleine Bekenner studierte. Er kam bis Untersekunda. Ohm Jakob hatte ihm bisher diese Wohltat verstattet, hatte gesorgt und gegeben, nachdem er durch seinen regen Betrieb sich ein erkleckliches Vermögen erspart und sich schließlich zur Ruhe gesetzt hatte. In grünen Plüschpantoffeln und einem Schlafrock von braunem Velvet hoffte er einen stillen Gottesfrieden und einen gesegneten Lebensabend zu finden. Er hatte sich redlich geplagt und durfte daher auch gewisse Ansprüche machen. Doch da starb er, nachdem er sein ganzes liegendes und bewegliches Eigen der alleinseligmachenden Kirche und dem Verein ›Zur Hebung der Sittlichkeit‹ vermacht, aber total vergessen hatte, seinen Neffen in die Heerohmestrümpfe und die geistlichen Schnallenschuhe schlüpfen zu lassen. »Siehst du nu, Jaköbche,« sagte die Mutter, »da habe mir der Hummersalat. Et schadet dem Käppesje ja nix, aber wofür der Unsinn! Un deshalb, Jaköbche: er war doch 'ne fiese Möpp, deine Ohm Jakob ...« und da blieb dem Enttäuschten nichts anders übrig, als den geistlichen Herrn schießen zu lassen, sich auf sich selbst zu besinnen und sich anderweitig nützlich zu machen. Aber Weihrauch, Klingelbeutelgezwitscher und Maiandachten, die mußte er haben; ohne sie war ihm das Leben nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle, und so blieb er denn im kirchlichen Fahrwasser, messedienerte sich durch die Jugendjahre hindurch, machte sich mit den Pflichten und Obliegenheiten eines Ministranten und Kerzenziehers vertraut, um schließlich die Würde eines Küsters auf seine frommen Schultern zu laden; erst im Kölner Sprengel, wo die Menschen spitze Gesichter haben und die Glocken nur mit einem mageren Gebimmel ihre Stimmen erheben, und dann am Niederrhein, im Kirchspiel von Sankt Nikolai, in der klevischen Gegend. Hier zwischen Weiden und Dämmen, wo im Juni das Grasmeer sich auf- und niederwellte wie eine mannshohe Dünung und die Glockentöne wie fette Wachteln und Graugänse über die Niederung ruderten, fühlte er sich wie die Ortolane im Weizen, lobte Gott und diente dem Herrn in getragener Einfalt.
Langsam trat er von den Altarstufen herunter. Trotz der empfindlichen Kälte, die die Kirchenhallen durchwehte, schritt er wie durch die Wärme einer behaglichen Sonne oder eines wohligen Herdfeuers, zufrieden und glücklich, und nur die verdämmerten Augen glommen noch immer wie die trüben Unschlittlichtchen in einer Totenkapelle.
»Herr Bollig,« meinte der Dechant, nachdem er zu verschiedenen Malen rückwärts geschaut und seine Blicke auf den Eingang der Kirche gerichtet hatte, »Sie haben doch den Herrn Türlütt verständigt?«
Herr Bollig lächelte.
»Gewiß, Herr Dechant,« sagte er ruhig.
»Und den Herrn Kirchenrendanten?«
»Auch der is bisorg.«
»Dann begreife ich nicht, weshalb sie dem Ansuchen bis jetzt keine Folge gegeben haben.«
»Hab' ich auch als gedach. Aber et jaloppiert sich so schnell nich. Un denn die Kälte; die is Giff für die Herren. Da bleib weiter nix übrig: mir müsse warte, Herr Dechant. Aber ich denken doch: gleich müsse sie komme.«
Herr Jakob Bollig hatte richtig geweissagt.
Die beiden erschienen, und Herr Türlütt, der etwas fuselselig heranpendelte, schmunzelte teils verlegen, teils gütig: »Pardon, Herr Dechant! Man muß die Umstände schon in die richtige Beobachtung nehmen. Beispielsmäßig das Wetter, 'ne gewiße Unpäßlichkeit und dann noch die Arbeit.«
»Stimmt,« pflichtete ihm der Kirchenrendant bei und schliff gleichzeitig mit Mittel- und Zeigefinger zwischen Hals und Vatermörder hindurch, »man hat seine Bequemlichkeit nötig – hat für seinen Hausstand zu sorgen – und gehört auch nicht mehr zu den Jüngsten im Lande. Was dem einen recht ist, ist dem andern billig. Kurz, man hat schon seine täglichen Miesepetereien zu tragen.«
»Auch seine Pflichten,« sagte der geistliche Herr mit etwas gehobener Stimme, »und deshalb bat ich Sie her, meine Herren, um mit mir Rats zu pflegen und die dem Altar zu den Sieben Schmerzen Mariä durch ein unseliges Mißgeschick zugefügten Schäden bald zu beheben.«
»So, so! – bald zu beheben,« meinte der Kirchenrendant und wiegte den Marabukopf bedenklich auf den mageren Schultern. »Unglaublicher Zustand – unglaublich! Hörte bereits davon – aber nur wenig. War für einige Tage in Kleve – hatte Geschäfte – dringlich – sehr dringlich. Und da muß so was vorkommen! Wird Geld kosten – viel Geld... und ich möchte nur wissen: wie konnte eine derartige tiefbeklagenswerte Sache passieren?«
»Wie eben ein Unglück geschieht,« versetzte der Dechant. »Aber ein solches läßt sich nicht rechten und richten. Wir müssen halt die Verhältnisse nehmen, wie sie nun einmal liegen. Eine ungeschickte Hand brachte den Leuchter zu Fall, und damit hat die Predella, leider sei es geklagt, schweren Schaden genommen.«
»Predella, Predella!« ereiferte sich Anatole von Klotz, machte sich lang und streckte die Hand, mit der er den fuchsigen Zylinder hielt, so energisch von sich, daß die Manschette wieder davon fliegen wollte. »Nicht zu begreifen, fast eine Roheit, diesen heiligen Schrein so zu mißhandeln. Herrgott, diese menschliche Dummheit, um mich keines stärkern Wortes zu bedienen! Distanz, meine Herren... ich sehe mit leiblichen Augen und höre mit leiblichen Ohren: das weint und wimmert ja aus dem köstlichen Schnitzwerk. Herr ...!« und bolzengerade und drohend stand er plötzlich dem ahnungslosen Küster gegenüber. Die scharfen Lichter in seinen kreisrunden Augen begannen unheimlich aufzuleuchten. »Wo soll ich das hintun? Da müßte Herr Samson mit seiner Guillotine dahinter.«
»Beispielsmäßig,« konstatierte Herr Türlütt.
»François. ich bitte um Ruhe.«
»Ich meine nur, Schwager.«
»Herr ...!« und wieder nahm er den Küster aufs Korn. »Ich fordere Rechenschaft von Ihnen. Oder« – und seine Stimme nahm einen schartigen Ton an – »sind Sie vielleicht selber das unglückselige Karnickel gewesen?«
Auch Herr Türlütt trat näher.
»Beispielsmäßig. Herr Bollig?«
Die Zimmergesellen grinsten.
Der Küster wäre vor Entsetzen fast auf den Nacken geschlagen. Die Finger des aus seiner Seelenruhe gekommenen Mannes krümmten sich in den schwarzwollenen Handschuhen. Er streifte diese von den Fäusten herunter.
»Herr, diese Bimerkung brauchen ich mir nich gefallen ze lasse! Nur gut, dat ich hier der Küster als Standesperson bin un nich der Herr Bollig, sons ... Wat meinen Sie wohl, wat ich dann täte? hier meine fünf Fingere künnten Ihr Ridaxionspültche verarbeite, dat Sie nich mehr wisse sollte, wo sich Ihr Kamesol noch bifindet.«
»Ich bitte, Herr Bollig...«
Der Dechant legte sich ins Mittel und versuchte, die etwas kritische und außer Kurs geratene Stimmung wieder in stille Wasser zu leiten.
Endlich gelang's ihm.
»Meine Herren, warum diese unnütze Debatte? Sie fördert in keiner Weise und schafft nur Gegensätze. Also lassen wir das. Die Erregung der Herren kann ich begreifen, und es ist schlimm und bitter genug, daß ein derartiges Mißgeschick über uns hereinbrechen konnte. Seien Sie überzeugt, es wäre mir lieber gewesen, Sie in einer freudigen Angelegenheit bei mir zu sehen. Aber ich betone nochmals: keine nachweisbare Verschuldung liegt vor. Nur die unachtsame Hand eines Ministranten tat uns diesen seelischen Schmerz an und verstümmelte ein christliches Kunstwerk in bedenklicher Weise. Bei dieser Gelegenheit möchte ich ferner der Erwägung anheimstellen, ob es nicht angezeigt wäre, das Mittelfeld des Schreines mit einem würdigen Gnadenbilde zu schmücken. Das jetzt vorhandene ist lediglich ein schwacher Ersatz für die in dunkeln und traurigen Zeiten auf unaufgeklärte Weise abhanden gekommene Pieta. Doch dieses nur nebenher, meine Herren. – Vor allen Dingen liegt es uns ob, den unermeßlichen Schaden baldmöglichst zu beheben und die Arbeit eines Meisters aus verklungenen Tagen wieder in alter Glorie und Reinheit erstehen zu lassen.«
»Na denn,« sagte Anatole von Klotz, wandte sich an den noch immer mißgestimmten und schmollenden Küster und hielt ihm die Hand hin. »Nichts für ungut, Herr Bollig.«
»Merci,« versetzte dieser nach einigem Zögern, räusperte sich und legte seine seifenschaumkalten, friseurglitschigen Finger in die des Kirchenrendanten.
Die wechselseitigen Beziehungen schienen wieder hergestellt und alle Mißhelligkeiten behoben zu sein, als Herr Türlütt, noch ganz unter dem Bann der geistlichen Worte stehend und sichtlich von den Geisterlein des genossenen Grogs beeinflußt, in eine seltsame Bewegung geriet. Sie wurde äolsharfenweich und lau und erinnerte an das Säuseln der Trauerweiden, die sinnig und lieb das Grab seiner allzufrüh heimgegangenen Gattin, der ehrsamen Célestine, geborenen von Klotz, umstanden. Erschüttert suchte er in die Nähe der Predella zu kommen. Gott, was sah er nicht alles! Diese Verwüstung! Die Worte des geistlichen Herrn traten ihm erneut vor die Seele. Das waren sinnige Worte, ergreifende Worte, und alle trugen ein Dornenkränzlein um die hämmernden Schläfen. Herr Türlütt fühlte die getragene Weihe der jetzigen Stunde. Rosenfarbige, aromatische Punsch- und Grogdämpfe umgaukelten ihn.
»Nein, dieser Meister aus verklungenen Tagen!« legte er los. »Wenn er das sähe, er müßte sich im Grabe noch umdrehen. Nun steht der Verstorbene vor den Trümmern seiner gemordeten Lebensaufgabe, seines unter Seufzern geschaffenen Werkes. Eitelkeit über Eitelkeit, alles ist eitel! O diese Menschen...!« – Und dann ward er gerührt, zog sein Schnupftuch und weinte still vor sich hin; denn er sah sich vor die Gewissensfrage gestellt, ob er nicht selbst einen großen Teil der Schuld hätte auf sich nehmen müssen. Er war doch der Präsident der Bruderschaft Unserer Lieben Frau und somit auch der Pfleger des Altars zu den Sieben Schmerzen Mariä. Hatte er in dieser Hinsicht überhaupt seine Pflicht getan? Hätte er nicht besser aufpassen müssen? Ja, das hätte er, das wäre er sich selber und dem ›Meister aus verklungenen Tagen‹ schuldig gewesen. Und jetzt stand er hier, gewissermaßen als ein verlorener Mensch, als ein Tempelschänder und ein großer, wenn auch reuiger Sünder.
Immer nachhaltiger flossen die Tränen, immer lustiger griemelten die Zimmer- und Schreinergesellen.
Der Dechant trat auf den Trostlosen zu und führte ihn seitwärts.
»Herr Türlütt,« sagte er schmunzelnd, »darf ich mir eine unverbindliche Frage erlauben?«
Der abgebrochene, aus dem Leim gegangene Riese nickte ihm zu, freundlich und schmerzlich. »Ja, Sie dürfen es, Sie dürfen fragen, Hochwürden. Ich bitte darum. O! – es ist für mich eine auserwählte Bekömmnis.«
Gütig und wohlwollend tastete er nach der Hand des geistlichen Herrn.
»Ja, fragen Sie nur, mein lieber Herr Dechant.«
»Herr Türlütt,« sagte dieser mit einem gewissen schalkhaften Anflug, »draußen herrscht eine barbarische Kälte, und um diese zu bannen, haben Sie vielleicht etwas zu tiefgründig mit dem Gläschen geäugelt? Hand aufs Herz, mein lieber Herr Türlütt!«
»I Gott bewahre, und nichts für ungut, Herr Dechant! Aber wer andern in der Nase herumpopelt, hat selber was drin.«
Das gutmütige Antilopengesicht lächelte selig.
»Gott sei Dank, nein! – bei Ihnen aber, Herr Türlütt ...«
»Keine Spur von Idee! Wie werde ich denn, mein hochverehrter Herr Dechant l Agape, satanas! Alkohol ist Gift für die Menschheit und verdirbt den Charakter. Ich für meine Person genehmige nie einen Tropfen,« und feierlich hob er die Schwurfinger aufwärts, »so wahr mir Gott helfe, so wahr die Mutter Gottes von Kevelaer ... Aber es gibt Ausnahmen, Hochwürden. Beispielsmäßig, um meinem Schwager Gesellschaft zu leisten ...«
»François...!«
Herr Anatole drohte verwarnend mit dem Regenschirm und den verwahrlosten Fischbeinstäben.
»Ich meine nur, Schwager ... beispielsmäßig, um uns für die lange Kirchensitzung zu stärken. Ach Gott, Herr Dechant! – dieser traurige Anblick und dieser ›Meister aus verklungenen Tagen‹! Diese menschliche Seele! Dieser Künstler, um sich so nach seinem gottwohlgefälligen Tode zertöppert zu sehen! Indessen, Herr Dechant,« und der prächtige Mann arbeitete sich wieder aus dem Pomeranzen- und Fuselnebel heraus und machte eine pompöse Handbewegung, »indessen, Herr Dechant, ich bin kein begüterter Mann, habe jedoch ein Herz und eine Seele von Gold und kann auch über etliche Papiere verfügen ... und wenn Sie gestatten,« und seine Stimme wurde schön und voll und tönte wie eine Domorgel am Tag der Verheißung, »im Angedenken an den ›Meister aus verklungenen Tagen‹ – ich trage die Kosten.«
Dabei hatte er die Hände des vor ihm Stehenden ergriffen und schüttelte sie so gönnerhaft und treuherzig, als müsse er hierdurch eine edle Verpflichtung eingehen, eine Verpflichtung für immer, von jetzt an bis in alle Ewigkeit – Amen.
Anatole von Klotz blies sich den Frost von den knochigen Händen und sah seinen Schwager an, als sei dieser wirbelsinnig geworden und unter die Verschwender gegangen. »Mensch, du,« rief er ihn an, »du bist wohl mit den Silbergruben der Kordilleren verschwägert?!« Dann aber, als er ihn so offen und ehrlich dastehn sah, die kleinen Saupostenaugen fromm und glaubensstark auf den geistlichen Herrn gerichtet, da legte auch er alle Bedenken beiseite, gab dem Großmütigen einen fidelen Klaps auf die Schulter und sagte: François, du schwingst dich auf zu höheren Sphären. Edle Anwandlungen – Kavalier – siebenzackige Vornehmheit – über Bürgertum hinaus – weit über Bürgertum ... und wenn auch kein blaues Blut dir den Adel verleiht, die Gesinnung tut es, und selbst mein großer Ahnherr, Anacharsis von Klotz« – dabei hob der Sprecher seinen schäbigen Zylinder langsam in die Höhe und ließ ihn wieder feierlich sinken – »hätte dich für würdig befunden, mit ihm für Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit das Schafott zu besteigen.«
Der Zylinder hob sich wieder: » Vive la république! Vive la montagne! – und Sie, Herr Dechant, was denken Sie über das Weihgeschenk meines vornehmen und sinnigen Schwagers?«
»Wenn Herr Türlütt auch jetzt noch, und zwar aus reiflicher Überlegung heraus, die löbliche Absicht vertritt, dem versprochenen Anerbieten den entsprechenden Rückhalt zu geben, die Kirche würde sich ihm gegenüber für verpflichtet halten und solches in den Annalen dankbar verzeichnen.«
»Herr Dechant« – und der kurzbeinige Gefühlsmensch schluchzte bewegt – »so wahr mir Gott helfe ...«
Helle Tränen kullerten ihm über die kummerseligen und vom Pomeranzenlikör gedunsenen Wangen.
»Denn zur Sache,« meinte Herr Anatole Baron zu Klotz, »und Sie, Hochwürden, haben wohl die Liebenswürdigkeit, uns mit der Materie vertraut zu machen und das Nähere in die Wege zu leiten.«
Gemeinsam traten sie vor den Altarschrein, an dem die Schreinergesellen den Untersatz bereits auseinandergenommen und die Schäden bloßgelegt hatten. Jetzt erst sah man das Wunderwert in seinen einzelnen Teilen, vor denen die Seele erschauern mußte.
»Der Liebenswürdigkeit eines unserer angesehensten Mitbürger haben wir es zu danken,« nahm nun Herr Petrikettenfeier das Wort, »daß die nicht unbeträchtlichen Kosten für die Erneuerungsarbeiten gesichert erscheinen. Die zweite Frage wäre: wem soll die Lösung dieser heiklen Aufgabe anvertraut werden?«
»Sehr richtig.« bestätigte Herr Bollig.
»Ersten Künstlerhänden natürlich,« ergänzte der Dechant. »Aber wo sind diese Künstlerhände zu finden? Unsere Zeit ist nicht reich daran, und dennoch glaube ich, diese Künstlerhände gefunden zu haben.«
»Bravo! – und beispielsmäßig, die wären?«
»Hierzu muß ich ausholen,« sagte der Dechant. »Kein Zweifel besteht: die Meister sämtlicher Altäre konnten einwandfrei aus den Regesten des städtischen Archivs festgestellt werden. Nur dem Schrein zu den Sieben Schmerzen Maria war bis jetzt dieses Los nicht beschieden, obgleich sich der junge Lehrer, Herr Vogels, alle Mühe gab, das mystische Dunkel aufzuhellen und Klarheit zu schaffen. Indessen – alle bis jetzt durchforschten Akten, Rechnungen und Bruderschaftslisten schwiegen darüber. Und dennoch: ich habe meine eigenen Gedanken und stehe nicht an, diese Perle auserwählter Holzbildnerkunst dem Meister Heinrich Douwermann auf sein Konto zu setzen.«
»Das wäre denn doch ...!« ereiferte sich der Kirchenrendant. »Kaum glaublich! Dann hätten wir ja mit der seit Jahren aufgestellten Behauptung unseres braven Arnt Douwermann zu rechnen?«
»Allerdings,« sagte ten Hompel.
»Und Ihre Gründe, Herr Dechant?«
»Ich komme später darauf; leider sind sie bis jetzt aus den Schreinsurkunden und Akten nicht zu ersehen. Aber gedulden wir uns. Der emsigen Forschung wird es schließlich gelingen, meiner Behauptung das Rückgrat zu steifen. Meister Heinrich ging seine eigenen Pfade, ganz unabhängig von der Kalkarschen Schule. Nur noch geringfügige Anlehnungen sind in seinen Werken verkörpert. Er war malerisch bis in die Zehenspitzen hinein, wenn er auch im großen und ganzen in Linien dachte. Beglaubigt von ihm ist der Marienaltar im Dom zu Xanten, und diesen habe ich als Basis meiner Betrachtung genommen.«
»Und Sie folgern hieraus?« fragte der Kirchenrendant, machte den Hals lang und warf sich eine Prise Spaniol in die Nase.
»Vergleicht man diesen mit dem zu den Sieben Schmerzen Maria, so drängen sich Ähnlichkeiten auf, die für meine Zwecke Erfreuliches zeigen. Bei beiden Altären noch der Sinn für spätgotische Formen, nur anders, abgeblaßter und selbständiger wie bei den zeitgenössischen Werken. Eigenes Erleben beginnt schon seine Wurzeln zu schlagen. Die Neuzeit dämmert herauf. Das Malerische offenbart sich in sieghafter Kraft. Der Gedanke wird freier. Hier wie dort die Piastik von Bewegung und Leben, drängen die weiblichen Formen nach Reife, schmiegen sich die Gewänder eng um sie her und kommen die Gegensätze von Licht und Schatten zu einer glücklichen Lösung. In beiden Werken ist der Künstler gewissermaßen der Vermittler zwischen Derick Jeger und dem Schöpfer des Berendonkschen Kreuzwegs in Xanten. Beide Altäre haben ihre persönliche Note. Hier wie dort das ruhige und abgeklärte Gefüge der Körper und die straffe Zucht des Schnitzmessers mit Rücksicht auf die Gestaltung der Massen. Nur dem Kopfe ein und desselben Meisters konnten diese Werke entspringen, und daher bin ich der felsenfesten Überzeugung, obgleich die schriftlichen Beweise noch fehlen: wie er den Marienaltar in Xanten geschaffen, so ist Heinrich Douwermann auch zweifelsohne der Schöpfer des hiesigen Schreines zu den Sieben Schmerzen Maria gewesen, und somit, meine Herren ...«
Eine Bewegung entstand.
Die Zimmer- und Schreinergesellen, die mittlerweile auch die letzten schadhaften Reste beseitigt und das krause und verzwickte Ranken- und Maßwerk der Predella völlig auseinandergelegt hatten, steckten die Köpfe zusammen.
Einer von ihnen hatte etwas gefunden, ein unscheinbares Ding, gewissermaßen ein Garnichts – und trotzdem... Zwischen den Verkröpfungen des Wurzelstockes Jesse, ganz zu hinterst, in einer verlorenen Ecke, bisher jedem menschlichen Auge verborgen – da hatte es gelegen, unscheinbar und mit einem seinen, grauen Mulm überzogen.
»Was gibt's da?«
Herr Bollig packte zu.
Ein Messer ...! – nicht groß und mit hölzernem Handgriff.
Der Küster wischte den Staub von der Klinge, säuberte das Heft und sah eingegrabene Zeichen und Zahlen.
»Da kann m'r ja tirek der Tummeleut schlage for Freud, wo einem eso wat bigegnet. I zum Takerent noch emal! – da soll m'r an 'ne Vorsehung nich glaube?! Ich bitte, Hochwürden.«
Er reichte ihm das Fundstück hin. Der Dechant nahm es, zog die Augenbrauen zusammen und las die verwaschenen Buchstaben, erst flüchtig und fahrig, dann nochmals, aber nachhaltig und schärfer und schließlich mit der sinnigen Ruhe eines Forschers, gewillt, jeden einzelnen auf Herz und Nieren und seine lautere Echtheit zu prüfen. Und als er alles genau überlegt und erwogen hatte, als er sich nicht mehr irren konnte, da wurde er fröhlichen Sinnes, und über seine stillen und versonnenen Züge breitete sich ein seliger Abglanz.
»Es lag bis jetzt ein eigentümliches Dunkeln und Dämmern über diesem Schrein,« sagte er hierauf. »Alle Bemühungen, einen Strahl der Erkenntnis in das mystische Träumen zu bringen, mißlangen. Schließlich aber stand der Tag auf den Bergen. Aber er kam nicht in seiner gewöhnlichen Weise, nicht mit seinen Vorboten und seinem leisen Gesäusel. Nicht mit dem fahlen, langgezogenen Streifen im Osten und dem verworrenen Vogelzwitscher im Heidekraut. Nein, er kam aus vollem Dunkel heraus, so ganz unvermittelt und herrisch, selbstgefällig und hell wie das Licht, und sagte: Hier bin ich. – Ja, meine Herren, nun steht der Tag auf den Bergen, und mit ihm ist das Wissen gekommen. All dieses Tasten und Suchen, all dieses Vermuten und Wiederverwerfen ist nun eitel und nichtig geworden. Wir haben die Wahrheit. Was Jahrhunderte hindurch verschwiegen und stumm war, dem wurde die Zunge gelöst; was scheinbar tot war und nicht zu atmen vermochte, dem wurde Leben und Odem gegeben. Meine Vermutung hat Fundament und Basis erhalten. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder! Ein Zufall machte uns sehend. Kein Zweifel mehr« – und die Stimme des Sprechers nahm einen seidenglänzenden und sonnigen Ton an – »der Altar zu den Sieben Schmerzen Maria hat seinen Meister gefunden.«
Er zeigte das Messer.
»Hier auf dem Heft ... ganz deutlich ... Bitte, meine Herren, lesen Sie selber! Ganz einwandfrei ... Heinrich Douwermann, Anno Domini 1520.«
Triumphierend sah sich der kleine, lebhafte Herr um. »Jesus, Maria un Joseph ...!« sagte Herr Bollig.
»Allen Respekt,« pflichtete der Kirchenrendant bei. »Fein gegeben, Herr Dechant! Bewundernswert! Ich stimme zu, man kann sich diesen Argumenten nicht mehr verschließen. Man muß eben glauben – glauben – unbedingt glauben. Kein anderer Ausweg mehr möglich – absolut nicht mehr möglich.«
»Und daher,« stellte der geistliche Herr mit apodiktischer Sicherheit fest, »dürfte sich der zweite und letzte Punkt der Tagesordnung von selber erledigen.«
»Wieso das, Hochwürden?«
Herr Anatole von Klotz ließ die stechenden Äugelchen blinken.
»Die Wiederherstellung der Predella, desgleichen die vorgesehene neue Pieta – alles das muß in der Familie Douwermann bleiben.«
»So?!« fragte der Kirchenrendant, und dieses ›so‹ hatte eine Auslage wie der Busen einer schlampigen Köchin.
»Ja, Herr von Klotz. Urkundlich steht fest, daß die hiesige Familie gleichen Namens identisch ist mit der aus dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert. In unserm hochachtbaren Mitbürger Arnt Douwermann sehen wir einen direkten Nachkommen des gefeierten Meisters und in der Tochter Johanna eine Erbin seiner Kunst, die ihresgleichen sucht bis weit in die Niederlande hinein. Wenn auch das geflügelte Wort, der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande, noch immer sein Unwesen treibt, so möchte ich doch meinerseits dieses Unwesen nicht fördern. Alle Gründe sprechen dafür, ihr die Arbeit anzuvertrauen. Ich bitte um Ihre diesbezügliche Ansicht. Herr Türlütt ...?«
Mit einem seinen Lächeln glitt das weißhaarige Männchen über das schwammige Antlitz des fettleibigen Biedermannes, der sich zappelig in den breiten Hüften schaukelte und nicht so recht wußte, was er mit den präzisen Worten des Fragestellers anfangen sollte.
Nachdenklich wiegte er den Antilopenkopf auf den gedrungenen Halswirbeln, von dem Herr Anatole behauptete, selbst ein Meister wie Citoyen Samson hätte seine ganze Kraft aufbieten müssen, ihn dem Besitzer sachlich und regelrecht vor die Füße zu legen.
»Wenn mein Schwager die nämliche Ansicht vertritt,« meinte er schließlich, »so wäre ich beispielsmäßig nicht abgeneigt ... Also ich bitte, Herr Schwager!«
»Hm!« sagte dieser, und zwar mit einem so wichtigen Gesicht und einem so gezwungenen Lippenspiel, als habe er schwer und tiefgründig sein eigenes Ich zu erforschen – alles dazu angetan, das Ansehen seiner Person in die beste Beleuchtung zu setzen. »Ich hörte. Leider neigen die Douwermanns etwas zum Hochmut. Wollen höher hinaus – aus dem bürgerlichen Dunstkreis hinaus. Gott, diese Leutchen! – Unmöglich! – Im übrigen gutes Milieu – stramme Gesinnung – sehr stramm – fast