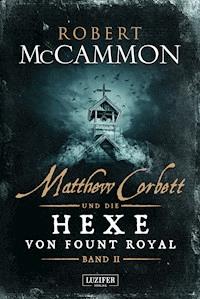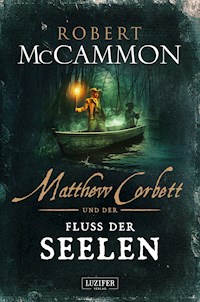Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Matthew Corbett
- Sprache: Deutsch
Sandra Brown hat sein episches Meisterwerk "Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal" über die Hexenjagd in einer amerikanischen Koloniestadt begeistert als "zutiefst überzeugend … mit unvergleichlicher Kenntnis der menschlichen Seele erzählt" charakterisiert. Nun bringt Robert McCammon seinen Helden Matthew Corbett ins New York des frühen achtzehnten Jahrhunderts: Ein Mörder übt über die geschäftige Stadt, die ihre unverwechselbare Identität noch entwickelt, eine blutige und entsetzliche Macht aus – und auch über Matthews eigene unsichere Zukunft. Inhalt: Der ungelöste Mordfall an einem angesehenen Arzt versetzt die Bewohner der noch jungen Stadt New York in Angst und Schrecken. Wer hat das Leben des respektablen Mannes mit einem Messerschnitt auf mitternächtlicher Straße ausgelöscht? Der Herausgeber von New Yorks erster und einziger Zeitung tauft das Monster "Den Maskenschnitzer" und gießt damit nur noch mehr Öl auf die Flammen des ungelösten Rätsels. Als der Maskenschnitzer ein neues Opfer fordert, wird der junge Gerichtsdiener Matthew Corbett in einen Irrgarten aus forensischen Anhaltspunkten und gefährlichen Nachforschungen gelockt, die sowohl sein Talent für Ermittlungen als auch seinen Gerechtigkeitssinn wecken. Am seltsamsten ist aber, dass die Informationen zur Enttarnung des Maskenschnitzers womöglich in einem Tollhaus zu finden sind, in dem die "Königin der Verdammten" regiert – und nur jemand mit Matthews Verstand und Einfühlsamkeit hat eine Chance, ihre Geheimnisse aufzudecken. Matthews Ehrgeiz führt ihn vom Hafen bis zur Wall Street, von vornehmen Herrenhäusern bis zu den mit Blut beschmierten Rinnsteinen … und zu Antworten, vor denen niemand entkommen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Matthew Corbett und die Königin der Verdammten
– Band 1 –
Robert McCammon
übersetzt von Nicole Lischewski
Copyright © 2003 by Robert McCammon Published by Arrangement with THE MCCAMMON CORPORATION
This Work was negotiated through Literary Agency Thomas Schlück GmbH, 30827 Garben Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE QUEEN OF BEDLAM Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Nicole Lischewski
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-327-5
Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte
unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Für meine Tochter Skye
EINS
EINS
Es heißt, dass es besser sei, eine Kerze anzuzünden als die Dunkelheit zu verfluchen. Im Sommer 1702 war man in der Stadt New York allerdings geneigt, beides zu tun – denn die Kerzen waren klein und die Dunkelheit war groß. Wohl wahr; es gab die städtischen Wachtmeister und Schutzmänner. Zwischen der Dock Street und dem Broad Way jedoch verloren diese Helden der Nacht ihren Mut nur allzu oft an eine Flasche John Barleycorn und all die anderen Verlockungen, die die Abendbrise so schamlos mit sich brachte, seien es vergnügte Töne aus den Hafenpinten oder der betörende Parfümgeruch aus Polly Blossoms rosafarbenem Haus.
Das Nachtleben war, um es mit einem einzigen Wort zu beschreiben, lebhaft. Obwohl die Stadt bereits vor Sonnenaufgang zum fleißigen Arbeitslärm der Kaufleute und Bauern erwachte, gab es viele, die ihre Stunden des Schlafs lieber Zerstreuungen wie dem Saufen und Spielen widmeten, sowie auch dem Schindluder, das diese lästigen Zwillingssünden oft mit sich zogen. Jeden Morgen ging mit Sicherheit die Sonne auf – aber der Abend blieb eine einzige Versuchung. Warum sonst sollte diese draufgängerische und gierige, von Niederländern aufgebaute und jetzt den Engländern übernommene Stadt mehr als ein Dutzend Schänken ihr eigen nennen, wenn nicht aus Freude an ausschweifender, fröhlicher Runde?
Der junge Mann, der im Hinterzimmer des Old Admiral allein an einem Tisch saß, suchte jedoch nicht Gesellschaft – weder die von Menschen noch die von Bierhefe. Er hatte zwar einen Humpen dunkles Starkbier vor sich stehen, an dem er ab und zu nippte, aber das war lediglich ein Requisit, um sich der Szene anzupassen. Einem Beobachter wäre aufgefallen, wie er beim Trinken das Gesicht verzog, denn um den Schiffsreiniger des Old Admiral herunterzuwürgen zu können, musste man ein geübter Trinker sein. Es handelte sich hier nicht um sein übliches Lokal. Im Trot Then Gallop, oben in der Crown Street, kannte man ihn gut. Hier jedoch war er nur einen Steinwurf vom Great Dock am East River entfernt, wo die Segelschiffe auf den nächtlichen Strömungen und im Tidenhub flüsterten und seufzten und die Fackeln der Fischerboote rot in der Nebenströmung flackerten. Im Old Admiral trieb der blaue Rauch der Tonpfeifen durchs Lampenlicht, während die Männer nach mehr Bier oder Wein brüllten und das Klackern der Würfel auf den Tischen widerhallte wie Pistolenschüsse vieler kleiner Kriege. Das Geräusch erinnerte Matthew Corbett stets an den Schuss, der das Gehirn von … nun, das war vor drei Jahren gewesen, und es war besser, sich dieses längst verblichene Bild nicht wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Er war erst dreiundzwanzig Jahre alt, aber irgendetwas an ihm wirkte wesentlich älter. Vielleicht war es sein bedachter Ernst, sein nüchternes Auftreten oder auch die Tatsache, dass er bevorstehenden Regen anhand der Schmerzen in seinen Knochen ebenso gut vorhersagen konnte wie ein zahnlos über seinen Brei grummelnder Greis. Um ganz genau zu sein: Er wusste es dank der schmerzenden Rippen unter seinem Herz sowie seiner linken Schulter; Knochenbrüche, die ihm ein als Jack One Eye verrufener Bär zugefügt hatte. Dem Bären hatte Matthew auch die sichelförmige Narbe zu verdanken, die gleich über seiner rechten Augenbraue begann und sich zum Haaransatz nach oben bog. In der Carolina-Kolonie hatte ihm einst ein Arzt gesagt, dass der Damenwelt ein Mann mit einer kühnen Narbe gefiele. Diese Narbe schien die Damen jedoch zu warnen, dass er Schnitter Tod nur knapp von der Klinge gesprungen war; vielleicht haftete seiner Seele immer noch die Kälte der Gruft an. Fast ein ganzes Jahr lang war sein linker Arm nach dem Zwischenfall gefühllos geblieben. Er hatte damit gerechnet, für den Rest seines Lebens einarmig zurechtkommen zu müssen, bis ihm hier in New York ein guter, wenn auch recht unkonventioneller Arzt Armübungen verschrieben hatte – eine masochistische Folter mit einer Eisenstange, an deren Enden Hufeisen angekettet waren –, die er neben heißen Umschlägen und Dehnübungen täglich durchführen sollte. Eines Morgens geschah schließlich das Wunder, dass er seine Schulter wieder ganz drehen konnte – und die weitere Behandlung ließ seine alte Kraft fast unvermindert zurückkehren. Damit endeten die Auswirkungen einer von Jack One Eyes letzten Taten auf dieser Erde, auch wenn der inzwischen tote Bär wohl kaum in Vergessenheit geraten würde.
Matthews kühlgraue Augen, die wie Rauch zur Dämmerstunde mit Dunkelblau gesprenkelt waren, hatten sich auf einen Tisch an der anderen Seite des Raums gerichtet. Er achtete allerdings darauf, nicht zu auffällig hinüber zu starren, sondern seinen Blick nur wandern, sich kurz darauf heften und dann zurück auf sein Bier gleiten zu lassen. Er bewegte seine Schultern, ließ den Blick erneut schweifen und sich auf den anderen Tisch richten. Die Vorsichtsmaßnahmen waren im Grunde egal. Das Objekt seines Interesses hätte blind und dumm sein müssen, um seine Anwesenheit nicht zu bemerken, und das wahre Böse ist nicht so. Nein, das wahre Böse sprach ungerührt weiter, grinste und schlürfte mit gespitzten Lippen ein schmieriges Glas Wein, stieß aus einer schwarzen Tonpfeife einen Rauchring aus und redete und grinste weiter, während das Spiel unter den Ausrufen und dem Würfelklackern schattenhafter Gestalten weiterging, die brüllten, als wollten sie die Morgendämmerung verjagen.
Matthew wusste jedoch, dass sich das wilde Gelage nicht nur auf Humor, einem Besäufnis und dem Spielergehabe in dieser Pinte begründete, der sich das Meer gegen die Brust und die Wildnis gegen den Rücken presste. Es lag an dem, von dem niemand sprach. Dem Vorfall. Dem unglücklichen Ereignis.
Der Maskenschnitzer war der Grund.
Trinkt nur Wein aus neuen Fässern und blast euren Tabakrauch zum Mond hinauf, dachte Matthew. Heult wie die Wölfe und grinst wie Diebe. Heute Nacht müssen wir alle auf einer finsteren Straße nach Hause gehen.
Und jeder dieser Männer konnte der Maskenschnitzer sein, überlegte er. Der Maskenschnitzer konnte auch bereits wieder auf dem Weg, auf dem er gekommen war, verschwunden sein, um hier nie wieder gesehen zu werden. Wer wusste das schon? Ganz sicher nicht diese Idioten, die sich heutzutage Wachtmeister nannten und denen der Stadtrat die Autorität verliehen hatte, die Straßen zu patrouillieren. Ihm kam der Gedanke, dass die vermutlich auch irgendwo drinnen saßen, obwohl es warm war und der Mond zur Hälfte schien – dumm waren sie zwar, aber nicht leichtsinnig.
Matthew nahm einen Schluck von seinem Bier und ließ seinen Blick wieder zu dem Tisch an der anderen Wand wandern. Pfeifenrauch hing in blauen Schleiern, verschob sich mit dem von einer Bewegung oder einem Ausatmen verursachten Luftzug. Drei Männer saßen an dem Tisch. Ein älterer, fett und aufgebläht, und zwei junge, die wie Raufbolde aussahen. Da Raufbolde sich hier nur so tummelten, war das an sich nicht weiter bemerkenswert. Matthew hatte den fetten Blähbalg noch nie zuvor in Begleitung einer der beiden jüngeren Männer gesehen. Sie trugen beide einfache Kleidung, alte Lederwesten über einem weißen Hemd, und die Bundhosen des einen waren an den Knien mit Leder geflickt. Wer waren diese Männer?, fragte er sich. Und was hatten sie mit Eben Ausley zu schaffen?
Nur sehr vereinzelt und bloß für einen kurzen Moment fing Matthew das Glitzern von Ausleys auf ihn gerichteten schwarzen Augen auf, aber genauso schnell drehte der Mann seinen mit einer weißen Perücke bedeckten Kopf zur Seite und unterhielt sich weiter mit den beiden jungen Männern.
Kein Betrachter würde darauf kommen, dass sich der jugendliche Corbett mit seinem hageren, langen Gesicht, seinem unordentlichen, feinen schwarzen Schopf und seiner kerzenbeleuchteten, blassen Haut auf einem Kreuzzug befand, der sich langsam, eine Nacht nach der anderen, in Besessenheit verwandelt hatte. Mit seinen braunen Stiefeln, grauen Kniebundhosen und dem einfachen weißen Hemd, das am Kragen und den Handgelenken ausgefranst, aber blütenrein gewaschen war, schien er nicht mehr herzumachen, als sein Beruf als Gerichtsdiener verlangte. Richter Powers würde von diesen nächtlichen Unternehmungen nicht angetan sein, aber Matthew fand sich dazu gezwungen. Denn sein größter Herzenswunsch war es, Eben Ausley am Galgen der Stadt baumeln zu sehen.
Jetzt legte Ausley seine Pfeife hin und zog die Lampe auf dem Tisch näher an sich heran. Sein Begleiter zur Linken – ein dunkelhaariger Mann mit tief liegenden Augen, der vielleicht neun oder zehn Jahre älter als Matthew sein mochte – sprach leise und ernst. Ausley, ein Hängebackenschwein Mitte fünfzig, hörte konzentriert zu. Schließlich sah Matthew, wie er nickte und in den Gehrock seines vulgären weinlilafarbenen Anzugs fasste. Die Rüschen seines Hemds erzitterten unter dem Druck des Bauchs. Ausleys weiße Perücke war mit aufwendigen Löckchen verziert, die vielleicht zurzeit in London modern waren, hier in New York aber nur wie die Kopfgarnierung eines Gecken wirkten. Ausley förderte aus seinem Rock einen mit Bindfaden umwickelten Bleistift und ein handgroßes schwarzes Notizbuch zutage, das Matthew ihn schon unzählige Male hatte herausziehen sehen. Der Einband war mit Schnörkeln aus Goldblatt versehen. Matthew war bereits der Gedanke gekommen, dass Ausley eine Notizensucht hatte, die seiner Sucht nach Spielen wie Ombre und Ticktack, an die sowohl sein Verstand als auch seine Brieftasche gefesselt zu sein schienen, in nichts nachstand. Mit einem schwachen Lächeln stellte Matthew sich vor, was für Notizen auf jene Seiten gekritzelt wurden: Heute Morgen gut geschissen … bin ein bisschen was losgeworden … oh je, heute einen Nugget verloren … Ausley leckte den Bleistift an und begann zu schreiben. Es schien Matthew, als schrieb er drei oder vier Zeilen. Dann wurde das Notizbuch geschlossen und weggesteckt, und danach auch der Stift. Ausley sagte wieder etwas zu dem dunkelhaarigen jungen Mann, während der andere – gedrungen und mit sandfarbenem Haar, langsam wie ein Ochse mit schweren Augenlidern blinzelnd – einer lauten Partie Bone-Ace in der Ecke zuschaute. Ausley grinste, und das gelbe Lampenlicht sprang ihm förmlich von den Zähnen. Eine Horde Säufer stolperte zwischen Matthew und dem Objekt seines Interesses hindurch. Schnell standen Ausley und die beiden Männer auf und griffen nach ihren Hüten an den Wandhaken. Ausleys Dreispitz war mit einer rotgefärbten Feder verziert. Der dunkelhaarige Mann mit den Lederflicken an der Hose dagegen trug einen breitrandigen Lederhut und der dritte im Bunde eine gewöhnliche Kappe mit kurzem Schirm. Langsam begab sich das Dreiergespann zum Wirt an die Bar, um zu bezahlen.
Matthew wartete. Als die Münzen im Einnahmekasten verschwunden waren und die Männer auf die Dock Street hinausgingen, setzte Matthew sich seine braune Leinenkappe auf und erhob sich. Ihm war etwas schwindelig. Das starke Bier, die Rauchschwaden und der raue Lärm hatten ihm die Sinne betäubt. Schnell bezahlte er und trat in die Nacht hinaus.
Ach, welch Erleichterung! Die laue Brise, die ihm ins Gesicht wehte, fühlte sich im Vergleich zur aufgeheizten Enge einer vollen Schänke geradezu kühl an. Diesen Effekt hatte das Old Admiral immer auf ihn. Da er Ausley hierhin schon oft gefolgt war, sollte er dagegen eigentlich immun sein – aber seine Vorstellung von einem schönen Abend war ein nettes Glas Wein im Gallop und eine Partie Schach mit den Stammgästen. Er konnte im Wind den Mief von Teereimern und toten Hafenfischen riechen. Der gleiche Windhauch brachte jedoch noch einen ganz anderen Geruch mit sich, den Matthew erwartet hatte: Eben Ausley benutzte ein durchdringendes Rasierwasser, das nach Nelken stank. Er schien fast darin zu baden. Der Mann hätte ebenso gut eine Fackel tragen können, die seine Schritte verriet; es machte es auf jeden Fall leichter, Ausley nachts zu verfolgen. An diesem Abend schien es allerdings, als hätten es Ausley und seine Kumpane nicht eilig, denn sie schlenderten langsam vor Matthew her. Als sie unter dem Lichtkegel einer Laterne entlangkamen, die an der Kreuzung der Dock Street und Broad Street von einem Holzpfosten hing, sah Matthew, dass sie gen Westen auf die Bridge Street zuhielten.
Nun, das ist doch einmal etwas Neues, dachte er.
Normalerweise ging Ausley auf direktem Wege Richtung Norden sechs Straßenblöcke weit zum Waisenhaus in der King Street. Matthew beschloss, lieber etwas mehr Abstand zu wahren. Es ist besser, einfach unauffällig weiterzugehen und aufzupassen.
Matthew folgte ihnen über das Kopfsteinpflaster auf die andere Straßenseite. Er war groß und dünn, aber nicht schwächlich, und musste seine von Natur aus langen Schritte zügeln, um nicht zu den Verfolgten aufzuschließen. Die Gerüche vom Great Dock verloren sich und wurden durch das kräftige Aroma von Heu und Vieh ersetzt. In diesem Teil der Stadt gab es mehrere Ställe und eingezäunte Flächen für Schweine und Kühe. In den Lagerhallen stapelten sich Kisten und Fässer voller Schifffahrtsutensilien, sowie Tierfutter. Ab und zu erhaschte Matthew durch die Fenster einen Blick auf Kerzenlicht, wo sich jemand durch einen der Ställe oder Kontore bewegte. Man sollte den Bewohnern von New York nicht nachsagen, dass sich alle nachts vergnügten oder schliefen, denn wenn die körperlichen Kräfte es zugelassen hätten, wäre so manch einer rund um die Uhr am Arbeiten gewesen.
Der Hufschlag eines Pferdes, dessen Reiter hochpolierte Stiefel trug, klapperte vorbei. Matthew sah, dass Ausley und die beiden anderen an der nächsten Ecke in der Nähe des Governor's House rechts vom Broad Way abbogen. Vorsichtigen Schrittes bog auch er ab. Die Verfolgten befanden sich einen Straßenblock vor ihm und schlenderten noch immer langsam dahin. Matthew bemerkte, dass hinter den Mauern von Fort William Henry im ersten Stock des aus weißen Ziegeln gebauten Gouverneurhauses in mehreren Fenstern Kerzen brannten. Der neue Gouverneur, Lord Cornbury, war gerade erst vor ein paar Tagen aus England eingetroffen. Matthew hatte ihn noch nicht zu Gesicht bekommen, und auch niemand, den er kannte, aber überall hingen Aushänge, die für den morgigen Nachmittag eine öffentliche Versammlung im Rathaus ankündigten. Er erwartete daher, den Gentleman, dem Queen Anne die Zügel überreicht hatte, bald in Augenschein nehmen zu können. Es würde angenehm sein, wenn jemand wieder das Sagen hatte – denn die Wachtmeister waren wie ein heilloses Durcheinander und der Bürgermeister Thomas Hood war im Juni gestorben.
Matthew sah, dass der rotgefiederte Geck und seine Kumpane auf ein anderes Wirtshaus zuhielten, das Thorn Bush. Diese widerwärtige kleine Pinte war eine noch verruchtere Spielerhölle als der Admiral. Im November hatte Matthew beobachtet, wie Ausley beim Bankafalet-Spiel anscheinend ein halbes Vermögen verloren hatte. Nach noch mehr Herumsitzen in Wirtshäusern war Matthew an diesem Abend allerdings nicht zumute. Sollten sie doch gehen und sich besaufen, bis sie blau anliefen. Es war Zeit, nach Hause und ins Bett zu gehen.
Ausley und die beiden Männer gingen jedoch am Thorn Bush vorbei, ohne auch nur einen Blick hineinzuwerfen. Als Matthew die Schänke fast erreicht hatte, wankte ein betrunkener junger Mann – im gelben Lampenlicht erkannte Matthew, dass es sich um Andrew Kippering handelte – mit einem dunkelhaarigen, stark geschminkten Mädchen auf die Straße hinaus und lachte mit ihr über irgendeinen gemeinsamen Witz. Sie streiften Matthew beim Vorbeigehen und hielten Kurs auf den Hafen. Kippering war ein recht bekannter Anwalt und wirkte meist sehr zugeknöpft, aber es war kein Geheimnis, dass er auch gern trank und in Madam Blossoms Etablissement verkehrte.
Ausley bog mit den beiden Männern nach rechts auf die Beaver Street ab und überquerte die Broad Street in östlicher Richtung auf den Fluss zu. An den Straßenecken brannten hie und da Laternen, die von Pfosten hingen, und jedes siebte Haus war gesetzlich verpflichtet, eine Lampe anzuhaben. Hinter einem weißen Holzzaun bellte wütend ein Hund, und wie ein Echo erklang in der Ferne ein Antwortbellen. Ein Mann mit Spazierstock, dessen Dreispitz mit einer Goldborte verziert war, drehte urplötzlich vor Matthew zur Seite hin ab und erschreckte ihn fast zu Tode. Doch der Mann schritt nur mit einem kurzen Nicken davon, vom Tapp-Tapp seines Stocks auf dem Ziegelweg begleitet.
Matthew ging schneller, um Ausley nicht aus den Augen zu verlieren; vorsichtig achtete er trotzdem darauf, so zu treten, dass seine Stiefel nicht mit dem Dung beschmiert wurden, der oft sowohl auf dem Ziegelweg als auch auf dem Kopfsteinpflaster lag. Ein Pferdekarren, über dessen Zügel eine einsame Gestalt gekauert war, rollte an ihm vorbei. Matthew befand sich in einer engen, von weißen Steinmauern eingefassten Straße. Rechts vor ihm, vom Lichtschein einer fast erloschenen Straßenlaterne gerade noch beleuchtet, bog Ausley mit seinen Begleitern in die Sloat Lane ab. Zu Anfang des Sommers war hier ein Feuer ausgebrochen, das mehrere Häuser verschlungen hatte. Der Geruch von Asche und Verbranntem hing noch immer in der Luft, vermischt mit verwelkten Nelken und dem Gestank eines Schweins, das dringend geröstet werden musste. Matthew blieb stehen und spähte argwöhnisch um die Ecke. Die Männer waren zwischen finsteren Holzhäusern und behäbigen kleinen Gebäuden aus Ziegelsteinen verschwunden, darunter auch mehrere ausgebrannte Ruinen. Die Laterne am Eckpfosten flackerte, war kurz davor zu verlöschen. Matthews Nackenhaare stellten sich auf. Er schaute nach hinten. Ein Stück hinter ihm stand eine dunkel gekleidete Gestalt, vom Lichtschein der Ecklaterne beschienen, an der er gerade erst vorbeigekommen war. Er wohnte nicht in dieser Gegend, und mit einem Mal wurde ihm bewusst, wie er weit von zu Hause entfernt war.
Die Gestalt stand einfach da und schien ihn anzustarren, wobei Matthew nicht in der Lage war, unter dem Dreispitz ein Gesicht auszumachen. Matthews Herz begann gegen seine Rippen zu trommeln. Wenn das der Maskenschnitzer war, dachte er, dann wollte er verdammt sein, wenn er sein Leben ohne einen Kampf aufgab. Was für eine gute Idee, mein Junge, fuhr ihm mit schwarzem Humor durch den Kopf. Fäuste gewannen schließlich immer gegen ein Messer an der Kehle.
Matthew wollte der Gestalt gerade etwas zurufen – nur was?, fragte er sich. Eine herrliche Nacht für einen kleinen Spaziergang, nicht wahr, Sir? Ach ja, und wenn Ihr bitte mein Leben verschonen könntet? –, doch der mysteriöse Mann drehte sich um und verschwand mit zielsicheren Schritten aus dem Lichtkreis der Laterne. Matthew pfiff der angehaltene Atem aus der Lunge. An seinen Schläfen spürte er kalten Schweiß. Das war nicht der Maskenschnitzer!, hielt er sich etwas gereizt vor. Natürlich nicht! Vielleicht war es ein Wachtmeister gewesen oder einfach jemand wie er selbst, der zu Fuß unterwegs war! Bloß war er nicht einfach zu Fuß unterwegs, dachte er. Er war wie ein Schaf, das einen Wolf verfolgte.
Ausley und seine Wirtshauskumpane waren fort: Nirgendwo war noch etwas von ihnen zu sehen. Die Frage war, ob Matthew diese nach Asche stinkenden Gasse weiter hinuntergehen oder dahin umkehren sollte, wo der Maskenschnitzer wartete? Hör schon auf damit, du Idiot!, befahl er sich. Es war nicht der Maskenschnitzer, denn der Maskenschnitzer hatte New York verlassen! Warum sollte sich der Maskenschnitzer noch in diesen Straßen herumtreiben? Weil sie ihn noch nicht gefasst hatten, dachte Matthew grimmig. Darum.
Er beschloss weiterzugehen, aber aufzupassen, dass sich hinter ihm nicht ein Stück Dunkelheit vom Rest der Nacht löste und auf ihn stürzte. Und er war nur um die zehn Schritte weit gegangen, als sich ein Stück Dunkelheit nicht hinter, sondern direkt vor ihm bewegte.
Wie angewurzelt blieb er stehen und bewegte sich nicht. Er war nur noch eine Hülle seiner selbst, so als seien sein Blut und Atem in einer Sommernacht verschwunden, die plötzlich zu Winter geworden war.
Ein Funke sprang und entzündete in einer kleinen Schachtel ein Stück Baumwolle, an dem ein Streichholz angesteckt wurde.
»Corbett«, sprach der Mann, während er die Flamme an den Pfeifenkopf führte. »Wenn Ihr so erpicht darauf seid, mir zu folgen, sollte ich Euch eine Audienz gewähren. Meint Ihr nicht?«
Matthew antwortete nicht. Seine Zunge war noch immer wie versteinert.
Eben Ausley nahm sich die Zeit, seine Pfeife anzustecken, bis sie richtig brannte. Hinter ihm befand sich eine vom Feuer geschwärzte Ziegelsteinmauer. Sein korpulentes Gesicht war brodelnd rot. »Was für ein Wunder Ihr doch seid, mein Junge«, sagte er mit seiner hohen, krakeelenden Stimme. »Den lieben langen Tag plagt Ihr Euch über Papieren und Tintenfässern ab, und nachts lauft Ihr hinter mir her durch die Stadt. Wann schlaft Ihr denn?«
»Ich komme schon zurecht«, erwiderte Matthew.
»Ich glaube, dass Ihr mehr schlafen solltet. Ich glaube, dass Ihr Euch einmal richtig erholen müsst. Findet Ihr nicht auch, Mr. Carver?«
Matthew hörte die Bewegung hinter sich zu spät. Zu spät merkte er, dass die beiden anderen Männer sich in den verbrannten Ruinen versteckt hatten, die zu beiden Seiten …
Ein Brett traf ihn am Hinterkopf und beendete seine Spekulationen. Die Wachtmeister mussten sicher denken, dass eine Kanone abgefeuert worden war, denn es war so laut – aber dann riss ihn die Gewalt des Schlags von den Beinen. Brüllender Schmerz überwältigte ihn und es gab nur noch Sterne und Feuerräder. Auf den Knien hockend nahm er alle Willenskraft zusammen, nicht auf die Straße umzufallen. Er biss die Zähne zusammen. Seine Sinne waren getrübt, sodass er nur wie durch Nebel erkannte, wie Ausley ihn auf fröhlicher Fährte in diese Schafsfalle gelockt hatte.
»Ach, ich denke, das reicht«, sagte Ausley. »Wir wollen ihn nicht umbringen, oder? Wie fühlt sich das an, Corbett? Hat Euch das schön den Kopf geklärt?«
Matthew hörte die Stimme wie ein aus weiter Ferne hallendes Echo. Wenn es doch nur so wäre. Irgendetwas Hartes drückte sich gegen seinen Rücken. Ein Stiefel, wurde ihm klar. Der ihn gleich zu Boden treten würde.
»Ist schon gut so, wie er da so sitzt«, sagte Ausley gleichgültig. Der Stiefel entfernte sich von Matthews Rücken. »Ich bezweifle, dass er noch irgendwo hingehen wird. Ihr nicht auch, Corbett?« Er wartete nicht auf eine Antwort, die sowieso nicht gekommen wäre. »Wisst Ihr, wer dieser junge Mann ist, meine Freunde? Wisst Ihr, dass er mich hin und her, vor und zurück verfolgt, und das schon seit … wie lange jetzt, Corbett? Zwei Jahre?«
Zwei Jahre lang ganz planlos, dachte Matthew. Nur die letzten sechs Monate etwas zielgerichteter.
»Dieser junge Mann war einer meiner Lieblingsschüler«, fuhr Ausley mit einem frechen Grinsen fort. »Jawohl, einer meiner Knaben. Ist da im Waisenhaus großgeworden. Ich hab ihn zwar nicht von der Straße geholt – das war mein Vorgänger Staunton gewesen. Der dumme Alte hat ihn für ein lohnenswertes Projekt gehalten: aus einem elenden Straßenjungen einen gebildeten Gentleman zu machen; also bitte. Bücher hat er ihm zu lesen gegeben und ihm … was hat er Euch beigebracht, Corbett? Wie man zu einem verdammten Esel wird, wie er es war?« Heiter fuhr er mit seiner Version der Dinge fort. »Dieser junge Mann ist seit seiner Kindheit weit gekommen. Oh ja. Der Richter Isaac Woodward hat ihn als Gerichtsdiener in Stellung genommen und ist mit ihm in die weite Welt hinausgefahren. Hat ihm die Möglichkeit geschenkt, wie ein Gentleman leben zu lernen und ein Mensch zu werden, der einen Wert hat.« Eine Pause entstand, als Ausley seine Pfeife erneut ansteckte.
»Und dann, meine Freunde«, sagte Ausley und puffte an der Pfeife, »und dann hat er seinen Mentor verraten, indem er sich mit einer Frau zusammengetan hat, die in einem winzigen Kaff unten in der Carolina-Kolonie der Hexerei angeklagt war. Eine Mörderin, soviel ich weiß. Eine Ränke schmiedende Hure, die dem jungen Mann was vorgemacht hat und am Tod unseres edlen Richter Woodward Schuld ist, möge Gott seiner Seele gnädig sein.«
»Lügen«, brachte Matthew heraus. Es war nur ein Flüstern. Er versuchte es erneut: »Das ist … gelogen.«
»Hat er gesprochen? Hat er etwas gesagt?«, fragte Ausley.
»Er hat was gemurmelt«, sagte der Mann, der hinter Matthew stand.
»Soll er doch murmeln«, meinte Ausley. »Im Waisenhaus hat er auch viel gemurmelt und gegrummelt. Nicht wahr, Corbett? Wenn ich meinen Mentor umgebracht hätte, indem ich ihn zuerst einem alles durchweichenden Unwetter ausgesetzt und danach durch Verrat sein Herz gebrochen hätte, würde aus mir wohl ebenso ein murmelnder Tropf werden. Sagt mir doch, wie schafft Richter Powers es, Euch so weit zu vertrauen, dass er Euch den Rücken zudrehen kann? Oder habt Ihr von Eurer Freundin ein paar Zaubersprüche gelernt?«
»Wenn der hexen kann«, sagte eine andere Stimme, »hat ihm das heute Nacht aber nichts gebracht.«
»Nein«, gab Ausley zurück. »Er kann nicht hexen. Wenn er es könnte, würde er sich zumindest in einen unsichtbaren Widerling verwandeln, statt ein Widerling zu sein, den ich beim Rausgehen jedes Mal anschauen muss. Corbett!«
Dem Befehl, ihm seine gesamte Aufmerksamkeit zu schenken, konnte Matthew nur nachkommen, indem er seine pochende Hirnschale auf ihrem welken Strunk hob. Matthew musste bei dem Versuch blinzeln, Ausleys widerwärtige Visage nicht vor seinen Augen verschwimmen zu lassen.
Der Leiter des King Street Waisenhauses für Knaben mit der feschen Hahnenfeder und dem dicken Bauch sagte mit leiser Verachtung: »Ich weiß, was du willst. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Als du hierher zurückgekommen bist, wusste ich, dass es nun losgeht. Und ich hab dich gewarnt, nicht wahr? An deinem letzten Abend im Waisenhaus? Hast du das vergessen? Antworte mir!«
»Ich habe es nicht vergessen«, sagte Matthew.
»Plane niemals einen Krieg, den du nicht gewinnen kannst. Stimmt's?«
Matthew antwortete ihm nicht. Er verspannte sich in der Erwartung, wieder den Fuß im Rücken zu spüren, doch das blieb ihm erspart.
»Dieser Jüngling … Bursche … Idiot«, korrigierte Ausley sich und wandte sich damit seinen zwei Begleitern zu, »ist zu dem Urteil gelangt, dass ihm meine Strafmethoden nicht passen. Diese Knaben haben alle eine so bedauerliche Einstellung. Manche sind wie wilde Tiere, für die selbst eine Scheune noch zu gut wäre – die beißen einem glatt den Arm ab und pinkeln einem ans Bein. Tagein, tagaus werden sie von den Kirchen und den Hospitälern an meiner Tür abgesetzt. Die Familie ist bei der Überfahrt von Europa gestorben, niemand fühlt sich verantwortlich – was soll ich denn mit ihnen machen? Die Familie eines anderen ist von den Indianern massakriert worden, dann gab's einen, der einfach nichts arbeiten wollte, oder einen, der besoffen in der Gosse lag. Was soll ich denn mit denen machen, außer ihnen Disziplin beizubringen? Ja, ich habe mich vieler von ihnen angenommen. Viele musste ich auf strengste Art bestrafen, weil sie sich an nichts hielten, das …«
»Es geht nicht um Strafe«, unterbrach Matthew ihn und legte seine ganze Kraft in seine Stimme. Sein Gesicht hatte sich gerötet und zwischen den geschwollenen Lidern glitzerten seine Augen vor Wut. »Bei Euren Methoden … würden der Kirchenrat und Vorstand von den Hospitälern es sich noch mal überlegen … ob sie Euch noch weiterhin unterstützen wollen. Und auch die Stadt mit ihren Geldern für Euch. Wissen die denn alle, dass Ihr Sodomie für Disziplin haltet?«
Ausley sagte nichts. Die Welt und die Zeit schienen in dem sich ausbreitenden Schweigen zum Stillstand zu kommen.
»Ich habe sie spät nachts schreien gehört«, fuhr Matthew fort. »In vielen Nächten habe ich sie gesehen – hinterher. Manche … wollten nicht mehr leben. Keiner von ihnen war noch so wie vorher. Und Ihr habt Euch immer nur die Jüngsten herausgepickt. Die, die sich nicht wehren konnten.« Seine Augen brannten. Selbst nach acht Jahren betäubten ihn diese Gefühle noch. Er atmete tief durch, und dann entfuhren ihm die nächsten Worte: »Für all diese Jungen kämpfe ich, du räudiger Hund!«
Ausleys Lachen hallte durch die Dunkelheit. »Oho! Oho, meine Freunde! Sehet nur den Racheengel! Auf der Erde und um Atem ringend!« Er trat ein paar Schritte näher an Matthew heran. Als er an seiner Pfeife sog, sah Matthew im roten Schein der Tabakglut eine Grimasse auf Ausleys Gesicht, die selbst den Engel Michael erschreckt hätte. »Du machst mich krank, Corbett! Mit deiner Dummheit und deiner widersinnigen Ehre. Mit deinem ständigen Hinterherrennen, mir vor die Füße laufen und mich ins Stolpern bringen. Das machst du nämlich, nicht wahr? Versuchst was herauszufinden? Mir hinterherzuspionieren? Mir verrät das etwas sehr Wichtiges: Du hast nichts in der Hand. Wenn du außer deinen aberwitzigen Mutmaßungen und erfundenen Erinnerungen etwas hättest – irgendetwas –, würdest du mir nämlich zuerst deinen heiß geliebten, inzwischen verstorbenen Richter Woodward oder jetzt deinen neuen Herrn Powers auf den Hals gehetzt haben. Habe ich nicht recht?« Plötzlich veränderte sich sein Ton und er hörte sich an wie ein altes, verärgertes Weib: »Da siehst du, in was ich wegen dir getreten bin!«
Nach einer gedankenvollen Pause fuhr er fort: »Mr. Bromfield, schleift doch bitte Mr. Corbett hier herüber.«
Eine Hand packte Matthew am Kragen und eine zweite fasste sein Hemd unten am Rücken. Schnell und zielstrebig wurde er von einem Mann gezogen, der wusste, wie man mit einem bewegungslosen Körper verfährt. Matthew spannte die Muskeln an und versuchte, sich zusammenzukrümmen, aber eine Faust – Carvers, nahm er an – stieß ihn fest genug in die Rippen, um ihm mitzuteilen, dass Stolz zu Knochenbrüchen führen würde.
»Du hast so schmutzige Gedanken«, sagte Ausley, dessen Geruch nach Nelken und Tabakrauch Matthew jetzt erfasste. »Ich finde, wir sollten die etwas schrubben und am besten im Gesicht anfangen. Mr. Bromfield, wenn Ihr ihn bitte für mich saubermachen könntet.«
»Mit Vergnügen«, sagte der Mann, der Matthew gepackt hatte. Mit teuflischer Lust fasste er Matthews Kopf und stieß ihn mit dem Gesicht in die fliegenübersäten Pferdeäpfel, in die Ausley getreten war.
Matthew hatte geahnt, dass dies geschehen würde. Es gab keinen Weg daran vorbei. Es gelang ihm noch, fest den Mund zu schließen und die Augen zuzukneifen, und dann landete sein Gesicht auch schon in dem frischen Haufen. Die analytische Hälfte von Matthews Verstand, die Fakten beurteilte, registrierte, wie unangenehm frisch die Pferdeäpfel waren. Geradezu seidig. Als würde man sein Gesicht in einer Seidentasche vergraben. Warm waren sie auch noch. Das Zeug quoll ihm ihn die Nasenlöcher, aber ihm saß der Atem noch in der Lunge. Er wehrte sich nicht – auch nicht, als er eine Stiefelsohle am Hinterkopf zu spüren bekam, die sein Gesicht durch die widerliche Scheiße fast bis aufs Kopfsteinpflaster darunter drückte. Sie wollten, dass er sich wehrte, damit sie ihn brechen konnten. Und gerade deshalb würde er nicht kämpfen, auch wenn ihm jetzt die Luft ausging und sein Gesicht noch immer vom Stiefel eines Hurensohns in den Dreck gepresst wurde. Er würde nicht kämpfen, damit er eines Tages noch auf den Beinen stehen und einen besseren Kampf austragen konnte.
»Zieht ihn hoch«, sagte Ausley.
Bromfield gehorchte.
»Seht zu, dass er Luft in die Lunge bekommt, Carver«, befahl Ausley.
Eine flache Hand schlug Matthew mitten auf die Brust. Mit einem Sprühregen aus Pferdemist schoss ihm die Luft aus dem Mund und der Nase.
»Scheiße!«, schrie Carver. »Er hat mir das ganze Hemd dreckig gemacht!«
»Na, dann macht doch Platz. Geht schon. Macht genügend Platz, dass er merkt, wie er stinkt.«
Das merkte Matthew. Ihm steckte das Zeug noch immer in der Nase. Wie Sumpfschlick klebte es ihm im Gesicht und roch zum Erbrechen nach saurem Gras, vergorenem Futter und … tja, und nach stinkendem Mist, der frisch aus dem Pferdehintern gefallen war. Er würgte und versuchte sich die Augen sauber zu reiben, aber Bromfield hielt seine Arme fest wie das Fesselseil eines Räubers.
Ausley gab ein flatterhaft kurzes, schrilles Lachen von sich. »Ach, schaut ihn Euch an! Der Racheengel ist zur Vogelscheuche geworden! Mit der Visage kannst du selbst die Aasgeier erschrecken, Corbett!«
Matthew spuckte aus und schüttelte wild den Kopf; leider war ihm etwas des ungenießbaren Mahls in den Mund gelangt.
»Ihr könnt ihn jetzt laufen lassen«, sagte Ausley. Bromfield ließ Matthew los und stieß ihn gleichzeitig so hart nach vorn, dass er wieder zu Boden fiel. Als Matthew sich auf die Knie rappelte und den Mist aus seinen Augen rieb, stellte Ausley sich über ihn und sagte mit leiser, gelangweilter Stimme, in die sich eine Drohung mischte: »Du wirst mir nicht mehr folgen. Verstanden? Halte dich daran, sonst werden wir dich das nächste Mal nicht mit Samthandschuhen anfassen.« Und zu den anderen: »Sollen wir den jungen Mann seinen Grübeleien überlassen?«
Das Geräusch von feuchtem Räuspern wurde laut. Matthew spürte durch sein Hemd, wie ein Klumpen Schleim auf seiner linken Schulter landete: Carver oder Bromfield bewiesen, wie hochwohlgeboren sie waren. Danach hörte er, wie sich Stiefel entfernten. Ausley sagte etwas und einer der anderen lachte. Dann waren sie verschwunden.
Matthew saß auf der Straße und wischte sich das Gesicht mit den Ärmeln sauber. In seinem Bauch gärte und schwappte die Magensäure. Die Wut und sein Schamgefühl brannten so stark, dass ihm war, als würde er unter der unbarmherzigen Mittagssonne vergehen. Sein Kopf brachte ihn fast um, ihm liefen die Augen. Dann krampfte sich sein Magen zusammen, und das Bier aus dem Old Admiral sowie der Großteil des Salmagundi, das er zu Abend gegessen hatte, ergossen sich aus seinem Mund. Er erkannte, dass er an diesem Abend noch einige Zeit an der Waschschüssel zu tun haben würde.
Endlich, es kam ihm wie eine geschlagene, schreckliche Stunde vor, konnte er aufstehen und daran denken, wie er nun nach Hause kam. Bis zu seiner Kammer am Broad Way über Hiram Stokelys Töpferladen waren es gut zwanzig Minuten zu Fuß – vermutlich sehr lange, stinkende zwanzig Minuten. Aber eine andere Wahl gab es nicht. Und so zog er los, wutentbrannt und wankend und stinkend und sich ganz und gar unwohl in seiner Haut fühlend. Er hielt nach einem Pferdetrog Ausschau. Dort wollte er sich waschen und so sein Gesicht und seine Gedanken reinigen.
Und morgen? Würde er so frech sein, sich im Dunkeln wieder vor dem Waisenhaus in der King Street herumzudrücken und darauf zu warten, dass Ausley zu seinem Ausflug durch die Spielhöllen erschien? Und ihm in der Hoffnung auf … was, genau, hinterherspionieren? Oder würde er in seinem kleinen Zimmer bleiben und sich mit der kalten Tatsache anfreunden, dass Ausley recht hatte? Er hatte rein gar nichts gegen ihn in der Hand und würde in diesem Tempo wohl auch kaum etwas erfahren. Aber aufzugeben … aufzugeben … hieße, alle im Stich zu lassen. Hieße, vor dem Grund für seine verzehrende Wut zu kapitulieren, und die Jagd, die ihn seinem Gefühl nach von allen anderen Bürgern der Stadt unterschied, aufzugeben. Durch die hatte er ein Ziel. Wer würde er ohne das sein?
Er würde der Schreiber eines Richters und der Kehrer eines Töpfers sein, dachte er auf seinem Heimweg den ruhigen Broad Way entlang. Er würde nur noch ein junger Mann sein, der die Feder und den Besen schwang, und dessen Verstand sich mit der Vorstellung quälte, dass an Unschuldigen Unrecht begangen wurde. Genau das hatte ihn vor drei Jahren im Städtchen Fount Royal gegen Richter Woodward – seinen Mentor, der ihm fast wie ein Vater gewesen war, wenn man ehrlich sein wollte – rebellieren lassen. Er hatte beweisen wollen, dass Rachel Howarth keine Hexe war. Hatte das den kranken Richter ins Grab getrieben? Vielleicht. Und dies war eine Qual, brennend wie der heiße Schlag einer wiederholt geschwungenen Kuhpeitsche, die Matthew zu jeder sonnen- oder kerzenbeleuchteten Stunde schwer auf der Seele lastete.
An der Trinity-Kirche, wo die Wall Street auf den Broad Way traf, fand er einen Pferdetrog. Das solide niederländische Kopfsteinpflaster endete hier, und die nur aus festgetretener Erde bestehenden englischen Straßen begannen. Als Matthew sich über den Trog beugte und versuchte, sich mit dem schmutzigen Wasser das Gesicht zu waschen, war ihm fast zum Weinen zumute. Aber weinen kostete zu viel Kraft, und davon hatte er keine mehr übrig.
Aber morgen war ein neuer Tag, nicht wahr? Ein neuer Anfang – sagte man nicht so? Wer kann schon sagen, was sich innerhalb eines Tages alles zu verändern vermag? In seinem Innersten gab es allerdings Dinge, die sich niemals ändern würden, dessen war er ganz sicher. Irgendwie musste er Eben Ausley für die brutalen, lüsternen Verbrechen an Unschuldigen zur Rechenschaft ziehen. Es musste ihm einfach gelingen. Er befürchtete, dass ihn seine aussichtslose Jagd sonst verzehren und zu einer widerstandslosen Akzeptanz von etwas verkommen lassen würde, das seiner Ansicht nach niemals akzeptiert werden konnte.
Obwohl er noch immer wie der Albtraum eines jeden Kindes aussah, war er schließlich doch so weit hergerichtet, dass er nach Hause weitergehen konnte. Seine Kappe hatte er noch, das war gut. Er war am Leben – auch das war gut. Und so machte er seinen Rücken gerade und dachte auf seinem Weg durch die mitternächtliche Stadt, dass er Glück gehabt hatte. Er war ein einsamer junger Mann.
Zwei
An diesem strahlenden Morgen wusste keiner von Matthews Frühstücksköchen von seinen Nöten der Nacht. Ohne Rücksicht auf seine Kopfschmerzen und Übelkeit frotzelten sie daher fröhlich darüber, was der Tag wohl bringen mochte. Er behielt seine Verletzungen für sich, während Hiram Stokely und seine Frau Patience in der sonnigen Küche ihres kleinen weißen Hauses hinter der Töpferei werkelten.
Matthews Teller war mit Maisbrot und einer Scheibe Pökelschinken beladen, über den er sich an jedem anderen Tag gefreut hätte. Heute aber ging es ihm zu schlecht, um den Schinken wirklich zu schätzen. Die beiden waren gute und freundliche Menschen, und er hatte Glück gehabt, über der Werkstatt eine Unterkunft zu finden. Im Gegenzug hatte er sich verpflichtet, alles sauber zu halten und beim Töpfern und Brennen zu helfen, soweit seine beschränkten Talente es zuließen. Es gab zwei Söhne – einen Handelsschiffskapitän und einen Buchhalter in London – und Matthew hatte das Gefühl, dass seine Vermieter beim Essen gern Gesellschaft hatten.
Das dritte Mitglied der Stokely-Familie fand an diesem Morgen allerdings irgendetwas sonderbar an Matthew. Er dachte zuerst, dass ihn Cecily, die als Haustier gehaltene Sau, wegen des gepökelten Schinkens gnadenlos mit der Nase bearbeitete. Obwohl sie sich inzwischen an diese Kannibalen gewöhnt haben musste, die sie zu sich geholt hatten, konnte er sich gut vorstellen, dass ihr nicht gefiel, wie er einem ihrer Artgenossen mit Messer und Gabel zusetzte. Nach zwei Jahren des verwöhnt werdens sollte sie jedoch wissen, dass sie nicht für den Teller gedacht war – denn sie war ein kluges Stück Schweinefleisch. Aber da sie an diesem Tag so penetrant schnüffelte und ihn mit der Nase stieß, fragte Matthew sich, ob er sich allen Pferdemist aus den Haaren gewaschen hatte. Gestern Nacht hatte er sich in der Waschschüssel mit Sandelholzseife fast die Haut vom Leibe geschrubbt, aber vielleicht roch Cecilys talentierte Nase noch einen hängengebliebenen Mief.
»Cecily!«, rief Hiram nach einem besonders harten Stoß der rundlichen Schweinedame gegen Matthews rechte Kniescheibe. »Was ist denn heute nur mit dir los?«
»Ich weiß es jedenfalls leider nicht«, war Matthews Antwort, obwohl er annahm, dass Cecily von irgendeinem Aroma, das er trotz sauberer Hose, Hemd und Strümpfe verströmte, ans Herumsuhlen im Schweinestall erinnert wurde.
»Sie ist nervös, das ist, was mit ihr los ist.« Patience, eine große, stämmige Frau, deren graue Haare unter einer blauen Baumwollhaube hochgesteckt waren, sah von der Feuerstelle auf. Mit dem Blasebalg heizte sie das Feuer unter der Brotpfanne an. »Irgendwas macht sie unruhig.«
Hiram, der genauso massiv gebaut war wie seine Frau und der weiße Haare, einen weißen Bart und Augen vom selben hellen Braun wie der Ton hatte, den er so gewissenhaft verarbeitete, schlürfte seinen Tee. Er beobachtete, wie Cecily eine Runde durch die Küche lief und dann unter den Tisch zurückkehrte, um abermals schnaufend gegen Matthews Knie zu stoßen. »So hat sie sich doch ein, zwei Tage vor dem Feuer verhalten, weißt du nicht mehr? Ich glaube ja, dass sie weiß, wenn sich was Schlimmes ereignen wird.«
»Ich wusste nicht, dass sie eine Wahrsagerin ist.« Matthew schob seinen Stuhl ein Stück zurück, damit Cecily mehr Platz bekam. Leider schubste sie ihn weiter mit der Schnauze.
»Na, sie mag Euch.« Kurz zeigte sich ein spöttisches Lächeln auf Hirams Gesicht. »Vielleicht versucht sie Euch was zu sagen.«
Einen Tag zu spät, dachte Matthew.
»Ich weiß noch«, sagte Patience leise und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu, »als Dr. Godwin das letzte Mal hier war. Um seine Teller abzuholen. Kannst du dich erinnern, Hiram?«
»Dr. Godwin?« Hirams Augen verschmälerten sich um einen Millimeter. »Hm«, machte er.
»Was war denn mit Dr. Godwin?«, fragte Matthew. Ihm schien, dass er es vielleicht wissen sollte.
»Es ist nicht weiter wichtig.« Hiram trank wieder einen Schluck und machte sich daran, das letzte Stück Maisbrot auf seinem Teller zu essen.
»Ich denke aber doch«, beharrte Matthew. »Wenn Ihr es schon erwähnt, muss es das doch sein.«
Hiram zuckte die Achseln. »Na ja, es war eben nur … Cecily, sonst nichts.«
»Aha. Und was hat Cecily mit Dr. Godwin zu tun?«
»An dem Tag, als er kam, um seine Teller abzuholen, hat sie sich auch so benommen.«
»An dem Tag?« Matthew wusste genau, was er damit meinte, aber er musste trotzdem fragen: »Ihr meint den Tag, an dem er ermordet wurde?«
»Es tut doch wirklich nichts zur Sache«, sagte Hiram, rutschte aber unruhig auf seinem Stuhl herum. Er hatte gedacht, dass er sich an Matthews unersättlichen Appetit für Fragen und besonders an den durchdringenden Gesichtsausdruck des jungen Mannes gewöhnt hatte, der sich immer zeigte, sobald er auf etwas Interessantes stieß. »Ich bin mir nicht sicher, ob es an genau dem Tag oder einem anderen gewesen ist. Und danke, Patience, dass du das erwähnt hast.«
»Ich habe nur laut gedacht«, sagte sie in fast entschuldigendem Tonfall. »Ich habe damit nichts weiter gemeint.«
»Hörst du damit jetzt auf?« Entnervt erhob sich Matthew, um Cecily zu entkommen. Die Knie seiner Hose trieften von Schweinesabber. »Ich muss mich auf den Weg machen. Vor der Arbeit habe ich noch etwas zu erledigen.«
»Die Maisfladen sind fast fertig«, meinte Patience. »Setzt Euch, der Richter wird …«
»Nein, entschuldigt bitte. Danke für das Frühstück. Ich nehme an, dass ich Euch beide bei Lord Cornburys Ansprache sehen werde?«
»Wir werden da sein.« Auch Hiram erhob sich. »Matthew, das bedeutet doch alles nichts. Es ist nur ein Schwein, das mit Euch spielt.«
»Ich weiß, dass es nichts bedeutet. Ich habe nicht das Gegenteil behauptet. Und ich weise die Idee zurück, dass es irgendeine Verbindung zwischen Dr. Godwin und mir gibt. Ich meine … was das ermordet werden angeht.« Guter Gott, dachte er. Habe ich Fieber? »Dann sehe ich Euch heute Nachmittag«, sagte er und wich Cecily aus, die ihn schnaufend umkreiste. Er ging zur Tür hinaus und marschierte über den mit Naturstein gelegten Pfad zur Straße.
Wie albern!, sagte er sich auf seinem Weg in südliche Richtung. Sich wegen der angeblichen hellseherischen Qualitäten eines Schweins durcheinanderbringen zu lassen – als ob er tatsächlich an so etwas glaubte. Nun, manch einer glaubte Derartiges. Manche behaupteten, dass Tiere einen Wetterwechsel und dergleichen schneller als Menschen spüren konnten, aber einen Mord vorherzusagen … das klang wie Hexerei. Und daran glaubte er auch nicht!
An diesem schönen Morgen wirkte es, als wäre die gesamte Bevölkerung von New York auf den Straßen unterwegs. Sie liefen, hockten, huschten und bellten rund um ihn herum – und das waren nur die Katzen, Ziegen, Hühner und Hunde. Die Stadt wurde immer mehr zum Zoo, da die Hälfte der Menschen die dreimonatige Überfahrt von England nicht überlebte, während ihr Vieh sich am grüneren Gras von Nordamerika labte.
Die Töpferei der Stokelys war eines der abgelegensten Häuser der Stadt. Gleich nördlich der Haustür lag die High Road, die über gewellte Felder und mit dichten grünen Wäldern bekränzte Hügel zur weit entfernten Stadt Boston führte. Goldene Sonnenflecken schimmerten auf dem Wasser des East River und des Hudson, und als Matthew auf seinem Weg den Broad Way entlang auf einer Anhöhe ankam, genoss er die weite Aussicht über New York, über die er sich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit freute.
Über den unzähligen gelbgeschindelten Wohnhäusern, Geschäften und Gebäuden, die sich vor ihm ausbreiteten, hing der Rauch von Feuerstellen und Schmiedefeuern. Auf den Straßen waren die fleißigen Bürger unterwegs, entweder zu Fuß, per Pferdewagen oder mit dem Ochsenkarren. Krämer standen mit ihren Karren an den Straßenecken und boten ihre Körbe, Seile und allerlei andere Waren feil. Auch der Lumpensammler war unterwegs und schaufelte den Mist der Tiere, der sich über Nacht angesammelt hatte, in seinen eimerartigen Karren, um ihn auf dem Bauernmarkt zu verkaufen. Matthew wusste, wo der Mann in der Nähe der Sloat Lane einen wahren Schatz an Pferdeäpfeln finden konnte.
Drei Skiffs trieben unter weißen Segeln vor dem Wind den East River entlang. Ein größeres Segelschiff, das von zwei langen Ruderboten aus dem Hafen gelotst wurde, verließ unter Glockengeläut eine kleine Gruppe Abschiedsnehmer am Great Dock. An den Piers wurden natürlich viele Geschäfte gemacht, und schon vor Sonnenaufgang ging es zu wie in einem Bienenstock – dafür sorgten all die Segelmacher, Ankerschmiede, Kabeljaufischer, Flaschenzughersteller, Takler, Teerbuben, Schiffsbauer, Holzzapfenschnitzer und wer noch alles zur Besetzung eines maritim ausgerichteten Theaterstücks gehörte. Schaute man zu den rechts von den Docks gelegenen Geschäften und Gebäuden, erblickte man das Reich der Packer, Mauteintreiber, Zahlmeister, Schauermänner, Lotsen, Schreiber, Ausrufer und Papierschöpfer, wo die Kontoristen und Einkäufer entschieden, welche Güter die Stadt verließen oder hereinkamen. In der Stadtmitte standen das Zollhaus, das Haus des Bürgermeisters und das neugebaute Rathaus, das errichtet worden war, um die Amtsstuben der Einwohner, die die alltägliche Politik und alles Gewichtige im Leben von New York überblickten, an einem Ort zu vereinen. Hier waren die Bezirksabgeordneten, das Stadtarchiv, die Richter, der vorstehende Wachtmeister und der Staatsanwalt zu finden. Im Grunde, dachte Matthew, hatten sie sich darum zu kümmern, rivalisierende Geschäftsleute davon abzuhalten, einander zu ermorden. Sie waren zwar in der Neuen Welt – aber die alten unzivilisierten Empfindlichkeiten Londons waren mit über den Atlantik gekommen.
Schnellen und bestimmten Schrittes ging Matthew den Hügel hinab auf sein Ziel in der Stadt zu. Seine tägliche Routine und die Sonnenuhr vor Madam Kennedays Bäckerei verrieten ihm, dass er noch eine halbe Stunde Zeit hatte, bis Richter Powers in der Amtsstube erscheinen würde. Diesen Morgen wollte Matthew einem Schmied Feuer unter dem Hintern machen, bevor er seine Feder auf Papier setzte.
Trotz all der Viehpferche, Ställe, Abdeckereien, Lagerhallen und heruntergekommenen Pinten war New York eine hübsche Stadt. Die niederländischen Pioniere hatten der Siedlung durch charakteristisch schmale Fassaden, hohe Giebeldächer und ihrer Liebe für Wetterhähne, verzierte Rauchfänge und einfache, aber präzise angelegte Gärten ihr Siegel aufgedrückt. Alle Gebäude südlich der Wall Street waren unverkennbar holländisch, während die Häuser und Gebäude nördlich dieser Linie in typisch kantiger englischer Bauweise errichtet worden waren. Matthew hatte sich gerade ein paar Abende zuvor im Gallop mit jemandem darüber unterhalten. Eines Tages, so hatte er behauptet, würde man erkennen, dass die Holländer wie Gärtner dachten und sich bemüht hatten, ihre Umgebung mit Gärten und Parks zu verschönern – während es den Engländern nur darum ging, im Namen des Handels ihre Kastenhäuser auf jedes freie Fleckchen zu quetschen. Wollte man sehen, wodurch sich London von Amsterdam unterschieden, musste man nur die Wall Street überqueren. Natürlich hatte er diese Städte nie besucht, aber er besaß eine ganze Büchersammlung und hatte sich schon immer für Reiseberichte interessiert. Und er war mit einer eigenen Meinung gewappnet, die ihn in den abendlichen Diskussionen im Gallop entweder zum Helden oder Dummkopf machte.
Es stimmte schon, überlegte er, als er über die Broad Street auf den Kirchturm der Trinity Church zuging, dass New York zu einer … hm, wie sollte man es sagen … Weltstadt wurde, vielleicht? Dass die Existenz dieser Stadt und ihre mögliche Bedeutung in der Zukunft rund um die Welt bemerkt wurden? Ihm kam es zumindest so vor. An jedem beliebigen Tag konnte man buntgekleidete Besucher aus Indien über das Kopfsteinpflaster schreiten sehen, belgische Finanziers, die in ihren dunklen Anzügen und schwarzen Dreispitzen ein Bild ernsten Vorhabens abgaben – sogar niederländische Händler in vergoldeten Westen gab es, aus deren luxuriösen Perücken bei jedem Schritt Puder puffte. Sie bewiesen, dass Feinde sich zum gegenseitigen Profit über Kassenzetteln treffen konnten. In den Bierschänken fand man Tag und Nacht kubanische Zuckerkaufleute aus Barbados, jüdische Edelsteinhändler aus Brasilien und Tabakankäufer aus Stockholm, die bei Wein und Kabeljau neue Geschäfte aushandelten. Regelmäßig trafen Lieferanten von Indigofärbe aus Charles Town und Geschäftsgesandte aus Philadelphia und Boston in der Stadt ein. Es war kein ungewohntes Bild, Sint Sink, Irokesen und Mohikaner zu sehen, die ganze Wagenladungen von Hirsch-, Biber- und Bärenfellen in die Stadt brachten und unter Menschen und Hunden gleichermaßen für Aufregung sorgten. Und natürlich liefen Sklavenschiffe aus Afrika oder den Westindischen Inseln in den Hafen ein. Sklaven, die nicht zur Arbeit in New York erworben wurden, fanden sich an andere Orte wie Long Island zur Auktion weiterverschifft. Vielleicht jeder fünfte Haushalt in New York hielt sich einen Sklaven. Obwohl es ihnen gesetzlich verboten war, sich zu mehr als zu zweit zu versammeln, kamen von den Hafenhändlern alarmierende Berichte über Sklavenbanden, die dort nachts ihr Unwesen trieben und sich gegenseitig attackierten – vielleicht in einer Art Weiterführung alter Stammesfehden um beanspruchte Gebiete.
Matthew fragte sich während seines Marsches, ob der Wandel zu einer Weltstadt bedeutete, dass das ungezügelte Wachstum, die menschliche Erniedrigung und Verrohung Londons in New York neuentstanden. Die Geschichten, die er über diese verrückte Stadt gehört hatte, ließen ihm das Blut gerinnen – alles gab es dort, von zwölfjährigen Prostituierten über die Zurschaustellung von abnorm gewachsenen Menschen im Zirkus, bis hin zum freudig erregten Gedränge bei öffentlichen Hinrichtungen. Der Gedanke brachte ihm Rachel Howarth in Fount Royal in den Sinn, die fast bei lebendigem Leibe verbrannt worden war, und wie die aufgeregte Menge dort gejubelt hätte, wenn die Asche geflogen wäre. Er fragte sich, wie New York wohl in hundert Jahren aussehen mochte. Er fragte sich, ob das Schicksal und die menschliche Natur sich verschworen hatten, jedes Bethlehem mit der Zeit zu einem Tollhaus wie dem berüchtigten Bedlam in London verkommen zu lassen.
Als er vor der Trinity Church und dem schwarzen Eisenzaun, der den Friedhof umgab, die Wall Street überquerte, warf er einen Blick auf den Trog, in dem er die Spuren seiner gefährlichen nächtlichen Begegnung abgewaschen hatte. Einst hatten hier die drei Meter hohen niederländischen Palisaden aus Baumstämmen gestanden, um den Engländern den Angriffsweg zu versperren. Das war, bevor die Stadt vor achtunddreißig Jahren die Hände wechselte. Matthew kam der Gedanke, dass New York inzwischen keinen Feind mehr hatte, der von außen kam; abgesehen von einer schweren Epidemie oder unvorhergesehenen Katastrophen war es nun gesichert. Vielleicht würde das Überleben der Stadt stattdessen von innen bedroht werden, wenn man die dunkle Seite menschlicher Gier vergaß.
Zu seiner Linken, ebenfalls an der Wall Street, lagen das aus gelbem Stein erbaute Rathaus und das Gefängnis, vor dem der berüchtigte Taschendieb Ebenezer Grooder am Pranger den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt war. Für Bürger, die noch ein wenig mehr Gerechtigkeit walten lassen wollten, stand ein Korb mit faulen Äpfeln bereit. Matthew ging weiter gen Süden in das rauchdunstige Reich der Ställe, Lagerhallen und Schmieden.
Sein Ziel war das Gebäude, auf dessen Schild nur Ross, Schmied stand. Durch das offenstehende Scheunentor trat er ins schummerige Halbdunkel ein, wo Hämmer auf Eisen rangen und im rußigen Glühofen orangefarbene Flammen brodelten. Ein untersetzter junger Mann mit blonden Locken war mit dem Blasebalg dabei, das Feuer zum Auflodern und Funkenspucken anzufachen. Hinter ihm hämmerten der alte Schmiedemeister Marco Ross und der andere Lehrling auf ihren Ambossen die unverzichtbare Ware: Hufeisen. Der Schlag des einen Hammers hatte einen höheren Klang als der andere, und so wirkte der Lärm wie holperige Musik. Alle drei Schmiede trugen Lederschürzen, um ihre Kleidung vor den herumfliegenden, glühend heißen Metallsplittern zu schützen. Die Hitze und harte Arbeit hatten die Männer bereits zu dieser frühen Stunde den Rücken ihrer Hemden durchschwitzen lassen. Wagenräder, Pflugscharten und anderes Ackerwerkzeug waren wie in einer Warteschlange aufgereiht und zeigten, dass Meister Ross sich nicht um Arbeit sorgen musste.
Matthew überquerte den Ziegelboden und stellte sich neben den jungen Mann am Blasebalg. Er wartete, bis John Five seine Anwesenheit endlich spürte und einen Blick über die Schulter warf. Matthew nickte. John erwiderte das Nicken; sein engelhaftes Gesicht war von der Hitze gerötet und seine Augen unter den dichten blonden Brauen blassblau. Da während des Hämmerns jedes Wort ungehört unterging, drehte er sich wieder um, ohne etwas zu sagen.
Immerhin wusste John, dass Matthew sich nicht fortschicken lassen würde. Matthew konnte es im Zusammensacken der Schultern des jungen Mannes erkennen. Allein das deutete für ihn auf den Ausgang ihres bevorstehenden Gesprächs hin. Trotzdem musste er darauf bestehen. John Five hörte mit der Blasebalgarbeit auf, schwenkte den Arm durch die Luft, um Meister Ross' Aufmerksamkeit zu erhaschen, und hielt dann fünf Finger hoch, um sich so viel Zeit für eine Pause zu erbitten. Meister Ross bedachte Matthew mit einem strengen Blick, der sagte: Manche von uns haben Arbeit zu verrichten, nickte kurzangebunden und schlug wieder mit dem Hammer zu.
Im rauchdurchwirkten Sonnenlicht vor der Scheune wischte John Five sich die glänzende Stirn mit einem Lappen ab. »Matthew, wie geht's?«
»Gut, danke. Und dir?«
»Auch gut.« John war nicht so hochgewachsen wie Matthew, hatte aber die breiten Schultern und dicken Unterarme eines Mannes, der geboren war, um Eisen zu bearbeiten. Er war vier Jahre jünger als Matthew, jedoch alles andere als ein naives Bübchen. Im King Street Waisenhaus – das damals noch Das Heim des Geheiligten Johannes für Knaben hieß, bevor es um zwei Gebäude erweitert wurde, in denen elternlose Mädchen und erwachsene Arme aufgenommen wurden – war er von sechsunddreißig Jungen der fünfte John gewesen, daher sein Name. John Five hatte nur ein Ohr, das linke war abgehackt worden. Eine tiefe Narbe am Kinn verzog seinen rechten Mundwinkel zu permanenter Traurigkeit. John Five erinnerte sich noch an einen Vater und eine Mutter und ein Blockhaus auf einer Lichtung in der Wildnis; vielleicht ein verklärtes Bild. Er erinnerte sich an zwei kleine Geschwister, zwei Brüder, glaubte er. An die Palisaden eines Forts konnte er sich erinnern und an einen Mann mit einem goldverzierten Dreispitz, der mit seinem Vater redete und ihm den Schaft eines zerbrochenen Pfeils zeigte. Sein Gedächtnis konnte das schrille Kreischen einer Frau zutage fördern und verschwommene Gestalten, die durch die Fensterläden und die Tür hereinbrachen. Er sah noch, wie sich der Schein des Feuers in einem erhobenen Beil spiegelte. Dann erlosch die Flamme seines Verstandes.
An eins konnte er sich sehr genau erinnern – und das hatte er Matthew und ein paar anderen eines Nachts im Waisenhaus erzählt –, nämlich an einen spindeldürren Mann mit schwarzen Zähnen, der sich etwas aus einer Flasche in den Mund goss und ihm befahl: Tanz, tanz, du kleines Arschloch! Tanz für unser Abendessen! Und lache, sonst schneide ich dir einen fröhlichen Mund ins Gesicht!
John Five erinnerte sich, wie er in einem Wirtshaus getanzt hatte und dabei seinen kleinen, an die Wand geworfenen Schatten sah. Der dürre Mann erhielt von der Kundschaft Münzen, die er in einen braunen Topf warf. Er erinnerte sich, wie der Mann betrunken und fluchend auf einem widerlichen Bett irgendwo in einem kleinen Zimmer gelegen hatte. Er erinnerte sich, wie er zum Schlafen unter das Bett gekrabbelt war, und dass zwei andere Männer in das Zimmer eingebrochen waren und den Betrunkenen mit Knüppeln zu Tode geprügelt hatten. Und er erinnerte sich, wie er, während das Gehirn des Mannes an die Wände und das Blut auf den Boden spritzte, gedacht hatte, dass er das Tanzen nie mochte.
Bald danach brachte ein fahrender Pfarrer den neunjährigen John ins Waisenhaus und vertraute ihn der Pflege des Leiters Staunton an, der hohe Anforderungen an die Knaben stellte, aber gerecht war. Als Staunton sich jedoch zwei Jahre später auf einen Traum hin berufen fühlte, den Indianern Gottes Wort zu bringen, nahm Eben Ausley seine Stelle ein, der mit dem Ernennungsbrief in der Hand frisch aus dem guten alten England eingetroffen war.
Die Stadt begann sich jetzt in den Rhythmus eines neuangebrochenen Tages der Geschäftemacherei zu wiegen. Von den Strömungen ihres Leben bewegt wie Fische in den Flüssen zogen Einwohner an den beiden Männern vor Meister Ross' Schmiede vorbei. Matthew schaute auf seine Schuhe hinab und legte sich die Worte sorgsam zurecht, mit denen er sich an John Five wandte. »Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, hast du gesagt, du würdest über meine Bitte nachdenken.« Er blickte auf und sah dem jüngeren Mann in die Augen, die er so gut zu lesen verstand wie jedes Buch in seiner Sammlung. Und doch musste er fortfahren. »Hast du das?«
»Habe ich«, antwortete John.
»Und?«
Johns Gesicht verzog sich gequält. Er starrte seine Fingerknöchel an, ballte die Hände und stieß sie gegeneinander, als führte er einen inneren Kampf. Matthew wusste, dass er das tatsächlich tat. Trotzdem musste Matthew darauf beharren: »Du und ich, wir wissen beide, was getan werden muss.«
Keine Antwort kam. Matthew bohrte weiter: »Er denkt, dass er mit allem davonkommt. Er denkt, dass es niemanden interessiert. Ich hab ihn gestern Abend gesehen, oh ja. Er hat wie ein Verrückter gehöhnt, dass ich dem Richter nichts gesagt habe, weil ich nichts gegen ihn in der Hand hätte. Du weißt ja selbst, dass der Hauptwachtmeister einer seiner Spielerkumpane ist. Ich muss also Beweise haben, John. Ich muss irgendwen haben, der den Mund aufmacht.«
»Irgendwen«, sagte John mit nur einem Hauch von Bitterkeit in der Stimme.
»Myles Newell und seine Frau sind nach Boston gezogen«, erinnerte Matthew ihn. »Er war dazu bereit gewesen und kurz davor, aber da er nun fort ist, liegt es an dir.«
John schwieg, drückte noch immer die Fäuste gegeneinander. Seine Augen hatten sich verdunkelt.
»Letzten Monat hat Nathan Spencer sich erhängt«, sagte Matthew. »Zwanzig Jahre alt, und trotzdem hat es ihm keine Ruhe gelassen.«
»Ich weiß, dass Nathan tot ist. Ich war auch auf der Beerdigung. Und ich hab an ihn gedacht – an vielen Tagen. Er ist auch hergekommen und hat geredet, genau wie du. Aber sag mir, Matthew«, jetzt starrte John Five seinem Freund mit Augen ins Gesicht, die gleichzeitig von Qualen erschüttert waren und doch so heiß wie ein Schmiedefeuer brannten, »hat es Nathan keine Ruhe gelassen … oder dir nicht?«
»Es ging uns beiden so«, sagte Matthew ehrlich.
John grunzte leise und schaute wieder weg. »Es tut mir leid um Nathan. Er hat sich so viel Mühe gegeben, es zu vergessen. Aber du hast das nicht zugelassen, oder?«
»Ich hatte keine Ahnung, dass er vorhatte, sich umzubringen.«
»Vielleicht hatte er das auch nicht, bis du ständig hinter ihm her warst. Hast du dir das mal durch den Kopf gehen lassen?«
Ehrlich gesagt hatte Matthew das tatsächlich. Es war allerdings etwas, das er von sich weggeschoben hatte. Er konnte es nicht ertragen vor sich zuzugeben, dass seine Bitten an Nathan, vor Richter Powers und Staatsanwalt James Bynes gegen Eben Ausley auszusagen, zu einem über die Sparren der Dachkammer des jungen Mannes geschlungenen Seil geführt hatten.
»Nathan ging es nicht gut«, sprach John Five weiter. »Im Kopf. Er war schwach. Du als großer Gelehrter hättest das wissen sollen.«
»Ich kann ihn nicht wieder lebendig machen und du auch nicht«, sagte Matthew heftiger, als er eigentlich wollte – es hörte sich zu sehr an, als lehnte er kurzangebunden jede Verantwortung ab. »Wir müssen da weitermachen, wo wir …«
»Wir?« John blickte finster drein; eine Drohung, die nicht auf die leichte Schulter zu nehmen war. »Wer ist dieses wir? Ich habe nicht gesagt, dass ich was damit zu tun haben will. Ich hab dir nur beim Reden zugehört, mehr nicht. Weil du jetzt so hochgebildet bist – und ich muss sagen, dass du schön daherreden kannst, Matthew. Aber nur mit Reden kommt man nicht so weit.«
Wie es seine Gewohnheit war, übernahm Matthew die Initiative. »Das finde ich auch. Es ist Zeit, etwas zu tun.«
»Du meinst, Zeit, dass ich meinen Hals auch in eine Schlinge stecke, was?«
»Nein, das meine ich nicht.«