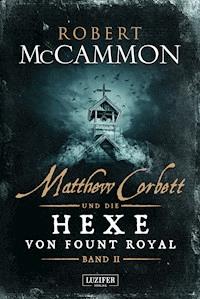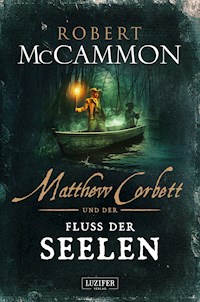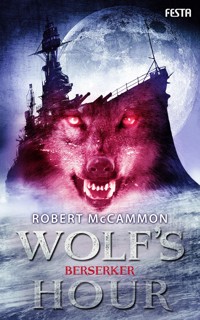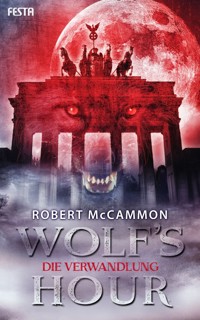4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Swans Song - Buch 2: Das scharlachrote Auge Eine erkaltete, hoffnungslose Welt. Heimgesucht von einer uralten bösen Macht. Er ist der Mann mit dem scharlachroten Auge, der Mann der vielen Masken. Er vereint die Kraft der menschlichen Gier und des Wahnsinns. Er durchstreift das nuklear verstrahlte Land auf der Suche nach einem Kind, ein Mädchen mit den Namen Swan. Das Kind muss vernichtet werden, denn es besitzt die Gabe. Swan kann den toten Boden wieder Leben geben und den Menschen somit Rettung bringen … Das Ende der Welt ist nur der Start für den letzten Kampf der Menschheit. Stephen King: 'Einer der besten Horror- und Thrillerautoren …' Publishers Weekly: 'Überwältigend … Ein tiefer Blick in die Hölle und Erlösung.' Dean Koontz: 'Ein irrer Sturz in den Terror. Eine große und erschreckende Geschichte.' Der legendäre US-Bestseller. Düster, brutal und mit epischer Wucht erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Manfred Sanders
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Swan Song erschien 1987.
Copyright © 1987 by Robert McCammon
1. Auflage Mai 2015
Copyright © dieser Ausgabe 2015 by Festa Verlag, Leipzig
Veröffentlicht mit Erlaubnis von The McCammon Corporation
Literarische Agentur: Thomas Schlück GmbH, 30872 Garbsen
Titelbild: Arndt Drechsler
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-356-3
www.Festa-Verlag.de
Die Kröte mit den goldenen Flügeln
Der letzte Apfelbaum
Verlasst das Kainsmal
Täglich eine gute Tat
Die Hiobsmaske
Der einsame Wanderer
Eine neue rechte Hand
Weiße Blüten
48
Schnee fiel aus dem düsteren Himmel und wehte über eine schmale Landstraße, die noch vor sieben Jahren durch den Bundesstaat Missouri geführt hatte.
Ein geschecktes Pferd – alt und mit durchhängendem Rücken, aber immer noch kräftig und arbeitswillig – zog einen kleinen, grob zusammengezimmerten Wagen, der eine seltsame Mischung aus Planwagen und Pkw-Anhänger darstellte. Gestell und Rahmen des Wagens bestanden aus Holz, aber er hatte Metallachsen und Gummireifen. Das mehrfach geflickte dunkelgrüne Verdeck war ein altes Zweimannzelt, das man über gebogene Holzrippen gespannt hatte. Auf beiden Seiten des Wagens stand mit weißer Farbe auf der Zeltplane die Aufschrift WANDERZIRKUS. Und darunter verkündeten kleinere Buchstaben: Magie!, Musik! und Messt euch mit dem Maskierten Mephisto!
Zwei dicke Bretter dienten dem Wagenlenker als Sitz und Fußstütze. Er trug einen schweren Wollmantel, der sich an den Nähten allmählich auflöste, und einen Cowboyhut, dessen Krempe von Schnee und Eis herabgedrückt wurde; seine Füße steckten in abgewetzten alten Cowboystiefeln. Die Handschuhe an seinen Fingern waren nötig, um den beißenden Wind abzuwehren, und ein karierter Wollschal verhüllte den unteren Teil seines Gesichtes. Nur seine Augen – deren Farbe irgendwo zwischen Nussbraun und Topas lag – und ein Streifen rauer, runzliger Haut waren den Elementen ausgesetzt.
Der Wagen bewegte sich langsam durch eine schneebedeckte Landschaft, vorbei an dichten schwarzen Wäldern ohne jede Spur von Laub. Zu beiden Seiten der Straße sah man gelegentlich vereinzelte Scheunen oder Farmhäuser, die unter dem Gewicht von sieben Jahren Winter eingestürzt waren. Die einzigen Anzeichen von Leben waren schwarze Krähen, die eifrig auf den gefrorenen Boden einhackten.
Einige Meter hinter dem Wagen stapfte eine große Gestalt in einem langen grauen Mantel mit knirschenden Stiefeln durch den Schnee. Der Mann verbarg seine Hände in den Taschen seiner braunen Cordhose, sein Kopf steckte unter einer schwarzen Skimaske, die an den Löchern für Augen und Mund rot umrandet war. Seine Schultern beugten sich unter dem Ansturm des Windes und seine Beine schmerzten von der Kälte. Etwa drei Meter hinter ihm folgte ein Terrier, dessen Fell weiß vom Schnee war.
Ich rieche Rauch, dachte Rusty Weathers. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, durch den weißen Vorhang vor ihm etwas zu erkennen. Doch dann drehte sich der Wind und nagte aus einem anderen Winkel an ihm, und der Geruch nach Holzfeuer – sofern er ihn sich nicht nur eingebildet hatte – war verschwunden. Aber ein paar Minuten später gab es einen neuen Hinweis darauf, dass sie sich der Zivilisation näherten; rechts von ihnen, mit roter Farbe auf den breiten Stamm einer unbelaubten Eiche gemalt, standen die Worte: VERBRENNT EURE TOTEN.
Solche Botschaften sah man immer wieder. Meistens waren sie ein Indiz dafür, dass man sich einer Siedlung näherte. Vor ihnen lag wahrscheinlich ein Dorf oder eine Geisterstadt voller Skelette – je nachdem, was die Strahlung angerichtet hatte.
Der Wind drehte sich erneut, und wieder roch Rusty den Rauch. Es ging eine leichte Steigung hinauf. Muli strengte sich an, so gut er konnte, ließ sich aber Zeit. Rusty trieb ihn nicht an. Warum auch? Wenn sie einen Unterschlupf für die Nacht fanden – prima. Wenn nicht, würden sie sich schon irgendwie behelfen. Im Laufe von sieben langen Jahren hatten sie gelernt, zu improvisieren und aus allem, was sie vorfanden, das Beste zu machen. Es war eine ganz einfache Wahl: überleben oder sterben – und es hatte viele Tage gegeben, an denen Rusty Weathers am liebsten gar nicht mehr aufgestanden wäre, aber jedes Mal hatten Josh oder Swan ihn durch Scherze oder Sticheleien dazu gebracht, weiterzumachen, genau wie er die beiden im Laufe der Jahre immer wieder angetrieben hatte. Sie waren ein Team, zu dem auch Muli und Killer gehörten, und in den kältesten Nächten, wenn sie nirgendwo Schutz gefunden hatten, war es die Wärme der beiden Tiere gewesen, die Rusty, Josh und Swan vor dem Erfrieren bewahrt hatte.
Denn schließlich, dachte Rusty mit einem vagen, grimmigen Lächeln unter seinem karierten Schal, muss die Show ja weitergehen!
Als sie den höchsten Punkt der Erhebung erreicht hatten und wieder abwärtsfuhren, erspähte Rusty weiter rechts ein gelbes Leuchten durch den fallenden Schnee. Für eine Minute wurde das Licht von toten Bäumen verdeckt – aber dann war es wieder da und Rusty war sich sicher, dass es das Flackern einer Lampe oder eines Feuers war. Er wusste, dass es sinnlos war, nach Josh zu rufen, einerseits wegen des Windes, aber auch weil Josh nicht mehr gut hörte. Er zügelte Muli und trat mit dem Fuß einen hölzernen Hebel nach vorn, der die Vorderachse blockierte. Dann stieg er vom Wagen und ging nach hinten, um Josh das Licht zu zeigen und ihm zu sagen, dass er dorthin fahren würde.
Josh nickte. Nur ein Auge war durch die schwarze Skimaske zu sehen. Das andere wurde von einer grauen, narbenartigen Hautwucherung verdeckt.
Rusty kletterte wieder auf den Wagen, löste die Bremse und ließ die Zügel schnalzen. Muli trottete sofort weiter; vermutlich hatte er ebenfalls den Rauch gerochen und wusste, dass sie vielleicht bald einen Unterschlupf finden würden. Eine weitere Straße, ungepflastert und noch schmaler, zweigte nach rechts in die schneebedeckten Felder ab. Der Lichtschimmer wurde stärker und schon bald konnte Rusty vor ihnen ein Farmhaus erkennen, aus dessen Fenster das Licht fiel. Neben dem Haus gab es einige Wirtschaftsgebäude, darunter auch eine kleine Scheune. Rusty fiel auf, dass in allen Richtungen um das Haus herum die Bäume abgeholzt waren; Hunderte von Stümpfen waren durch den Schnee zu erkennen. Ein einzelner toter Baum stand noch, klein und schmächtig, etwa 30 Meter vor dem Haus. Rusty roch das Aroma von brennendem Holz und vermutete, dass die ganzen Bäume nach und nach im Kamin der Hausbewohner verschwunden waren. Aber brennendes Holz roch nicht mehr so, wie es vor dem 17. Juli gerochen hatte, denn die Strahlung hatte sich über die Wälder gelegt; der Rauch hatte einen leicht chemischen Geruch, wie von verbranntem Plastik. Rusty erinnerte sich noch gut an das süße Aroma sauberen Kaminholzes – ein Geruch, der wahrscheinlich für immer verloren war, genau wie der Geschmack von sauberem Wasser. Wasser schmeckte heutzutage nur noch ranzig und hinterließ einen öligen Film im Mund. Geschmolzenen Schnee zu trinken – mittlerweile fast der einzige noch verfügbare Wasservorrat –, führte zu Kopfschmerzen, Magenkrämpfen und Sehstörungen, wenn man zu viel davon trank. Frischwasser, etwa aus einem Brunnen oder Mineralwasser in Flaschen, war so wertvoll wie in einer früheren Welt auserlesene französische Weine.
Rusty zügelte Muli vor dem Haus und arretierte die Bremse des Wagens. Sein Herz schlug schneller. Jetzt kommt der knifflige Teil, dachte er. Oft genug war auf sie geschossen worden, wenn sie um einen Platz für die Nacht gebeten hatten. Er trug die Narbe eines Streifschusses auf seiner linken Wange.
Im Haus war keine Bewegung zu erkennen. Rusty langte nach hinten und zog den Reißverschluss der Zeltplane ein Stück auf. Im Inneren, über den ganzen Wagen verteilt, um das Gewicht auszubalancieren, befanden sich ihre spärlichen Habseligkeiten: ein paar Plastikkanister mit Wasser, mehrere Dosen Bohnen, ein Sack Holzkohlenbriketts, einige Kleidungsstücke und Decken, ihre Schlafsäcke und die alte Martin-Akustikgitarre, die zu spielen Rusty sich gerade selbst beibrachte. Musik lockte die Menschen an, sie half ihnen, die Monotonie des Lebens zu durchbrechen. Einmal hatte eine Frau ihnen ein Huhn geschenkt, als Rusty unbeholfen die Akkorde von ›Moon River‹ für sie zupfte. Die Gitarre und einen Stapel Liederbücher hatte er in der toten Stadt Sterling, Colorado, gefunden.
»Wo sind wir?«, fragte das Mädchen aus dem Inneren des Zeltes. Eingerollt in ihren Schlafsack hatte sie dem rastlosen Heulen des Windes gelauscht. Ihre Aussprache war sehr undeutlich, aber wenn sie langsam redete und sich Mühe gab, konnte Rusty sie verstehen.
»Wir sind auf einer Farm. Vielleicht überlassen sie uns die Scheune für eine Nacht.« Sein Blick wanderte zu der roten Decke, die um die drei Gewehre gewickelt war. Eine 38er Pistole und eine Schachtel Patronen lagen in einem Schuhkarton in Reichweite seiner rechten Hand. Wie meine Mama schon immer sagte –man muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Er wollte auf alles vorbereitet sein und streckte die Hand nach der 38er aus, um sie unter seinem Mantel zu verstecken, wenn er zur Tür ging.
Swan unterbrach seine Gedanken. »Es ist wahrscheinlicher, dass man auf dich schießt, wenn du die Waffe mitnimmst.«
Er zögerte und erinnerte sich daran, dass er mit einem Gewehr bewaffnet gewesen war, als er den Streifschuss an der Wange abbekommen hatte. »Ja, wahrscheinlich hast du recht«, räumte er ein. »Wünsch mir Glück.« Er zog den Zelteingang wieder zu und stieg vom Wagen, dann nahm er einen tiefen Atemzug von der winterlichen Luft und ging zum Haus. Josh blieb neben dem Wagen stehen und sah ihm zu, während Killer sich an einem Baumstumpf erleichterte.
Rusty trat an die Tür, um anzuklopfen, aber gerade als er die Faust hob, öffnete sich ein Schlitz in der Mitte der Tür und ein Gewehrlauf glitt heraus, der ihm direkt ins Gesicht starrte. Oh, Scheiße, dachte er, aber seine Beine versagten ihm den Dienst und er stand hilflos da.
»Wer sind Sie und was wollen Sie?«, fragte eine Männerstimme.
Rusty hob die Hände. »Mein Name ist Rusty Weathers. Meine beiden Freunde und ich suchen einen Platz für die Nacht, bevor es zu dunkel wird. Ich habe Ihr Licht von der Straße aus bemerkt, und wie ich sehe, haben Sie eine Scheune, also dachte ich, vielleicht …«
»Woher kommen Sie?«
»Von Westen. Wir sind durch Howes Mill und Bixby gekommen.«
»Von den Städten ist nichts mehr übrig.«
»Ich weiß. Bitte, Mister, wir suchen doch nur einen Platz zum Schlafen. Wir haben ein altes Pferd, das ein Dach über dem Kopf gebrauchen könnte.«
»Nehmen Sie das Halstuch ab und lassen Sie mich Ihr Gesicht sehen. Für wen halten Sie sich? Jesse James?«
Rusty tat wie geheißen. Eine Pause entstand. »Es ist schrecklich kalt hier draußen, Mister«, sagte Rusty. Die Pause dehnte sich aus. Rusty konnte hören, wie der Mann mit jemandem redete, aber er verstand nicht, was gesagt wurde. Dann wurde der Gewehrlauf plötzlich zurück in das Haus gezogen und Rusty stieß den angehaltenen Atem in einer weißen Wolke aus. Die Tür wurde entriegelt – mehrere Bolzen wurden zurückgeschoben –, dann schwang sie auf.
Ein hagerer, verhärmt aussehender Mann um die 60, mit lockigem weißem Haar und dem ungebändigten Bart eines Eremiten, stand vor ihm, das Gewehr locker an seiner Seite, aber wachsam. Das Gesicht des Mannes war so hart und runzlig, dass es wie gemeißelter Stein aussah. Der Blick seiner dunkelbraunen Augen wanderte von Rusty zum Wagen. »Was steht da auf der Seite? Wanderzirkus? Was, in Judas’ Namen, soll das heißen?«
»Das, was es besagt. Wir sind … wir sind Entertainer.«
Eine ältere Frau in blauer Hose und einem dicken weißen Pullover lugte misstrauisch über die Schulter des Mannes. »Entertainer«, wiederholte er und runzelte die Stirn, als hätte er etwas Übles gerochen. Sein Blick kehrte zu Rusty zurück. »Habt ihr Entertainer was zu essen dabei?«
»Wir haben ein paar Konserven. Bohnen und so.«
»Wir haben eine Kanne Kaffee und ein bisschen gepökeltes Schweinefleisch. Stellen Sie den Wagen in die Scheune und bringen Sie die Bohnen her.« Dann schloss er die Tür direkt vor Rustys Gesicht.
Nachdem Rusty den Wagen in die Scheune gefahren hatte, schirrte er mit Joshs Hilfe das Pferd ab, damit es zu einem kleinen Haufen Stroh und ein paar Maiskolben trotten konnte. Josh goss für Muli etwas Wasser in einen Eimer und fand ein unbenutztes Einkochglas, aus dem Killer trinken konnte. Die Scheune war solide gebaut und hielt den Wind ab, deshalb würden die Tiere nicht in Gefahr sein, zu erfrieren, sobald es dunkel und richtig kalt wurde.
»Was meinst du?«, fragte Josh. »Kann sie reingehen?«
»Ich weiß nicht. Die beiden scheinen in Ordnung zu sein, sind aber ein bisschen nervös.«
»Sie könnte die Wärme gebrauchen, wenn die da drinnen ein Feuer haben.« Josh blies in seine Hände und beugte sich vor, um seine schmerzenden Knie zu massieren. »Wir können ihnen erklären, dass es nicht ansteckend ist.«
»Aber das wissen wir doch gar nicht.«
»Du hast es nicht bekommen, oder? Wenn es ansteckend wäre, hättest du es auch schon lange, oder nicht?«
Rusty nickte. »Yeah. Aber wie sollen wir denen das begreiflich machen?«
Plötzlich wurde der Reißverschluss der hinteren Zeltbahn von innen aufgezogen. Mit undeutlicher Stimme sagte Swan: »Ich bleibe hier. Es ist nicht nötig, den Leuten Angst einzujagen.«
»Sie haben ein Feuer im Haus«, wandte Josh ein und ging zum Heck des Wagens. Swan kauerte gebückt im Eingang, eine Silhouette im schwachen Lampenschein. »Ich glaube, es ist okay, wenn du mit reinkommst.«
»Nein, ist es nicht. Ihr könnt mir mein Essen hier herausbringen. Es ist besser so.«
Josh blickte zu ihr hinauf. Sie hatte eine Decke um ihre Schultern und ihren Kopf geschlungen. In den sieben Jahren war sie zu einer Größe von 1,75 Metern aufgeschossen, schlank und etwas schlaksig. Josh wusste, dass sie recht hatte, und das brach ihm fast das Herz; wenn die Leute im Haus wirklich so nervös waren, dann war es tatsächlich am besten, wenn sie hierblieb. »Okay«, meinte er mit erstickter Stimme, »ich bringe dir was zu essen.« Er wandte sich schnell vom Wagen ab, bevor er schreien musste.
»Kannst du mir bitte ein paar Dosen Bohnen geben?«, bat Rusty sie. Swan nahm Crybaby und tappte damit nach den Dosen, dann rutschte sie hinüber und reichte Rusty einige davon aus dem Wagen.
»Rusty, wenn die ein paar Bücher übrig hätten, wäre ich wirklich sehr dankbar«, sagte sie. »Ganz egal, was.«
Er nickte, erstaunt, dass sie überhaupt noch lesen konnte.
»Wir bleiben nicht lange«, versprach Josh und folgte Rusty aus der Scheune.
Als sie gegangen waren, klappte Swan die hölzerne Heckklappe des Wagens herunter und stellte eine kleine Trittleiter auf den Boden der Scheune. Ihren Weg mit der Wünschelrute ertastend, stieg sie die Stufen herab und ging zur Tür der Scheune, Kopf und Gesicht noch immer mit der Decke verhüllt. Killer sprang neben ihr her, eifrig mit dem Schwanz wedelnd und um ihre Aufmerksamkeit buhlend. Sein Bellen war nicht mehr ganz so munter wie vor sieben Jahren, und das Alter hatte seinem Schritt etwas an Schwung genommen.
Swan blieb stehen, legte Crybaby zur Seite und nahm Killer auf den Arm. Dann drückte sie die Scheunentür auf und legte ihren Kopf auf die linke Seite, um durch das Schneegestöber nach draußen zu schauen. Das Farmhaus sah so warm aus, so einladend – aber sie wusste, dass es besser war, hierzubleiben. In der Stille klang ihr Atmen wie ein asthmatisches Krächzen.
Durch den Schnee konnte sie den einzelnen Baum erkennen, der vom Licht aus dem Fenster schwach beleuchtet wurde. Warum gerade der Baum?, wunderte sie sich. Warum haben sie alle anderen abgeholzt und den einen stehen gelassen?
Killer reckte den Hals und schlappte in der Dunkelheit nach ihrem Gesicht. Sie blieb noch eine Minute stehen und betrachtete den Baum, dann schloss sie die Scheunentür wieder, hob Crybaby vom Boden auf und ertastete sich den Weg zu Muli, um ihn abzureiben.
Im Farmhaus loderte ein Feuer in einem gemauerten Kamin. Über den Flammen hing ein gusseiserner Topf, in dem gepökeltes Schweinefleisch in einer Gemüsebrühe garte. Sowohl der ältere Mann mit dem strengen Gesicht als auch seine etwas scheuere Frau zuckten erkennbar zusammen, als Josh Hutchins hinter Rusty durch die Haustür trat. Es war mehr seine Größe als seine Maske, die sie erschreckte, denn obwohl er in den letzten Jahren einiges an Gewicht verloren hatte, hatte er an Muskelmasse zugelegt und war noch immer ein beeindruckender Anblick. Joshs Hände hatten helle Hautflecken; der alte Mann starrte sie unbehaglich an, bis Josh sie in die Hosentaschen steckte.
»Hier sind die Bohnen«, sagte Rusty nervös und hielt sie dem Mann hin. Das Gewehr lehnte am Kamin, in bequemer Reichweite des Alten, falls er der Meinung sein sollte, es zu brauchen.
Der alte Herr nahm die Konserven entgegen und reichte sie seiner Frau. Mit einem misstrauischen Blick auf Josh verschwand sie im hinteren Teil des Hauses.
Rusty zog Handschuhe und Mantel aus, legte sie auf einen Stuhl und setzte seinen Hut ab. Sein Haar war fast ganz ergraut, an den Schläfen hatte er sogar weiße Strähnen, obwohl er gerade mal 40 war. Auch sein Bart hatte graue Stellen, die Streifschussnarbe war ein blasser Strich auf seiner Wange. Um die Augen breitete sich ein dichtes Netz von Runzeln und Furchen aus. Er stand vor dem Kamin und aalte sich in der wundervollen Wärme. »Ein gutes Feuer haben Sie hier«, sagte er. »Treibt einem die Kälte aus den Knochen.«
Der alte Mann starrte immer noch Josh an. »Sie können den Mantel und die Maske jetzt ausziehen, wenn Sie wollen.«
Josh schälte sich aus dem Mantel. Darunter trug er zwei dicke Pullover übereinander. Er machte keine Anstalten, die schwarze Skimaske abzunehmen.
Der alte Mann trat näher an Josh heran, doch dann blieb er abrupt stehen, als er die graue Wucherung sah, die das rechte Auge des Riesen überzog.
»Josh ist Wrestler«, sagte Rusty schnell. »Der Maskierte Mephisto – das ist er! Ich bin Zauberer. Wir sind ein Wanderzirkus. Wir ziehen von Stadt zu Stadt und treten für das auf, was die Menschen uns geben können und wollen. Josh ringt mit jedem, der bereit ist, es mit ihm aufzunehmen, und wenn der andere es schafft, Josh von den Beinen zu bringen, bekommt die ganze Stadt die Show umsonst.«
Der alte Mann nickte gedankenverloren, den Blick unverwandt auf Josh gerichtet. Die Frau kam mit den Dosen, die sie geöffnet hatte, zurück und kippte den Inhalt in den Topf, dann rührte sie das Ganze mit einem Holzlöffel um. Schließlich meinte der Alte: »Sieht aus, als hätte Sie da einer grün und blau geprügelt, Mister. Schätze, das gab ’ne Gratisshow für die Stadt, was?« Er grunzte und stieß ein hohes, gackerndes Lachen aus. Rusty entspannte sich ein wenig; heute würden die Waffen wohl nicht mehr sprechen. »Ich hol uns ’ne Tasse Kaffee«, sagte der alte Mann und verließ das Zimmer.
Josh ging zum Feuer, um sich zu wärmen, und die Frau wich vor ihm zurück, als hätte er die Pest. Da er sie nicht unnötig ängstigen wollte, ging er hinüber zum Fenster und schaute hinaus auf das Meer der Baumstümpfe und den einzelnen verbliebenen Stamm.
»Ich heiße Sylvester Moody«, verriet der alte Mann, als er mit einem Tablett zurückkam, auf dem mehrere braune Tonbecher standen. »Die Leute nennen mich Sly, nach dem Burschen, der diese ganzen Actionfilme gedreht hat.« Er stellte das Tablett auf einen kleinen Tisch aus Kiefernholz, dann ging er zum Kamin und nahm einen dicken Asbesthandschuh vom Sims. Er zog ihn an und langte in die Feuerstelle, wo er eine angekokelte metallene Kaffeekanne von einem Nagel in der Rückwand nahm. »Gut und heiß«, meinte er und goss die schwarze Flüssigkeit in die Becher. »Milch und Zucker haben wir nicht, also fragen Sie gar nicht erst.« Er deutete mit dem Kopf auf die Frau. »Das ist Carla, meine Frau. Fremde machen sie immer ’n bisschen nervös.«
Rusty nahm einen der heißen Becher und trank den Kaffee mit wahrer Wonne, obwohl das Zeug so stark war, dass es Josh problemlos in einem Wrestling-Match hätte umhauen können.
»Warum der eine Baum, Mr. Moody?«, fragte Josh.
»Hm?«
Josh stand noch am Fenster. »Warum haben Sie den stehen gelassen? Warum haben Sie ihn nicht wie die anderen abgeholzt?«
Sly Moody nahm eine Kaffeetasse und ging damit zu dem maskierten Riesen. Er versuchte, nicht zu sehr die weiß gefleckte Hand anzustarren, die den Becher entgegennahm. »Ich lebe jetzt schon fast 35 Jahre in diesem Haus«, antwortete er. »Das ist eine lange Zeit, immer nur in einem Haus und auf einem Stück Land, stimmt’s? Oh, ich hatte ein prima Maisfeld da drüben.« Er winkte zur Rückseite des Hauses. »Ich hab auch ’n bisschen Tabak und ’n paar Stangenbohnen angebaut, und jedes Jahr sind Jeanette und ich raus in den Garten gegangen …« Seine Stimme verklang, er blinzelte und schaute zu Carla, die ihn mit großen, erschrockenen Augen ansah. »Tut mir leid, Liebling«, sagte er. »Ich meine … Carla und ich sind raus in den Garten gegangen und haben ganze Körbe voll gutem Gemüse geerntet.«
Die Frau, offenbar zufriedengestellt, hörte auf, im Topf zu rühren, und verließ das Zimmer.
»Jeanette war meine erste Frau«, erklärte Sly mit gedämpfter Stimme. »Sie starb etwa zwei Monate, nachdem es geschah. Und dann ging ich eines Tages die Straße entlang zu Ray Featherstones Farm – ungefähr anderthalb Kilometer von hier – und stieß auf einen Wagen, der von der Straße abgekommen und halb in einer Schneewehe vergraben war. Na ja, da saß ein toter Mann mit blauem Gesicht hinterm Lenkrad und neben ihm eine Frau, die auch fast tot war. Auf ihrem Schoß lag der aufgeschlitzte Kadaver eines Pudels und sie hielt eine Nagelfeile in der Hand – und fragen Sie mich bitte nicht, was sie getan hat, um nicht zu erfrieren. Jedenfalls war sie so durch den Wind, dass sie gar nichts mehr wusste, nicht mal mehr ihren eigenen Namen oder wo sie herkam. Ich nannte sie Carla, nach dem ersten Mädchen, das ich geküsst habe. Sie blieb bei mir und jetzt glaubt sie, dass sie seit 35 Jahren mit mir auf dieser Farm lebt.« Er schüttelte den Kopf, seine Augen sahen dunkel und gequält aus. »War sowieso ’ne komische Sache – der Wagen war ein Lincoln Continental, und als ich sie fand, war sie ganz mit Diamanten und Perlen aufgedonnert. Ich hab den Krempel in einen Schuhkarton gepackt und später gegen Mehl und Speck eingetauscht. Schätze, sie brauchte das Zeug nicht mehr. Leute kamen und haben Teile von dem Wagen mitgenommen und irgendwann war nichts mehr davon übrig. Ist besser so.«
Carla kam mit ein paar Tellern zurück und begann sie mit Eintopf zu füllen.
»Schlimme Zeiten«, sagte Sly Moody leise, den Blick unverwandt auf den Baum gerichtet. Dann klärten sich seine Augen und er lächelte verhalten. »Das da ist mein Apfelbaum! Wissen Sie, ich hatte eine richtig schöne Apfelwiese da drüben. Hab die Äpfel scheffelweise geerntet – aber nachdem es passiert war und die Bäume starben, hab ich angefangen, sie abzuholzen und zu verfeuern. Man sollte nicht zu weit in den Wald gehen, um Feuerholz zu besorgen, nein, Sir! Ray Featherstone ist 100 Meter vor seiner eigenen Haustür erfroren.« Er schwieg einen Moment und seufzte dann schwer. »Ich hab die Apfelbäume mit meinen eigenen Händen gepflanzt. Hab ihnen beim Wachsen zugesehen und wie sie Früchte bekamen. Wissen Sie, was heute ist?«
»Nein«, sagte Josh.
»Ich führe einen Kalender. Ein Strich pro Tag. Hab ’ne Menge Bleistifte verbraucht. Heute ist der 26. April. Es ist Frühling.« Er lächelte bitter. »Ich hab sie alle bis auf den einen abgehackt und ins Feuer geworfen. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Axt gegen diesen letzten erhebe. Ich kann es nicht.«
»Das Essen ist fertig«, meldete Carla. Sie hatte einen Nordstaatenakzent, der sich sehr von Slys breitem MissouriAkzent unterschied. »Nehmen Sie sich einen Teller.«
»Moment mal.« Sly sah Rusty an. »Sagten Sie nicht, Sie wären mit zwei Freunden hier?«
»Ja. Ein Mädchen reist noch mit uns. Sie ist …« Er warf Josh einen schnellen Blick zu, dann sah er wieder Sly an. »Sie ist draußen in der Scheune.«
»Ein Mädchen? Um Gottes willen, Leute! Holen Sie sie her, damit sie was Warmes zu essen bekommt!«
»Äh … ich glaube nicht …«
»Jetzt holen Sie sie schon!«, beharrte Sly. »Eine Scheune ist doch kein Ort für ein Mädchen!«
»Rusty?« Josh schaute aus dem Fenster. Die Nacht brach jetzt schnell herein, aber trotzdem konnte er noch den letzten Apfelbaum sehen und die Gestalt, die neben ihm stand. »Komm mal her.«
Swan hielt sich die Decke wie ein Cape um Kopf und Schultern und blickte hoch zu den Ästen des dürren Apfelbaumes. Killer rannte ein paarmal um den Stamm herum und bellte halbherzig, er wollte zurück in die Scheune. Über Swans Kopf bewegten sich die Äste im Wind wie magere, suchende Arme.
Sie trat vor und legte ihre nackte Hand auf den Baumstamm. Ihre Stiefel versanken zentimetertief im Schnee.
Der Baum fühlte sich kalt an. Kalt und lange tot.
Genau wie alles andere, dachte sie. All die Bäume, das Gras, die Blumen – alles verbrannt von der Strahlung vor vielen Jahren.
Aber es war ein hübscher Baum, fand sie. Er strahlte eine gewisse Würde aus, wie ein Denkmal, er hatte es nicht verdient, inmitten all der hässlichen Stümpfe ehemaliger Bäume zu stehen. Sie wusste, dass das Schmerzgeräusch an diesem Ort ein langes, qualvolles Wehklagen gewesen sein musste.
Ihre Hand strich leicht über das Holz. Selbst im Tod hatte der Baum noch etwas Stolzes an sich, etwas Trotziges und Elementares – ein ungebändigter Geist, wie das Herz einer Flamme, die nie ganz ausgelöscht werden konnte.
Killer kläffte zu ihren Füßen und drängte sie, sich mit dem, was sie da tat, zu beeilen – was es auch immer sein mochte. »Schon gut«, sagte Swan. »Ich komme ja sch…«
Sie verstummte. Der Wind wirbelte um sie herum, zerrte an ihrer Kleidung.
Kann das sein?, wunderte sie sich. Ich träume das doch nicht … oder?
Ihre Finger kribbelten. Ganz schwach, gerade eben spürbar in der Kälte.
Sie legte die Handfläche auf den Stamm. Ein kribbelndes, prickelndes Gefühl wie von feinen Nadelstichen breitete sich in ihrer Hand aus – sehr schwach nur, aber spürbar stärker werdend.
Ihr Herz tat einen Satz. Leben, erkannte sie. Dort war noch Leben, tief im Inneren des Baumes. Es war so lange her – so entsetzlich lange –, seit sie gespürt hatte, wie sich unter ihren Fingern Leben regte. Das Gefühl war beinahe neu für sie und erst jetzt wurde ihr klar, wie sehr sie es vermisst hatte.
Jetzt stieg etwas, das sich wie ein schwacher elektrischer Strom anfühlte, aus der Erde durch die Sohlen ihrer Stiefel auf, wanderte ihr Rückgrat hinauf und dann durch ihren Arm und ihre Hand in das Holz des Baumes. Als sie die Hand zurückzog, hörte das Kribbeln auf. Noch einmal drückte sie ihre Finger an den Baum, mit klopfendem Herzen, und etwas durchzuckte sie so heftig, als schieße ein Feuerstrahl ihre Wirbelsäule hinauf.
Ihr Körper zitterte. Das Gefühl wurde immer stärker, fast schmerzhaft jetzt, ihre Knochen ächzten unter der Energie, die durch sie hindurch in den Baum floss. Als sie es nicht länger aushalten konnte, zog sie die Hand zurück. Ihre Finger kribbelten noch.
Aber sie war noch nicht fertig. Aus einem Impuls heraus streckte sie den Zeigefinger aus und malte unsichtbare Buchstaben auf den Baumstamm: S … W … A … N.
»Swan!« Die Stimme kam vom Haus und schreckte sie auf. Sie drehte sich zu dem Rufer um, und dabei riss ihr der Wind das provisorische Cape von Schultern und Kopf.
Sly Moody stand zwischen Josh und Rusty. Er hielt eine Laterne in der Hand; in ihrem gelben Licht sah er, dass die Gestalt neben dem Apfelbaum kein Gesicht hatte.
Ihr Kopf war ganz von den grauen Wucherungen bedeckt, die als kleine schwarze Warzen begonnen hatten und sich im Laufe der Jahre immer mehr vergrößert und ausgebreitet und sich mit grauen Ausläufern, die aussahen wie ineinander verflochtene Ranken, verbunden hatten. Die Wucherungen umschlossen ihren ganzen Schädel wie ein knotiger Helm. Sie bedeckten und verbargen ihr Gesicht bis auf einen schmalen Schlitz vor ihrem linken Auge und ein unförmiges Loch vor ihrem Mund, durch das sie atmete und aß.
Hinter Sly schrie Carla auf. Sly flüsterte: »Oh … mein Gott …«
Die gesichtslose Gestalt schnappte die Decke und verhüllte ihren Kopf. Josh hörte ihren herzzerreißenden Schrei, als sie zur Scheune rannte.
49
Dunkelheit brach über die verschneiten Überreste von Broken Bow, Nebraska, herein. Stacheldraht umzäunte die Kleinstadt, und hier und da brannten Holz- und Stoffreste in alten Ölfässern, aus denen der Wind orangefarbene Funken in den Himmel wirbelte. Auf dem geschwungenen Nordwestbogen des Highway 2 hatte man Dutzende tiefgefrorene Leichen liegen gelassen, wo sie gestorben waren, und in den Karosserien verkohlter Fahrzeuge flackerten noch die Flammen.
In der Festung, die Broken Bow nun seit zwei Tagen war, versuchten 317 kranke und verletzte Männer, Frauen und Kinder verzweifelt, sich an einem großen Feuer in der Mitte des Ortes aufzuwärmen. Die Häuser von Broken Bow wurden auseinandergenommen und an die Flammen verfüttert. Weitere 264 Männer und Frauen, bewaffnet mit Gewehren, Pistolen, Äxten, Hämmern und Messern, kauerten in den Gräben, die eilig entlang des Stacheldrahts am westlichen Ende der Stadt ausgehoben worden waren. Ihre Gesichter waren nach Westen gewandt, in den jaulenden, frostigen Wind, der schon so viele getötet hatte. Sie zitterten in ihren zerlumpten Mänteln, und heute Abend fürchteten sie sich vor einem anderen Tod.
»Da!«, rief ein Mann mit einem vereisten Verband um den Kopf. Er zeigte in die Ferne. »Da! Sie kommen!«
Ein Chor von Rufen und Warnungen wanderte den Graben entlang. Schnell wurden Gewehre und Pistolen bereit gemacht. Eine nervöse Spannung hing über dem Schützengraben, und der Atem menschlicher Wesen waberte durch die Luft wie Diamantenstaub.
Sie sahen die Scheinwerfer langsam über das Schlachtfeld auf dem Highway wandern. Dann wehte der beißende Wind die Musik zu ihnen herüber. Es war Jahrmarktsmusik, und als die Scheinwerfer näher kamen, stand ein magerer, hohläugiger Mann in einem schweren Schaffellmantel in der Mitte des Grabens auf und richtete ein Fernglas auf das anrückende Fahrzeug. Sein Gesicht war mit dunkelbraunen Keloiden überzogen.
Er setzte das Fernglas ab, bevor das Okular in der Kälte an seinem Gesicht festfrieren konnte. »Noch nicht schießen!«, rief er nach links. »Weitersagen!« Die Nachricht lief die Verteidigungslinie entlang. Er blickte nach rechts und rief den gleichen Befehl. Dann wartete er, eine behandschuhte Hand auf das Ingram-Maschinengewehr unter seinem Mantel gelegt.
Das Fahrzeug passierte ein brennendes Auto und im roten Schein der Flammen konnte man erkennen, dass es sich um einen Lieferwagen handelte, dessen verblichene Lackierung auf beiden Seiten für verschiedene Eiscremesorten warb. Zwei Lautsprecher waren oben auf dem Fahrerhaus montiert und die Windschutzscheibe durch eine Metallplatte ersetzt worden, in der sich zwei schmale Sehschlitze für Fahrer und Beifahrer befanden. Die vordere Stoßstange und den Kühlergrill hatte man mit Metallplatten verstärkt, aus der Panzerung ragten gezackte Metallspitzen, die etwa einen halben Meter lang waren. Das Glas der beiden Scheinwerfer war mit dickem Klebeband verstärkt und mit Maschendraht überzogen. Beide Seiten des Lieferwagens hatten Schießscharten und aus einem provisorisch gefertigten Geschützturm aus Metallblech auf dem Dach ragte der Lauf eines schweren Maschinengewehrs.
Der frisierte Motor des gepanzerten Eiscremewagens schnaufte, als das Gefährt mit kettenbewehrten Reifen über den Kadaver eines Pferdes rollte und etwa 50 Meter vor dem Stacheldraht zum Stehen kam. Die fröhliche Kirmesmusik vom Band lief noch zwei Minuten weiter – und brach dann plötzlich ab.
Die Stille dehnte sich aus. Und dann erklang eine Männerstimme aus dem Lautsprecher: »Franklin Hayes! Hörst du mich, Franklin Hayes?«
Der magere, erschöpfte Mann im Schaffellmantel kniff die Augen zusammen, sagte aber nichts.
»Franklin Hayes!«, fuhr die Stimme in einem spöttischen, singenden Tonfall fort. »Du hast uns einen guten Kampf geliefert, Franklin Hayes! Die Armee des Fortschritts salutiert dir!«
»Fick dich«, murmelte eine zitternde Frau mittleren Alters im Schützengraben neben Hayes. Sie hatte ein Messer im Gürtel und eine Pistole in der Hand. Ein grünes Keloid in der Form eines Seerosenblattes bedeckte ihr Gesicht.
»Du bist ein ausgezeichneter Kommandant, Franklin Hayes! Wir hätten nie gedacht, dass ihr nach Dunning noch genug Kraft hättet, uns zu entkommen. Wir dachten, ihr würdet alle auf dem Highway sterben. Wie viele von euch sind noch übrig, Franklin Hayes? 400? 500? Und wie viele davon können noch kämpfen? Die Hälfte? Die Armee des Fortschritts hat 4000 gesunde Soldaten, Franklin Hayes! Einige von ihnen haben zuvor für dich gelitten, aber dann haben sie entschieden, lieber ihr Leben zu retten und zu uns überzulaufen!«
Weiter links im Graben feuerte jemand sein Gewehr ab; andere Schüsse folgten. Hayes schrie: »Hört auf, eure Kugeln zu verschwenden, verdammt!« Die Schüsse ließen nach und hörten dann ganz auf.
»Deine Soldaten sind nervös, Franklin Hayes!«, spottete die Stimme. »Sie wissen, dass sie sterben werden.«
»Das sind keine Soldaten«, flüsterte Hayes zu sich selbst. »Du verfluchter Irrer, wir sind keine Soldaten!« Wie seine Gemeinschaft von Überlebenden – einst mehr als 1000 Menschen, die versuchten, die Stadt Scottsbluff wiederaufzubauen – in diesen irrsinnigen ›Krieg‹ hineingeraten war, hatte er bis heute nicht begriffen. Ein Lieferwagen, gefahren von einem stämmigen rotbärtigen Mann, war eines Tages nach Scottsbluff gekommen, und ein anderer, zerbrechlich aussehender Mann war ausgestiegen. Sein ganzes Gesicht war von einem Verband verhüllt gewesen – bis auf die Augen, die hinter einer dicken Fliegerbrille steckten. Der Mann mit dem Verband hatte mit einer hohen, jungen Stimme gesprochen und erklärt, er habe vor langer Zeit schwere Verbrennungen erlitten. Er bat um Wasser und einen Platz für die Nacht, ließ aber nicht zu, dass Dr. Gardner seine Verbände auch nur berührte. Hayes, damals Bürgermeister von Scottsbluff, hatte den jungen Mann auf einen Rundgang geführt und ihm alles gezeigt, was sie in der Stadt wieder aufbauten. Irgendwann in der Nacht waren die beiden Männer wieder abgefahren, und drei Tage später war Scottsbluff überfallen und bis auf die Grundmauern niedergebrannt worden. Die Schreie seiner Frau und seines Sohnes hallten noch immer in Hayes’ Ohren. Und dann hatte Hayes die Überlebenden nach Osten geführt, um den Wahnsinnigen zu entfliehen, die hinter ihnen her waren – aber die ›Armee des Fortschritts‹ hatte mehr Autos, Lastwagen, Pferde, Wohnwagen und Benzin als sie, mehr Waffen und Munition und ›Soldaten‹, und die Gruppe, die Hayes folgte, ließ Hunderte von Toten hinter sich zurück.
Es war ein nicht enden wollender fiebriger Albtraum. Einst war Hayes ein angesehener Professor für Wirtschaftslehre gewesen und jetzt fühlte er sich wie eine Ratte, die in der Falle saß.
Die Scheinwerfer des gepanzerten Eiscremewagens funkelten wie boshafte Augen. »Die Armee des Fortschritts lädt alle körperlich gesunden Männer, Frauen und Kinder, die nicht länger leiden wollen, ein, sich uns anzuschließen«, dröhnte die Lautsprecherstimme weiter. »Steigt nur über den Zaun und geht nach Westen, dann wird man sich um euch kümmern – wir haben warmes Essen für euch, ein Bett, eine Unterkunft und Sicherheit. Bringt eure Waffen und eure Munition mit, aber richtet die Läufe eurer Waffen auf den Boden. Wenn ihr körperlich und geistig gesund und nicht mit dem Kainsmal gezeichnet seid, heißen wir euch voller Liebe und mit offenen Armen willkommen. Ihr habt fünf Minuten, um euch zu entscheiden.«
Das Kainsmal, dachte Hayes grimmig. Diesen Ausdruck hatte er schon einmal aus diesen verdammten Lautsprechern gehört; damit waren die Keloide und die Wucherungen gemeint, mit denen die Gesichter vieler Menschen bedeckt waren. Sie wollten nur die ›Ungezeichneten‹ und ›Gesunden‹. Aber was war mit dem jungen Mann mit der dicken Brille und dem verbundenen Gesicht? Warum hatte er diesen Verband getragen, wenn er nicht ›vom Kainsmal gezeichnet‹ war?
Wer auch immer diese Bande von Plünderern und Vergewaltigern anführte, hatte alles Menschliche weit hinter sich gelassen. Irgendwie war es ihm – oder ihr – gelungen, den Köpfen von über 4000 Gefolgsleuten eine brutale Blutgier einzuimpfen, und jetzt töteten, plünderten und brandschatzten sie aus reiner Lust am Zerstören.
Weiter rechts hörte man einen Ruf. Zwei Männer kletterten durch den Stacheldraht; sie rissen sich Mäntel und Hosen auf, kamen aber durch und rannten nach Westen, die Läufe ihrer Gewehre zum Boden gerichtet. »Feiglinge!«, rief jemand. »Ihr dreckigen Feiglinge!« Aber die beiden Männer schauten nicht zurück.
Eine Frau lief hinüber, gefolgt von einem weiteren Mann. Dann sprangen ein Mann, eine Frau und ein Junge aus dem Graben und flohen nach Westen, alle samt Waffen und Munition. Wütende Rufe und Schimpfworte wurden ihnen hinterhergerufen, aber Hayes machte ihnen keinen Vorwurf. Keiner von ihnen hatte Keloide; warum sollten sie bleiben und sich abschlachten lassen?
»Kommt nach Hause«, säuselte es aus dem Lautsprecher wie die verführerischen Versprechungen eines Erweckungspredigers. »Kommt zu uns, zu unserer Liebe und unseren offenen Armen. Verlasst das Kainsmal und kommt nach Hause … kommt nach Hause … kommt nach Hause.«
Noch mehr Leute überkletterten den Stacheldraht. Sie verschwanden nach Westen in die Dunkelheit.
»Ihr müsst nicht zusammen mit den Unreinen leiden! Kommt nach Hause, verlasst das Kainsmal!«
Ein Schuss war zu hören und einer der Scheinwerfer des gepanzerten Wagens zersplitterte, aber der Maschendraht lenkte die Kugel ab und das Licht brannte weiter. Immer noch stiegen Leute über den Stacheldraht und rannten nach Westen.
»Ich gehe nirgendwohin«, sagte die Frau mit dem Seerosenkeloid zu Hayes. »Ich bleibe hier.«
Der Letzte, der ging, war ein Teenager mit einer Schrotflinte. Die Taschen seines Mantels waren vollgestopft mit Patronen.
»Es ist so weit, Franklin Hayes!«, rief die Stimme.
Hayes zog die Ingram unter seinem Mantel hervor und entsicherte sie.
»Es ist so weit!«, schrie die Stimme – und in den Schrei stimmte ein anderes Gebrüll ein, übertönte es, vermischte sich damit und verschmolz zu einem einzigen, unmenschlichen Kriegsschrei. Aber es war das Gebrüll von anspringenden Motoren, die stotternd und spuckend zu lärmigem Leben erwachten. Und dann gingen die Scheinwerfer an – Dutzende, Hunderte von Scheinwerfern, die in einem Bogen zu beiden Seiten des Highway 2 standen, dem Schützengraben gegenüber. Mit hilflosem Entsetzen erkannte Hayes, dass die anderen gepanzerten Lastwagen, Sattelschlepper und aufgemotzten Fahrzeuge heimlich bis fast an die Stacheldrahtbarriere geschoben worden waren, während der Eiscremewagen sie abgelenkt hatte. Die Strahlen der Scheinwerfer bohrten sich in die Gesichter der Menschen im Graben, als die Motoren hochgedreht wurden und die mit Ketten geschützten Reifen knirschend über Schnee und gefrorene Leichen walzten.
Hayes sprang auf, um »Feuer!« zu rufen, aber das Gefecht hatte bereits begonnen. Mündungsfeuer blitzten den ganzen Graben entlang auf; Kugeln prallten pfeifend von Schutzblechen, Kühlerpanzerungen und Geschütztürmen ab. Immer noch rollten die Kampfwagen vorwärts, fast schon gemächlich, und noch hatte die Armee des Fortschritts nicht das Feuer eröffnet. »Setzt die Bomben ein!«, schrie Hayes, aber über den Tumult war seine Stimme nicht zu hören. Doch den Grabenkämpfern musste nicht erst befohlen werden, nach den benzingefüllten Flaschen zu greifen, von denen jeder drei neben sich liegen hatte, die benzingetränkten Lappen an das Feuer der Ölfässer zu halten und die improvisierten Bomben auf die Angreifer zu schleudern.
Die Flaschen explodierten und ließen brennende Benzinzungen über den Schnee peitschen, aber in dem unsteten roten Flackern rückten die gepanzerten Monster unversehrt weiter vor, und jetzt rollten einige auch schon über den Stacheldraht wenige Meter vor dem Schützengraben. Eine Flasche landete genau im Sichtschlitz der gepanzerten Windschutzscheibe eines Pinto; sie zersplitterte und verspritzte brennendes Benzin. Der Fahrer sprang heraus, schreiend und mit brennendem Gesicht. Er taumelte auf den Draht zu und Franklin Hayes erschoss ihn mit seiner Ingram. Der Pinto rollte weiter, durchbrach die Barrikade und begrub vier Menschen unter sich, die nicht mehr rechtzeitig aus dem Graben klettern konnten.
Die Fahrzeuge zerfetzten die Stacheldrahtbarriere und plötzlich feuerten Gewehre, Pistolen und Maschinengewehre aus den selbst gebauten Geschütztürmen und Schießscharten und überzogen den Schützengraben mit einem Kugelhagel. Hayes’ Leute versuchten zu fliehen, Dutzende rutschten zurück in den Graben oder blieben bewegungslos im schmutzigen, blutigen Schnee liegen. Eins der brennenden Ölfässer kippte um und entzündete unbenutzte Molotowcocktails, die sofort im Graben explodierten. Überall gab es Brände und pfeifende Kugeln, sich krümmende Leiber, Schreie und allgemeines Chaos. »Rückzug!«, schrie Franklin Hayes. Die Verteidiger flohen zur zweiten Barrikade etwa 50 Meter zurück – eine anderthalb Meter hohe Mauer aus Steinen, Holzbalken und den gefrorenen Leichen ihrer Freunde und Verwandten, aufgestapelt wie Kaminholz.
Franklin Hayes sah Soldaten zu Fuß, die rasch hinter der ersten Welle der Fahrzeuge vorrückten. Der Graben war breit genug, dass jedes Fahrzeug, das ihn zu überqueren versuchte, darin stecken blieb, aber die Infanterie der Armee des Fortschritts würde sich nicht von ihm aufhalten lassen – und durch den Qualm und das Schneegestöber sah es aus, als wären es Tausende. Hayes hörte ihren Kriegsschrei – ein tiefes, animalisches Grollen, das die Erde zu erschüttern schien.
Plötzlich starrte ihm der gepanzerte Kühler eines Lastwagens ins Gesicht. Er kletterte aus dem Graben, während das Fahrzeug einen halben Meter davor anhielt. Eine Kugel pfiff an seinem Kopf vorbei und er stolperte über die Leiche der Frau mit dem seerosenförmigen Keloid. Und dann war er auf den Beinen und rannte, Kugeln schlugen dumpf in den Schnee um ihn herum ein, und er kletterte über die Mauer aus Steinen und Leichen und wirbelte herum, um sich wieder den Angreifern zu stellen.
Explosionen rissen die Mauer auseinander, Metallsplitter flogen durch die Luft. Hayes sah, dass sie Handgranaten einsetzten – die sie sich bis jetzt aufgespart hatten –, und feuerte weiter auf rennende Gestalten, bis die Ingram so heiß war, dass er Blasen an den Fingern bekam.
»Auf der rechten Seite sind sie durchgebrochen!«, rief jemand. »Sie kommen rein!«
Menschen liefen in alle Richtungen. Hayes wühlte in seiner Jackentasche, fand ein frisches Magazin und legte es ein. Einer der feindlichen Soldaten sprang über die Mauer und Hayes hatte gerade noch Zeit zu sehen, dass sein Gesicht mit so etwas wie indianischer Kriegsbemalung beschmiert war, bevor der Mann herumwirbelte und einer Frau, die ein paar Meter weiter kämpfte, ein Messer in die Seite rammte. Hayes schoss ihn in den Kopf und feuerte auch noch weiter, als der Mann zusammenzuckte und zu Boden fiel.
»Lauft! Zurück!«, schrie jemand. Andere Stimmen, andere Schreie durchbrachen den allgemeinen Lärmpegel: »Wir können sie nicht aufhalten! Sie brechen durch!«
Ein Mann, dem Blut übers Gesicht lief, packte Hayes am Arm. »Mr. Hayes!«, rief er. »Sie brechen durch! Wir können sie nicht mehr aufha…«
Er wurde von einer Axt unterbrochen, die sich in seinen Schädel grub.
Hayes stolperte zurück. Die Ingram fiel ihm aus den Händen und er sank auf die Knie.
Die Axt wurde losgerissen und der Tote fiel in den Schnee.
»Franklin Hayes?«, fragte eine leise, fast schon sanfte Stimme.
Eine langhaarige Gestalt ragte vor ihm auf, ihr Gesicht konnte er nicht erkennen. Er war todmüde, vollkommen erschöpft. »Ja«, antwortete er.
»Zeit, schlafen zu gehen«, sagte der Mann und hob die Axt.
Als sie herabsauste, sprang ein Zwerg, der auf der eingerissenen Mauer gehockt hatte, auf und klatschte in die Hände.
50
Ein verbeulter Jeep mit nur noch einem funktionierenden Scheinwerfer tauchte aus dem Schneegestöber des Missouri Highway 63 auf und rollte in das, was von der kleinen Stadt übrig war. Lampen leuchteten in einigen der Holzhäuser, ansonsten beherrschte Dunkelheit die Straße.
»Halt da mal an.« Sister deutete auf ein Ziegelsteingebäude auf der rechten Seite. Die Fenster des Gebäudes waren mit Brettern vernagelt, aber auf einer Schotterfläche vor dem Haus standen mehrere alte Pkws und Pick-ups. Als Paul Thorson den Jeep auf den Parkplatz lenkte, schweifte der Scheinwerfer über eine Aufschrift, die in roter Farbe auf einem der verrammelten Fenster stand: Gasthaus zum Bluteimer.
»Äh … sicher, dass du hier anhalten willst?«, fragte Paul.
Sie nickte. Ihr Kopf wurde von der Kapuze eines dunkelblauen Parkas verhüllt. »Wo es Autos gibt, müsste auch jemand wissen, wo man Benzin bekommen kann.« Sie warf einen Blick auf die Tankanzeige. Die Nadel näherte sich dem roten Bereich. »Vielleicht kriegen wir auch heraus, wo zur Hölle wir eigentlich sind.«
Paul stellte die Heizung ab, dann den Scheinwerfer und den Motor. Er trug seine altbewährte Lederjacke über einem roten Wollpullover, dazu einen Schal um seinen Hals und eine braune Wollmütze auf dem Kopf. Sein Bart war aschgrau, ebenso der Großteil seines Haars, aber seine stahlgrauen Augen leuchteten noch kräftig und ungetrübt aus seinem tief gefurchten, wettergegerbten Gesicht. Mit einem unbehaglichen Blick auf die Schrift am Fenster stieg er aus dem Jeep. Sister griff nach hinten in das Gepäckfach, wo ein Sortiment an Stofftaschen, Pappkartons und Kisten mit Kette und Vorhängeschloss gesichert war. Direkt hinter ihrem Sitz lag eine abgewetzte braune Umhängetasche aus Leder, die sie jetzt aufhob und mitnahm.
Durch die Tür hörte man das Geklimper eines verstimmten Klaviers und raues Männerlachen. Paul atmete tief durch, schob die Tür auf und ging hinein, dicht gefolgt von Sister. Die Tür, die mit straffen Federn am Rahmen befestigt war, schlug hinter ihnen zu.
Sofort brachen Musik und Gelächter ab. Misstrauische Augen musterten die Neuankömmlinge.
In der Mitte des Raumes, neben einem frei stehenden gusseisernen Ofen, spielten sechs Männer an einem Tisch Karten. Gelber Dunst vom Qualm der selbst gedrehten Zigaretten hing in der Luft und trübte das Licht einiger Lampen, die an Haken an der Wand hingen. Andere Tische waren von zwei oder drei weiteren Männern und ein paar derb aussehenden Damen besetzt. Ein Barkeeper in einer mit Fransen besetzten Lederjacke stand hinter der langen Theke, die mit Einschusslöchern übersät war. In einem Kamin an der hinteren Wand versprühten lodernde Holzscheite rote Funken und am Klavier saß eine stämmige junge Frau mit langem schwarzem Haar und einem violetten Keloid, das die untere Hälfte ihres Gesichtes und ihren Hals bedeckte.
Sister und Paul fiel auf, dass die meisten Männer Waffen am Gürtel trugen und dass an ihren Stühlen Gewehre lehnten.
Der Boden war zentimeterhoch mit Sägespänen bedeckt, und die Kneipe roch nach ungewaschenen Leibern. Es gab ein scharfes Ping, als einer der Männer am Kartentisch Tabaksaft in einen Eimer spuckte.
»Wir haben uns verfahren«, sagte Paul. »Wie heißt diese Stadt?«
Ein Mann lachte. Er hatte fettiges schwarzes Haar und trug einen Mantel, der aussah, als bestünde er aus Hundefell. Er blies den Rauch einer braunen Zigarette in die Luft. »In welche Stadt wollen Sie denn, Kumpel?«
»Wir haben kein Ziel. Ist dieser Ort auf der Karte?«
Die Männer wechselten amüsierte Blicke, einige lachten. »Welche Karte meinen Sie?«, fragte der mit dem fettigen Haar. »Von vor dem 17. Juli oder danach?«
»Davor.«
»Die Davor-Karten taugen nichts«, sagte ein anderer Mann. Er hatte ein knochiges Gesicht und war fast kahl geschoren. Vier Angelhaken hingen an seinem linken Ohrläppchen und er trug eine Lederweste über einem rot karierten Hemd. An seiner mageren Hüfte hing ein Halfter mit Pistole. »Alles hat sich verändert. Städte sind zu Friedhöfen geworden. Flüsse sind über die Ufer getreten, haben ihren Lauf geändert und sind eingefroren. Seen sind ausgetrocknet. Wo Wälder waren, ist jetzt Wüste. Deshalb taugen die Davor-Karten nichts.«
Das war Paul alles bekannt. Nach sieben Jahren Reise auf einem Zickzackkurs durch ein Dutzend Staaten gab es nur wenig, was ihn oder Sister noch schockieren konnte. »Hatte diese Stadt früher mal einen Namen?«
»Moberly«, antwortete der Barkeeper. »Moberly, Missouri. Hier haben mal 15.000 Menschen gelebt. Schätze, jetzt sind’s noch 300 oder 400.«
»Yeah, aber ’s waren nicht die Bomben, die sie umgebracht haben!«, rief eine runzlige Frau mit rotem Haar und roten Lippen von einem anderen Tisch. »Es ist der Rachenputzer, den du hier verkaufst, Derwin!« Sie gackerte und hob ein Glas mit einer ölig aussehenden Flüssigkeit an ihre Lippen, während die anderen lachten und johlten.
»Ah, du mich auch, Lizzie!«, gab Derwin zurück. »Deinen Rachen putzt du dir doch schon, seit du zehn warst.«
Sister ging zu einem unbesetzten Tisch und legte ihre Tasche darauf. Ihr Gesicht unter der Kapuze des Parkas war zum größten Teil von einem dunkelgrauen Schal verhüllt. Sie öffnete die Tasche, holte den ramponierten und tausendmal gefalteten Rand-McNally-Straßenatlas heraus, strich ihn glatt und schlug die Karte von Missouri auf. Im dämmrigen Licht der Schänke fand sie die dünne rote Linie des Highway 63 und folgte ihr bis zu einem Punkt namens Moberly, etwa 120 Kilometer nördlich des Kraters von Jefferson City. »Hier sind wir«, sagte sie zu Paul, der über ihre Schulter blickte.
»Großartig«, meinte er grimmig. »Und was sagt uns das? In welche Richtung müssen wir von …?«
Plötzlich wurde die Umhängetasche vom Tisch geschnappt. Sister blickte erschrocken auf.
Der knochengesichtige Mann mit der Lederweste hatte die Tasche. Er wich mit einem Grinsen auf seinem schmallippigen Mund zurück. »Seht mal, was ich hier hab, Jungs!«, rief er. »’ne hübsche neue Tasche!«
Sister rührte sich nicht. »Gib sie mir zurück«, sagte sie, leise, aber nachdrücklich.
»Hab was gefunden, wo ich reinscheißen kann, wenn’s im Wald zu kalt ist!«, fuhr der Mann fort und die anderen am Tisch lachten. Seine kleinen schwarzen Augen richteten sich herausfordernd auf Paul.
»Hör auf mit dem Scheiß, Earl!«, schimpfte Derwin. »Was willst du mit dem Ding?«
»Och, nur mal sehen, was da so drin ist!« Earl steckte die Hand in die Tasche und sie kam mit Socken, Schals und Handschuhen wieder hervor. Dann wühlte er noch tiefer und zog einen Ring aus Glas heraus.
Er leuchtete blutrot in seiner Hand; Earl starrte ihn mit offenem Mund an.
Die Gaststube war totenstill bis auf das Knacken der Holzscheite im Kamin.
Die alte Rothaarige erhob sich langsam von ihrem Stuhl. »Heilige Mutter Gottes«, flüsterte sie.
Die Männer am Spieltisch gafften, und die Schwarzhaarige stand von ihrem Klavierhocker auf und humpelte näher.
Earl hielt sich den Ring vor das Gesicht und sah zu, wie die Farben an- und abschwollen wie Blut, das durch Adern floss. Aber sein Griff um den Ring erzeugte brutale Farbtöne: schlammiges Braun, öliges Gelb und Tiefschwarz.
»Das gehört mir.« Sisters Stimme wurde von ihrem Schal gedämpft. »Bitte gib es mir zurück.«
Paul trat einen Schritt vor. Earls Hand schnellte mit dem Reflex eines Revolverhelden zum Griff seiner Pistole und Paul blieb stehen. »Hab ’n Spielzeug gefunden – hübsch, nicht?«, fragte Earl. Der Ring pulsierte jetzt schneller, wurde von Sekunde zu Sekunde dunkler und hässlicher. Alle Spitzen bis auf zwei waren im Lauf der Jahre abgebrochen. »Edelsteine!«, staunte Earl, als ihm klar wurde, woher die Farben kamen. »Das Ding muss ’n gottverdammtes Vermögen wert sein!«
»Ich habe dich gebeten, es mir zurückzugeben«, sagte Sister.
»Ich hab hier ’n verdammtes Vermögen in der Hand!«, rief Earl. Seine Augen funkelten gierig. »Ich brech das Scheißding auf und hol die Klunker raus, dann bin ich reich!« Er grinste irre, hielt den Ring über seinen Kopf und stolzierte um seine Freunde am Tisch herum. »Seht her! Ich hab ’n Heiligenschein, Jungs!«
Paul trat einen weiteren Schritt vor und sofort wirbelte Earl zu ihm herum. Die Pistole glitt aus dem Halfter.
Aber Sister war schneller. Die abgesägte Schrotflinte, die sie unter ihrem Parka hervorgezogen hatte, donnerte wie ein Machtwort Gottes.
Earl wurde hochgerissen und flog durch die Luft. Sein Körper segelte krachend über mehrere Tische, während sein eigener Schuss ein paar Splitter aus einem Holzbalken über Sisters Kopf schlug. Er landete in einem zerknitterten Haufen auf dem Boden, eine Hand noch immer um den Ring gelegt. Die trüben Farben pulsierten wild.
Der Mann mit dem Hundefellmantel machte Anstalten, sich zu erheben. Sister pumpte eine neue Patrone in die qualmende Kammer, fuhr herum und hielt ihm die Mündung an den Hals. »Willst du auch?« Er schüttelte den Kopf und sank wieder auf seinen Stuhl zurück. »Waffen auf den Tisch«, befahl sie – und acht Handfeuerwaffen wurden auf die schmierigen Karten und Münzen in der Tischmitte geworfen.
Paul hatte den Hahn seiner 357er Magnum gespannt und wartete ab. Aus den Augenwinkeln sah er eine Bewegung des Barkeepers und richtete die Waffe auf den Kopf des Mannes. Derwin hob die Hände. »Ganz ruhig, Freund«, sagte der Barkeeper nervös. »Ich will noch ’n bisschen leben, okay?«
Das Pulsieren des Glasrings wurde langsamer und schwächer. Paul ging seitwärts zu dem Sterbenden hinüber, während Sister mit der abgesägten Flinte die anderen in Schach hielt. Die Waffe hatte sie vor drei Jahren in einer verlassenen Dienststelle der Highway-Polizei gefunden; sie besaß genug Durchschlagskraft, um einen Elefanten umzuhauen. Sie hatte sie bisher nur ein paarmal benutzen müssen, mit dem gleichen Ergebnis wie jetzt.
Paul versuchte, nicht in die große Blutlache zu treten. Eine Fliege summte an seinem Gesicht vorbei und schwebte über dem Ring. Sie war groß und grün, ein hässliches Biest, und einen Moment lang war Paul verblüfft, denn seit Jahren hatte er keine Fliegen mehr gesehen; er hatte geglaubt, sie seien alle tot. Eine zweite Fliege gesellte sich zur ersten und gemeinsam umschwirrten sie den zuckenden Körper und den Glasring.
Paul bückte sich. Der Ring leuchtete für einen Moment rot auf – und wurde dann schwarz. Paul wand ihn aus dem Griff des Toten, und als er ihn in seiner Hand hielt, kehrten sofort die Regenbogenfarben zurück. Er steckte ihn wieder in die Umhängetasche und bedeckte ihn mit den Socken, Schals und Handschuhen. Eine Fliege landete auf seiner Wange; er zuckte mit dem Kopf, denn es fühlte sich an, als werde ihm ein gefrorener Nagel in die Haut gebohrt.
Auch den Straßenatlas steckte er zurück in die Tasche. Alle Augen ruhten auf der Frau mit der Schrotflinte. Sie nahm ihre Tasche und wich langsam zur Tür zurück, die Waffe weiter auf den Kartentisch gerichtet. Ihr war nichts anderes übrig geblieben, als den Mann zu töten; den Glasring hatte sie jetzt schon zu lange, um ihn von irgendeinem dahergelaufenen Idioten kaputt machen zu lassen.
»He«, meinte der Mann mit dem Hundefellmantel. »Ihr wollt doch wohl nicht gehen, ohne dass wir euch einen ausgeben, oder?«
»Was?«
»Earl war ein Arschloch«, meldete sich ein anderer zu Wort. Er beugte sich zur Seite und spuckte Tabaksaft in den Eimer. »Der schießwütige Idiot hat dauernd Leute umgelegt.«
»Jimmy Ridgeway hat er genau hier erschossen, vor ’n paar Monaten«, sagte Derwin. »Der Bastard war einfach zu gut mit seiner Knarre.«
»Bis jetzt«, fügte der andere hinzu. Die Kartenspieler teilten bereits die Münzen des Toten unter sich auf.
»Bitte schön.« Derwin nahm zwei Gläser und zapfte eine ölige bernsteinfarbene Flüssigkeit aus einem Fässchen. »Selbstgebrannter. Schmeckt ’n bisschen komisch, vertreibt aber Kummer und Sorgen.« Er stellte die Gläser vor Paul und Sister auf die Theke. »Geht aufs Haus.«
Es war Monate her, seit Paul das letzte Mal Alkohol getrunken hatte. Der kräftige, holzige Geruch des Zeugs schwebte zu ihm herüber wie das verlockende Parfüm einer Sirene. Er war noch ganz zittrig von dem, was geschehen war; seine Magnum hatte er noch nie gegen einen Menschen eingesetzt und er betete, dass es auch so blieb. Paul nahm das Glas. Er hatte das Gefühl, dass die Alkoholdünste ihm die Augenbrauen versengten, aber er trank trotzdem.
Es war, als würde er mit geschmolzenem Metall gurgeln. Tränen traten ihm in die Augen. Er hustete, spuckte und keuchte, als das Gebräu – Gott allein wusste, woraus es gebrannt war – seinen Rachen hinablief. Die Rothaarige gackerte wie eine Krähe und einige der Männer lachten laut los.
Während Paul noch versuchte, zu Atem zu kommen, stellte Sister die Umhängetasche auf den Boden – nicht zu weit weg – und hob das andere Glas. Der Barkeeper sagte: »Yeah, im Grunde habt ihr dem alten Earl Hocutt nur ’n Gefallen getan. Seit seine Frau und die Kleine letztes Jahr am Fieber gestorben sind, hatte er’s regelrecht drauf angelegt, mal bei ’ner Schießerei draufzugehen.«
»Ist das so?«, fragte Sister und zog sich den Schal vom Gesicht. Sie hob das Glas an ihre deformierten Lippen und trank, ohne mit der Wimper zu zucken.
Derwins Augen wurden groß. Er wich so schnell zurück, dass er ein Regal mit Gläsern und Bierkrügen umstieß.
51
Sister war auf diese Reaktion vorbereitet. Sie hatte sie schon viele Male erlebt. Gemächlich nahm sie noch einen Schluck von dem Selbstgebrannten und fand ihn nicht schlechter oder besser als so manches Gesöff, das sie in den Straßen von Manhattan getrunken hatte. Sie spürte, dass alle in der Bar sie angafften. Wollt ihr mehr sehen?, dachte sie. Wollt ihr es euch mal ganz genau anschauen? Sie stellte das Glas ab und drehte sich um, damit alle sie sehen konnten.
Die Rothaarige hörte abrupt auf zu gackern, als hätte sie einen Schlag an die Kehle bekommen.
»Gott Allmächtiger«, krächzte der Tabakkauer, nachdem er seinen Tabaksaft verschluckt hatte.
Die untere Hälfte von Sisters Gesicht war ganz mit grauen Hautwucherungen bedeckt. Knotige Fasern überzogen, teilweise ineinander verflochten, ihr Kinn und ihre Wangen. Die harten Wucherungen schoben Sisters Mund etwas nach links und verliehen ihr ein sardonisches Grinsen. Ihr Schädel unter der Kapuze des Parkas war eine einzige schorfige Kruste; die Wucherungen hatten ihre Kopfhaut vollständig umschlossen und schickten nun erste graue Ausläufer über ihre Stirn und beide Ohren.
»Eine Aussätzige!« Einer der Kartenspieler sprang auf die Beine. »Sie hat Lepra!«
Die Erwähnung dieser gefürchteten Krankheit ließ auch die anderen aufspringen. Sie vergaßen Waffen, Karten und Münzen und wichen vor Sister zurück. »Verschwinde von hier!«, schrie ein anderer. »Steck uns nicht mit dem Scheiß an!«
»Aussätzige! Aussätzige!«, kreischte das rothaarige Weib und griff nach einem Bierkrug, um ihn auf Sister zu werfen. Es gab noch andere Rufe und Drohungen, aber Sister blieb ungerührt. Das war nur die übliche Reaktion, wenn sie gezwungen war, ihr Gesicht zu enthüllen.
Über dem Tumult der Stimmen hörte man ein lautes, durchdringendes Krack! … Krack! … Krack!
Eingerahmt vom Feuerschein des Kamins stand eine schmale Gestalt an der gegenüberliegenden Wand und schlug beharrlich mit einer hölzernen Krücke auf eine der Tischplatten. Nach und nach setzte sich der rhythmische Laut durch, bis eine unbehagliche Stille in der Schänke herrschte.
»Gentlemen … und Ladies«, sagte der Mann mit der Krücke mit krächzender Stimme, »ich kann Ihnen versichern, dass das Gebrechen unserer Freundin dort keine Lepra ist. Tatsächlich glaube ich nicht, dass es auch nur im Geringsten ansteckend ist – es ist also nicht nötig, dass Sie sich Ihre Unterwäsche ruinieren.«
»Was weißt du denn schon, Drecksack?«, fuhr ihn der Mann mit dem Hundefellmantel an.
Die Gestalt schwieg einen Moment, dann schob sie sich die Krücke unter die linke Achsel und humpelte vorwärts. Das linke Hosenbein des Mannes war direkt über dem Knie hochgesteckt. Er trug einen zerlumpten braunen Mantel über einem schmutzigen beigen Strickpullover, an den Händen hatte er Handschuhe, die so abgetragen waren, dass die Finger herausschauten.
Er trat in den Lampenschein. Silbernes Haar floss in Wellen um sein Gesicht, allerdings war die Mitte seines Schädels kahl und von braunen Keloiden überzogen. Er hatte einen kurzen grau melierten Bart und fein geschnittene Gesichtszüge, eine schmale, elegante Nase. Eigentlich war er ein recht gut aussehender Mann, fand Sister – abgesehen von dem leuchtenden purpurfarbenen Keloid, das die eine Hälfte seines Gesichts bedeckte wie ein Portweinfleck. Er blieb zwischen Sister, Paul und den anderen stehen. »Mein Name lautet nicht ›Drecksack‹«, sagte er mit der Würde verletzter Vornehmheit. Seine tief liegenden, gepeinigten grauen Augen richteten sich auf den Mann im Hundefellmantel. »Früher kannte man mich als Hugh Ryan. Doktor Hugh Ryan, Chirurg am Amarillo Medical Center in Amarillo, Texas.«
»Du willst Arzt sein?«, schnaubte der andere. »Blödsinn.«
»Mein gegenwärtiger Lebensstandard veranlasst diese Gentlemen zu der Vermutung, ich sei mit einem unheilbaren Durst geboren worden«, sagte Ryan zu Sister. Er hob eine zitternde Hand. »Natürlich bin ich nicht mehr in der Verfassung, ein Skalpell zu führen. Aber andererseits – wer ist das schon?« Er humpelte zu Sister und berührte ihr Gesicht; der Geruch seines ungewaschenen Körpers raubte ihr beinahe den Atem, aber sie hatte auch schon Schlimmeres gerochen. »Das ist keine Lepra«, wiederholte er. »Es ist eine Masse faserigen Gewebes von subkutanem Ursprung. Wie tief die faserige Schicht reicht, weiß ich nicht – aber ich habe diesen Befund schon viele Male gesehen, und meiner Überzeugung nach ist es nicht ansteckend.«
»Wir haben auch schon andere damit gesehen«, meinte Paul. Er war an Sisters Aussehen gewöhnt, da es sich erst nach und nach so entwickelt hatte. Angefangen hatte es mit den schwarzen Warzen in ihrem Gesicht. Paul untersuchte immer wieder sein eigenes Gesicht und seinen Kopf danach, aber bislang war er nicht davon befallen. »Was ist die Ursache dafür?«
Hugh Ryan zuckte die Schultern, während er weiter Sisters Wucherungen abtastete. »Vielleicht ist es eine Hautreaktion auf Strahlung, Umweltgifte, fehlendes Sonnenlicht – wer weiß? Oh, ich habe vielleicht 100 oder mehr Menschen mit diesen Symptomen gesehen, in vielen unterschiedlichen Stadien. Glücklicherweise scheint immer eine kleine Lücke zum Atmen und zum Essen zu bleiben, wie ernst das Krankheitsbild auch ist.«
»Ich bleib dabei, es ist Lepra!«, behauptete die Rothaarige, aber die Männer hatten sich bereits wieder beruhigt und kehrten an den Kartentisch zurück. Ein paar von ihnen verließen die Kneipe, die anderen starrten Sister weiter mit morbider Faszination an.
»Es juckt wie verrückt und manchmal tut mir der Kopf weh, als würde er gleich platzen«, sagte Sister. »Wie werde ich es wieder los?«
»Da bin ich leider überfragt. Ich habe nie erlebt, dass sich eine Hiobsmaske wieder zurückbildet – aber andererseits habe ich auch nie einen Fall über längere Zeit beobachten können.«
»Hiobsmaske? Nennt man es so?«
»Na ja, so nenne ich es. Passt doch, oder?«