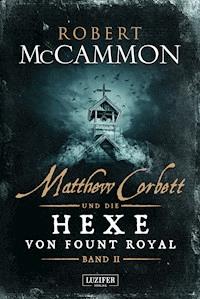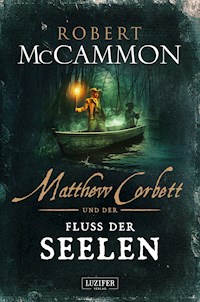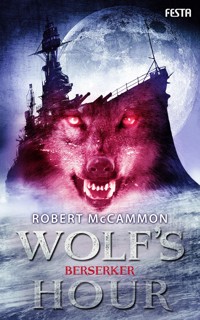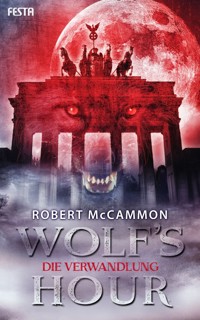
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der bissige und blutige US-Bestseller. 1944. D-Day steht kurz bevor. Für Nazideutschland wird die Luft immer dünner. Doch Hitlers Wissenschaftler arbeiten an einer geheimen Wunderwaffe, die die Invasion mit einem Schlag beenden könnte. Die letzte Hoffnung der Alliierten liegt auf den Schultern eines Mannes: Michael Gallatin. Er ist ein Meisterspion a la James Bond – und ein Werwolf! Das zweibändige Epos über Michael Gallatin. Als Junge erlebt er den Mord an seinen Eltern mit und flieht in die russischen Wälder. Dort trifft er auf ein Wolfsrudel – doch die Wölfe lassen das Menschenkind leben und weisen es in die Geheimnisse der Lycanthropie ein. Wer sind die wahren Monster? Die Wölfe oder vielleicht doch die Menschen? Stephen King: 'Robert McCammon ist einer der besten Horror- und Thrillerautoren.'
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
#
Aus dem Englischen von Manfred Sanders
Prolog
1
Der Krieg dauerte an.
Im Februar 1941 war er wie ein Flächenbrand vom europäischen Kontinent auf die Küste Nordwestafrikas übergesprungen, als der Befehlshaber von Hitlers Truppen, ein fähiger Offizier namens Erwin Rommel, zur Unterstützung der Italiener in Tripolis landete und begann, die Briten zum Nil zurückzudrängen.
Entlang der Küstenstraße von Bengasi über El Agheila, Adschdabiya und Mechili marschierte die Panzerarmee mit ihren Fahrzeugen und Soldaten durch ein Land der Sandstürme und der unerträglichen Hitze, entlang an Wasserrinnen, die den Geschmack des Regens vergessen hatten, und schroffen Abhängen, die steil zu endlosen leeren Ebenen abfielen. Die geballte Masse aus Soldaten, Panzerabwehrwaffen, Lastwagen und Panzern rückte nach Osten vor, eroberte am 20. Juni 1942 die Festung Tobruk von den Briten und näherte sich der verlockenden Trophäe, die Hitler so sehr begehrte: dem Suezkanal. Die Kontrolle über diesen wichtigen Wasserweg wäre ein herber Schlag für die alliierte Schifffahrt und würde es Nazideutschland ermöglichen, den Marsch nach Osten fortzusetzen, um in den weichen Unterleib Russlands vorzustoßen.
Die erschöpften Soldaten der britischen Achten Armee schleppten sich in den letzten brütend heißen Tagen des Junis 1942 zu einer Eisenbahnstation, die El Alamein hieß. In ihrem Kielwasser legten die Pioniere eilig komplizierte Muster von Minenfeldern an, in der Hoffnung, die nachrückenden Panzer aufhalten zu können. Es gab Gerüchte, Rommel fehle es an Treibstoff und Munition, aber in ihren Schützenlöchern, die sie sich in die harte weiße Erde gegraben hatten, spürten die Soldaten, wie die Ketten der deutschen Panzer den Boden erbeben ließen. Und während die Sonne vom Himmel brannte und die Geier kreisten, stiegen am westlichen Horizont Staubsäulen auf. Rommel kam nach El Alamein, und er hatte nicht vor, sich sein Festessen in Kairo verwehren zu lassen.
Blutrot ging die Sonne am milchigen Himmel unter. Die Schatten des 30. Juni krochen über die Wüste. Die Soldaten der Achten Armee warteten, während ihre Offiziere in den Zelten schweißfleckige Karten studierten und Pioniertrupps weiter die Minenfelder zwischen den englischen und deutschen Linien verstärkten. Die Sterne kamen heraus und glitzerten am mondlosen Himmel. Unteroffiziere überprüften Munitionsreserven und blafften die Männer an, ihre Schützenlöcher zu säubern – damit sie irgendetwas zu tun hatten, um ihre Gedanken von dem Gemetzel abzulenken, das bei Sonnenaufgang unweigerlich beginnen würde.
Einige Kilometer weiter westlich, wo Aufklärungstrupps mit sandzerkratzten BMW-Motorrädern und Panzerspähwagen am Rande des Minenfeldes durch die Dunkelheit rumpelten, landete ein kleines sandfarbenes Storch-Flugzeug mit fauchenden und Staub aufwirbelnden Propellern auf einem Landestreifen, der von blauen Leuchtfackeln begrenzt wurde. Schwarze Hakenkreuze waren auf die Tragflächen gemalt.
Sobald die Räder der Maschine zum Stillstand gekommen waren, näherte sich von Nordwesten ein offenes Befehlsfahrzeug mit abgeschirmten Scheinwerfern. Ein deutscher Oberstleutnant in der staubigen blassbraunen Uniform des Afrikakorps und mit einer Fliegerbrille zum Schutz gegen den aufgewirbelten Sand stieg aus dem Flugzeug. Er hielt eine abgewetzte braune Aktentasche in der Hand, die mit einer Kette an seinem Handgelenk befestigt war. Zackig salutierte ihm der Fahrer des Wagens und hielt ihm die Beifahrertür auf. Der Pilot wartete im Cockpit des Flugzeugs, auf Anweisung des Offiziers. Dann rumpelte der Geländewagen den Weg zurück, den er gekommen war, und sobald er außer Sicht war, nahm der Pilot einen Schluck aus seiner Feldflasche und versuchte ein bisschen zu schlafen.
Sich durch Sand und scharfkantige Steine wühlend, erklomm der Geländewagen eine kleine Anhöhe. Auf der anderen Seite standen die Zelte und Fahrzeuge eines Aufklärungsbataillons. Alles war dunkel bis auf den schwachen Schimmer von Lampen in den Zelten und das gelegentliche Aufleuchten abgeschirmter Scheinwerfer, wenn ein Motorrad oder ein Panzerwagen auf irgendeiner Mission unterwegs war. Der Geländewagen hielt vor dem größten, zentral gelegenen Zelt, und der Oberstleutnant wartete, bis ihm die Tür aufgehalten wurde, bevor er ausstieg.
Als er zum Zelteingang ging, hörte er das Klappern von Blechdosen. Ein paar magere Hunde durchwühlten den Abfall. Einer von ihnen kam auf ihn zu, mit deutlich vortretenden Rippen und Augen, die hohl waren vor Hunger. Der Oberstleutnant trat nach dem Tier, bevor es ihn erreichte. Sein Stiefel traf den Hund in die Seite und scheuchte ihn zurück, aber das Tier gab keinen Laut von sich. Der Offizier wusste, dass diese Drecksviecher Läuse hatten, und bei der momentanen Wasserknappheit war er nicht scharf darauf, sich die Haut mit Sand abzureiben. Der Hund schlich davon, auf dem Fell noch weitere Stiefelabdrücke, sein Tod durch Verhungern längst entschieden.
Der Offizier blieb vor dem Zelteingang stehen.
Dort draußen war noch etwas. Gleich jenseits der Grenze der Dunkelheit, noch hinter den Hunden, die den Abfall nach Essensresten durchwühlten.
Er konnte die Augen sehen – ein grünes Funkeln, in dem sich das schwache Licht einer Zeltlaterne spiegelte. Sie beobachteten ihn, ohne auch nur einmal zu blinzeln, und in ihnen war kein Ducken oder Betteln. Noch so ein verdammter Eingeborenenhund, dachte der Offizier, obwohl er außer den Augen nichts sehen konnte. Die Hunde folgten den Lagern, und es hieß, sie würden auch Pisse von einem Teller lecken, wenn man sie ihnen hinhielt. Es gefiel ihm nicht, wie diese Bestie ihn beobachtete; die Augen waren kalt und hinterlistig, und er war versucht, seine Luger zu ziehen und dieses Hundebiest in den Moslemhimmel zu schicken. Diese Augen erzeugten ein Kribbeln des Unbehagens in seinem Bauch, denn es war keine Angst in ihnen.
»Oberstleutnant Voigt. Wir haben Sie schon erwartet. Bitte kommen Sie herein.«
Der Zelteingang war zurückgeschlagen worden. Major Stummer, ein Mann mit einem rauen Gesicht, kurz geschnittenen rötlichen Haaren und runden Brillengläsern, salutierte und Voigt erwiderte den Gruß mit einem Nicken. Im Zelt standen drei weitere Offiziere um einen Tisch herum, auf dem mehrere Karten ausgebreitet lagen. Das Laternenlicht beleuchtete die kantigen, sonnengebräunten Germanengesichter, die sich erwartungsvoll Voigt zugewandt hatten. Der Oberstleutnant zögerte am Eingang des Zeltes; sein Blick wanderte nach rechts, vorbei an den mageren, verhungernden Hunden.
Die grünen Augen waren verschwunden.
»Herr Oberstleutnant?«, fragte Stummer. »Stimmt etwas nicht?«
»Nein, nein.« Die Antwort kam zu schnell. Es war dumm, sich von einem Hund aus der Fassung bringen zu lassen. Der Oberstleutnant hatte persönlich in einem Gefecht den Befehl erteilt, mit einer »Acht-Acht« vier britische Panzer zu zerstören, und dabei eine größere Gemütsruhe an den Tag gelegt, als er in diesem Moment verspürte. Wohin war der Hund verschwunden? Hinaus in die Wüste natürlich. Aber warum war er nicht näher gekommen, um wie die anderen im Abfall herumzuschnüffeln? Nun, es war Unsinn, damit seine Zeit zu verschwenden; Rommel hatte ihn hergeschickt, um Informationen einzuholen und zum Hauptquartier der Panzerarmee zu bringen. »Alles in Ordnung, außer dass ich Magengeschwüre habe, einen Hitzeausschlag am Hals und unbedingt mal wieder Schnee sehen muss, bevor ich verrückt werde«, sagte Voigt, als er in das Zelt trat und die Stoffbahn hinter ihm zufiel.
Voigt stand mit Stummer, Major Kleinhorst und den beiden anderen Bataillonsoffizieren am Tisch. Mit seinen harten blauen Augen studierte er die Karten. Sie zeigten die unerbittliche, von tiefen Rillen durchzogene Wüste zwischen Anhöhe 169 – der kleinen Erhebung, über die sie gefahren waren – und den britischen Stellungen. Rot eingezeichnete Kreise markierten Minenfelder, und blaue Quadrate standen für die vielen Verteidigungsposten, bewehrt mit Stacheldraht und Maschinengewehren, die auf dem Vormarsch nach Osten überwunden werden mussten. Die Karten zeigten außerdem, in schwarzen Linien und Quadraten, wo die deutschen Truppen und Panzer aufgestellt waren. Jede Karte trug den offiziellen Stempel des Aufklärungsbataillons.
Voigt nahm seine Offiziersmütze ab, wischte sich mit einem fleckigen Taschentuch den Schweiß aus dem Gesicht und musterte die Karten. Er war ein kräftiger, breitschultriger Mann, dessen helle Haut hart und spröde wie Leder geworden war. Sein blondes Haar hatte graue Strähnen an den Schläfen, seine dichten Augenbrauen waren fast komplett grau. »Ich nehme an, die Karten sind aktuell?«, fragte er.
»Ja, Herr Oberstleutnant. Der letzte Spähtrupp kam vor 20 Minuten herein.«
Voigt grunzte unverbindlich. Er spürte, dass Stummer auf ein Kompliment wegen der gründlichen Erkundung der Minenfelder durch sein Bataillon wartete. »Ich habe nicht viel Zeit. Generalfeldmarschall Rommel wartet. Wie lauten Ihre Empfehlungen?«
Stummer war sichtlich enttäuscht, dass die Arbeit seines Bataillons keine Würdigung erfuhr. Die letzten zwei Tage und Nächte, die sie mit der Suche nach einer Lücke in den britischen Befestigungen verbracht hatten, waren hart und anstrengend gewesen. Manchmal kam es ihm vor, als hockten er und seine Männer am Ende der Welt, so öde und trostlos war es um sie herum. »Hier.« Er nahm einen Bleistift und tippte auf eine der Karten. »Wir glauben, am leichtesten dürfte der Durchbruch in diesem Bereich gelingen, gleich südlich des Ruweisat-Kamms. Die Minenfelder sind nicht so dicht, und wie Sie sehen können, gibt es eine Lücke im Schussfeld zwischen diesen beiden Verteidigungsstellungen.« Er tippte auf zwei blaue Quadrate. »Ein konzentrierter Vorstoß müsste leicht ein Loch in die Reihen sprengen können.«
»Major«, meinte Voigt müde, »nichts in dieser verdammten Wüste ist leicht. Wenn wir nicht bald das Benzin und die Munition bekommen, die wir brauchen, werden wir zu Fuß gehen und mit Steinen werfen müssen, bevor die Woche um ist. Falten Sie die Karten für mich zusammen.«
Einer der jüngeren Offiziere kam dem Befehl nach. Voigt öffnete die Aktentasche und steckte die Karten hinein. Dann schloss er die Tasche, wischte sich erneut den Schweiß aus dem Gesicht und setzte seine Mütze wieder auf. Jetzt noch der Flug zurück zu Rommels Befehlsstand, und der Rest der Nacht würde aus Diskussionen, Besprechungen und der Verlegung von Truppen, Panzern und Nachschub in die Bereiche, die Rommel für den Angriff auswählte, bestehen. Ohne diese Karten waren die Entscheidungen des Generalfeldmarschalls nicht mehr als ein blinder Würfelwurf.
Die Aktentasche hatte jetzt ein befriedigendes Gewicht. »Ich bin sicher, der Generalfeldmarschall würde wollen, dass ich Ihnen sage, dass Sie bemerkenswerte Arbeit geleistet haben, Major«, sagte Voigt schließlich. Stummer sah erfreut aus. »Wir werden an den Ufern des Nils auf den großartigen Erfolg der Panzerarmee Afrika anstoßen. Heil Hitler.« Voigt hob lässig die rechte Hand, und die anderen – bis auf Kleinhorst, der keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber der Partei machte – antworteten mit dem Führergruß. Dann war das Treffen vorüber, und Voigt wandte sich vom Tisch ab und ging mit schnellen Schritten aus dem Zelt und zum wartenden Wagen. Der Fahrer stand schon bereit, um ihm die Tür aufzuhalten, und Major Stummer trat aus dem Zelt, um Voigt zu verabschieden.
Voigt war nur noch wenige Schritte vom Wagen entfernt, als er aus den Augenwinkeln eine schnelle Bewegung zu seiner Rechten bemerkte.
Sein Kopf fuhr herum, und augenblicklich wurden ihm die Knie weich.
Keine Armlänge entfernt stand ein schwarzer Hund mit grünen Augen. Er kam offensichtlich von der anderen Seite des Zeltes und war so schnell herangeprescht, dass weder der Fahrer noch Stummer reagieren konnten. Die schwarze Bestie unterschied sich sehr von den anderen, halb verhungerten Wildhunden; sie war groß wie eine Bulldogge, mit einem Dreiviertelmeter Schulterhöhe und Muskeln wie straffe Klaviersaiten an Rücken und Lenden. Die Ohren lagen flach an dem glatthaarigen Schädel, und die Augen leuchteten hell wie grüne Signallampen. Sie starrten Voigt durchdringend an, und in ihnen erkannte der deutsche Offizier eine tödliche Intelligenz.
Das war kein Hund, begriff Voigt.
Es war ein Wolf.
»Mein Gott«, stieß Voigt aus. Es klang, als hätte er einen Schlag in seinen geschwürigen Magen erhalten. Dieses muskelbepackte Monster von einem Wolf stand direkt neben ihm, und jetzt öffnete es das Maul und bleckte seine weißen Reißzähne und roten Gaumen. Voigt spürte den heißen Atem auf dem Rücken seines angeketteten Handgelenks, und als er mit einem Aufflackern von Panik begriff, was die Bestie vorhatte, fuhr seine linke Hand zum Griff seiner Luger.
Die Zähne des Wolfs schlossen sich um Voigts Handgelenk, und mit einer brutalen Drehung des Kopfes brach das Tier ihm die Knochen.
Ein Knochensplitter bohrte sich durch Voigts Haut, und ein Blutstrahl schoss in hohem Bogen aus der Bissstelle und spritzte an die Seite des Geländewagens. Voigt brüllte vor Schmerzen, während er verzweifelt versuchte, die Klappe des Holsters zu öffnen und die Luger herauszuziehen. Er wollte sich losreißen, aber der Wolf stemmte seine Pfoten in den Boden und ließ nicht locker. Der Fahrer war starr vor Schreck, und Stummer brüllte ein paar andere Soldaten herbei, die gerade von einer Erkundung zurückkamen. Voigts ledriges Gesicht hatte eine gelbliche Farbe angenommen. Die Kiefer des Wolfes arbeiteten; die Zähne trafen sich durch die zermalmten Knochen und das blutige Fleisch. Die grünen Augen starrten Voigt herausfordernd an. »Hilfe! Hilfe!«, schrie der Oberstleutnant, und der Wolf belohnte ihn mit einem heftigen Schütteln des Kopfes, das unerträgliche Schmerzen durch jeden Nerv seines Körpers jagte und die Hand fast abtrennte.
Der Ohnmacht nahe, gelang es Voigt endlich, die Luger aus dem Holster zu ziehen, gerade als der aus der Erstarrung erwachte Fahrer den Hahn seiner Walther spannte und auf den Kopf des Wolfes zielte. Voigt richtete seine Pistole auf die blutverschmierte Schnauze der Bestie.
Aber als die beiden Finger sich um die Abzüge krümmten, warf der Wolf plötzlich seinen Körper zur Seite, immer noch in Voigts Handgelenk verbissen, und der Offizier wurde direkt vor den Lauf der Walther gerissen. Mit einem lauten Knall ging die Pistole los, während gleichzeitig die Luger in den Boden feuerte. Die Kugel der Walther drang in Voigts Rücken ein und hinterließ ein rot umrandetes Loch in seiner Brust, als sie wieder austrat. Als Voigt zusammenbrach, riss der Wolf mit einem heftigen Ruck die Hand ab. Die Handschelle, an der die Aktentasche hing, rutschte herunter und fiel zu Boden. Mit einer schnellen Kopfdrehung schleuderte der Wolf die zuckende Hand aus seinem blutigen Maul. Sie fiel zwischen die verhungernden Hunde, die sich sofort auf die Beute stürzten.
Der Fahrer feuerte noch einmal, mit zitternder Hand und schockverzerrtem Gesicht. Erde spritzte zur Linken des Wolfes auf, als dieser zur Seite sprang. Drei Soldaten kamen aus einem anderen Zelt gerannt, alle mit MP-40-Maschinenpistolen bewaffnet. »Tötet das Biest!«, kreischte Stummer, und Kleinhorst stürmte mit einer Pistole in der Hand aus dem Kommandozelt. Aber das schwarze Tier sprang vorwärts, über Voigts Leiche. Seine Zähne fanden die Metallschelle und packten sie. Als der Fahrer ein drittes Mal feuerte, drang die Kugel durch die Aktentasche und prallte vom Boden ab. Kleinhorst zielte – aber bevor er abdrücken konnte, rannte der Wolf im Zickzack in die Dunkelheit östlich des Lagers.
Der Fahrer feuerte den Rest seines Magazins ab, aber man hörte kein schmerzerfülltes Jaulen. Weitere Soldaten kamen aus ihren Zelten, und überall im Lager wurden Alarmrufe laut. Stummer rannte zu Voigts Leiche, drehte sie um und erschrak vor dem vielen Blut. Er schluckte schwer, konnte noch gar nicht begreifen, wie schnell sich das alles abgespielt hatte. Und dann wurde ihm schlagartig klar, was das eigentliche Problem war: Der Wolf hatte sich die Aktenmappe mit den Karten des Aufklärungsbataillons geschnappt und rannte nach Osten.
Nach Osten. Auf die britischen Linien zu.
Die Karten zeigten auch die Positionen von Rommels Truppen, und wenn die Briten sie in die Finger bekamen …
»Aufsitzen!«, schrie er und sprang auf die Beine, als wäre ihm eine Eisenstange durch das Rückgrat geschoben worden. »Beeilung, um Gottes willen! Beeilung! Wir müssen das Biest aufhalten!« Er rannte an dem Geländewagen vorbei zu einem anderen Gefährt, das nicht weit entfernt stand: ein gelber Panzerwagen mit einem schweren Maschinengewehr an der Frontscheibe. Der Fahrer folgte ihm, und jetzt rannten auch andere Soldaten zu ihren BMW-Motorrädern und Beiwagen, die ebenfalls mit Maschinengewehren bewaffnet waren. Stummer sprang auf den Beifahrersitz, der Fahrer ließ den Motor an und schaltete die Scheinwerfer ein; die Motoren der Krafträder stotterten und brüllten auf und ihre Lampen leuchteten gelb, und Stummer schrie »Los!« aus einer Kehle, die bereits die Schlinge des Henkers spürte.
Der Panzerwagen schoss nach vorne, seine Reifen wirbelten Staub auf, und vier Motorräder kurvten um ihn herum, beschleunigten und donnerten davon.
Ein paar Hundert Meter voraus rannte der Wolf. Sein Körper war eine Maschine, getrimmt auf Geschwindigkeit und Ausdauer. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, seine Zähne waren fest um die Handschelle geschlossen. Die Aktentasche schlug in einem gleichmäßigen Rhythmus auf den Boden, und das Atmen des Wolfes klang wie ein tiefes, kraftvolles Grollen. Das fliehende Tier schwenkte ein paar Grad nach rechts und lief einen felsigen Hügel hinauf und wieder hinunter, als folge es einem vorher festgelegten Kurs. Sand flog unter seinen Pfoten davon, und vor ihm brachten sich Skorpione und Eidechsen in Sicherheit.
Seine Ohren zuckten. Ein Brummen näherte sich rasch von links. Der Wolf wurde schneller, seine Pfoten trommelten auf den festgebackenen Sand. Das Brummen war jetzt näher … viel näher … jetzt war es fast direkt links von ihm. Ein Suchscheinwerfer schwenkte über das Tier hinweg, kam zurück und verharrte auf der fliehenden Gestalt. Der Soldat im Beiwagen des Motorrads rief: »Da ist er!« und legte den Sicherheitshebel seines Maschinengewehrs um. Er drehte den Lauf zum Wolf herum und eröffnete das Feuer.
Schlitternd kam der Wolf in einer Staubwolke zum Stehen, und die Kugeln zeichneten ein feuriges Muster auf die Erde vor ihm. Das Motorrad raste vorbei, der Fahrer kämpfte mit Bremse und Lenker. Und dann änderte der Wolf den Kurs und rannte mit vollem Tempo weiter, immer noch nach Osten, immer noch die Handschelle im Maul.
Das Maschinengewehr knatterte weiter. Leuchtspurgeschosse zeichneten orangefarbene Linien in die Dunkelheit und prallten von Steinen ab wie weggeworfene Zigarettenkippen. Aber der Wolf rannte im Zickzack, den Körper dicht am Boden, und während die Leuchtspurgeschosse noch durch die Luft pfiffen, jagte das Tier über einen weiteren Hügel und aus der Reichweite des Scheinwerfers.
»Da drüben!«, rief der MG-Schütze gegen den Wind. »Er ist über den Hügel gerannt!« Der Fahrer riss das klobige Gespann herum und fuhr ihm nach. Weißer Staub wirbelte im Licht des Scheinwerfers. Er drehte das Gas voll auf und der Motor antwortete mit dem kehligen Brüllen deutscher Maschinerie. Sie erreichten die Hügelkuppe und fuhren abwärts – und der Scheinwerfer zeigte direkt unter dem Hügel eine zweieinhalb Meter tiefe Rinne, die auf sie wartete wie ein verzerrtes Grinsen.
Das Motorrad krachte in die Rinne, überschlug sich, und das Maschinengewehr ging los und feuerte in einem großen Bogen seine Kugeln ab, die von den Seiten der Vertiefung abprallten und in die Körper von Fahrer und Schütze eindrangen. Das Motorrad wurde zerdrückt, der Benzintank explodierte.
Auf der anderen Seite der Rinne, die der Wolf mit einem gewaltigen Sprung überwunden hatte, lief das Tier weiter und wich heißen Metallfetzen aus, die um es herum herunterregneten.
Durch die Echos der Explosion war der Lärm eines weiteren Verfolgers zu hören, diesmal von rechts. Der Kopf des Wolfes ruckte herum und er sah den Suchscheinwerfer des Beiwagens. Das Maschinengewehr begann zu feuern, Kugeln schlugen neben den Beinen des Wolfes ein und pfiffen um ihn herum, als er jetzt in schnellen, verzweifelten Haken und Zickzacklinien rannte. Aber das Motorrad verringerte den Abstand, und die Kugeln kamen ihrem Ziel immer näher. Ein Leuchtspurgeschoss schoss so dicht an ihm vorbei, dass der Wolf den bitteren Schweißgeruch eines Menschen daran riechen konnte. Und dann schlug er einen weiteren schnellen Haken, sprang hoch in die Luft, während die Kugeln unter seinen Beinen tanzten, und landete in einer Rinne, die in südöstlicher Richtung durch die Wüste schnitt.
Das Motorrad raste am Rand der Rinne entlang, der Schütze im Beiwagen suchte die Vertiefung mit dem kleinen Suchscheinwerfer ab. »Ich hab ihn getroffen!«, rief er. »Ich bin mir sicher, dass die Kugeln …« Er spürte, wie sich seine Nackenhaare aufrichteten. Als er den Suchscheinwerfer herumriss, sprang der riesige schwarze Wolf, der hinter dem Motorrad hergelaufen war, vom Boden ab, flog über den Beiwagen und rammte mit seinem vollen Gewicht den Fahrer. Zwei Rippen des Mannes brachen wie sprödes Holz, und als er aus dem Sitz gestoßen wurde, schien der Wolf sich auf die Hinterbeine aufzurichten und über die Frontscheibe zu springen, wie es ein Mensch tun würde. Sein Schwanz klatschte dem Schützen verächtlich ins Gesicht. Hektisch kletterte der Mann aus dem Beiwagen, und das Motorrad fuhr noch ein paar Meter weiter, bis es über die Kante kippte und in die Rinne krachte. Der schwarze Wolf rannte weiter, jetzt wieder auf östlichem Kurs.
Hier endete das Labyrinth aus Wasserrinnen und Hügeln, und die Wüste lag flach und felsig unter den funkelnden Sternen. Immer noch rannte der Wolf, sein Herz schlug schneller und seine Lunge pumpte den sauberen Geruch der Freiheit, das Parfüm des Lebens, in seine Nasenlöcher. Er warf den Kopf schnell nach links, ließ die Handschelle los und biss in den Ledergriff der Aktentasche, damit sie nicht länger gegen den Boden schlug beim Laufen. Er überwand den Drang, den Griff wieder auszuspucken, der noch den faulen Geschmack einer Menschenhand trug.
Und dann erklang von hinten ein neues gutturales Knurren, deutlich tiefer als die Stimmen der anderen beiden Jäger. Der Wolf warf einen Blick zurück und sah ein Paar gelber Monde durch die Wüste eilen, auf den Spuren des Tieres. Ein Maschinengewehr bellte – eine rote Explosion über den doppelten Monden – und Kugeln spritzten weniger als einen Meter neben dem Wolf in den Sand. Das Tier sprang zur Seite, schlug einen Haken, bremste und preschte wieder vorwärts, und die nächste lange Salve Leuchtspurmunition sengte die Haare an seinem Rücken an.
»Schneller!«, rief Stummer dem Fahrer zu. »Nicht abhängen lassen!« Er feuerte eine weitere Salve ab, und wieder spritzte Sand auf, als der Wolf scharf nach links abbog. »Verdammt!«, schrie er. »Hinterher!« Das Tier hatte immer noch Voigts Aktenmappe und lief damit direkt auf die britischen Linien zu. Was war das für eine Kreatur, die eine Mappe voller Karten stahl statt Essensreste vom Abfallhaufen? Dieses verdammte Untier musste um jeden Preis aufgehalten werden. Stummers Handflächen schwitzten, und er hatte Mühe, das Biest ins Visier des MGs zu bekommen, aber es wich immer wieder aus, bremste ab und wurde wieder schneller, als ob es …
Ja, dachte Stummer. Als ob es wie ein Mensch denken kann.
»Sachte!«, blaffte er. Aber der Wagen traf auf eine Bodenwelle, und wieder verlor er das Tier aus dem Visier. Er musste den Boden vor dem Wolf beharken und hoffen, dass das Biest in die Kugeln lief. Er stemmte sich gegen den Rückstoß und drückte den Abzug.
Nichts geschah. Die Waffe war heiß wie die Mittagssonne, und sie hatte entweder eine Ladehemmung oder keine Munition mehr.
Der Wolf schaute zurück und registrierte, dass der Wagen schnell näher kam. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Gelände zu – aber zu spät. Ein Stacheldrahtzaun war direkt vor ihm, keine zwei Meter entfernt. Der Wolf spannte die Muskeln und sprang. Aber der Zaun war schon zu nahe, um ihm ganz auszuweichen; die Brust des Wolfes wurde von den stacheligen Knoten aufgeritzt, und als er auf der anderen Seite landete, verfing sich sein rechter Hinterlauf in dem Draht.
»Jetzt!«, schrie Stummer. »Überfahren!«
Der Wolf zappelte wild, Muskeln spannten sich an seinem ganzen Körper. Er krallte sich mit den Vorderbeinen in den Boden, aber es nützte nichts. Stummer stand jetzt im Wagen, der Wind blies ihm ins Gesicht, und der Fahrer trat das Gaspedal durch. Der Panzerwagen war vielleicht fünf Sekunden davon entfernt, den Wolf unter seinen Geländereifen zu zerquetschen.
Und was Stummer in diesen fünf Sekunden sah, hätte er niemals geglaubt, wenn er es nicht selbst gesehen hätte. Der Wolf drehte seinen Körper herum, und mit seinen Vorderpfoten packte er den Stacheldraht, der sein Bein gefangen hielt. Die Pfoten drückten den Draht auseinander und hielten ihn fest, während er sein Bein herauszog. Und dann war er wieder auf allen vieren und flitzte davon. Der Panzerwagen zermalmte den Stacheldraht unter seiner Masse, aber der Wolf war nicht mehr da.
Doch der Scheinwerfer hielt ihn noch fest, und Stummer konnte sehen, dass das Tier jetzt mehr hüpfte als lief, nach rechts und links sprang, manchmal mit einem einzelnen Hinterbein den Boden berührte, bevor es sich wieder drehte und in eine andere Richtung hüpfte.
Stummers Herz blieb stehen.
Es weiß Bescheid, dachte er. Das Tier weiß Bescheid …
Er flüsterte: »Wir sind in einem Minenf…«
Und dann traf der linke Vorderreifen auf eine Mine, und die Explosion schleuderte Major Stummer aus dem Wagen wie ein blutiges Feuerrad. Der linke Hinterreifen brachte die nächste Mine zur Detonation, und die zerfetzte Masse des rechten Vorderrades traf die dritte. Der Panzerwagen bäumte sich auf, sein Tank explodierte und riss die Schweißnähte auseinander, und in der nächsten Sekunde rollte er über eine weitere Mine, und dann war da nichts mehr außer einem Ball aus rotem Feuer und glühendem Metall, der himmelwärts stieg.
60 Meter voraus blieb der Wolf stehen und blickte zurück. Er betrachtete für einen Augenblick das Feuer, das sich in seinen grünen Augen spiegelte, dann drehte er sich abrupt um und schlich weiter durch das Minenfeld in die Sicherheit des Ostens.
2
Bald würde er hier sein. Die Gräfin war aufgeregt wie ein Schulmädchen bei seiner ersten Verabredung. Über ein Jahr war es jetzt her, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte. Wo er während dieser Zeit gewesen war und was er gemacht hatte, wusste sie nicht. Es kümmerte sie auch nicht. Das ging sie nichts an. Man hatte ihr nur gesagt, dass er einen Zufluchtsort benötigte und dass er eine gefährliche Mission für den Secret Service erledigt hatte. Mehr zu wissen als das, war zu gefährlich.
Sie saß vor dem ovalen Spiegel in ihrem lavendelfarbenen Ankleidezimmer und trug sorgfältig ihren Lippenstift auf. Die goldenen Lichter Kairos glitzerten hinter der Glastür, die zur Terrasse führte. In der Abendbrise konnte sie Zimt und Muskat riechen, und Palmwedel flüsterten leise im Hof unter ihr. Sie merkte, dass sie zitterte, deshalb legte sie den Lippenstift lieber beiseite, bevor sie ihr Make-up ruinierte. Ich bin doch keine gefühlsduselige Jungfrau, ermahnte sie sich – mit einem gewissen Bedauern. Aber vielleicht war auch das ein Teil seiner Magie; bei seinem letzten Besuch hier hatte er ihr jedenfalls das Gefühl vermittelt, dass sie eine Erstklässlerin in der Schule der Liebe sei. Vielleicht, so überlegte sie, war sie deshalb so aufgeregt, weil sie während dieser ganzen Zeit – und von einer ganzen Serie sogenannter Liebhaber – niemals so berührt worden war wie von ihm und sich zutiefst danach sehnte.
Sie erkannte, dass sie genau die Sorte Frau war, vor der ihre Mutter sie immer gewarnt hatte, damals in Deutschland, bevor dieser Wahnsinnige das Land einer Gehirnwäsche unterzogen hatte. Aber das gehörte auch zu diesem Leben dazu, und die Gefahr stimulierte sie. Es ist besser, zu leben, als nur zu existieren, dachte sie. Woher hatte sie das? Ach ja; von ihm.
Sie strich sich mit einer Elfenbeinbürste durch das Haar, das blond war und frisiert wie das von Rita Hayworth – voll und sanft über die Schultern wallend. Sie war gesegnet mit einer grazilen Statur, hohen Wangenknochen, hellbraunen Augen und einer schlanken Figur. Hier war es nicht schwer, ihre Figur zu halten, denn sie machte sich nicht viel aus der ägyptischen Küche. Sie war 27 Jahre alt, dreimal verheiratet gewesen – jeder Ehemann reicher als der vorherige – und sie besaß den Hauptanteil an Kairos englischsprachiger Tageszeitung. In letzter Zeit las sie ihre eigene Zeitung mit größerem Interesse, seit Rommel sich dem Nil näherte und die Briten sich tapfer dem Naziansturm entgegenstellten. Die Schlagzeile von gestern hatte gelautet: ROMMELS VORMARSCH GESTOPPT. Der Krieg ging weiter, aber es sah so aus, als würde – zumindest in diesem Monat – östlich von El Alamein niemand den Arm zum Führergruß heben.
Sie hörte das leise Schnurren des Rolls-Royce Silver Shadow, als er vor dem Hauseingang vorfuhr, und ihr Herz machte einen Satz. Sie hatte den Chauffeur losgeschickt, um ihn entsprechend ihren Instruktionen am Shepheard’s Hotel abzuholen. Er wohnte dort nicht, hatte da aber an einer Besprechung oder so etwas teilgenommen – ein »Debriefing« nannte man es wohl in diesen Kreisen. Im Shepheard’s Hotel mit seinem berühmten Foyer, das mit Korbstühlen und orientalischen Teppichen eingerichtet war, wimmelte es von kriegsmüden britischen Offizieren, betrunkenen Reportern, muslimischen Meuchelmördern und natürlich neugierigen Naziaugen und -ohren. Ihr Anwesen, am Ostrand der Stadt, war ein sichererer Ort für ihn als ein öffentliches Hotel. Und auch wesentlich zivilisierter.
Gräfin Margritta stand von ihrer Frisierkommode auf. Hinter ihr war ein Paravent, der mit blauen und goldenen Pfauen verziert war; sie nahm das Kleid in blassem Meergrün, das darüber hing, zog es an und knöpfte es zu. Noch ein Blick auf ihr Haar und ihr Make-up, schnell noch etwas von Chanels neuem Duft auf ihren weißen Hals gesprüht, und sie war bereit. Doch nein, nicht ganz. Sie beschloss, einen strategischen Knopf zu öffnen, um die Wölbung ihres Busens besser zur Geltung zu bringen. Dann schlüpfte sie in ihre Sandalen und wartete darauf, dass Alexander in ihr Ankleidezimmer kam.
Er kam nach etwa drei Minuten. Der Butler klopfte leise an die Tür, und sie sagte: »Ja?«
»Mr. Gallatin ist eingetroffen, Gräfin.« Alexanders Stimme klang britisch steif.
»Sagen Sie ihm, ich bin gleich unten.« Sie lauschte Alexanders Schritten auf dem Teakholzboden des Flures. So sehr sie sich auch danach sehnte, ihn zu sehen, sie konnte auf keinen Fall nach unten gehen, ohne ihn ein Weilchen warten zu lassen; das gehörte zum Spiel zwischen Damen und Herren. Also ließ sie noch drei oder vier Minuten verstreichen, dann atmete sie einmal tief durch und verließ das Ankleidezimmer mit ruhigem, gemessenem Schritt.
Sie ging durch einen Korridor, der mit Rüstungen, Speeren, Schwertern und anderen mittelalterlichen Waffen geschmückt war. Sie gehörten dem früheren Besitzer des Hauses, einem Hitler-Sympathisanten, der aus dem Land geflohen war, als die Italiener 1940 von O’Connor verjagt wurden. Die Gräfin machte sich nicht viel aus Waffen, aber die Ritterrüstungen passten ganz gut zum Teakholz und der Eiche des Hauses, außerdem waren sie wertvoll und vermittelten ihr das Gefühl, rund um die Uhr beschützt zu werden. Sie erreichte die breite Treppe mit dem Geländer aus geschnitzter Eiche und stieg ins Erdgeschoss hinab.
Die Türen zum Wohnzimmer waren geschlossen; sie hatte Alexander angewiesen, ihn dorthin zu bringen. Ein paar Sekunden blieb sie stehen, um sich zu sammeln, hielt sich die Hand vor den Mund und hauchte hinein – minzig, Gott sei Dank –, dann öffnete sie die Türen mit nervösem Schwung.
Silberlampen leuchteten auf niedrigen polierten Tischen. Ein kleines Feuer flackerte im Kamin, denn nach Mitternacht wurde der Wüstenwind kalt. Kristallgläser und Flaschen mit Wodka und Scotch fingen das Licht ein und funkelten auf einer kleinen Anrichte an der Stuckwand. Der Teppich war ein Flächenbrand aus verflochtenen orangefarbenen und grauen Figuren, und auf dem Kaminsims tickte eine Uhr auf neun zu.
Und dort saß er, auf einem Korbstuhl, die Füße übereinander gelegt, sein Körper entspannt und selbstsicher, wie jemand, der sich im Besitz des Gebietes wusste, das er erobert hatte, und kein Eindringen zulassen würde. Er betrachtete gedankenverloren die Trophäe, die an der Wand über dem Kamin hing.
Aber plötzlich fand sein Blick den ihren, und er erhob sich mit geschmeidiger Eleganz. »Margritta«, sagte er und reichte ihr die roten Rosen, die er in der Hand hielt.
»Oh … Michael, sie sind wunderschön!« Ihre Stimme klang rauchig und hatte den anmutigen singenden Tonfall des norddeutschen Flachlandes. Sie ging zu ihm – Nicht zu schnell!, ermahnte sie sich. »Wo in Kairo hast du zu dieser Jahreszeit Rosen gefunden?«
Er lächelte und ließ seine kräftigen weißen Zähne aufblitzen. »Im Garten deines Nachbarn«, antwortete er. Sie konnte in seiner Stimme eine Andeutung des russischen Akzents hören, der sie so verwirrte. Was brachte einen in Russland geborenen Gentleman dazu, für den britischen Secret Service in Nordafrika zu arbeiten? Und warum klang sein Name nicht russisch?
Margritta lachte und nahm die Rosen entgegen. Natürlich scherzte er nur; Peter Van Gynts Garten hatte tatsächlich ein makellos gepflegtes Rosenbeet, aber die Mauer, welche die Grundstücke trennte, war zwei Meter hoch. Die hätte Michael Gallatin unmöglich überklettern können, außerdem wies sein Kakianzug nicht den geringsten Flecken auf. Er trug ein hellblaues Hemd und eine Krawatte mit gedämpften grauen und braunen Streifen, und sein Gesicht hatte eine ledrige Wüstenbräune. Margritta roch an einer der Rosen; sie waren noch taufrisch.
»Du siehst wunderschön aus«, sagte er. »Du hast eine neue Frisur.«
»Ja. So trägt man es jetzt. Gefällt es dir?«
Er berührte eine Locke ihres Haars. Seine Finger streichelten es, dann bewegte sich seine Hand langsam zu ihrer Wange. Von der sanften Berührung bekam Margritta eine Gänsehaut. »Du frierst«, meinte er. »Du solltest dich näher ans Feuer stellen.« Seine Hand wanderte die Linie ihres Kinns entlang, die Finger streiften ihre Lippen, zogen sich dann zurück. Er trat näher zu ihr und legte einen Arm um ihre Hüfte. Sie wich nicht zurück. Ihr Atem stockte. Sein Gesicht war direkt vor ihr, seine grünen Augen fingen ein rotes Schimmern vom Kamin auf, als loderten Flammen in ihnen. Langsam senkte sein Mund sich herab. Sie spürte ein schmerzhaftes Pochen in ihrem ganzen Körper. Und dann verharrten seine Lippen, nur wenige Zentimeter von ihren entfernt, und er sagte: »Ich verhungere.«
Sie blinzelte, wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Ich habe seit dem Frühstück nichts gegessen«, fuhr er fort. »Eipulver und getrocknetes Rindfleisch. Kein Wunder, dass die englische Armee so verbissen kämpft; die Männer wollen nach Hause und etwas Vernünftiges essen.«
»Essen«, keuchte sie. »Oh. Ja. Essen. Ich habe den Koch etwas für dich zubereiten lassen. Hammel. Das ist dein Lieblingsgericht, nicht wahr?«
»Freut mich, dass du dich daran erinnerst.« Er küsste sie leicht auf die Lippen, dann schnupperte er ganz kurz mit einer Zärtlichkeit an ihrem Hals, dass es ihr eiskalt den Rücken herunterlief. Er ließ sie los, die Nasenflügel noch geweitet vom Chanelduft und dem intensiven Aroma ihrer Weiblichkeit.
Margritta nahm seine Hand. Die Handfläche war rau, als hätte er Pflastersteine verlegt. Sie führte ihn zur Tür, und als sie fast dort waren, fragte er: »Wer hat den Wolf getötet?«
Sie blieb stehen. »Entschuldigung?«
»Der Wolf.« Er deutete auf den grauen Wolf, der über dem Kamin hing. »Wer hat ihn getötet?«
»Oh. Du hast bestimmt von Harry Sandler gehört, oder?«
Er schüttelte den Kopf.
»Harry Sandler. Der amerikanische Großwildjäger. Er war vor zwei Jahren in allen Zeitungen, weil er einen weißen Leoparden auf dem Kilimandscharo geschossen hatte.« Noch immer schien der Name Michael nichts zu sagen. »Wir sind … Freunde geworden. Er hat mir den Wolf aus Kanada geschickt. Ein wunderschönes Tier, nicht wahr?«
Michael knurrte leise. Er betrachtete die anderen Trophäen, die Sandler Margritta geschenkt hatte – die Köpfe eines afrikanischen Wasserbüffels, eines prächtigen Hirsches, eines Leoparden, eines schwarzen Panthers –, aber sein Blick kehrte zum Wolf zurück. »Kanada«, meinte er. »Wo in Kanada?«
»Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, Harry sagte etwas von Saskatchewan.« Sie zuckte mit den Achseln. »Na ja, Wolf ist Wolf, oder?«
Michael antwortete nicht. Dann sah er sie an, mit durchdringendem Blick, und lächelte. »Irgendwann muss ich Mr. Harry Sandler einmal kennenlernen.«
»Schade, dass du nicht vor einer Woche hier warst. Harry kam auf dem Weg nach Nairobi durch Kairo.« Sie zerrte spielerisch an seinem Arm, um seine Aufmerksamkeit von der Trophäe abzulenken. »Komm, dein Essen wird kalt.«
Michael verspeiste seine Hammelmedaillons an einem langen Esszimmertisch unter einem Kristallleuchter. Margritta stocherte in einem Palmherzensalat herum und trank ein Glas Chablis, und sie plauderten darüber, was es in London Neues gab – die angesagten Theaterstücke, die Mode, Literatur und Musik: alles Dinge, die Margritta schmerzlich vermisste. Michael meinte, ihm habe das letzte Werk Hemingways gefallen, der Mann habe ein sicheres Auge.
Und während sie sich unterhielten, musterte Margritta Michaels Gesicht und stellte – im helleren Licht des Kronleuchters – fest, dass er sich in dem Jahr und den fünf Wochen seit ihrem letzten Zusammentreffen verändert hatte. Die Veränderungen waren subtil, aber vorhanden: Es gab mehr Linien um seine Augen und vielleicht auch mehr graue Stellen in seinem glatten, kurz geschnittenen Haar. Sein Alter war ein weiteres Mysterium; er mochte irgendetwas zwischen 30 und 34 sein. Dennoch hatten seine Bewegungen die Geschmeidigkeit der Jugend, und seine Schultern und Arme waren von beeindruckender Kraft. Seine Hände waren ein Rätsel; sie waren kräftig, langfingrig und grazil – die Hände eines Pianisten –, aber ihre Rücken waren mit feinen dunklen Haaren gesprenkelt. Gleichzeitig waren es die Hände eines Arbeiters, daran gewöhnt, zuzupacken, und doch handhabten sie das Silberbesteck mit überraschender Anmut.
Michael Gallatin war ein großer Mann, fast 1,90 Meter, und er hatte breite Schultern, schmale Hüften und lange, schlanke Beine. Margritta hatte ihn bei ihrem ersten Zusammentreffen gefragt, ob er einmal Leichtathlet gewesen sei, aber seine Antwort hatte gelautet, er »laufe manchmal zum Vergnügen«.
Sie nippte an ihrem Chablis und betrachtete ihn über den Rand des Glases. Wer war er wirklich? Was machte er für den Secret Service? Woher kam er und wohin wollte er? Er hatte eine scharf geschnittene Nase, und Margritta war aufgefallen, dass er an jedem Bissen und jedem Getränk schnupperte, bevor er sie zu sich nahm. Sein Gesicht war düster attraktiv, glatt rasiert und markant, und wenn er lächelte, war es wie ein Lichtblitz – aber dieses Lächeln ließ er nicht sehr oft sehen. Im Ruhezustand wirkte sein Gesicht sogar noch düsterer, und wenn das Leuchten dieser grünen Augen nachließ, erinnerte ihre dunkle Farbe Margritta an die tiefen Schatten eines Urwaldes, ein Ort von Geheimnissen, die man am besten unerforscht ließ. Und vielleicht auch ein Ort großer Gefahren.
Er griff nach seinem Wasserglas, ließ den Chablis unberührt, und Margritta sagte: »Ich habe dem Personal für heute Nacht freigegeben.«
Er trank einen Schluck und stellte das Glas ab; stach die Gabel in ein weiteres Stück Fleisch. »Wie lange arbeitet Alexander schon für dich?«, wollte er wissen.
Die Frage kam vollkommen unerwartet. »Fast acht Monate. Das Konsulat hat ihn empfohlen. Warum?«
»Er hat …« Michael zögerte, überdachte seine Worte. Einen nicht vertrauenswürdigen Geruch, hätte er beinahe gesagt. »… einen deutschen Akzent.«
Margritta wusste nicht, wer von ihnen beiden verrückt war, denn noch britischer als Alexander konnte man nur sein, wenn man Unterwäsche mit dem Union Jack trug.
»Er verbirgt es gut«, erklärte Michael. Er schnupperte an dem Hammel, bevor er den Bissen in den Mund steckte, und kaute, bevor er weitersprach. »Aber nicht gut genug. Der britische Akzent ist nur Maskerade.«
»Alexander ist durch alle Sicherheitsüberprüfungen gegangen. Du weißt, wie gründlich die sind. Ich kann dir seine Lebensgeschichte erzählen, wenn du sie hören willst. Er wurde in Stratford-upon-Avon geboren.«
Michael nickte. »Eine Theaterstadt, wenn es je eine gab. Das trägt deutlich die Handschrift der Abwehr.« Die Abwehr, wusste Margritta, war Hitlers Geheimdienst. »Morgen früh um Punkt sieben kommt ein Wagen, der mich abholt. Ich denke, du solltest mitkommen.«
»Mitkommen? Wohin?«
»Weg von hier. Weg aus Ägypten, wenn möglich. Vielleicht nach London. Ich glaube, hier ist es für dich nicht mehr sicher.«
»Unmöglich. Ich habe zu viele Verpflichtungen. Mein Gott, mir gehört die Zeitung! Ich kann nicht einfach von einem Tag auf den anderen verschwinden!«
»Gut, dann bleib im Konsulat. Aber ich glaube, du solltest Nordafrika so schnell wie möglich verlassen.«
»Es gibt keine undichte Stelle«, beharrte Margritta. »Du irrst dich in Alexander.«
Michael sagte nichts. Er aß noch ein Stück Hammel und tupfte sich den Mund mit einer Serviette ab.
»Gewinnen wir?«, fragte Margritta nach einer weiteren Pause.
»Wir halten die Stellung«, erwiderte er. »Mit Krallen und Zähnen. Rommels Nachschublinien sind zusammengebrochen, seinen Panzern geht das Benzin aus. Hitlers ganze Aufmerksamkeit gilt im Moment der Sowjetunion. Stalin verlangt nach einer alliierten Offensive im Westen. Kein Land, nicht einmal eins, das so stark ist wie Deutschland, kann an zwei Fronten Krieg führen. Wenn es uns also gelingt, Rommel standzuhalten, bis er keine Munition und kein Benzin mehr hat, können wir ihn zurück nach Tobruk drängen. Und darüber hinaus, wenn wir Glück haben.«
»Ich wusste nicht, dass du an Glück glaubst.« Sie hob eine blassblonde Augenbraue.
»Es ist ein subjektiver Begriff. Dort, wo ich herkomme, sind ›Glück‹ und ›rohe Gewalt‹ ein und dasselbe.«
Sie nutzte die Gelegenheit. »Und wo kommst du her, Michael?«
»Von einem Ort weit weg von hier«, lautete seine Antwort, und die Art, wie er es sagte, verriet ihr, dass es keine weitere Unterhaltung über seine Vergangenheit geben würde.
»Es gibt noch Dessert«, sagte sie, als er sein Mahl beendet hatte und den Teller von sich schob. »Eine Schokoladentorte, in der Küche. Ich werde uns auch Kaffee kochen.« Sie stand auf, aber er war schneller. Er war an ihrer Seite, bevor sie zwei Schritte gehen konnte, und sagte: »Verschieben wir Torte und Kaffee auf später. Ich hatte ein anderes Dessert im Sinn.« Er nahm ihre Hand und küsste sie, langsam, Finger für Finger.
Sie legte die Arme um seinen Hals. Ihr Herz hämmerte wild. Mühelos hob er sie auf seine Arme, dann nahm er eine Rose aus der blauen Vase, die in der Tischmitte stand.
Er trug sie die Treppe hinauf, durch den Flur mit den Rüstungen und Waffen, in ihr Schlafzimmer mit dem Himmelbett und dem Blick über die Hügel von Kairo.
Im Kerzenlicht entkleideten sie sich gegenseitig. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie behaart seine Arme und seine Brust waren, aber jetzt sah sie auch, dass er verletzt war; er hatte mehrere Verbände quer über der Brust. »Was ist passiert?«, fragte sie und strich mit den Fingern über seine harte braune Haut.
»Ich habe mich nur in etwas verfangen.« Er sah zu, wie das Spitzenhöschen zu Boden fiel, dann hob er sie aus ihrem Kleiderhaufen und legte sie auf das kühle weiße Laken.
Er war jetzt auch nackt und wirkte im Kerzenlicht, das seine kräftigen Muskeln betonte, noch größer als zuvor. Er sank neben ihr auf das Bett, und sie nahm unter seinem schwachen Limonenduft noch einen weiteren Geruch wahr. Es war ein schweres, wildes Aroma, und wieder musste sie an grüne Wälder und kalte Winde denken, die durch die Wildnis bliesen. Seine Finger zeichneten kleine Kreise um ihre Brustwarzen, und dann war sein Mund auf ihrem und ihrer beider Hitze verband sich, verschmolz miteinander, und sie erbebte bis in die Seele.
Etwas ersetzte seine Finger: die samtweiche Rose, die um ihre aufgerichteten Brustwarzen strich, ihre Brüste wie mit Küssen liebkoste. Er fuhr mit der Rose bis zu ihrem Bauch hinunter, umkreiste ihren Nabel, dann weiter hinab in die Fülle des goldenen Haars, immer weiter kreisend und liebkosend mit einer zarten Berührung, die ihren Körper erbeben und schmachten ließ. Die Rose wanderte in das feuchte Zentrum ihres Verlangens, flatterte zwischen ihren angespannten Schenkeln, und dann war auch seine Zunge dort, und sie packte sein Haar und stöhnte, als sie ihm das Becken entgegenstreckte.
Er hielt inne, ließ ihre Erregung abebben, dann machte er weiter, mit Zunge und Rose im Kontrapunkt, wie Finger auf einem feinfühligen goldenen Instrument. Und Margritta machte Musik, sie flüsterte und stöhnte, als die warmen Wellen sich in ihr aufbauten und ihre Sinne überfluteten.
Und dann war sie da, die grellweiße Explosion, die ihren Oberkörper hochfahren und sie seinen Namen rufen ließ. Sie sank zurück wie ein Herbstblatt, voller Farbe und welk an den Rändern.
Er vereinte sich mit ihr, Hitze auf Hitze, und sie umklammerte seinen Rücken und hielt sich fest wie ein Reiter im Sturm; seine Hüften bewegten sich kontrolliert, nicht in wildem Verlangen, und gerade als sie dachte, sie könnte nicht mehr von ihm aufnehmen, öffnete ihr Körper sich und sie versuchte, ihn in den Ort zu holen, wo es nur noch eine Kreatur mit zwei Namen und pochenden Herzen geben würde, und dann würden auch die harten Kugeln seiner Männlichkeit in sie eindringen, statt nur gegen die Feuchte gepresst zu werden. Sie wollte alles von ihm, jeden Zentimeter und jeden Tropfen, den er ihr geben konnte. Aber selbst inmitten des Strudels der Gefühle spürte sie, wie er sich zurückhielt, als gäbe es etwas in ihm, an das nicht einmal er selbst herankam. In ihrer Zelle der Leidenschaft glaubte sie, ihn knurren zu hören, aber der Laut erklang gedämpft an ihrem Hals, und sie war sich nicht sicher, ob es nicht sogar ihre eigene Stimme war.
Die Bettfedern sprachen. Sie hatten für viele Männer gesprochen, aber noch nie so eloquent.
Und dann bäumte sein Körper sich auf – einmal, zweimal, ein drittes Mal. Fünfmal. Er erschauderte, seine Finger krallten sich in das zerwühlte Laken. Sie klammerte die Beine um seinen Rücken, drängte ihn zu bleiben. Ihre Lippen fanden seinen Mund, und sie schmeckte das Salz seiner Anstrengungen.
Sie ruhten ein wenig, unterhielten sich wieder, aber diesmal flüsternd, und das Thema war nicht London oder der Krieg, sondern die Kunst der Liebe. Und dann nahm sie die Rose vom Nachttisch und folgte der Spur bis hinunter zu seiner sich erneut rührenden Männlichkeit. Es war eine wundervolle Maschine, und sie überschüttete sie mit Liebe.
Rosenblätter lagen auf dem Bett. Die Kerze war heruntergebrannt. Michael Gallatin lag auf dem Rücken, schlafend, mit Margrittas Kopf an seiner Schulter. Er atmete mit einem leisen, heiseren Brummen, wie ein gut gewarteter Motor.
Etwas später erwachte sie und küsste ihn auf die Lippen. Er schlief tief und fest und reagierte nicht. Ihr Körper war ein einziger angenehmer Schmerz; es fühlte sich an, als wäre sie gestreckt und zu Michaels Gestalt umgeformt worden. Einen Moment lang betrachtete sie sein Gesicht, prägte sich die markanten Gesichtszüge ein. Es war für sie zu spät, um noch wahre Liebe zu empfinden. Da waren zu viele Körper gewesen, zu viele Schiffe, die in der Nacht den Hafen passierten. Sie wusste, dass sie für den Secret Service als Refugium und Kontaktperson für Agenten, die einen Zufluchtsort benötigten, nützlich war, aber das war auch alles. Natürlich entschied sie selbst, mit wem sie schlief und wann, aber es waren viele gewesen. Die Gesichter verschmolzen miteinander – aber seines blieb getrennt. Er war nicht wie die anderen. Er glich keinem Mann, den sie kannte. Nennen wir es also eine Mädchenschwärmerei und belassen es dabei, dachte sie. Er hatte seinen Bestimmungsort und sie ihren, und es war unwahrscheinlich, dass es der gleiche Hafen war.
Vorsichtig stieg sie aus dem Bett, um ihn nicht zu wecken, und ging nackt in den großen begehbaren Kleiderschrank, der ihr Schlafzimmer vom Ankleidezimmer trennte. Sie schaltete das Licht ein, wählte einen weißen Seidenbademantel aus, zog ihn über, dann nahm sie einen braunen Frotteebademantel von einem Bügel und hängte ihn über eine weiblich geformte Kleiderpuppe im Schlafzimmer. Ein kurzer Gedanke: vielleicht ein Hauch Parfüm zwischen ihre Brüste und einmal durch die Haare bürsten, bevor sie sich endgültig schlafen legte. Der Wagen mochte um sieben kommen, aber sie erinnerte sich daran, dass er gern um halb sechs aufstand.
Mit der verbrauchten Rose in der Hand betrat Margritta das Ankleidezimmer. Eine kleine Tiffanylampe brannte noch auf dem Tisch. Sie hielt sich die Rose an die Nase und roch die Gerüche der letzten Nacht, dann stellte sie sie in eine Vase. Diese Blume musste zwischen Seide gepresst werden. Margritta atmete zufrieden durch, nahm ihre Bürste und schaute in den Spiegel.
Der Mann stand hinter dem Paravent. Sie konnte sein Gesicht über dem Rand sehen, und in dem Sekundenbruchteil der ruhigen Betrachtung, bevor die Panik einsetzte, erkannte sie, dass es ein perfektes Mördergesicht war: bar jeder Emotion, blass und vollkommen unscheinbar. Es war ein Gesicht, das perfekt in einer Menschenmenge verschwindet und an das man sich einen Moment, nachdem man es gesehen hat, schon nicht mehr erinnert.
Sie öffnete den Mund, um nach Michael zu rufen.
3
Es gab ein höfliches Husten, und das Auge eines Pfaus spie Feuer. Die Kugel traf Margritta in den Hinterkopf, exakt dort, wohin der Attentäter gezielt hatte. Blut, Knochensplitter und Gehirnmasse spritzten auf den Spiegel, und ihr Kopf schlug dumpf zwischen den Flakons der Schönheit auf.
Er kam aus seinem Versteck, schnell wie eine Schlange, gekleidet in eng anliegendes Schwarz, die kleine Pistole mit dem Schalldämpfer in einer schwarz behandschuhten Hand. Er warf einen Blick auf den mit Gummi überzogenen Kletterhaken, der an der Brüstung der Terrasse hing; das Seil führte hinunter in den Hof. Die Frau war tot und der Auftrag erledigt, aber er wusste, dass auch ein britischer Agent hier war. Er schaute auf seine Armbanduhr. Noch fast zehn Minuten, bis der Wagen ihn am Tor abholen würde; genug Zeit, das Schwein in die Hölle zu schicken.
Er spannte den Hahn der Pistole und trat in den begehbaren Kleiderschrank. Da war das Schlafzimmer des Weibsstücks, eine fast heruntergebrannte Kerze flackerte, unter der Bettdecke lag eine Gestalt. Er zielte mit der Pistole dorthin, wo der Kopf sein musste, und stützte sein Handgelenk mit dem anderen Arm; die Haltung eines geübten Schützen. Der Schalldämpfer hustete – einmal, dann noch einmal. Die Aufschlagwucht der Kugeln ließ die Gestalt im Bett hüpfen.
Und dann, wie ein guter Künstler, der sich das Ergebnis seiner Bemühungen ansehen muss, zog er die Decke von der Leiche.
Nur war es keine Leiche.
Es war eine Kleiderpuppe, mit zwei Einschusslöchern in der glatten weißen Stirn.
Eine Bewegung zu seiner Rechten, sehr schnell. Der Mörder geriet in Panik und wirbelte herum, um einen Schuss abzufeuern, aber ein Stuhl traf ihn im Rücken, und er verlor die Pistole, bevor er abdrücken konnte. Sie flog zwischen die Laken und außer Sicht.
Der Mörder war ein kräftiger Mann, 1,90 Meter groß und über 100 Kilo schwer, alles wohlgenährte Muskeln; er schnaufte wie eine Lokomotive, die aus einem Tunnel gerast kam, und die Wucht des Schlages brachte ihn ins Wanken, aber nicht zu Fall. Er riss seinem Gegner den Stuhl aus der Hand, bevor er noch einmal benutzt werden konnte, und trat zu, traf mit dem Stiefel den Magen des Mannes. Der Tritt entlockte seinem Gegner ein befriedigendes Stöhnen, und der britische Agent, ein Mann in einem braunen Bademantel, krachte gegen die Wand, die Hände in den Bauch gepresst.
Der Attentäter warf den Stuhl. Michael sah es an der Armbewegung des Mannes und duckte sich; der Stuhl zerbrach an der Wand. Und dann stürzte der Mörder sich auf ihn, Finger krallten sich um seine Kehle, gruben sich brutal in seine Luftröhre. Schwarze Flecken wirbelten durch Michaels Blickfeld; er hatte den Eisengeruch von Blut und Gehirnmasse in der Nase – der Geruch von Margrittas Tod, den er wahrnahm, unmittelbar nachdem er das tödliche Flüstern des Schalldämpfers gehört hatte.
Dieser Kerl war ein Profi, das war Michael klar. Nun galt es Mann gegen Mann, und nur einer von ihnen würde die nächsten Minuten überleben.
Dann sollte es wohl so sein.
Michael schlug in einer schnellen Bewegung die Hände nach oben, löste den Griff des Mörders und rammte ihm die rechte Handfläche gegen die Nase. Er hatte vor, ihm das Nasenbein ins Gehirn zu bohren, aber der Mörder war schneller und drehte den Kopf, um den Stoß abzulenken. Trotzdem traf und brach Michael mit einem blutigen Schlag die Nase, und die Augen des Mannes füllten sich mit Tränen des Schmerzes. Er taumelte zwei Schritte zurück, und Michael versetzte ihm eine schnelle Links-Rechts-Kombination ans Kinn. Die Unterlippe des Mörders platzte auf, aber er packte Michael am Kragen des Bademantels, hob ihn hoch und schleuderte ihn durch die Schlafzimmertür.
Michael flog in den Korridor und in eine der mittelalterlichen Rüstungen. Mit einem lauten Scheppern fiel sie von ihrem Gestell. Der Naziattentäter kam durch die Tür gestürmt, mit blutverschmiertem Gesicht, und als Michael sich aufzurappeln versuchte, traf ihn ein Tritt an der Schulter und schleuderte ihn weitere zweieinhalb Meter durch den Korridor.
Der Mörder sah sich um und seine Augen glänzten beim Anblick der Rüstungen und Waffen; für einen Augenblick nahm sein Gesicht einen Ausdruck der Ehrfurcht an, als hätte er einen heiligen Schrein der Gewalt gefunden. Er hob einen Morgenstern auf – einen Holzgriff mit einer Kette, an der eine Eisenkugel mit spitzen Stacheln befestigt war – und ließ ihn fröhlich um seinen Kopf wirbeln. Er rückte gegen Michael Gallatin vor.
Die mittelalterliche Waffe pfiff durch die Luft, als sie in Richtung von Michaels Schädel geschwungen wurde, aber Gallatin duckte sich und stolperte aus ihrer Reichweite. Die Kugel schwang zurück, bevor er sein Gleichgewicht wiedergewann, und die Eisenspitzen zupften an braunem Frotteestoff, aber Michael machte noch einen Satz zurück und stieß mit einer weiteren Rüstung zusammen. Als sie zu Boden schepperte, schnappte er sich einen Metallschild und wirbelte herum, um gerade noch den nächsten Schlag des Morgensterns abzufangen, der auf seine Beine zielte. Funken sprühten vom polierten Metall, die Vibrationen wanderten durch Michaels Arm bis in seine lädierte Schulter. Und dann holte der Mörder weit aus, um den Morgenstern auf Michaels Schädel niedersausen zu lassen – und Gallatin warf den Schild, traf mit der Kante die Knie des Mannes und riss ihn von den Beinen. Als der Mörder zu Boden stürzte, hob Michael das Bein, um ihm ins Gesicht zu treten, bremste sich aber: Ein gebrochener Fuß würde seiner Beweglichkeit nicht gerade förderlich sein.
Der Mörder rappelte sich wieder hoch, immer noch den Morgenstern in der Hand. Michael sprang zur Wand und riss ein Breitschwert aus seiner Halterung, dann wirbelte er herum, um sich dem nächsten Angriff zu stellen.
Der Deutsche beäugte argwöhnisch das Schwert und riss seinerseits eine Streitaxt von der Wand. Den Morgenstern warf er beiseite. Die beiden Männer taxierten sich ein paar Sekunden, auf der Suche nach einer guten Eröffnung, dann täuschte Michael mit einem Stoß an und die Streitaxt wehrte ihn klirrend ab. Der Mörder sprang vor, wich einem Hieb des Schwertes aus und hob die Axt zum Schlag. Aber Michaels Schwert war zur Stelle, um ihn abzufangen; die Axt traf das Heft des Schwertes in einem blauen Funkenschauer, brach die Klinge ab und ließ Gallatin mit einem nutzlosen Stummel zurück. Der Mörder schwang die Axt nach dem Gesicht seiner Beute und spannte seine Muskeln für den bevorstehenden Aufprall.
In Sekundenbruchteilen hatte Michael die subtilen Winkel und Richtungen des Schlages abgeschätzt. Er begriff, dass ihn ein Schritt nach hinten den Kopf kosten würde, ebenso ein Schritt nach rechts oder links. Also bewegte er sich nach vorne, auf den Angreifer zu, und da Schläge ins Gesicht nicht viel auszurichten schienen, rammte er seine Faust in die exponierte Achselhöhle des Mannes und zielte mit den Knöcheln auf den Druckpunkt der Venen und Arterien.
Der Mörder schrie vor Schmerzen auf, und als sein Arm taub wurde, verlor er die Kontrolle über die Axt. Sie flog ihm aus der Hand und bohrte sich fünf Zentimeter tief in die Eichenvertäfelung der Wand. Michael schlug ihm auf die gebrochene Nase, was seinen Kopf nach hinten klappen ließ, und setzte sofort mit einem Schlag auf die Kinnspitze nach. Der Deutsche grunzte, spuckte Blut und stolperte rückwärts gegen das Geländer der Galerie. Michael folgte ihm, holte aus, um nach seiner Kehle zu schlagen – aber plötzlich schnellten die Arme des Attentäters vor, klammerten sich um Gallatins Hals und hoben ihn von den Beinen.
Michael trat um sich, hatte aber keinen Bodenkontakt mehr. Der Mörder hielt ihn fast auf eine Armlänge Abstand, und es würde nicht lange dauern, bis ihm die Idee kam, Michael über das Geländer auf den Fliesenboden der Halle zu werfen. Einen halben Meter über Michaels Kopf verlief ein Eichenbalken, aber der war glatt poliert und bot keinen Halt für die Finger. Das Blut dröhnte in seinem Kopf, öliger Schweiß drang aus seinen Poren – und tief in seinem Inneren begann sich etwas anderes zu regen und aus einem schattenhaften Schlaf zu erwachen.
Die Finger pressten sich in Michaels Arterien und unterbrachen die Blutzufuhr zu seinem Gehirn. Der Mörder schüttelte ihn, zum Teil aus Verachtung, zum Teil, um einen besseren Griff zu bekommen. Das Ende war nah; der Deutsche konnte sehen, wie die Augen des anderen immer mehr vortraten.
Michaels Arme langten nach oben, Finger kratzten den Eichenbalken. Sein Körper bebte heftig, eine Bewegung, die der Attentäter als das Nahen des Todes interpretierte.
Und das war es auch – aber für ihn.
Michael Gallatins rechte Hand begann sich zu verkrampfen und zu verzerren. Schweiß lief ihm übers Gesicht, und äußerste Qualen spiegelten sich darauf wider. Das schwarze Haar auf seinem Handrücken kräuselte sich, die Sehnen verschoben sich. Es gab leise, knackende Geräusche wie von brechenden Knochen. Die Hand krümmte sich, die Knöchel schwollen an, die Haut wurde fleckig und grob, das schwarze Haar breitete sich aus.
»Stirb, du Schweinehund!«, sagte der Mörder auf Deutsch. Er schloss die Augen, konzentrierte sich ganz darauf, den Briten zu erwürgen. Nicht mehr lange … wenige Sekunden …
Etwas bewegte sich unter seinen Händen. Es fühlte sich an wie krabbelnde Ameisen. Der Körper wurde schwerer. Kräftiger. Da war ein durchdringender Tiergeruch.
Der Mörder öffnete die Augen und sah sein Opfer an.
Er hielt etwas in den Händen, das kein Mensch mehr war.