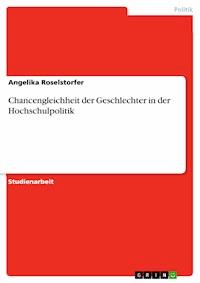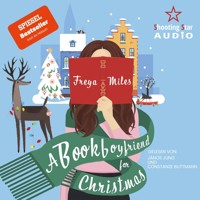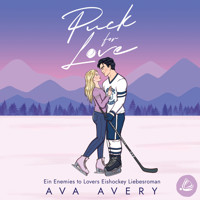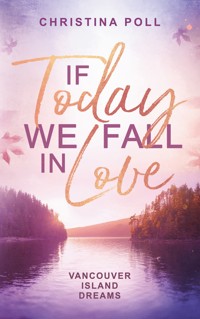39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Medien und Politik, Pol. Kommunikation, Note: 2, Universität Wien (Staatswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit fokussiert auf die Forschungsthese antiserbischer mediale Berichterstattung in Österreich und versucht diese These mittels der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse zu verifizieren. Theoretisch verortet sie sich auf dem Feld der Öffentlichkeitsforschung, wobei explizit auf Habermas und Luhmann Bezug genommen wird; weiters werden die Denkfigur des kollektiven Gedächtnisses und der Stereotypenbildung miteinbezogen. Die Medien werden als Konstrukteure gesellschaftlicher Wirklichkeiten betrachtet. Nach dem theoretischen Teil folgt ein kurzer historischen Abriss zum Jugoslawienkrieg 1991-1995 und die Inhaltsanalyse der gewählten Printmedien. Die zur Beantwortung der Forschungsfrage bestimmten Kategorien sind geeignet, die Hypothese nach antiserbischer Berichterstattung österreichischer Printmedien zu untersuchen. Die dabei gewonnenen Ergebnisse bestätigen – mit einer Ausnahme - das die analysierten Printmedien durchgehend auf antiserbische Stereotypen zurückgreifen bzw. antiserbische Feindbildkonstruktionen verwenden. In den Schlußbemerkungen werden Begründungen für diese Berichterstattung vorgeschlagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
1 SCHÖPFUNG DER FRAGEN 7
1.1 FORSCHUNGSTHESE
1.2 THEORIE
1.2.1 Methode
1.3 INHALTUNDAUFBAU2 VORVERSTÄNDNISSE: MEDIEN, ÖFFENTLICHKEIT, KOLLEKTIVE SYMBOLE 11
2.1 STRUKTURWANDELDERÖFFENTLICHKEITIMLAUFEDERZEIT 11
2.2 DAS VERHÄLTNIS MEDIENUNDÖFFENTLICHKEIT
2.2.1 Mediale Öffentlichkeit und Medienwirkung
2.2.2 Medien und Macht
2.2.3 Medien als Ort des Diskurses und des politischen Geschehens
2.2.4 Printmedien als öffentlicher Raum in Österreich?
2.3 BEGRIFFSABKLÄRUNGEN
2.3.1 Ein Modell der Öffentlichkeit
2.3.2 Information
2.3.3 Massenmedien
2.3.4 Medienkompetenz
2.4 WIRKLICHKEITSKONSTRUKTIONDERMEDIENIMKRIEG
2.4.1 Krisendefinition und die Medienfunktion der Krisenkommunikation
2.4.2 Konstruierte Realität und soziale Wirklichkeit
2.4.3 Stereotype als Denkfigur und Kollektivsymbole
2.4.4 Feindbildkonstruktion
2.4.4.1 Die Funktion der Sprache und Sprachbilder
2.4.4.2 “Atrocity Propaganda“ - ein historischer Exkurs
2.5 DIEFORSCHUNGSLEITENDEMETHODE - QUALDERWAHL?
2.5.1 Qualitative oder quantitative Methode?
2.5.2 Text- und Inhaltsanalyse als qualitative Forschungsstrategie 443 ABRISS DES KRIEGSVERLAUFS 46
3.1 DER BEGINNDESKRIEGS 1991 46
3.2 KONZENTRATIONSLAGERINBOSNIEN-HERZEGOWINA 1992
3.3 DAS KRIEGSJAHR 1993
3.4 DIE INTERNATIONALISIERUNGDESKRIEGES
3.5 BOSNIEN-HERZEGOWINA 19954 INHALTSANALYSE: DIE MEDIEN UND DER JUGOSLAWISCHE KRIEG 66
4.1 KOMMUNIKATIONSEREIGNISSE
4.1.1 Erzählungen über den Krieg - „balkanische Zustände“
4.1.1.1 Der Balkan als kulturelle Peripherie
4.1.1.2 Die mediale Sprache - Kriegsbeschreibungen
4.1.2 Das Arsenal der Holocaust-Erinnerungen
4.1.2.1 Vergleiche mit dem Nationalsozialismus
4.1.2.2 Sklaven und Deportationen
4.1.2.3 Konzentrationslager
Page 7
1 Schöpfung der Fragen
1.1 Forschungsthese
Ich gehe von der These aus, dass wie in den allermeisten damals veröffentlichten und den meist unbegründet gebliebenencommon senseverfolgenden Büchern und Publikationen sich auch die österreichische Medienlandschaft bei ihren Berichten über den jugoslawischen Krieg aus österreichischer Sicht auf eine einseitige und ausschließlich zu Lasten der Serben gehende Berichterstattung beschränkt hat. Ich werde versuchen, in den Printmedien Berichte zu finden, die diese „antiserbische“ Berichterstattung deutlich widerspiegeln und damit die Theorie der Macht der Medien als Akteur im Krieg bestätigen. Im Sinne einer Inhalts- und Textanalyse werde ich versuchen, dies zu verifizieren. In den Schlussbemerkungen werde ich Begründungen für die überwiegend unkritische „antiserbische“ österreichische Berichterstattung über den Krieg und die in diesen Diskussionen „konstruierte Realität“ vorschlagen.
1.2 Theorie
Da im jugoslawischen Krieg die Medien eine meist unkritische und vorgefertigte Meinung transportierten ist die Frage interessant: „Wer erzählt was und warum?“ Wie entsteht so genanntes Wissen über einen als wahr erkannten Sachverhalt - zum Beispiel die Rolle des Aggressors im Krieg - und kann gar von einer Wissenskonstruktion die Rede sein? Da die öffentliche Kommunikation und das Wechselspiel zwischen Autor und Rezipient
Page 8
entscheidend für die Beantwortung dieser Frage ist, muss die vorliegende Arbeit auf dem Feld der Öffentlichkeitsforschung verortet werden.
Massenmedien stellen einen öffentlichen Raum für Diskussion zur Verfügung. Erst die Repräsentation in den Massenmedien stiftet in der Gegenwarts- und Informationsgesellschaft die Qualität der allgemeinen öffentlichen Diskussion. Im Krieg werden die Medien deshalb als„vierterAkteur“ bezeichnet. Die in den Medien erzeugten und veröffentlichten Texte sind Beiträge zur gesellschaftlichen Wirklichkeitskonstruktion, sie bestimmen durch ihreredaktionellen - Selektionsprozesse zum Beispiel den politischen Code, was politisch denkbar ist1.
Die Massenmedien eignen sich in besonderer Weise als Grundlage für eine empirische Analyse öffentlicher Diskussion, sie sind nämlich die Schauplätze, auf denen über dieöffentliche - Bedeutung von Botschaften entschieden wird.
Diese Arbeit gründet sich daher auf dem Verständnis der Öffentlichkeit und der Öffentlichkeitsforschung, da öffentliche Kommunikation vor allem in den Massenmedien verortet wird. Im Besonderen wird Jürgen Habermas´ Modell der Öffentlichkeit und das Denkgebäude der „Vermachteten Arena2“, in dem organisierte Kollektive - die Massenmedien - die Öffentlichkeit herstellen und die Diskussionen der Öffentlichkeit beherrschen, berücksichtigt. Auch auf die Denkgebäude zur Stereotypenbildung und der Kollektivsymbole sowie auf Luhmanns Idee der „konstruierten Realität3“ wird eingegangen, soweit es für die Analyse erforderlich erscheint. Die Theorien des Sozialkonstruktivismus werden nur gestreift um die Phänomene einer Wirklichkeitskonstruktion zu illustrieren.
Diese Ideen sind geeignet, eine Analyse der Konstruktion von Wirklichkeit das Thema der vorliegenden Arbeit betreffend zu erstellen und das Wechselspiel zwischen Wirklichkeitskonstruktion und Wirklichkeitsobjektivierung zu beleuchten.
1Bourdieu, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht, VSA-Verlag, Hamburg 1992.
2Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1990, S.28.
3Luhmann,Niklas: Die Realität der Massenmedien, 3. Auflage, VS Verlag, Wiesbaden 2004, S. 138 ff.
Page 9
1.2.1 Methode
Die Methode dieser Theorie ist die Inhalts- und Textanalyse der qualitativen Sozialforschung also die empirische Untersuchung von Daten bzw. eines Datenkorpus´. Entscheidend für die Durchführung einer solchen Analyse ist die Untersuchung dessen, „was zu wem in welchem Kontext gesagt wird4“. Der Datenkorpus besteht aus Artikeln österreichischer Printmedien zur Berichterstattung in den Kriegsjahren 1991-1995, die entsprechende „antiserbische“ Narrative, Sprachbilder und Stereotype enthalten. Für die Erhebung des benötigten Datenkorpus habe ich umfassende Recherchen in verschiedenen Archiven und Bibliotheken der Ministerien, der Landesverteidigungsakademie, der Militärakademie in Wiener Neustadt, der Staatendokumentation des Bundesministerium für Inneres, und der Österreichischen Nationalbibliothek sowie engmaschige Online-Recherche mittels der APA-Defacto Suchmaschine durchgeführt. Ausgewählte Artikel werden für die Inhaltsanalyse herangezogen.
1.3 Inhalt und Aufbau
Im ersten Teil meiner Arbeit werde ich deskriptiv auf die Theorien der Öffentlichkeit nach Michael Jäckel eingehen5, mich kurz dem Verhältnis von Medien und Macht widmen und mich dem Begriff „Öffentlichkeit“ und seiner Bedeutung für die Massenmedien von Jürgen Habermas sowie dem Topos der „konstruierten Realität“ und der Wirklichkeitskonstruktion nähern. Die Theorie der Kollektivsymbolik wird im Rahmen der Betrachtung von Stereotypenbildung Erwähnung finden. Ein kurzer Abriss über Methodenwahl und untersuchten Datencorpus ergänzt dieses Kapitel.
Für die notwendige Analyse der Berichterstattung über den jugoslawischen Krieg wird die Wirklichkeitskonstruktion unter besonderer Berücksichtung der Krisenkommunikation und der konstruierten Realität beleuchtet. Es ist dazu notwendig, spezielle Faktoren der Kriegsberichterstattung im Zusammenhang mit der Bildung von Stereotypen und
4Keller, Reiner: Wissenssoziologische Diskursanalyse. Grundlegung eines Forschungsprogramms, Verlag für Sozialwissenschaften, 1. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 281.
5Jäckel, Michael (Hrsg.): Mediensoziologe, Grundlagen und Forschungsfelder, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S. 295-318.
Page 10
Feindbildkonstruktionen einerseits und der Theorie der Kollektivsymbolik andererseits zu betrachten, da diese Hilfsmittel bei Konstruktion von Wirklichkeiten sind. Werke von Habermas, Chomsky, Luhmann, Melčić, Silber/Little, Beham, Bittermann und Elsässer genauso wie einige Werke zur Einführung in die Medien- und Diskurstheorie sind Grundlage für den theoretischen Teil der der geplanten Arbeit.
In einem Teil meiner Arbeit ist es erforderlich, die historischen Fakten des jugoslawischen Kriegs aus österreichischer Sicht im Zeitraum 1991-1995 in Form einer deskriptiven Zeitleiste zu beschreiben um Verständnis für die Ereignisse jener Zeit zu schaffen, da nur auf Grundlage des objektiven Faktenwissens die darauf gründenden Medienberichte und die daraus folgende Medienanalyse verständlich gemacht werden kann. Für den Umfang der Arbeit erscheint es jedoch dann geboten, einzelne Kommunikationsereignisse aus dem Kriegsverlauf herauszugreifen und der Analyse zugänglich zu machen.
Der dritte Abschnitt - und Hauptteil der Arbeit - liefert eine empirische Untersuchung einschlägiger österreichischer Printmedienartikel im betreffenden Zeitabschnitt des jugoslawischen Kriegs. Diese Analyse wird aus dem Blickwinkel der Inhaltsanalyse betrieben, die Frage „Wer sagt was zu wem warum?“ wird der leitende Gedankengang dabei sein. Dieser Teil der Arbeit enthält eine Darstellung von Stereotypen, Sprachbildern und Metaphern der österreichischen Medienberichterstattung. anhand ausgewählter Artikel. Diese
Medienberichterstattung wird hinsichtlich im Sinne „antiserbisch“ kritischer und unkritischer Betrachtungsweise analysiert.
Letztlich werde ich die durch die empirische Analyse der Berichterstattung gewonnenen Erkenntnisse über die hinsichtlich Wirklichkeitskonstruktion bestehende politische Deutungs-und Gestaltungsmacht der Medien im Krieg zusammenfassen - ohne Medienkommunikation keine Politik! - und die im öffentlichen Raum der Medien stattfindende Diskussion über den jugoslawischen Krieg darstellen und versuchen, zu begründen. Dies stellt das Fazit meiner Arbeit dar.
Page 11
2 Vorverständnisse: Medien, Öffentlichkeit, kollektive
Symbole
2.1 Strukturwandel der Öffentlichkeit im Laufe der Zeit
Möchte man in einfachen Worten die Medientheorie beschreiben oder gar eine konkludente Definition liefern, stößt man bald auf ein theoretisch-strukturelles Problem der Abgrenzung des Begriffs „Medien“. Nicht nur fungieren unter anderen die Informations- und die Kommunikationswissenschaften, die Philosophie, Publizistik, Soziologie und sogar die Mathematik als Teilgebiete der Medientheorie, überdies herrscht ein gedachter Konsens der Wissenschaft, sich nicht auf einen einheitlichen Medienbegriff festzulegen. Zu unterschiedlich scheinen die Zugänge der geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen zu der relativ jungen Disziplin der Medientheorie zu sein. Diese Theorien haben sich für die vorliegende Arbeit nicht fruchtbar erwiesen.
Ergiebiger erscheinen da hingegen die Denkmodelle der Öffentlichkeitsforschung, die innerhalb der Kommunikationswissenschaft zu verorten sind. Öffentlichkeitsforschung widmet sich der öffentlichen Kommunikation, die in modernen Gesellschaften hauptsächlich in und durch Massenmedien stattfindet. Manchmal wird Öffentlichkeitsforschung sogar als Massenmedienforschung begriffen.
Noch vor einer Generation kam die Kommunikationsforschung ohne den Öffentlichkeitsbegriff aus. Erst Jürgen Habermas löste den Startschuss aus, nach dem Kommunikation ohne Beachtung der Öffentlichkeit nicht denkbar ist. Im Jahr 1961 habilitierte er mit dem Werk „Strukturwandel der Öffentlichkeit6“ und legte damit den Grundstein für die moderne Öffentlichkeitsforschung.
6Habermas 1990.
Page 12
Seit Habermas sind die „Politisierung des gesellschaftlichen Lebens“ und der „Aufstieg der Meinungspresse7“ im England des 18. Jahrhunderts zugleich Grundbedingung und Beginn der politischen Öffentlichkeit. Standen zuvor nur die öffentlichen Versammlungen in Kaffeehäusern, Salons und privaten Lesezirkeln als öffentlicher Ort für diepublic opinionund Diskussionen darüber zur Verfügung, so stieg in dieser Zeit das Angebot an Tageszeitungen und Magazinen rapide und die Presse etablierte sich zum „kritischen Organ eines politisch räsonierenden Publikums, als fourth Estate.8“ Die Tagespresse wurde zum „permanenten kritischen Kommentator, der die Exklusivität des Parlaments definitiv aufgebrochen hat und zum offiziell bestellten Diskussionspartner der Abgeordneten9“. Wie überaus aktuell!
Ganz so friktionsfrei dürften die Verhältnisse um diese neuen Zeitungen jedoch nicht gewesen sein, diente doch die Presse gleichzeitig auch den Interessen der Herrschenden. Eine Presseverordnung aus dem Jahre 1769 der Wiener Regierung stellt unmissverständlich klar: „Damit die Zeitungsschreiber wissen mögen, was für inländische Anordnungen, Anstalten und andere vorkommende Sachen für das Publikum geeignet sind, sollen solche von den Behörden wöchentlich zusammengefasst und an den Zeitungsverfasser abgegeben werden10.“
Als der Aufstieg der Meinungspresse nicht mehr aufzuhalten schien, hieß es in einer Anordnung aus dem Jahr 1784: „Eine Privatperson ist nicht berechtigt über Handlungen, das Verfahren, die Gesetze, Maßregeln und Anordnungen der Souveräne und Höfe, ihrer Staatsbedienten, Kollegien und Gerichtshöfe öffentliche, sogar tadelnde Urteile zu fällen, oder davon Nachrichten […] bekannt zumachen oder durch den Druck zu verbreiten11.“
In unserer heutigen Medien- und Informationsgesellschaft sind solche Anordnungen undenkbar. Die Öffentlichkeitsforschung wird durch die Diskussionen über medienabhängige und mediengestaltete Politik geprägt. Untersuchungsfeld ist unter anderen der Einfluss der öffentlichen Meinung auf die Politik wie zum Beispiel die anhand der kurz vor jeder Wahl veröffentlichten Meinungsumfragen und ihre Folgen für das Wählerverhalten diskutiert
7ebd. S 14.
8ebd. S. 126.
9ebd. S. 132.
10ebd. S. 79.
11ebd. S. 84.
Page 13
werden. Öffentlichkeit wird gedacht als politische Öffentlichkeit, in der sich „mindestens zwei Prozesse kreuzen - die kommunikative Erzeugung legitimer Macht einerseits und andererseits die manipulative Inanspruchnahme der Medienmacht zu Beschaffung von Massenloyalität und Nachfrage12.“ Die politische Kommunikation ist ein unabdingbarer Aspekt der Öffentlichkeitsforschung.
2.2 Das Verhältnis Medien und Öffentlichkeit
Trotz der von Habermas beschriebenen schwierigen Startbedingungen gewann die Presse zunehmend und unaufhaltsam an Bedeutung für die Gesellschaft und die politische Öffentlichkeit. Im Jahr 1816 erschien die erste Zeitung mit einer Auflage von mehr als 50.000 Stück, das „Cobbet´s Political Register“, ein äußerst regierungskritisches Blatt, dass die Interessen der Arbeiter vertrat. Die daraufhin notwendig gewordene Flucht des Journalisten William Cobbet nach Amerika konnte den Erfolg seiner Zeitung nicht aufhalten, wenige Jahre später wurden bereits über eine Million Stück verkauft.
Von einer Mediengesellschaft war man damals noch weit entfernt, aber das steigende Interesse der Rezipienten an Massenmedien war nicht aufzuhalten. Im Folgenden wird daher verstärkt auf die Bedeutung der Medien auf die Öffentlichkeit moderner Gesellschaften eingegangen denn die Medien sind nicht nur einfacher Akteur im Zusammenspiel zwischen öffentlicher Meinung und Gesellschaft, sie machen die Gesellschaft durch ihre Berichterstattung für ihre Teilnehmer beobachtbar und letztendlich tragen sie zu ihrer Gestaltung bei, so dass wir heute von einer Medien- und Informationsgesellschaft sprechen.
Nach Imhof ist es in einer modernen Gesellschaft notwendig, dass ihre Mitglieder ein politisches Bild ihrer Gesellschaft besitzen und einen gemeinsamen politischen Geltungsbereich erkennen. Erst dies macht eine Gesellschaft aus. Das System Politik muss in die Lage versetzt sein, allgemeingültige Normen und Entscheidungen zu treffen und Probleme seiner Sphäre zu lösen, zumindest zu bearbeiten. „Demokratische Selbstherrschaft“ impliziert, dass die Mitglieder einer Gesellschaft gleichsam selbst zu Autoren ihrer Gesetze und
12ebd. S. 45.
Page 14
Institutionen werden und das politische System somit weit aus seinem engen Institutionengeflecht hinausragt13. Was aber hat das mit öffentlicher Kommunikation zu tun?
Grundlage für die Einwirkung der Gesellschaftsmitglieder auf ihre Gesellschaft und somit auf sich selbst sowie für den gemeinsamen politischen Begriff einer Gesellschaft ist die öffentliche Kommunikation. Nur in der kommunizierenden Öffentlichkeit ist die Gesellschaft beobachtbar, gestaltbar, diskutierbar und letztendlich veränderbar.
Es stellt sich die Frage, was diese Öffentlichkeit eigentlich ist. Habermas beantwortet diese Frage umfangreich in historischem Kontext im „Strukturwandel der Öffentlichkeit“. Für ihn definiert sie sich als Netzwerk von Kommunikationsflüssen, die in bestimmten Arenen zusammentreffen. Dieses Netzwerk wird hauptsächlich durch die Systeme Politik, Ökonomie und Medien, aber auch durch die Zivilgesellschaft generiert. Öffentlichkeit entsteht zuerst auf Grund von Kommunikation von Akteuren und Organisationen und wird gleichzeitig durch prozesshafte öffentliche Kommunikation ergänzt. Habermas nennt diesen Denkansatz „diskursives oder kommunikatives Handeln14“.
Die öffentliche Kommunikation findet meist - und das lässt sich von jedem Einzelnen im täglichen Leben selbst überprüfen - anhand von aktuellen (Kommunikations)-Ereignissen statt. Imhof beschreibt die Arena des öffentlichen Aufmerksamkeitswettbewerbs, in der das für Gesellschaftsgruppen relevanteAgenda-Settingder Kommunikation stattfindet. Die Anzahl der teilnehmenden Akteure ist de facto unbegrenzt. Die Akteure richten ihre Kommunikation auf diese Kommunikationsereignisse und werden dabei wiederum beobachtet und besprochen. An ihren Äußerungen zu einem Ereignis werden sie unter Berücksichtung ihrer Definitionsmacht gemessen15. Journalisten werden zu Personen des öffentlichen Lebens, zu „Stars“, ihre Kolumnen sind wieder Gegenstand von öffentlichen Diskussionen und werden rezipiert.
13Imhof, Kurt: Medien und Öffentlichkeit, in: Jäckel, Michael (Hrsg.): Mediensoziologie, Grundfragen und Forschungsfelder, VS für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S. 273.
14Habermas 1990, S 34.
15Imhof 2005, S. 275.
Page 15
Die Medien ermöglichen dauerhafte öffentliche Kommunikation und stellen einen öffentlichen Raum für deren Beobachtung zur Verfügung. Besonders Printmedien - in neuerer Zeit verstärkt auch die Online-Medien - ermöglichen gesellschaftsweite Resonanz und Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Kommunikationsereignis. Sie generieren durch ihre Berichterstattung auch Kommunikationsereignisse und beobachten und referieren dann die gesellschaftliche Kommunikation darüber und lösen wiederum Kommunikation aus. Die medienvermittelte öffentliche Kommunikation ist gekennzeichnet durch ausgesprochene Selbstreferenz16und befindet sich quasi in einemcirculus vitiosus.
Wer aber kann nun als Akteur in diesem selbstreferentiellen Kommunikationssystem der öffentlichen Kommunikation betrachtet werden? Vor allem sind es die politischen Parteien und politische Institutionen, sämtliche Bestandteile eines politischen Systems inklusive der Zivilgesellschaft, welche Kommunikation mit ihrem Publikum, dem Souverän, herstellen. Diese Akteure bedienen sich professioneller Kommunikationsstrategen und Spezialisten derPublic Relationum ihrer Rolle des wichtigen Kommunikators gerecht werden zu können. Dies wird uns im Laufe der Arbeit noch näher beschäftigen denn es machte einen großen Unterschied in der Berichterstattung über die Vorgänge des jugoslawischen Krieges, ob und von welchen Kriegsparteien Kommunikationsprofis und PR-Agenturen beschäftigt wurden.
Weitere Akteure der öffentlichen Kommunikation seien hier nur der Vollständigkeit halber genannt: es sind dies die Wirtschaftsunternehmen, die mittels Werbeagenturen um Aufmerksamkeit der Zuhörer wetteifern. Es geht bei diesen Kommunikationen meist um das Ansprechen verschiedener Gesellschaftsgruppen in ihren Konsumentenrollen. Auch diese Akteure beschäftigen professionalisierte Marketing-Strategen um ihre Kommunikation in richtige Bahnen zu lenken und zu veröffentlichen. Als weitere Akteure seien genannt die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft, die Religion und viele andere, die öffentliche Kommunikation benötigen und herstellen.
Medienorganisationen haben die Funktion, die Gesellschaft und ihre Akteure zu beobachten und ihre Erkenntnisse zu kommunizieren. Ihre Rolle ist besonders interessant, da sich diese Organisationen in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu politischen
16ebd. S. 277.
Page 16
Organisationen oder auch Wirtschaftsunternehmen befinden. Denn sowie legitime Entscheidungen, Bekanntheit von Maßnahmen und Reputation von Entscheidungsträgern ohne die von den Medien veröffentlichte Kommunikation nicht denkbar ist, so benötigen die Medien schlicht Kommunikationsereignisse, die von diesen Akteuren zuverlässig geliefert werden. Ohne Medienkommunikation keine Politik, ohne Politik keine Medien!
2.2.1 Mediale Öffentlichkeit und Medienwirkung
Daher ist es angezeigt, nun den Fokus auf die Massenmedien zu lenken. Massenmedien haben die öffentliche Kommunikation grundlegend verändert, sie wurde zur medial vermittelten Kommunikation. Damit einhergehend hat sich die Öffentlichkeit verändert, sie wurde zur medialen Öffentlichkeit.
War vor dem bereits beschriebenen Aufschwung der Presse die Kommunikation und somit die Öffentlichkeit noch an Ort und Zeit gebunden, so sind Medien in unserer heutigen Gesellschaft in Permanenz verfüg- und gebrauchbar und ermöglichen Dauerkommunikation. Auch die Rezipienten als Ansprechpartner sind dauerhaft existent. In den Massenmedien gibt es Autoren und Rezipienten, geschulte Vermittler - Journalisten und Berichterstatterselektieren ihre Themen und werden zu den wichtigsten Akteuren der öffentlichen Kommunikation. Über enorme technische Reichweiten und daher zeit- und ortsunabhängige Kommunikation entsteht die jedermann zugängliche Massenkommunikation. Diese Freiheit und Unabhängigkeit ist aber nur eine vermeintliche! Durch die Abhängigkeit der Öffentlichkeit von den genannten Akteuren wird das Publikum zum passiven Zuhörer. Trotz der Vergrößerung der Zugangschancen eines einzelnen Rezipienten erlebt sich dieser als zunehmend ausgeliefert und einer neuen Macht hilflos ausgesetzt: der Medienmacht, „die manipulativ eingesetzt, dem Prinzip der Publizität seine Unschuld raubte17“.
Den Zusammenhang zwischen Massenmedien und Rezipienten zu erforschen, ist Teil und Aufgabe der Medienwirkungsforschung. Dieser Aspekt der Kommunikations- und Medienforschung interessiert seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Beginn dieser Forschungen
17Habermas 1990, S. 28.
Page 17
waren die Auswirkungen der Kriegsberichterstattung im Ersten Weltkrieg, der als einer der ersten „öffentlichen Kriege“ gelten kann, wie an späterer Stelle ausgeführt wird.
In den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts stellte der österreichische Soziologe Paul Lazarsfeld die Theorie auf, dass prinzipiell eine sehr geringe Medienwirkung der Massenmedien auf den Rezipienten vorläge, was meinungsändernde oder meinungsbildende Effekte betraf18. War man in den Anfängen dieser Forschungen noch überzeugt, dass Massenmedien auf alle Rezipienten gleich wirken, so gelangte man bald zu dem Schluss, dass zahlreiche in der Sphäre der Rezipienten liegende Faktoren die Medienwirkung beeinflussen. Als Beispiele für solche Faktoren können Wissen, Bildung aber auch die selektive Zuwendung und Wahrnehmung genannt werden. Letzte besagen, dass sich Rezipienten eher Medien zuwenden und Berichte wahrnehmen, die ihren eigenen Einstellungen nicht widersprechen und Medien sozusagen eine Verstärkerfunktion der eigenen Standpunkte einnehmen19. Dies erscheint in der eigenen persönlichen Praxis leicht überprüfbar, werden doch im Alltag selten Massenmedien konsumiert, deren Blattlinie und Berichterstattung am gegenüberliegenden Ende der eigenen Einstellungsskala liegen. In heutiger Zeit ist man überzeugt, dass Massenmedien prinzipiell eine starke Medienwirkung auf den Rezipienten besitzen. In der Medienwirkungsforschung ist der aktive Rezipient in den Vordergrund der Forschung getreten.
In der aktuellen Medienwirkungsforschung gibt es zahlreiche Richtungen, die hier zu beschreiben nicht der Platz ist. Eine dieser Forschungsrichtungen beschäftigt sich jedoch mit der Problematik der Wirklichkeitskonstruktion und der Theorie, dass Medien eine Realität schaffen, die vom Rezipienten nicht überprüft werden kann. Dies ist Thema und gedankliche Grundlage der vorliegenden Arbeit.
Massenmedien sind längst zum wichtigen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Sie entscheiden für uns, welches Bild wir und von der ins unsere Wohnzimmer übertragenen Welt machen und sie müssen eingedenk ihrer wirtschaftlichen Existenz Leser gewinnen. Wir müssen uns meist mangels Alternativen darauf verlassen, dass die Berichte, Analysen und
18vgl. Lazarsfeld, Paul ,Berelson, Bernard,Gaudet, Hazel: The People’s Choice. How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. Columbia University Press, 3. Auflage, New York 1968.
19Schenk, Michael : Medienwirkungsforschung, 3. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2007, S. 320.
Page 18
Reportagen nicht frei erfunden sind sondern der Wirklichkeit entsprechen. Ob die Medien mit dieser ihrer Macht verantwortungsvoll umgehen, kann vom Rezipienten nicht eingeschätzt werden. Er bleibt - gesetzt den Fall er macht sich überhaupt Gedanken darüber - hilflos zurück. Das wirksame Rezept dagegen ist die Medienkompetenz, deren Begriffsabklärung später erfolgen wird.
2.2.2 Medien und Macht
Es erscheint an dieser Stelle sinnvoll, kurz das Verhältnis von Medien und Macht zu hinterfragen. Der Soziologe Dr. Michael Jäckel hat hier eine oft rezipierte Studie vorgelegt, die auch den Zusammenhang mit Habermas´ „Vermachteter Arena“ herstellt20. Dieser Begriff wird später noch erläutert.
Wenn man über das Phänomen der Macht spricht, gilt es, den Unterschied zu Herrschaft zu untersuchen. Alltagsprachlich ist eines wie das andere, jedoch lassen sich aus soziologischer Sicht bedeutende Unterschiede festmachen. Max Weber definierte Herrschaft als „die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden21“. Damit wird eine Über- und Unterordnung angesprochen, die „Macht“ alleine noch nicht hat. Macht entsteht auf Grund von Herrschaft, Herrschaft legitimiert zur Durchsetzung von Macht.