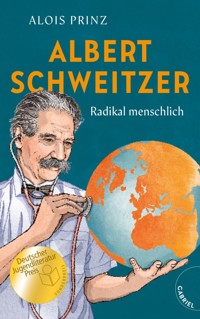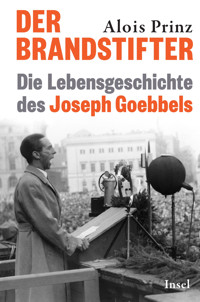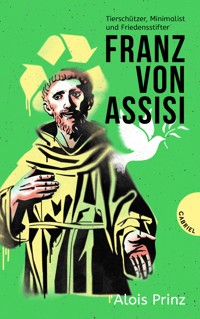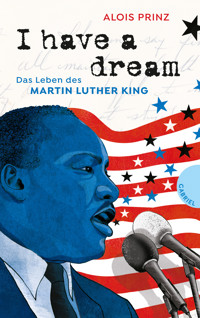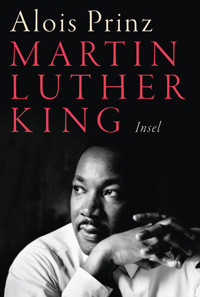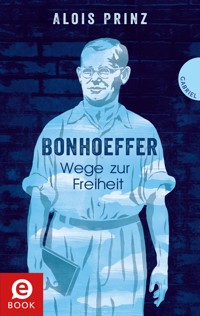11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gabriel Verlag/Thienemann
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wie wird aus dem Skeptiker Augustinus einer der großen Lehrer der Christenheit? Aus dem Kriegshelden Franziskus ein Ordensgründer? Was muss passieren, dass sich eine überzeugte Atheistin wie Edith Stein taufen lässt? Wie begründet die Theologin Dorothee Sölle ihr politisches Engagement? Alois Prinz erzählt von Menschen, die an ihre Grenzen kamen, sich nicht mehr zufrieden geben wollten mit der bestehenden Situation und sich auf die Suche machten. Von Menschen, die alle auf ihre Weise erlebt haben, dass etwas gänzlich Neues ins Spiel kam. "Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht", so fasst es Edith Stein zusammen. Lebensgeschichten für Jugendliche ab 13 Jahren von: Aurelius Augustinus, Franz von Assisi, Teresa von Avila, Martin Luther, Jesus von Nazareth, Blaise Pascal, Dorothee Sölle, Edith Stein, Elisabeth von Thüringen, Simone Weil
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buchinfo:
Wer bin ich – und was kann ich bewirken?
Teresa von Avila bezeichnet es als „Lockruf“, Dorothee Sölle als „Hunger“ – beide Begriffe beschreiben die Sehnsucht, die Menschen vorwärtstreibt, eine innere Stimme, der man folgt. Doch wie kommt es, dass sich Menschen überhaupt auf die Suche machen, sich nicht mehr zufrieden geben wollen mit der bestehenden Situation? Alois Prinz spürt in seinem neuen Buch diese „Bruchstellen“ auf, versucht zu ergründen, warum das Leben der Porträtierten eine derart radikale Wende nahm. Wie wird aus dem Skeptiker Augustinus einer der großen Lehrer der Christenheit? Aus dem Kriegshelden Franziskus ein Ordensgründer? Was muss passieren, dass sich eine überzeugte Atheistin wie Edith Stein taufen lässt? Wie begründet die Theologin Dorothee Sölle ihr politisches Engagement?
Entstanden sind berührende Lebensgeschichten von Menschen, die an ihre Grenzen kamen – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber auch von Menschen, die alle auf ihre Weise erlebt haben, dass etwas gänzlich Neues ins Spiel kam. „Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht“, so fasst es Edith Stein zusammen.
Autorenvita:
© Christina Häusler
Alois Prinz, geboren 1958, studierte Literaturwissenschaft und Philosophie. Mit seiner Familie lebt er in der Nähe von München. Er veröffentlichte bereits zahlreiche preisgekrönte Biografien über Georg Forster, Hannah Arendt, Hermann Hesse, Ulrike Meinhof, Franz Kafka und zuletzt über den Apostel Paulus (alle Beltz & Gelberg).
„Mehr als du denkst“ ist sein erstes Buch bei Gabriel.
Inhalt
Vorwort
Jesus von Nazareth
oder
Die Kunst des Fragens
Augustinus
oder
Die Unruhe des Herzens
Francesco
oder
Der Mut zur Armut
Elisabeth von Thüringen
oder
Von der natürlichen Demut
Teresa von Avila
oder
Der lebenslange Lockruf
Martin Luther
oder
Die gute Traurigkeit
Blaise Pascal
oder
Die Pflicht zu suchen
Edith Stein
oder
Die Entdeckung der Gelassenheit
Simone Weil
oder
Vom Sinn der Aufmerksamkeit
Dorothee Sölle
oder
Das Recht, ein anderer zu werden
Nachwort
Literaturhinweise
Vorwort
Es gibt viele Aussagen darüber, was der Mensch eigentlich ist und wodurch er sich von anderen Lebewesen unterscheidet. Eine könnte lauten, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das zweimal geboren wird. Einmal bei seiner leiblichen Geburt, am Anfang seines Lebens, durch seine Mutter. Und das zweite Mal, wenn er auch hinsichtlich seiner Bestimmung zur Welt kommt. Dieses zweite Ereignis meinen wir, wenn wir etwa sagen, dass jemand zu sich selbst gefunden hat oder sein wahres Ich entdeckt hat.
Solche Vorstellungen setzen voraus, dass ein Mensch noch nicht »fertig« ist, wenn er geboren ist, körperlich nicht, geistig nicht und auch seelisch nicht. Aber während die körperliche und geistige Entwicklung in den meisten Fällen sozusagen von selber abläuft, ist es nicht ausgemacht, ob jemand auch seine Bestimmung findet. Mit anderen Worten: Ob jemand seine zweite Geburt erlebt, ist nicht garantiert, sondern höchst offen. Hier kommt es auf die eigene Initiative an, hier gilt es, Hindernisse zu überwinden, Widerstände zu brechen, sich auf die Suche zu begeben und Sternen zu folgen.
In der Literatur und den Religionen wird dieser Vorgang oft verglichen mit einem Ei, dessen Schale durchbrochen werden muss. Das Küken in seinem Ei ist schon da, aber es ist noch nicht geboren. Es muss sich erst durch die Schale kämpfen, wenn es sich in die Welt befreien will.
Eine in den östlichen Religionen weitergegebene Variation dieses Bildes ist die Geschichte von den Göttervögeln.
Diese Vögel fliegen weit über den höchsten Bergen. Sie bleiben immer in der Luft und berühren nie den Erdboden. Auch ihre Eier legen sie in luftiger Höhe. Das Ei fällt der Erde entgegen, aber solange es fällt, hat das Küken Zeit, sich aus seinem Gefängnis zu befreien – sofern es überhaupt auf die Idee kommt, dass es diese Freiheit gibt.
Gelingt es ihm, dann schüttelt es die Eierschale ab, breitet die Flügel aus und steigt wieder nach oben. Ein neuer Göttervogel ist geboren.
Nur allzu oft ist es leider der Fall, dass einem Küken der Durchbruch nicht gelingt. Es müht sich immer verzweifelter, während die Erde immer näher kommt, und schließlich ist es zu spät und das Ei zerschellt am Boden. Das Küken ist nicht tot. Es ist benommen und nach kurzer Zeit rappelt es sich auf und macht erste Schritte. Es lernt zu gehen, aber eben nur zu gehen. Bei manchen bleibt höchstens eine schwache Erinnerung daran, dass es einmal möglich gewesen wäre zu fliegen.
Die in diesem Buch versammelten Lebensgeschichten erzählen von gelungenen Befreiungen aus dem fallenden Ei. Sie berichten von Menschen, die wir heute als Heilige oder zumindest als vorbildliche christliche Gestalten verehren. Die zweite Geburt ist bei diesen Personen eine religiöse, genauer gesagt eine christliche. Das heißt aber nicht, dass ihr Lebensweg zwangsläufig im Schoß der Kirche enden musste oder dass ihr Bekenntnis zum christlichen Glauben vorhersehbar war. Im Gegenteil. Die ausgewählten Frauen und Männer weisen sehr wechselvolle Schicksale auf, und es war für sie selbst und für ihre Umgebung nicht abzusehen, wohin ihr Weg sie führen wird.
Einige von ihnen, wie Aurelius Augustinus oder Franz von Assisi, standen dem christlichen Glauben lange Zeit fern. Andere, wie Edith Stein oder Simone Weil, verstanden sich sogar als Atheisten. Allen diesen Menschen ist gemeinsam, dass sie sich nicht mit dem Vorhandenen abgefunden und ihre innere Unruhe nicht betäubt haben. Sie wurden von ihren Problemen und Zweifeln vorwärtsgetrieben und hörten nicht auf, nach Lösungen zu suchen. Wir kommen, so meinte einmal Edith Stein, nicht an der Frage vorbei, wer wir sind und was wir wollen. Es war diese Frage, die Edith Stein ebenso wie Martin Luther, Blaise Pascal oder Dorothee Sölle dazu bewegt hat, sich auf die Suche zu machen. Diese Suche führte sie in eine Krise, die aber nicht ein Ende bedeutete, sondern einen neuen Anfang möglich machte. Erst auf solchen Umwegen kamen sie zu Antworten, die nach einem anderen Leben verlangten. Zu dieser Wende gehörte dann auch die Entdeckung, dass die gefundenen Antworten übereinstimmen mit den christlichen Aussagen über Gott und den Menschen. So ist es zu verstehen, wenn Edith Stein meinte: Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht.
Beispielhaft für diese Wahrheitssuche, die gleichzeitig eine Gottessuche ist, steht Jesus von Nazareth. Mit ihm beginnt die Reihe, weil sich bei ihm geradezu musterhaft zeigt, welche Voraussetzung für eine zweite Geburt unverzichtbar ist, dass wir nämlich zwei Welten angehören, einer menschlichen und einer, die darüber hinausgeht. Dementsprechend gehören zu dem »Weg«, den Jesus selbst geht und den er für alle verkörpert, zwei Geburten. Einmal die im Stall von Betlehem und zum anderen die bei der Taufe im Jordan, durch die seine eigentliche Bestimmung offenbar wurde. Mit dieser Taufe zog er sich nicht von dieser Welt zurück, sondern er wurde in einer tieferen Weise in sie hineingeboren, und er zeigte, wie man ganz in dieser Welt leben kann, ohne in ihr aufzugehen.
Die zweite Geburt folgt keinem festen Schema. Sie ist so unterschiedlich wie die Menschen, die sie erleben. Es kann sein, dass, wie bei Jesus von Nazareth oder Martin Luther, ein einziges Erlebnis das ganze bisherige Leben auf einen Schlag verändert. Es kann aber auch sein, dass eine Lebenswende durch viele kleine Erschütterungen herbeigeführt wird. Der Schnitt, der die Vergangenheit von der Zukunft trennt, kann radikal sein. Oder es kann, wie bei Teresa von Avila, sehr lange dauern, bis ein endgültiger Durchbruch gelingt. Manchmal müssen sich, wie bei Elisabeth von Thüringen, erst die Lebensumstände ändern, bis eine geistige Bekehrung sich auch in Taten und Handlungen voll entfalten kann. Denn auch das gehört zur zweiten Geburt – dass sie nicht nur ein inneres Erlebnis ist, sondern auch das Bedürfnis hervortreibt, die Welt zu ändern.
Was bei einer zweiten Geburt eigentlich stattfindet, das lässt sich nicht vollständig erklären. Es bleibt ein Rest Geheimnis. Andererseits geht ihr aber auch eine Entwicklung voraus, die man durchaus nachvollziehen kann. Es ist eine Entwicklung, in der sich Konflikte aufbauen, die sich dann irgendwann einmal in einer Explosion entladen. Welche Konflikte das sind, das hängt natürlich von der jeweiligen Zeit ab, von den Einflüssen, die jemanden prägen, in der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft.
So unterschiedlich die einzelnen Lebensgeschichten und Bekehrungserlebnisse sind, so weisen sie doch auch gewisse Ähnlichkeiten auf. Immer ist es so, dass eine scheinbar fest gefügte Welt aufgebrochen wird und ein viel weiterer Horizont sich auftut. Diese Erweiterung führt jedoch nicht weg von der alltäglichen Welt, sondern diese erscheint nur in einem anderen Licht. Bildlich gesprochen: Wenn der Vogel die Schale durchbrochen hat und sich aufschwingt, ist er immer noch in der gleichen Welt, aber er sieht sie von oben, mit den Augen eines Göttervogels. Für die Theologin Dorothee Sölle bedeutet die zweite Geburt, dass unsere Vorstellungen von der Welt und von uns selbst zerstört werden. Unser altes Ich wird überwunden, ein neues Ich tritt an seine Stelle. Diese Erfahrung kann, so glaubt sie, jeder Mensch machen. Wir sind, schreibt sie, nicht nur die, die wir kennen, die wir zu sein glauben. Wir sind alle fähig, anders zu sein, wir können uns selber verlassen, wir sind der Versenkung und der Transzendenz fähig.
Jesus von Nazareth
oderDie Kunst des Fragens
Für Christen ist Jesus von Nazareth das Vorbild für alle Menschen. Ihm sollen sie nachfolgen, das heißt, sie sollen so leben wie er. Ein solches Vorbild kann Jesus nur sein, weil er nicht nur Gottes Sohn war, sondern auch ein Mensch. Und wir Menschen sind im christlichen Verständnis nicht nur »Erdenwürmer«, sondern nach dem Bild Gottes geschaffene Wesen. Oder um es mit einem Bild des Apostels Paulus zu sagen – wir sind sehr zerbrechliche Gefäße, die einen ungeheuren Schatz in sich tragen.
Diese Spannung ist die Voraussetzung für eine Entwicklung. Auch Jesus von Nazareth hat sich im Laufe seines Lebens verändert und entwickelt. Auch er musste erst zu sich selber finden. Dreißig Jahre lang lebte er im Verborgenen in seinem Heimatdorf in Galiläa, bis er begann, herumzuziehen und seine Botschaft zu verbreiten. Aber auch schon in den Jahren davor gab es Hinweise, dass dieser Jesus mehr ist als ein Zimmermannssohn aus Nazareth. Der junge Jesus hat demnach in dem Bewusstsein gelebt, dass er etwas Besonderes ist und irgendwann der Durchbruch zu seinem eigentlichen Leben kommen wird. Aber wie lebte er mit diesem Wissen? War er ein Wunderkind oder ein ganz normaler Junge aus Galiläa?
Wo ist Joshua?
Über das Kind und den Jugendlichen Jesus, der in seiner Sprache, dem Hebräischen, Joshua hieß, weiß man so gut wie nichts. Im gesamten Neuen Testament gibt es nur eine einzige Episode aus seiner Kindheit. Darin erzählt der Evangelist Lukas, wie Joseph und Maria eines Tages mit ihrem ältesten Sohn Joshua zum Passahfest nach Jerusalem reisten. Joshua war damals zwölf Jahre alt und stand kurz vor seiner »Bar Mizwa«, seiner religiösen Volljährigkeit.
Nach dem Fest brachen Maria und Joseph wieder zur Heimreise auf. Sie waren mit anderen Leuten aus ihrer Heimat nach Jerusalem gekommen, und wie schon bei der Hinreise liefen die Kinder voraus und schlossen sich während der langen Wanderung Freunden und Verwandten an. Darum machte sich Maria auch keine Gedanken, als Joshua beim Aufbruch nicht bei seinen Eltern war und sie ihn auch die folgende Zeit nicht zu Gesicht bekam. Erst als die Gruppe schon den ganzen Tag gewandert war und die Männer sich nach einem geeigneten Platz für das Nachtlager umschauten, begann Maria nach ihrem Sohn zu suchen. Doch der war nirgends zu finden. Keiner hatte Joshua gesehen.
Langsam wurde es zur Gewissheit, dass Joshua nicht in der Gruppe war und in Jerusalem zurückgeblieben sein musste. Maria und Joseph kehrten sofort um und kamen wahrscheinlich erst spät in der Nacht in Jerusalem an. Am nächsten Morgen begannen sie, nach Joshua zu suchen. Sie durchforschten die engen Gassen der Stadt und fragten in Gasthöfen und bei Straßenhändlern nach, ob jemand einen allein herumirrenden Jungen gesehen hatte. Doch niemandem war etwas aufgefallen. Enttäuscht und voller Sorge kehrten Maria und Joseph am Abend zu ihrem Schlafplatz zurück.
Auch der nächste Tag endete ergebnislos. Joshua war nicht zu finden. Am dritten Tag gingen seine Eltern zum Tempel. Hier waren sie mit Joshua während des Passahfestes gewesen. Joseph hatte mit Tempelgeld eine Taube gekauft und sie zum Altar vor dem Allerheiligsten gebracht, wo das Tier von Priestern dem Gott Jahwe geopfert worden war.
In den Seitenräumen des Tempels wurden zwölf- oder dreizehnjährige Jungen von Schriftgelehrten unterrichtet. Gruppen von jungen Leuten saßen da beieinander, vor ihnen ein Rabbi, der aus einer Schriftrolle vorlas und die Stellen erklärte. Als Maria und Joseph einen Blick in einen dieser Räume warfen, sahen sie, dass dort viele ehrwürdige Rabbis versammelt waren. Und inmitten dieser gelehrten Gesellschaft saß ihr Sohn Joshua und redete mit den Schriftgelehrten wie ein Erwachsener.
Maria und Joseph wussten erst nicht, was sie tun sollten, so verblüfft waren sie. Schließlich war es Maria, die ihre Fassung zurückgewann. Bei aller Erleichterung und Freude darüber, dass sie Joshua gefunden hatten, war sie auch verärgert über ihn. Während sie tagelang besorgt und verzweifelt nach ihm gesucht hatten, saß er seelenruhig im Tempel, diskutierte mit den Rabbis und schien seine Eltern vergessen zu haben. Ohne auf die hohen Herren zu achten, ging Maria zu ihrem Sohn und nahm ihn streng an der Hand. »Kind«, sagte sie zu ihm, »wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht und wären fast gestorben vor Angst.« Joshua aber schaute seine Mutter nur verwundert an und meinte: »Warum habt ihr mich gesucht? Ihr hättet doch wissen können, dass ich da bin, wo mein Vater ist.«
Weder Maria noch Joseph verstanden, was er damit meinte. Sein Vater war doch nicht im Tempel gewesen, sondern auf dem Heimweg nach Nazareth, ihrer Heimat? Aber Joshua hatte schon oft Dinge gesagt, die sich sehr rätselhaft anhörten. Und in seinem Leben waren auch schon einige Sachen passiert, die sonderbar waren. Seine Eltern mussten nur zurückdenken an seine Geburt, damals in dem Stall bei Betlehem, und an die abenteuerliche Reise nach Ägypten und von dort zurück nach Nazareth. Und deshalb zerbrachen sich Maria und Joseph nicht lange den Kopf über Joshuas seltsame Entschuldigung für sein Verhalten. Sie waren froh, ihn wiederzuhaben, und machten sich auf den Weg nach Hause, nach Nazareth in Galiläa.
Nazareth in Galiläa
Die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel ist, wie gesagt, die einzige Stelle in der Bibel, wo wir etwas aus der Kindheit des Mannes aus Nazareth erfahren. Alle weiteren Berichte über ihn setzen erst ein, als er begann, herumzuwandern, Jünger um sich zu sammeln, Wunder zu wirken und seine Botschaft zu verbreiten – und da war er schon um die dreißig Jahre alt. Von alledem, was er als Kind, als Jugendlicher und junger Erwachsener getan und erlebt hat, wird nichts berichtet. Trotzdem kann man sich ungefähr vorstellen, wie das Leben des jungen Jesus ausgesehen haben muss.
Galiläa, das Land, in dem Joshua aufwuchs, war, anders als die Gegend um Jerusalem, sehr fruchtbar. Die Wiesen waren grün und im Frühjahr übersät von Blumen. In den Bächen gab es Fische und Schildkröten, und auf den Bäumen bauten Störche ihre großen Nester. Galiläa, das hieß wörtlich übersetzt »Land der Völker«, weil dort Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen lebten: Phönizier, Araber, Syrer und Griechen. In den großen Städten galten die Leute aus Galiläa als zurückgebliebene Bauern. »Dumm wie ein Galiläer«, sagte man, wenn man sich über einen beschränkten Hinterwäldler lustig machte.
Nazareth, wo Joseph mit seiner Familie lebte, war ein kleines Nest. Immerhin gab es eine Quelle, wo Karawanen Rast machten und mit deren Wasser die Tiere getränkt und die Felder bewässert werden konnten. Der Ort lag auf einem Hügel. An einigen Stellen waren Höhlen in die Abhänge gegraben, die als Vorratskammern für Lebensmittel und teilweise auch als Wohnung dienten. Die normalen Häuser sahen alle gleich aus. Es waren Hütten aus Steinen und Lehmziegeln mit nur einem Raum, der spärlich eingerichtet war. In einer Ecke war die Herdstelle, wo gekocht wurde, und als Betten dienten Matten, die auf dem Boden ausgebreitet waren. Das flache Dach gehörte sozusagen noch zum Wohnraum: Auf einer Leiter oder über eine Treppe konnten die Bewohner hinaufsteigen, um dort in den heißen Sommernächten zu schlafen. Das war nicht ganz ungefährlich. Wenn jemand einen unruhigen Schlaf hatte und sich herumwälzte, konnte es passieren, dass er vom Dach fiel und sich den Hals brach.
Kindheitsgeschichten
In den sogenannten apokryphen Schriften, also jenen Berichten und Legenden, die nicht ins Neue Testament aufgenommen wurden, gibt es noch weitere Geschichten über den jungen Jesus, die allerdings wenig glaubwürdig sind. Da wird etwa erzählt, wie das Kind Jesus mit seinen Freunden auf dem Hausdach spielte, bis einer der Jungen namens Zenon nicht aufpasste und herunterstürzte. Er blieb tot liegen. Vor Schreck liefen alle Kinder davon, nur Jesus blieb zurück. Als die Eltern des verunglückten Jungen kamen, beschuldigten sie Jesus, er sei schuld am Tod ihres Sohnes, er habe ihn gestoßen. Da sprang Jesus vom Dach und befahl Zenon, er solle wieder aufstehen. Der Junge erhob sich tatsächlich und sprach Jesus von jeder Schuld frei. Zenons Eltern warfen sich daraufhin vor Jesus nieder.
Diese Geschichte aus den apokryphen Schriften stammt von einem gewissen Thomas und ist lange nach dem Tod Jesu entstanden, als es schon viele christliche Gemeinden gab. Zu dieser Zeit, etwa 200 n. Chr., wuchs das Bedürfnis, mehr über das Leben des Jesus von Nazareth zu erfahren. Vor allem über seine Kindheit, über die man so gut wie gar nichts wusste. Also dachte sich jener Thomas Geschichten über Jesus aus, wie er ihn sich vorstellte. Er glaubte daran, dass Jesus von Nazareth der Erlöser, der Sohn Gottes war. Demnach müsse er auch schon in seiner Kindheit etwas Besonderes gewesen sein. Bei Thomas ist Jesus kein normales Kind, sondern ein Wunderknabe, der übermenschliche Fähigkeiten hat. In einer dieser Geschichten formt er aus Lehm Vögel, die lebendig werden und davonfliegen. Ein andermal stört ihn ein Kind beim Spielen und zur Strafe dafür lässt er den Jungen verdorren wie einen alten Baum.
Kein Wunder, dass die Eltern, Joseph und Maria, in den Thomas-Geschichten mit ihrem Kind viel Ärger haben. Dauernd beschweren sich die Leute im Dorf bei Joseph über seinen Sohn, weil er Leute, die ihm zuwider sind, in Böcke verwandelt oder blind werden lässt. Joseph zieht Jesus kräftig am Ohr und fordert ihn auf, mit diesem Unsinn aufzuhören, weil er sonst noch das ganze Dorf gegen die Familie aufbringt. Mehr fällt ihm auch nicht ein. Immerhin kann Jesus, laut Thomas, mit seinen Zauberkräften auch Gutes tun. Seinen Bruder Jakobus etwa macht er wieder gesund, nachdem der von einer Schlange gebissen wurde.
Auch Joseph selbst hat Vorteile von seinem wundersamen Sohn. Er ist nämlich in den Kindheitsgeschichten des Thomas ein ziemlich schlechter Zimmermann, dem oft etwas schiefgeht. Einmal soll er für einen reichen Auftraggeber ein Bett machen. Die seitlichen Bretter, die er dazu schreinert, sind aber unterschiedlich lang und Joseph ist ratlos. Zum Glück kommt ihm Jesus zu Hilfe, der das zu kurze Brett anfasst und wie mit Zauberhand auf die richtige Länge streckt.
Natürlich ist Jesus in diesem sogenannten Kindheitsevangelium allen anderen an Wissen und Weisheit überlegen. Darum können ihm auch Lehrer nichts mehr beibringen. Der Erste, der das versucht, ist ein Lehrer namens Zachäus. Er will Jesus das Alphabet lehren. Stattdessen erklärt ihm Jesus den tieferen Sinn der Buchstaben. Zachäus ist schließlich völlig verzweifelt darüber, dass ein Kind ihm so haushoch überlegen ist.
Der zweite Lehrer, zu dem Joseph seinen Sohn schickt, reagiert rabiater auf den Schüler, der klüger ist als er. Er schlägt zu, woraufhin Jesus ihn ohnmächtig zusammenbrechen lässt. Erst der dritte Lehrer erweist sich als ein guter Lehrer, weil er die Überlegenheit seines Schülers anerkennt und ihn demütig zu seinen Eltern zurückbringt.
Der Jesus in diesen Geschichten ist kein sympathisches Kind. Er ist ein altkluger kleiner Despot, dem man nicht im realen Leben begegnen möchte. Zu Recht sind darum diese Erzählungen nicht in das Neue Testament aufgenommen worden. Sie übersehen nämlich, dass Jesus nicht nur Gottes Sohn war, sondern auch ein richtiger Mensch mit all seinen Schwächen und Grenzen. So wird auch Joshua ein ganz normaler Junge gewesen sein, dessen Leben im Dorf Nazareth ablief wie das Leben Tausender anderer Kinder in Galiläa und ganz Palästina.
Ein Kind seiner Zeit
Um ermessen zu können, welch tief greifende Entwicklung Joshua bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr gemacht hatte, sollte man sich vergegenwärtigen, unter welchen Bedingungen er vermutlich aufwuchs und wie ihn diese prägten.
Sein Vater Joseph hatte als Zimmermann einen angesehenen Beruf, mit dem er, wie damals üblich, eine große Familie ernähren musste. Manche schätzen, dass Joshua noch fünf Brüder und zahlreiche Schwestern hatte. Im Haus der Familie ging es daher wohl sehr eng zu. Der Vater arbeitete sicher viel im Freien. Vielleicht hatte er auch einen Schuppen als Werkstatt und Lagerraum für seine Werkzeuge. »Wer seinen Sohn kein Handwerk lehrt, lehrt ihn zu rauben«, so lautete eine bekannte Lebensregel zu jener Zeit. Als ältester Sohn wird Joshua schon sehr früh seinem Vater zur Hand gegangen sein. Er musste lernen, wie man mit Hammer, Schlegel, Säge und Beil umgeht und wie man das Holz von Zedern, Palmen, Feigen- und Olivenbäumen voneinander unterscheidet.
Mit fünf Jahren wurde Joshua wie alle anderen Jungen in diesem Alter zur Schule geschickt. Maria brachte ihn vermutlich beim ersten Mal zum Wärter der Synagoge, der ihn dann zum Rabbi führte. Das war kein hauptberuflicher Priester, sondern ein frommer Mann aus dem Dorf, der auch die Aufgabe hatte, die Jugend zu unterrichten. Die Synagoge war gleichzeitig die Schule. Es war ein enger, karger Raum, vielleicht spärlich geschmückt mit Palmen und Davidsternen. Vorne war die Lade, in der die Schriftrollen aufbewahrt wurden. In der Mitte stand ein Holzstuhl, auf dem der Rabbi Platz nahm.
Er sprach mit seinen Schülern einen Dialekt des Aramäischen, wie sie es von zu Hause gewohnt waren. Im Laufe der Zeit lernten sie Hebräisch, um die Heilige Schrift lesen zu können. Es gab nämlich nur ein einziges Schulbuch, und das war kein gebundenes Buch, sondern eine Schriftrolle: die Thora. So heißen im Judentum die ersten fünf Bücher des Alten Testaments, in denen die Gesetze stehen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Diese Gesetze lesen zu können, sie zu verstehen und später danach zu leben, darauf zielte der ganze Unterricht ab. Also lernten die Schüler zunächst die Buchstaben des hebräischen Alphabetes, dann die ersten Hauptwörter und dann ganze Abschnitte aus der Thora. Das Lesen begleiteten sie mit rhythmischen Bewegungen der Hand oder indem sie bedächtig mit dem Kopf nickten. Manchmal zogen sie auch singend durch die Synagoge und schwangen die Gesetzesrollen über ihren Köpfen.
Der Unterricht dauerte den ganzen Vormittag. Erst mittags konnten die Kinder nach Hause. Maria durfte Joshua nicht fragen, was er in der Schule gelernt hat. Das stand einer Frau nicht zu. Sie hatte sich um das Haus und die Kinder zu kümmern, ansonsten musste sie den Mund halten und tun, was ihr Mann von ihr verlangte. Wenn er mit ihr unzufrieden war, konnte er sich von ihr scheiden lassen. Umgekehrt ging das natürlich nicht.
Für einen jüdischen Mann war die Frau ein minderwertiges Geschöpf. Er redete mit ihr möglichst wenig und er dankte täglich seinem Gott dafür, dass er nicht als Ungläubiger, als Sklave oder als Frau geboren worden war. Auch im Tempel in Jerusalem durften Frauen nur den Vorhof betreten. Vom religiösen Kult waren sie, weil sie als unrein galten, weitgehend ausgeschlossen. Besser das Gesetz gehe in Flammen auf, so lautete ein Spruch, als dass es an die Weiber geriete.
Joshua übernahm mit den Gesetzen seiner Religion auch diese Einstellung zu Frauen. Sie war für ihn selbstverständlich. Doch später, als er sein Zuhause verlassen hatte und als Prediger herumzog, verstieß er gegen viele Tabus seiner Zeit und seines Volkes. Er unterschied nicht mehr zwischen rein und unrein, zwischen Sündern und Gerechten, Heiden und Juden, Männern und Frauen. Das war wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum es unter seinen Anhängern so viele Frauen gab und er sie freundschaftlich und gleichberechtigt behandelte.
Die Kunst des Fragens
Mit etwa zwölf Jahren hatte Joshua seine religiöse Grundausbildung abgeschlossen. Er hatte sich nicht nur mit der Thora befasst, sondern auch mit den sehr viel schwierigeren mündlichen Auslegungen der Gesetzestexte. Sein Fest der religiösen Volljährigkeit, die Bar Mizwa, rückte näher, und zur Vorbereitung darauf nahmen ihn seine Eltern in diesem Jahr mit nach Jerusalem, zum Passahfest in den Tempel.
Joshuas Verschwinden in Jerusalem und sein Verhalten im Tempel kann man verstehen als ersten Schritt weg von seiner Familie und hin zu seiner eigentlichen Berufung. So gesehen könnte er durchaus in dem Gefühl gelebt haben, zu etwas Besonderem auserwählt zu sein. Dieses Bewusstsein machte ihn aber noch lange nicht überheblich oder besserwisserisch. Das wird auch in der biblischen Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel bestätigt. Dort heißt es im Evangelium des Lukas: Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und seine Fragen.
Das ist ein ganz anderer Jesus als in den Kindheitsgeschichten des Thomas. Er beschämt seine Lehrer nicht, weil sie die Frechheit haben, ihm, dem Allwissenden, etwas beibringen zu wollen. Der junge Jesus im Tempel hört aufmerksam zu und stellt Fragen und beeindruckt dadurch seine Zuhörer. Bei den jüdischen Gesetzeslehrern, den Rabbinern, galt nämlich die Fähigkeit zu fragen als die wichtigste Voraussetzung, um die Heilige Schrift zu verstehen.
Wahrhaft fragen kann jedoch nur jemand, der die Antwort nicht schon kennt. Andernfalls würde er sich wie ein Lehrer verhalten, der einen bestimmten Stoff abfragt, oder wie ein Rechtsanwalt, der den Angeklagten in die Enge treiben will. Wahrhaft fragen kann nur ein Suchender, für den die Antwort offen ist, der sich nicht mit bereitliegenden Wahrheiten zufriedengibt, der sich auch selbst infrage stellen kann und der sich nicht einbildet, alles schon zu wissen. Wer fragen kann, der gibt zu, dass er beschränkt ist in seinem Wissen und seiner Erkenntnisfähigkeit, und er gibt gleichzeitig zu erkennen, dass er die Sehnsucht hat, über seine Beschränktheit hinauszukommen. Fragen zu können ist ein Zeichen für den Hunger nach mehr, für den Hunger nach Gott. Deshalb galt bei den Rabbinern derjenige als dumm, der keine Fragen zu stellen vermochte.
Die Taufe am Jordan
Was in den Jahren nach dem Zwischenfall im Tempel mit Joshua geschah, davon wird in der Bibel nichts berichtet. Einiges spricht dafür, dass Joseph früh gestorben ist und Joshua das Handwerk seines Vaters weiterführte und sich um seine Mutter und die Geschwister kümmerte. Erst mit dreißig Jahren verließ er den engen Kreis seiner Familie und seines Heimatortes und begann als Wanderprediger herumzuziehen und Jünger um sich zu sammeln.
Zu dieser Zeit sorgte ein Verwandter Joshuas für großes Aufsehen. Er hieß Johannes und war eine furchterregende Erscheinung. Er hatte lange Haare und einen wilden Bart und trug nichts weiter als ein Gewand aus Kamelhaar, das von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Johannes der Täufer, wie man ihn nannte, lebte in der Wüste, am Fluss Jordan, und ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Er hielt donnernde Predigten, in denen er verkündigte, dass das Reich Gottes bald kommen und dann Gericht gehalten würde. Von überall her kamen die Leute, um Johannes zu hören. Er rief sie dazu auf, ihr bisheriges Leben aufzugeben, umzukehren und sich von ihm taufen zu lassen. Viele beeindruckten seine Worte und sie ließen sich reumütig von ihm taufen. Sie hielten ihn für einen neuen Propheten, manche sogar für den geweissagten Erlöser, den Messias. Solche Bezeichnungen wies Johannes von sich. Er sei, so sagte er, nur ein Vorbote, der auf einen warte, der viel größer sei als er, so groß und mächtig, dass er, Johannes, nicht wert wäre, dessen Sandalenriemen zu lösen.