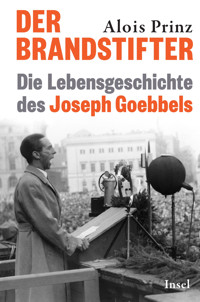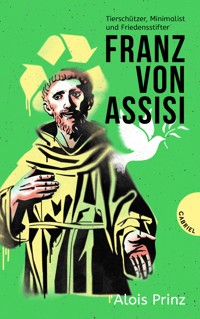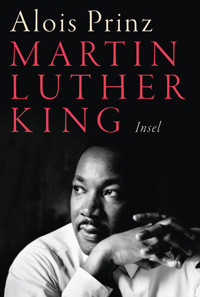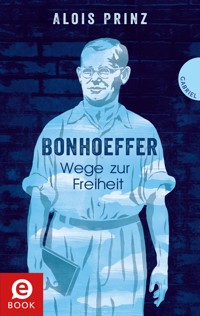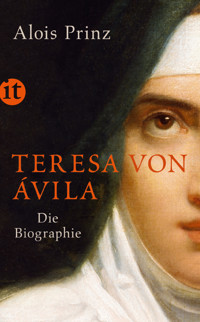
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Eine große, eine einmalige und doch so menschliche und anziehende Persönlichkeit«, nannte Papst Paul VI. sie, als er ihr erst 1970 als erster Frau den Titel »Lehrerin der Kirche« zuerkannte: Teresa von Ávila. Der Bestsellerautor Alois Prinz erzählt die Lebensgeschichte der Teresa von Ávila. Sie war nicht nur die größte Mystikerin des Christentums, sondern auch eine pragmatische und lebenskluge Frau von großer Tatkraft, denn der Glaube an Gott war für sie wertlos, wenn er nicht zu Taten führte. Gegen den Widerstand der Kirche reformierte sie den Karmeliterorden und gründete zahlreiche Klöster, die Orte des Gebetes und der Einkehr waren, vor allem aber auch Schutzräume, in denen Frauen in einer von Männern dominierten Gesellschaft nach ihren eigenen Vorstellungen leben konnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Teresa von Ávila gilt als größte Mystikerin des Christentums. Zu Lebzeiten geriet sie jedoch ins Visier der Inquisition, weil sie entgegen der Tradition einen persönlichen Umgang mit Gott pflegte; sie redete mit ihm wie mit einem Freund. Das machte sie nicht nur bei den Glaubenswächtern verdächtig, sie verstieß damit gegen die damals herrschende Auffassung von der geistigen und spirituellen Minderwertigkeit der Frau. Obwohl geistliche Schriften in der Volkssprache verboten waren, verfasste Teresa ihre Lebensgeschichte und beschrieb in mehreren Büchern ihre inneren Erfahrungen. Diese Texte zählen heute zur Weltliteratur, und die geschilderten seelischen Erlebnisse nehmen viele Erkenntnisse der modernen Psychologie voraus.
Teresa von Ávila war aber vor allem auch eine bodenständige Frau mit großer Tatkraft. Sie unternahm Reisen in ganz Spanien und gründete zahlreiche Klöster, die nicht nur Orte des Gebetes und der Einkehr waren, sondern auch Schutzräume, in denen Frauen in einer von Männern dominierten Gesellschaft nach ihren eigenen Vorstellungen leben konnten. Ihre Mitschwestern rief sie dazu auf, sich keine Angst einjagen zu lassen. Sie sollten zeigen, »was in ihnen steckt«, damit sie »die Männer in Erstaunen versetzen«.
Teresa von Ávila, geboren am 28. März 1515 in Ávila, wird in der katholischen Kirche als Heilige und Kirchenlehrerin verehrt. In der anglikanischen und evangelischen Kirche erinnern Gedenktage an sie. Sie begründete den bekanntesten Nonnenorden der Karmeliten, die Unbeschuhten Karmelitinnen. Sie starb am 4. Oktober 1582 in Alba de Tormes.
Alois Prinz, 1958 geboren, studierte Literaturwissenschaft und Philosophie und lebt heute in Feldkirchen. Er veröffentlichte mehrere erfolgreiche Biographien, u. a. über Georg Forster, Hermann Hesse, Ulrike Marie Meinhof und Franz Kafka. Seine Hannah-Arendt-Biographie war monatelang auf den deutschen Bestsellerlisten. Er wurde u. a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Evangelischen Buchpreis ausgezeichnet.
Alois Prinz
Teresa von Ávila
Die Biographie
Mit zahlreichen farbigen Abbildungen
Bildnachweis:
Umschlagabbildung: François Gérard, Die heilige Teresa von Ávila, 1827
Frontispiz: Juan de la Miseria, Die heilige Teresa von Ávila, 1576
Fotos: Erich Lessing, akg-images, Berlin
Die Fotografien 2, 4, 11, 12, 14, 15 sind von Gotthard Kießling, Warburg.
Alle weiteren Abbildungen stammen aus dem Archiv des Autors.
eBook Insel Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4422.
© Insel Verlag Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlag: glanegger.com, München
TERESA VON ÁVILA
Nada te turbenada te espante;todo se pasa,Dios no se muda.La pacienciatodo lo alcanza.Quien a Dios tienenada le falta.Sólo Dios basta.
Nichts soll dich verwirren,nichts dich erschrecken.Alles vergeht,Gott ändert sich nicht.Die Geduld erlangt alles.Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott nur genügt.
Teresa von Ávila
Inhalt
Einleitung
I. Die Mauern von Ávila
II. Ehre und Sünde
III. Der Mut gegen sich
IV. Aufmerksamkeit
V. Wie wird man ein Einzelner?
VI. Schlechte Lehrer, gute Lehrer
VII. Von dicken Leibern, dünnen Seelen und dürren Zweiglein
VIII. Aufruhr in Ávila
IX. Der Drang der Seele nach dem Paradies
X. Geh dorthin, wo du nichts bist
XI. Die Gründerin oder Marta und Maria
XII. Lachen und Leiden
XIII. Von himmlischer und irdischer Liebe
XIV. Die siebte Wohnung
XV. Solange die Liebe nicht schläft oder Aller Reisen Ende
Epilog
Zeittafel
Quellenverzeichnis
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Danksagung
EINLEITUNG
Spanien im Winter 1582. Das Wetter in der kastilischen Hochebene ist schlecht. Es regnet ununterbrochen und manchmal schneit es. Die Flüsse treten über die Ufer und die Wege sind verschlammt. Wer es vermeiden kann, reist an diesen Tagen nicht. Trotzdem brechen am 2. Januar in der Stadt Ávila zwei ungefederte Planwagen zu einer langen Reise ins nordspanische Burgos auf.1 Fuhrleute lenken die vorgespannten Maultiere. Neben und hinter den Wagen gehen einige Mönche in ihren langen Kutten und in Sandalen. In den vierrädrigen Karren befinden sich acht Nonnen, Angehörige des Ordens der Karmelitinnen. Unter ihnen ist Teresa, die sich Teresa von Jesús nennt. Sie ist fast schon eine Berühmtheit. Vor vielen Jahren hat sie in Ávila ein Kloster gegründet, in dem sie eine neue Form des geistlichen Zusammenlebens eingeführt hat. Den Unbeschuhten Karmelitinnen, wie sich Teresa und ihre Mitschwestern nennen, schlug damals viel Hass entgegen, sie wurden sogar mit Steinen beworfen.
Teresa hat sich nicht beirren lassen und hat in den folgenden Jahren an vielen Orten neue Klöster gegründet. Nun soll also eines in Burgos entstehen. Vielleicht das letzte, denn Teresa ist nicht mehr die Jüngste, fast siebenundsechzig Jahre alt, und mit ihrer Gesundheit steht es nicht zum Besten. Zudem ist ihr Arm verkrüppelt, den sie sich bei einem Sturz an Weihnachten vor fünf Jahren gebrochen hatte. Von einer Neugründung in Soria im letzten Sommer hat sie sich einigermaßen erholt. Damals waren es nicht Kälte und Regen, die ihr zugesetzt haben, sondern sengende Hitze und verstaubte, unbefahrbare Wege. Der junge Führer, den sie für die Rückfahrt angeworben hatte, verirrte sich oft, und der Wagen musste umkehren, wo es nicht mehr weiterging, oder steile Abhänge hinabgetragen werden.
Zu der Reise nach Burgos hatte Teresa anfangs wenig Lust. Sie fühlt sich alt und krank. Und die Aussicht, bei Schnee und Regen in einem ständig schaukelnden, zugigen Wagen über holprige Straßen zu fahren, war wenig reizvoll. Doch immer wenn sie mutlos ist und Krankheiten sie plagen, schöpft sie neue Kraft aus ihrem besonderen Gottesverhältnis, mit dem sie schon den Argwohn der Heiligen Inquisition auf sich gezogen hat. Denn für die Verwalter des rechten Glaubens ist es höchst verdächtig, dass Teresa einen persönlichen Umgang mit Gott pflegt und behauptet, sie könne mit ihm reden wie mit einem Freund. In diesem stillen Gebet ist der Mensch mit Gott allein und braucht weder vorgegebene Texte noch Weihrauch noch Priestergewänder – und vielleicht letztlich nicht einmal die Kirche. Im Zwiegespräch mit ihrem Gott vernimmt Teresa Worte, die sie mit unerschütterlicher Zuversicht erfüllen, einer Zuversicht, die alle Krankheiten und Widrigkeiten klein erscheinen lassen. So auch jetzt. »Gib nichts auf diese Kälte, denn ich bin die wahre Wärme«, so hat diese innere Stimme zu ihr gesprochen.2 Und augenblicklich waren Teresas Verzagtheit und ihre Schwerfälligkeit wie weggewischt und sie war zur Reise nach Burgos entschlossen.
Die Umstände scheinen sehr günstig. Der Erzbischof von Burgos erwartet bereits ihr Kommen, die Ratsherren der Stadt haben Teresas Plänen zugestimmt. Außerdem wird Teresa von Pater Jerónimo Gracián begleitet. An dem jungen Ordensmann schätzt sie nicht nur sein Wissen und sein Geschick im Umgang mit Menschen, sie scheut sich auch nicht, ihm in langen Briefen zu schreiben, wie gern sie ihn hat und wie glücklich sie in seiner Nähe ist.
Die Fahrt nach Burgos ist noch anstrengender und gefährlicher als erwartet. Die männlichen Begleiter Teresas müssen aufpassen, wohin sie treten, denn sie könnten plötzlich in einem Wasserloch versinken. Immer wieder bleibt der Wagen im Schlamm stecken. Dann müssen alle Schwestern aussteigen und mithelfen, den Wagen wieder aus einem Schlagloch herauszuheben. Dadurch verzögert sich die Weiterfahrt und die Reisegruppe kann nicht, wie vorgesehen, die nächste Herberge erreichen und muss anderweitig unterkommen. Das ist für die Schwestern besonders schlimm. Denn herumreisende Frauen sind zu dieser Zeit ein Skandal. Teresa hat es schon oft erlebt, dass sie unterwegs von den Leuten als Rumtreiberin und liederliche Frauensperson beschimpft wurde. Besonders für Männer ist solch eine Frau ein Ärgernis. Der Theologe Francisco de Osuna plädierte dafür, sie zu Hause einzusperren. »Und wenn das nicht helfen sollte«, so empfahl er, »dann brich ihr das Bein […].«3
Trotz aller Widrigkeiten geht es in Teresas Wagen recht lustig zu. Die Schwestern lachen und machen Verse zu allem, was ihnen auf der Reise passiert. Kurz vor Burgos scheint diese Reise zu Ende zu sein. Der Fluss Arlanzón, den sie überqueren müssen, führt so viel Wasser, dass die behelfsmäßig aus Einzelteilen zusammengefügte Pontonbrücke überschwemmt und nicht mehr zu sehen ist. Teresa besteht trotzdem darauf, im ersten Wagen über die schwankende Brücke zu fahren. Falls die Sache schiefgeht, sollen die anderen, so verlangt sie es, in die letzte Herberge zurückkehren. Mitten auf dem Fluss gerät der Wagen mit Teresa ins Rutschen und droht ins reißende Wasser zu stürzen. Teresa hat schon einmal eine ähnliche Situation erlebt. Auf der Reise nach Sevilla war es, als sie mit ihren Gefährtinnen auf einer Fähre einen Fluss überqueren wollte, die Fähre sich plötzlich losriss und ihr Wagen führerlos flussabwärts trieb. Damals ist alles noch einmal gut gegangen. Auch dieses Mal kommt es nicht zum Schlimmsten. Gerade noch kann ihr Wagen auf der Brücke gehalten werden und das andere Ufer erreichen.
Über drei Wochen nach ihrem Aufbruch von Ávila kommt die Reisegruppe im strömenden Regen in Burgos an, frierend und völlig durchnässt. Teresa und ihre Mitschwestern finden Aufnahme bei Catalina de Tolosa, einer Frau aus einer angesehenen Familie. Im Haus der Doña Catalina wird sofort im großen Kamin ein Feuer gemacht, damit die Gäste ihre Kleider trocknen können. Teresa ist dankbar, so verwöhnt zu werden, aber es geht ihr schlecht. Nicht nur hat sie Fieber und Halsschmerzen, so dass sie kaum etwas essen kann, am nächsten Morgen kann sie den Kopf nicht mehr heben und muss die ersten Verhandlungen im Liegen führen.
Teresa ist eine geschickte Geschäftsfrau. Darauf ist sie stolz. Was sie aber auf den Tod nicht ausstehen kann, sind Verhandlungspartner, die unberechenbar sind oder ihre Zusagen nicht einhalten wie der Bischof von Burgos. Plötzlich will er von seinen Versprechungen nichts mehr wissen und legt Teresa Steine in den Weg, wo er nur kann. Anscheinend genießt er seine Macht und will sich nicht einfach den Plänen einer Nonne, selbst wenn diese Teresa von Ávila heißt, unterwerfen. Auch deswegen ist es für Teresa und ihre Schwestern so wichtig, ein eigenes Kloster zu haben. Das Kloster ist ein Schutzraum, wo ihnen niemand dreinreden kann und in dem sie so leben können, wie sie es für richtig halten. Vor allem ist es ein Schutzraum vor Männern, denen in der spanischen Gesellschaft die Frauen oft hilflos ausgeliefert sind. Im Kloster seien, so schreibt Teresa, die Frauen davon befreit, »einem Mann unterworfen zu sein, der ihnen oftmals ihr Leben ruiniert und gebe Gott, nicht auch ihre Seele«4.
Den Schikanen des Bischofs haben es Teresa und ihre Begleiterinnen zu verdanken, dass sie vorerst in den engen Dachkammern eines Hospitals untergebracht werden. Doña Catalina versorgt sie mit dem Nötigsten, wofür sie den Tratsch der Einwohner über sich ergehen lassen muss. Man verflucht sie und wünscht sie in die Hölle, weil sie sich um die dahergelaufenen Nonnen kümmert. Für Teresa allerdings ist Catalina eine mutige und hilfsbereite Frau.
Nach langen, zähen Verhandlungen kann Teresa ein altes Haus erwerben, in das sie mit ihren Schwestern Mitte März einzieht. Das Haus mit einem kleinen Garten liegt am Ufer des Flusses Arlazón. Es ist ein anmutiger Ort, der allerdings seine Nachteile hat, wie Teresa im Frühjahr erfahren muss. Im Mai regnet es nämlich wieder tagelang. Der Regen und der Sturm sind so stark, dass Bäume entwurzelt werden und es auf dem Friedhof die Toten aus den Gräbern schwemmt. Die Stadtteile nahe dem Fluss, wo auch das Haus der Karmelitinnen liegt, stehen unter Wasser. Teresa und ihre Freundinnen fliehen in die oberen Stockwerke, wo sie hungernd ausharren, weil ihre Lebensmittel vom Wasser vernichtet sind. Einen Tag lang müssen sie fürchten, dass ihr Haus den Fluten nicht standhält. Im Erdgeschoss muss eine Mauer durchbrochen werden, damit das Wasser abfließen kann. Dann endlich lässt der Regen nach, und ein paar Tage später zieht sich der Fluss wieder in sein Bett zurück.5
Noch zwei Monate bleibt Teresa in Burgos, um alles so weit zu regeln, dass man ohne sie zurechtkommt. Am 26. Juli 1582 bricht sie zur Heimreise auf. Fünf ihrer Mitschwestern bleiben im neugegründeten Kloster. Zwei begleiten sie nach Hause. Teresa will nach Ávila, auch um sich von den Strapazen ein wenig zu erholen. Doch ihre Geburtsstadt wird sie nicht wiedersehen. In Medina del Campo erhält sie vom stellvertretenden Provinzial ihres Ordens den Befehl, nach Alba de Tores zu reisen, wo die Herzogin von Alba ein Kind erwartet und sich Teresas Beistand wünscht. Obwohl Teresa immer noch krank ist und Ruhe dringend nötig hätte, nimmt sie die beschwerliche Reise auf sich. In Alba hat sie starke Schmerzen und Blutungen. Sie weiß nicht, dass sie schon seit längerem an Krebs erkrankt ist.6 Die Aderlasse, die man ihr verordnet, machen alles nur noch schlimmer. Und in der Nacht des 4. Oktober 1582 stirbt sie.
Vierzig Jahre nach ihrem Tod wurde Teresa von Ávila heiliggesprochen. Zeit ihres Lebens hat es sich Teresa verbeten, in ihrer Gegenwart das Wort »heilig« auszusprechen. Und sie forderte ihre Mitschwestern auf, gegen dieses Wort einen »inneren Krieg« zu führen. Denn solch ein Wort, so meinte sie, könne nur Schaden anrichten, weil Menschen, denen so geschmeichelt wird, denken könnten, dass sie es »schon geschafft« hätten. »Es gibt keine Sicherheit«, so meinte sie, »solange wir leben.«7 Und darum sollten Menschen aufhören, danach zu streben, schon hier auf Erden vollkommen zu werden wie Engel. Sie sollten akzeptieren, dass sie einen Körper haben, der krank und gebrechlich wird. Vor allem sollten sie einsehen, dass sie schwach sind, oft versagen, sich selbst nicht kennen, sich und andere belügen oder ihren Eitelkeiten unterliegen. Teresa selbst durchlebte lange Jahre, in denen sie mutlos war, sich unnütz vorkam und sich am liebsten irgendwo versteckt hätte.8
Was ihr allein in solchen Dürrezeiten geholfen hat, war das, was sie »inneres Beten« nennt, das Gespräch mit einem Gott, den sie ganz nahe und als Freund erlebte. Teresa hat in mehreren Schriften versucht zu beschreiben, was dieses »innere Beten« bedeutet und was dabei in ihr vor sich geht. Das war ein gefährliches Unterfangen, besonders für eine Frau, die noch dazu theologisch ungebildet war. Einige Männer der Kirche, die sie um Rat fragte, hielten sie für vom Teufel besessen. Und nicht selten hat sie es erlebt, dass Menschen über ihre Schilderungen lachten und diese für überdrehte »Weibergeschichten«9 hielten.
Dabei war Teresa selbst überaus kritisch gegenüber ihren Visionen. Nie verließ sie die Sorge, vielleicht doch nur Täuschungen aufzusitzen. Von einem Kriterium für die Echtheit ihrer Erlebnisse war sie allerdings fest überzeugt. Wertlos waren innere Erleuchtungen für sie dann, wenn sie nicht zu Taten führten. Der Rückzug in die inneren Räume ihrer Seele und das tatkräftige Handeln in Liebe für andere, das gehörte für sie zusammen.
Nach Teresas Tod wurden viele ihrer Reformen wieder rückgängig gemacht oder aufgeweicht. Dennoch verbreitete sich die von ihr eingeleitete Bewegung über Spanien hinaus und führte zu neuen Klostergründungen. Heute gibt es in zahlreichen Ländern dieser Erde Ordensgemeinschaften von Frauen und Männern, die sich auf die Nonne aus Ávila berufen. Aber ist Teresas Anliegen überhaupt noch zeitgemäß? War ihre Welt nicht eine ganz andere? Hat sie nicht in einer Zeit gelebt, die von Religion und Kirche durchdrungen war, während wir heute, wenigstens in Europa, in säkularisierten Gesellschaften leben? Und selbst wenn Teresas Ideen heute noch von Belang sind – braucht es heute noch Klöster, um diese Ideen verwirklichen zu können?
Vierhunderteinunddreißig Jahre nach Teresas Reise nach Burgos hat sich wenigstens am Wetter nicht viel geändert. Im Frühjahr 2013 regnet es seit Wochen und im Radio höre ich die Meldungen über die gefährlich steigenden Pegelstände von Flüssen. Gott sei Dank brauche ich nicht mehr in einem Planwagen auf aufgeweichten Wegen zu reisen. Ich sitze in einem Auto, auf der Fahrt zu einem Kloster der Karmelitinnen im Münchner Norden. In das Navi habe ich eine Adresse in Dachau eingegeben. Die Navi-Stimme führt mich eine Mauer mit Stacheldraht entlang. Sie gehört zum ehemaligen Konzentrationslager Dachau, das heute eine Gedenkstätte ist. Am Ende der Mauer ist ein kleiner Parkplatz, von dort führt ein Fußweg zum Kloster »Heilig Blut« des Ordens der Unbeschuhten Karmelitinnen.
Die Gebäude des Klosters, die an Baracken erinnern, sind kreuzförmig angelegt, und die Fenster der Zellen sind auf das ehemalige Konzentrationslager gerichtet. Vom Innenhof des Klosters aus kann man durch eine schmale Pforte direkt auf das Lagergelände gehen. Hier der Ort, wo Menschen jede Würde genommen und sie auf bestialische Weise gequält und umgebracht wurden. Gleich daneben der Ort, wo Nonnen in der Erfahrung leben wollen, dass Gott in jedem Menschen wohnt und ihm eine unendliche Würde gibt. Die räumliche Nähe zum ehemaligen Lager, so heißt es in einer Denkschrift des Klosters, soll den Blick wachhalten für vergangenes und gegenwärtiges Unheil. Das Kloster als Gegenwelt zum Konzentrationslager oder sogar als Antwort darauf?
Auf mein Läuten hin öffnet mir eine Nonne und bringt mich durch lange Flure zu einem Besucherzimmer, wo Schwester V., mit der ich verabredet bin, auf mich wartet. Sie ist gekleidet in die Ordenstracht einer Karmelitin. Braunes Gewand mit Überwurf. Schwester V., so erzählt sie mir, war ursprünglich Lehrerin, bevor sie in den Orden eingetreten ist. Was sie stark angezogen hat, war die besondere Bedeutung der Meditation, wie sie in diesem Orden gepflegt wird. »Das Gebet öffnet innere Räume«, erklärt sie mir. Sie hat sich auch sehr intensiv mit anderen Formen der Spiritualität auseinandergesetzt und Lehrer wie Willigis Jäger oder den Inder Sebastian Painadath kennengelernt, die westliche mit östlicher Spiritualität zu verbinden suchen.
Das alltägliche Leben im Kloster ist streng geregelt. Es gibt feste Zeiten des gemeinsamen Betens, des Schweigens und der inneren Sammlung. Daneben gehen die Schwestern einer Beschäftigung nach, um zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen. Einige stellen Töpferwaren her, andere Kerzen oder widmen sich der Ikonenmalerei. Nur sehr selten und nur wenn es nicht zu vermeiden ist, etwa zu einem Arztbesuch, verlässt eine Schwester das Kloster. Umgekehrt soll auch möglichst wenig von der Welt draußen in das Innere der Gemeinschaft dringen. Das geistige Leben ist den Nonnen Abenteuer genug. Neue Moden oder technische Erfindungen haben für sie keinen Reiz. In manchen Klöstern gibt es kein Internet, keine Handys, keinen Fernseher, kein Radio. Um sich darüber zu informieren, was in der Welt vor sich geht, lesen die Schwestern Zeitungen.
Für Schwester V. ist Teresa von Ávila immer noch das große Vorbild. Sie ist der Überzeugung, dass Teresa inspiriert worden ist von der Lebensweise der Eremiten, die in frühchristlicher Zeit auf dem Berg Karmel eine Kolonie gegründet haben. Diesen Ursprungsgeist gilt es nach Schwester V. festzuhalten und in die moderne Zeit hinüberzuretten. Dabei ist sie sich im Klaren darüber, dass ein Leben, in dem Gebet und Meditation im Mittelpunkt stehen, eine »Provokation« für den modernen Zeitgeist darstellt. Rational erklären und verteidigen lasse sich die Entscheidung für ein solches Leben nicht. Nur wer diesen Weg selber gehe, könne erfahren, wie sinnvoll er sei, und damit auch andere überzeugen – auch davon überzeugen, wie wichtig es ist, in einer globalisierten Welt, die schnelllebig und von Medien beherrscht ist, Orte zu haben, wo Rückzug, Schweigen und Meditation möglich sind.
Auf meine Frage hin, ob die Lebensform der Karmeliten ein Vorbild für moderne Menschen sein kann, antwortet Schwester V. skeptisch. In ihrem Kloster fehlt der Nachwuchs. Nur drei Schwestern sind jünger als fünfzig. Ihrer Erfahrung nach sind heute zwar viele Menschen auf der Suche nach Stille und Kontemplation, Klöster haben eine starke Anziehungskraft, es werden auch in ihrem Kloster Meditationsnachmittage angeboten, aber auf Dauer will sich niemand auf ein klösterliches Leben einlassen.
Schwester V. hat nur eine Stunde Zeit für mich. Sie muss zum nächsten Stundengebet. Die Klosterpforte schließt sich hinter mir. Über den Innenhof gehe ich auf das Gelände der KZ-Gedenkstätte. Es regnet und nur wenige Besucher sind unterwegs. Nach allem, was ich von Schwester V. gehört habe, bin ich wohl ein typisch moderner Mensch. Worte wie Rückzug, Stille, Innehalten üben einen großen Reiz auf mich aus. Aber in einem Kloster zu leben kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Andererseits kann ich nicht glauben, dass Teresas Gedanken und Erfahrungen nur für eine kleine Elite von spirituell Begabten geeignet sind oder nur von Menschen gelebt werden können, die sich hinter Klostermauern von der Welt absondern. Hat sie nicht ihre Mitschwestern gewarnt davor, sich gerettet zu fühlen, nur weil sie im Kloster sind? Hat sie nicht selbst noch als Nonne ein sehr aktives und »weltliches« Leben geführt, viele Reisen gemacht, mit Gelehrten diskutiert, Geschäfte abgeschlossen, Hunderte von Briefen geschrieben, sich in politische Angelegenheiten eingemischt? Und hat sie nicht gesagt, dass Gott überall erfahrbar ist, auch in der Küche bei den Kochtöpfen? Was sie mit einem für die Menschen wichtigen »Freiraum« gemeint hat, kann, aber muss anscheinend nicht unbedingt eine Klosterzelle sein. Aber wie und wo kann man diese Schutzräume heute finden? Oder anders gefragt: Wohin können Menschen heute gehen, die zu Teresas Zeiten ins Kloster gegangen sind?
I. DIE MAUERN VON ÁVILA
Don Alonso Sánchez de Cepeda lebte 1515 nun schon über zwanzig Jahre in der kastilischen Stadt Ávila, und trotzdem war er lange nicht so angesehen wie die alteingesessenen Familien der Stadt, wie die Bracamontes, die Guieras oder die Cimbróns. Dabei erfüllte er doch alle Voraussetzungen eines ehrenhaften Bürgers. Er war ein guter Christ, hatte einen verbrieften Adelstitel und lebte von den Zinsen seines Vermögens. Er hatte eine Frau aus einer altchristlichen Familie geheiratet, die schon früh verstorben war und ihm zwei Kinder hinterließ, María und Juan. Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Catalina hatte Don Alonso wieder geheiratet, die erst vierzehnjährige Beatriz de Ahumada. Auch sie entstammte einer adligen, altchristlichen Familie, was seine Stellung in Ávila eigentlich hätte stärken müssen. Aber den Makel seiner Herkunft bekam er nicht los. Die Vergangenheit holte ihn immer wieder ein, eine Vergangenheit, die für Don Alonso mit traumatischen Erinnerungen verbunden war.
Als kleiner Junge hat er miterleben müssen, wie sein Vater, Juan Sánchez, gedemütigt und seine ganze Existenz zunichtegemacht wurde. Die Familie lebte damals in Toledo, und der Vater war ein reicher Tuchhändler. Dass er Jude war, hat ihm zwar Nachteile und die Abneigung mancher Mitbürger eingebracht, aber seinen Beruf und das Überleben seiner Familie konnte Juan Sánchez noch sichern. Doch das änderte sich Ende des 15. Jahrhunderts.
Jahrhundertelang hatten in Spanien Christen, Juden und Muslime relativ friedlich nebeneinandergelebt. Ende des 14. Jahrhunderts verarmten große Teile der Bevölkerung, und der Hass der verbitterten Menschen richtete sich gegen die Juden, die vermögend waren und einflussreiche Stellungen innehatten. Dieser Hass entlud sich in Städten wie Sevilla, Valencia und Barcelona, wo Judenviertel zerstört, die Bewohner getötet oder gezwungen wurden, sich taufen zu lassen. Viele Juden verließen daraufhin das Land oder nahmen mehr oder weniger freiwillig den christlichen Glauben an.
Dadurch wurde ihre Lage allerdings noch schlimmer. Denn die »conversos«, wie man die Konvertierten nannte, wurden von den standhaft gebliebenen Juden verachtet. Und bei den Christen standen sie im Verdacht, nur um ihrer Karriere willen den neuen Glauben angenommen zu haben, insgeheim aber noch ihrem alten Glauben anzuhängen. Dieser Verdacht wog umso schwerer, als konvertierte Juden nun nicht mehr an bestimmte Berufe gebunden waren, sondern in höchste Stellen in Staat und Kirche aufsteigen konnten. Nicht selten waren Bischöfe und Kardinäle Conversos. Die Angst, der christliche Glaube könne durch »Scheinchristen« unterwandert werden, wuchs. Als Folge begann ein geradezu hysterischer Kampf um die Reinheit des Glaubens.
Zum obersten Maßstab wurde nun die »honra«, die Ehre. Und die bemaß sich danach, welchen altchristlichen Stammbaum ein Mann, eine Frau vorweisen konnte. Je weiter zurück die christliche Tradition einer Familie reichte, desto größer war ihr Ansehen und desto größer die Chance, in der Gesellschaft aufzusteigen. Für einen verantwortungsvollen Posten waren nicht mehr die Bildung und Eignung eines Mannes ausschlaggebend, sondern die »Reinheit« seiner christlichen Abstammung. Und weil die bäuerliche Bevölkerung tiefer in der altchristlichen Tradition verwurzelt war, kam es immer öfter zu der grotesken Situation, dass Männer in hohe Ämter berufen wurden, nur weil ihre Vorfahren Bauern waren. Das konnten durchaus fähige Leute sein, doch manchmal galt es in solchen Fällen schon als Zeichen einer vornehmen Abstammung, wenn jemand seinen Namen nicht schreiben konnte.1
Abgesehen von diesen Folgen für die führende Schicht des Landes vergiftete der Streit um die Conversos das gesellschaftliche Klima. Angst und Misstrauen bestimmten den Umgang der Menschen miteinander. Denunzianten waren Tür und Tor geöffnet. Niemand konnte mehr sicher sein, dass nicht auch er als verkappter Jude verdächtigt wurde, zumal es jetzt die sogenannten »grünen Bücher« gab, in denen die Namen der Conversos-Familien aufgeführt waren. In Toledo, der Heimatstadt von Juan Sánchez, wurde 1449 ein Statut über die »Reinheit des Blutes« erlassen, um sicherzustellen, dass Scheinbekehrte von hohen Ämtern ausgeschlossen wurden. Noch prekärer wurde die Lage für Juden und Conversos, als im Jahr 1474 Isabella I. von Kastilien und Ferdinand II. von Aragonien den katalanischen Thron bestiegen. Das Königspaar gab dem Druck fanatischer Mönche nach und bat in Rom um die Zustimmung, eigene Gerichte zur Verfolgung von Häretikern einrichten zu dürfen. Papst Sixtus IV. gab sein Einverständnis. Und so wurde im Jahr 1481 in Sevilla die Heilige Inquisition eingeführt, und vor den Toren der Stadt wurden die ersten Ketzer verbrannt. Drei Jahre später nahm die Inquisition in anderen Städten Kastiliens ihre Arbeit auf.
So geschah es auch in Toledo, wo Juan Sánchez und seine Frau Inés de Cepeda bisher an ihrem jüdischen Glauben festgehalten hatten. In den Kirchen der Stadt wurde bekanntgegeben, dass sich alle, die mit ihrem jüdischen Glauben einen schädlichen Einfluss ausübten, bis zu einem gewissen Zeitpunkt melden konnten, um einer schweren Strafe zu entgehen. Wer dies nicht tat und unter Verdacht geriet, verlor automatisch seinen Besitz und musste mit einer Strafe rechnen. Auf leichtere Fälle stand der Kerker. Bei schweren Vergehen wurden die Verurteilten ausgepeitscht oder auf Galeeren verbannt. Und wenn jemand mehrmals rückfällig wurde, drohte ihm der Tod auf dem Scheiterhaufen. Niemand, der der christlichen Kirche gefährlich war, sollte den Netzen der Inquisition entgehen. Ketzer, die flohen, wurden steckbrieflich verfolgt, und sogar bereits verstorbene Verdächtige wurden aus ihren Gräbern geholt und nachträglich verbrannt, damit die Friedhöfe nicht mit deren Leichnamen entweiht wurden.2
Erst 1946 wurden Prozessakten entdeckt, die belegen, dass Juan Sánchez am 22. Juni 1485 vor dem Inquisitionstribunal in Toledo erscheinen musste. Wessen er genau angeklagt war, lässt sich nicht mehr sagen. Wahrscheinlich wurde ihm vorgeworfen, im Geheimen jüdische Rituale zu praktizieren. Fest steht aber, dass er sich für schuldig erklärte, schwere Vergehen gegen den katholischen Glauben begangen zu haben. Dieses Bekenntnis und das spätere Verhalten Juan Sánchez' und seiner Nachfahren lassen den Schluss zu, dass er vom jüdischen zum christlichen Glauben wechselte. Einer Strafe entging er dennoch nicht. Er musste, zusammen mit seinen Kindern, an sieben aufeinanderfolgenden Freitagen, bekleidet mit einem Büßergewand, in einer Strafprozession durch die Stadt laufen. Dieses Büßergewand wurde danach, versehen mit seinem Namen, in der Kirche aufgehängt.3 Sein Vermögen verlor er offenbar nicht, denn er konnte sich in den folgenden Jahren eine neue Existenz aufbauen.
Juan Sánchez hatte sich mit der katholischen Kirche versöhnt. Gerade noch rechtzeitig, denn einige Jahre später, 1492, mussten alle Juden Spanien verlassen. Juan Sánchez war nun ein Converso. Als Angehöriger einer diskriminierten Minderheit konnte er entweder forthin ein ärmliches Leben in Toledo führen. Oder er konnte an einem anderen Ort ein neues Leben als Christ beginnen.
Juan Sánchez entschied sich für die zweite Möglichkeit. 1493 zog er mit seiner Familie nach Ávila. Die Stadt war damals ein Zentrum für die Verarbeitung von Schafswolle, und da Juan Sánchez klug und geschäftstüchtig war, brachte er es in diesem Metier bald zu großem Erfolg. In der Calle de Andrín, im Zentrum jenes Viertels, wo viele Conversos ihre Geschäfte betrieben, hatte Juan Sánchez einen Laden für Wolle und Seide. Er lebte in Wohlstand und nutzte sein Ansehen dazu, Kontakte mit den wichtigsten Familien Ávilas zu knüpfen und vorteilhafte Ehepartner für seine Kinder zu finden.
Um das Jahr 1500 erwarb Juan Sánchez einen Adelsbrief, was bei Conversos häufiger vorkam und mit Hilfe von viel Geld und falschen Zeugen bewerkstelligt wurde. Er gehörte nun zum niedrigen Landadel, zu den »hidalgos«, war von Steuern befreit und durfte den Titel Don führen. Als Christ und Adliger musste Juan Sánchez ein tadelloses Leben führen, um möglichst seinen Geburtsfehler zu verdecken und keinerlei Verdacht aufkommen zu lassen. Das hieß aber auch, dass er kein Geschäft mehr betreiben durfte, denn das galt als typisch jüdisch und daher als entehrend. Nur landwirtschaftliche Arbeit war angesehen. Dazu aber war Juan Sánchez nicht geeignet. Also musste er von seinem Vermögen und von Pachterträgen leben. Und dieses Vermögen, oder das, was davon noch übrig war, vermachte er seinen Kindern, zu denen auch sein Sohn Alonso gehörte.
Don Alonso de Cepeda führte das Erbe seines Vaters fort. Und das in jeder Hinsicht. Immer war er darauf bedacht, den Makel seiner Geburt zu verbergen, und so führten er und seine Kinder den Namen Sánchez nicht mehr weiter, weil er zu jüdisch klang. Das Leben eines adligen Christen erwies sich auf die Dauer als kostspielig. Zwar konnte er seine finanzielle Situation durch die Mitgift seiner Ehefrauen verbessern. Aber mit Geld konnte er nicht gut umgehen, er machte Schulden. Hinzu kam die steigende Zahl von Kindern. Zwei waren aus seiner ersten Ehe mit Catalina. Seine junge zweite Frau Beatriz hatte ihm ebenfalls bereits zwei Kinder geschenkt, zwei Buben, Hernando und Rodrigo. Don Alonso führte genau Buch über die Geburten. Ende März 1515 schlug er dieses Buch wieder auf und notierte darin: »Am Mittwoch, den achtundzwanzigsten März des Jahres fünfzehnhundert fünfzehn /1515/ um fünf Uhr früh, mehr oder weniger (denn es war schon fast Tagesanbruch an jenem Mittwoch), wurde meine Tochter Teresa geboren.«4
Bei der Geburt Teresas hatte Ávila zwischen vier- und sechstausend Einwohner.5 Die meisten davon waren in der Wollindustrie tätig wie Weber, Färber oder Spinner. Sie begründeten den wachsenden Wohlstand Ávilas. Beherrscht wurde die Stadt allerdings von einer kleinen Zahl aristokratischer Familien, deren herrschaftliche Häuser in den zentralen Vierteln um die Kirchen von San Juan und San Pedro nahe dem großen Marktplatz standen. Sie hatten die politische Gewalt inne und übten auf die kirchlichen Einrichtungen großen Einfluss aus.
Die Familie Cepeda war bekannt und angesehen, aber sie gehörte nicht zur Elite Ávilas. Ihr Haus lag an der Plazuela de Santo Domingo, ein älterer Bau, eine ehemalige Münzpräge. Von außen wirkte dieser Palacio de la Moneda, wie das Gebäude hieß, ziemlich streng mit seinen schmalen, teilweise vergitterten Fenstern. Das Familienleben, das sich hinter den dicken Mauern und im schattigen Innenhof abspielte, blieb den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Vor allem von Beatriz wurde erwartet, dass sie dem Ideal einer Mutter und Gattin entsprach. Und dazu gehörte, dass sie in häuslicher Zurückgezogenheit lebte, anspruchslos, bescheiden und tief religiös war, und ihrem Mann viele Kinder schenkte.6 Nach Teresas Geburt brachte Beatriz fast jedes Jahr ein Kind zur Welt. Das Haus verließ sie vermutlich nur, wenn sie in Begleitung zur Kirche ging.
Teresa und ihre fast zehn Jahre ältere Halbschwester María blieben lange die einzigen Mädchen in der Familie. Und sie erlebten an ihrer Mutter hautnah, wie eine Frau in ihren Kreisen zu leben hatte. Ob Teresa auch etwas mitbekam von dem Schatten, der über der Familie lag? Der vierjährigen Teresa wird es jedenfalls nicht verborgen geblieben sein, dass ihr Vater im August 1519 wieder seine Ehre verteidigen musste. Und auch wenn sie noch nicht verstehen konnte, worum es ging, wird sie die Aufregung in der Familie und die Sorgen der Eltern doch gespürt haben. Offenbar waren von offizieller Seite wieder Zweifel am Adelsstand der Familie aufgekommen. Und so mussten Don Alonso und seine Brüder vor Gericht um die Anerkennung ihres Rufes kämpfen. Der Prozess zog sich über Jahre und endete für die Brüder Cepeda mit einem Erfolg. Ihr Adelsbrief wurde anerkannt, somit auch ihre christliche Gesinnung. Hätten die Brüder den Prozess verloren, wären sie vielleicht gezwungen worden, aus Ávila wegzuziehen oder sogar das Land zu verlassen. So aber konnten sie in Ávila bleiben.
Ávila in der kastilischen Hochebene glich zu jenen Zeiten einer riesigen Festung mit einer drei Meter dicken, zinnenbesetzten Stadtmauer und achtundachtzig wuchtigen Rundtürmen. Der wehrhafte Charakter der Stadt entsprach dem Selbstbewusstsein ihrer Bewohner. Die Patrizierfamilien Ávilas waren stolz darauf, dass ihre Vorfahren maßgeblich an der »Reconquista«, an der Rückeroberung des Landes durch christliche Heere, beteiligt gewesen waren. Jahrhundertelang hatten muslimische Eroberer aus Nordafrika über die iberische Halbinsel geherrscht. In zahllosen Kämpfen wurden diese Mauren immer weiter zurückgedrängt, und schließlich nahmen die Heere Isabellas und Ferdinands 1492 die letzte maurische Bastion, Granada, ein. Der letzte Maurenkönig Boabdil floh ins Exil nach Nordafrika. Das Königspaar Isabell und Ferdinand, das vom Papst den Ehrentitel »Katholische Könige« verliehen bekam, war somit seinem Ziel nähergekommen, Spanien politisch und vor allem religiös zu einigen.
Spanien sollte ein Bollwerk des katholischen Glaubens werden, an dessen Mauern alle fremden, feindlichen Einflüsse abprallten. Und solche Gefahren drohten von überall her. Im Osten drangen türkische Heere gegen die christlichen Länder Europas vor. Und aus dem Norden kamen beunruhigende Nachrichten, nach denen ein Mönch namens Martin Luther ketzerische Thesen an eine Kirchentür genagelt haben soll, in denen er zum Ungehorsam gegen den Papst aufrief.
Ávila war das Stein gewordene Sinnbild der spanischen Gesellschaft. Auf Schritt und Tritt traf man hier auf einen Zeitgeist, der viel auf Ehre hielt, der stolz war auf die eigene Rechtgläubigkeit und bereit, diese zu verteidigen. Und die junge Teresa blieb nicht unberührt von diesem Geist. In ihrer Lebensgeschichte, die sie als fünfzigjährige Frau niederzuschreiben begann, erzählt sie von einem Abenteuer, das sie sich als neunjähriges Mädchen leistete.7 Zusammen mit ihrem Lieblingsbruder Rodrigo riss sie von zu Hause aus. Die beiden wollten in das Land der Mauren wandern, um dort von den Ungläubigen geköpft zu werden und als christliche Märtyrer die himmlischen Belohnungen für ihren Opfertod zu empfangen. Ein Onkel der beiden machte diese hochfliegenden Pläne zunichte. Er fing sie außerhalb der Stadtmauern ab und brachte sie zu ihrer Familie zurück.
Diese Geschichte passt in die herkömmlichen Lebensgeschichten von Heiligen, in denen solche Begebenheiten als frühe Anzeichen einer besonderen Frömmigkeit präsentiert werden. Aber Teresa wollte als erwachsene Frau keine Heilige sein. Und sie war es schon gar nicht als Kind. Bei der Geschichte von der Ausreißerin muss man eher fragen, wie solche Flausen in ihren kindlichen Kopf kamen und welche Rückschlüsse auf ihre Erziehung dies zulässt. Denn offenbar wurden der kleinen Teresa schaurige Märtyrergeschichten erzählt, von ungläubigen und grausamen Mauren und von furchtlosen Christen, die bereit waren, ihr Leben für den Glauben zu lassen, und dafür im Himmel mit unvorstellbaren Wohltaten belohnt wurden. Die kleine Teresa konnte natürlich nicht wissen, dass sie und ihre Familie viel mit den gottlosen Mauren gemeinsam hatten. Auch die Mauren wurden verfolgt und 1501 endgültig aus Spanien vertrieben. Unter den Mauren gab es ebenfalls viele, die in der Not zum christlichen Glauben wechselten. Sie hießen dann nicht »conversos«, sondern Morisken, und waren wie die konvertierten Juden immer im Visier der Inquisition.
Teresa verschwieg noch in ihrer Lebensgeschichte ihre jüdischen Wurzeln. Und wenn sie nach ihrer Herkunft gefragt wurde, reagierte sie sehr gereizt.8 Man muss auch diesen Teil ihrer Geschichte kennen, um manches zu verstehen, was sie gedacht, geglaubt und getan hat.
Viele Söhne aus Conversos-Familien verließen die ummauerte Stadt, um den Repressionen, Vorurteilen und schlechten Zukunftsaussichten zu entkommen. Auch Teresas Brüder hofften, in den von Spanien eroberten Ländern Südamerikas ihr Glück zu machen. Teresa war als Frau dieser Weg versperrt. Sie entdeckte einen anderen Weg, um der geistigen Enge ihrer Zeit zu entkommen. Dieser Weg führte sie ins eigene Innere. Teresa beschrieb dieses Innere als Burg mit vielen Wohnungen, in der sie ein Vertrauen geschenkt bekam, das sie von allen Ängsten und Zwängen befreite.
II. EHRE UND SÜNDE
Teresa hat ihr Leben selbst beschrieben. Sie war fast vierzig Jahre alt, als sie die ersten Versuche machte, ihren Lebensweg und ihre geistige Entwicklung aufzuschreiben. Das tat sie aus dem Bedürfnis, sich selber Klarheit zu verschaffen. Gleichzeitig waren diese Auskünfte bestimmt für Kirchenmänner und Theologen, die beurteilen sollten, ob Teresas Ansichten und innere Erfahrungen im Einklang standen mit den Lehren der Kirche. Diese ersten Anläufe zu einer Autobiographie sind verloren gegangen. Erhalten geblieben ist dagegen eine umfangreiche Lebensgeschichte, die Teresa verfasste, als sie um die fünfzig Jahre alt war. Dass dieses Werk entstehen konnte, grenzt fast an ein Wunder. Denn nur wenige Jahre vorher, im August 1559, hatte der Großinquisitor Fernando de Valdés einen »Index verbotener Bücher« aufgestellt, demzufolge nun auch geistliche Schriften in der Volkssprache eine Gefahr für die »gesunde Lehre« waren.
Teresa schrieb in ihrer Muttersprache Kastilianisch. Noch dazu wollte sie sich möglichst verständlich ausdrücken und nur das beschreiben, was sie durch eigene Erfahrung verbürgen konnte. All das musste sie in den Augen der Inquisition zu einer höchst verdächtigen Person machen. Teresa konnte jedoch darauf verweisen, dass sie ihr Buch im Auftrag hochgestellter Kirchenmänner schrieb. Das bot ihr Schutz. Dennoch wusste sie, dass dieses Buch früher oder später auf den Tischen der Inquisition landen würde. Sie musste also vorsichtig sein und abwägen. Einerseits wollte sie nicht riskieren, dass das Buch verboten wurde oder sie selbst in die Fänge der Inquisition geriet. Andererseits wollte sie wahrhaftig bleiben und nichts beschreiben, von dem sie nicht zutiefst überzeugt war. Diese Gratwanderung gelang ihr – mit diplomatischem Geschick, mit Humor, manchmal mit Ironie und einer gehörigen Portion Schlitzohrigkeit. Für den Leser bedeutet das aber, dass er zwischen den Zeilen lesen muss, um ihre wahren Ansichten auch dort zu erkennen, wo sie sich scheinbar auf die Positionen ihrer Gegner einlässt.
Ihr Lebensbericht ist im Rückblick verfasst. Als Teresa sich daranmachte, ihren Lebensweg zu Papier zu bringen, war sie eine reife Frau, die ihrer Bestimmung sicher war und bereits ein eigenes Kloster gegründet hatte. Dementsprechend sah sie ihre Kindheit und Jugend mit den Augen einer überzeugten Christin. Dies führte dazu, dass sie die eigene Vergangenheit oft als eine Zeit voller Irrtümer, als Verirrung oder gar als Sünde schildert, obwohl sie als Kind und junge Frau viele angebliche Verfehlungen als »nicht schlimm« oder nicht als sündhaft empfunden hat.1 Die ältere Teresa hat also viel von ihrem Wissen und ihrem Bewusstsein in die »junge« Teresa hineinprojiziert. Gleichzeitig vermochte die »alte« Teresa sehr wohl, sich in den Kopf der »jungen« Teresa hineinzuversetzen. Der Leser muss beides auseinanderhalten, um Teresas Entwicklung nachvollziehen zu können. Nur so wird er davon abgehalten, Teresas Leben nach dem Muster einer typischen Heiligenlegende zu lesen, wonach ein Mensch von Kindheit an auf geradem Weg auf seine Bestimmung zusteuert. Diesen geraden Weg gibt es bei Teresa nicht. Ihre Vorstellung von Entwicklung ist eine andere.
Für einen modernen Menschen ergibt sich Entwicklung aus Erfahrung. Er macht im Leben Erfahrungen, gute und schlechte, lernt daraus, ändert sein Verhalten. Auch Teresa hat Erfahrungen gemacht und ist durch sie geprägt worden. Aber bei ihr kommt noch etwas anderes hinzu. Sie ist überzeugt davon, dass jeder Mensch eine intime Beziehung zum Göttlichen hat. Diese Beziehung äußert sich darin, dass in jedem Menschen etwas wirkt, das ihn dazu bewegen will, anders zu sein, als er ist. Teresa findet verschiedene Namen und Bilder für diese innere Unruhe. Einmal spricht sie vom »Lockruf«, den man im Innern hören kann. Ein andermal von »Durst« oder von einer »Sehnsucht«. Für Teresa ist es eine »Sehnsucht nach etwas, das uns fehlt«. Und das, was uns fehlt, kann uns, so schreibt sie, »so sehr fehlen, dass es uns umbringt, wenn es fehlt«.2 Diese Sehnsucht kann aber auch sehr schwach sein wie ein »leises Pfeifen«3, das kaum zu hören ist. Auf dieses Pfeifen können Menschen verschieden reagieren. Sie können sich so verhalten, dass sie es übertönen und damit überhören. Oder sie können hellhörig und empfänglicher werden. Jedenfalls gehören immer zwei Seiten dazu, damit eine Entwicklung in Gang kommt: der Lockruf im Innern einerseits und andererseits, wie der Mensch sich dazu verhält, ob er hört oder nicht hört.
Folgt man den Erinnerungen Teresas, so hat sie als Kind von diesem Lockruf nichts gewusst, geschweige denn einen solchen vernommen. Ihre christlichen Kinderspiele entsprangen nicht einer echten Frömmigkeit, sondern waren die Folge von Geschichten, die sie gehört hatte und die ihre Fantasie anregten. Nachdem der Plan, sich von den Mauren köpfen zu lassen, schiefgegangen war, begann Teresa, auf dem Landgut der Familie Einsiedler zu spielen. »In einem Garten, den es zu Hause gab«, so erzählt sie in ihren Erinnerungen, »versuchten wir, so gut es ging, Einsiedeleien zu bauen, indem wir kleine Steine aufschichteten, die aber bald wieder einfielen; so fanden wir keine Abhilfe für unseren Wunsch.«4 Geschichten von Heiligen und Märtyrern gehörten zur religiösen Unterweisung seitens der Eltern und der Kirche. Für ein Mädchen wie Teresa gab es keinen Schulunterricht. Dem Status ihrer Familie gemäß, lernte sie zu Hause lesen, schreiben, ein wenig rechnen und einige Handarbeiten.
Im Nachhinein war Teresa der Überzeugung, dass in der Kindheit Vorbilder die größte Rolle spielen. Und dabei dachte sie in erster Linie an ihre Eltern. Ihrer Mutter und ihrem Vater stellt sie ein gutes Zeugnis aus, sie seien »tugendhafte und gottesfürchtige Eltern«5 gewesen. Das klingt, als wolle sie ihre Eltern bei den kritischen Kirchenmännern, die diese Zeilen lesen würden, in ein günstiges Licht stellen. Ihren Vater schildert Teresa als sanften, sehr mitleidfähigen Mann, der, anders als in adligen Familien üblich, keine Sklaven hielt, weil er deren Unfreiheit nicht ertragen konnte. Alonso de Cepeda war es wohl auch, der Teresa lesen und schreiben beibrachte. Grundlage dafür war seine umfangreiche Bibliothek, die hauptsächlich religiöse Werke enthielt, etwa Bücher über das Leben Christi, über die heilige Messe oder die sieben Todsünden.
Don Alonso hat sicher gehofft, dass das Lesenlernen für Teresa gleichzeitig eine Einführung in die katholische Religion sein würde. Er muss enttäuscht gewesen sein, dass seine Tochter sich zu einer anderen Lektüre hingezogen fühlte. Und nicht ganz unschuldig daran war seine Frau Beatriz.
Teresa beschreibt ihre Mutter als sehr schöne, tugendhafte und intelligente Frau. Dass Beatriz Dávila y Ahumada, wie sie mit vollem Namen hieß, auch andere Seiten hatte, unterschlägt Teresa nicht, selbst wenn sie in der Vida nur angedeutet werden. Beatriz konnte ihre Schönheit nicht zeigen und ihre Begabungen nicht entfalten. Als Ehefrau und Mutter war sie ans Haus gefesselt. Nach Teresas Geburt brachte sie eine Reihe von Jungen zur Welt, die Juan, Lorenzo, Antonio, Pedro, Jerónimo hießen – und ein Ende des Kindersegens war nicht abzusehen. Durch die vielen Geburten und wahrscheinlich auch Fehlgeburten war Beatriz häufig krank und früh gealtert.
Der einzige Lichtblick in diesem beschwerlichen und oft trostlosen Leben waren für Beatriz ihre Bücher – ganz andere Bücher, als in der Bibliothek ihres Mannes standen. Es waren Liebes- und Abenteuerromane, in denen edle und starke Ritter mit Namen wie Amadis oder Florisandro die Herzen von Königstöchtern eroberten. Beatriz konnte ihre Pflichten in Haus und Familie nicht schnell genug erledigen, um wieder in die Welt der Abenteuer und großen Leidenschaften einzutauchen. Und ihre Tochter folgte ihr in diese Welt. Teresa las stundenlang in diesen Romanen, oft sogar noch heimlich nachts im Bett. »Es war derart extrem, wie ich davon erfüllt war«, so bekannte sie, »dass ich meinte, nicht glücklich zu sein, wenn ich kein neues Buch hatte.«6