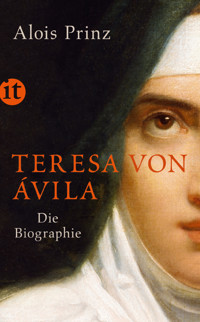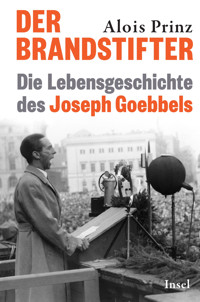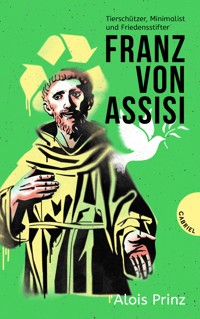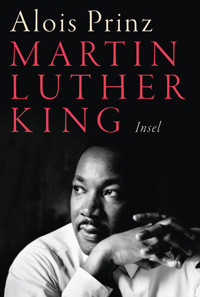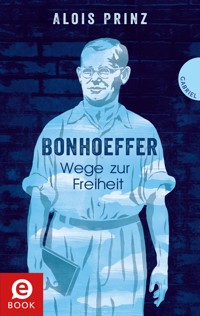14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Tagsüber Beamter in der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt, nachts Verfasser von Erzählungen: Franz Kafka schrieb vor allem für sich selbst. Es ist Max Brod zu verdanken, dass sein »Gekritzel«, wie er sein Schreiben selbst bezeichnete, längst zur Weltliteratur zählt – und bis heute in seiner Rätselhaftigkeit und Sprachvirtuosität fasziniert. Alois Prinz erzählt Kafkas Lebensgeschichte und findet über dessen Alltag Zugang zu seinen Texten und ihrer Bilderwelt. Er zeigt ihn im Kreis seiner Familie, seiner Freunde und der Frauen, die er liebte – Felice Bauer, Milena Jesenská und Dora Diamant –, als einen Mann, der Charme und Humor hatte, Liebesfähigkeit und Sanftmut – und liefert damit zugleich den idealen Einstieg in sein Werk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alois Prinz
Auf der Schwelle zum Glück
Die Lebensgeschichte des Franz Kafka
Insel Verlag
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuch 5020.
Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2024
Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung
© 2005 Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz Weinheim Basel
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Umschlagfoto: Franz Kafka, ca. 1911/1912 © Archiv Klaus Wagenbach, Berlin
Bildteil: Archiv Klaus Wagenbach, Berlin
eISBN 978-3-458-77818-9
www.suhrkamp.de
Inhalt
Prolog
I. Prag, Niklasstraße 36, vierter Stock
II. Nackte Wahrheiten
III. Ein schlechter Sohn
IV. Al Vero Eden
V. Im »Café Savoy«
VI. Goethe und Margarethe
VII. Sonne, Luft und Mädchen
VIII. Wahre Träume
IX. Franz, das Tier
X. Drum prüfe, wer sich ewig bindet
XI. Nicht lebendig, nicht tot
XII. Heiraten und / oder Berlin
XIII. Im »Askanischen Hof«
XIV. Weltenkrieg
XV. Unter dem schwachen Licht eines Engels
XVI. Körpersprachen
XVII. Katz und Maus
XVIII. Der Teufel auf der Brücke
XIX. Angst
XX. Die falsche Speise
XXI. Luftschlösser
XXII. Auf der Schwelle zum Glück
XXIII. Der Patient auf Nummer 12 oder Was Liebe ist
Zeittafel
Bibliographie
Quellenverzeichnis
Bildteil
Prolog
Der 11. August 1914 war ein Dienstag. Am Abend dieses Tages saß der Versicherungsangestellte Franz Kafka in der Wohnung seiner Schwester Valli in der Bilekgasse 10 in Prag. Kafka genoss die Ruhe in den leeren Räumen. Wenn er nachmittags von der Arbeit in die Bilekstraße kam, legte er sich zuerst auf das Kanapee und versuchte ein paar Stunden zu schlafen. Er brauchte den Schlaf, um abends und nachts ausgeruht zu sein. In Kafka gärte es nämlich wieder. Fast zwei Jahre war es her, dass er, in einer einzigen Nacht, eine Erzählung geschrieben hatte, die aus ihm herausgekommen war wie bei einer Geburt. Seither war die Quelle versiegt und er hatte vergeblich auf eine Wiederholung gewartet. Doch seit einigen Tagen schaute er nicht mehr so ins Leere. Er konnte wieder ein Zwiegespräch mit sich führen, und das hieß, er konnte wieder schreiben. Mit den ersten Versuchen war er nicht zufrieden. Aber jetzt machte er einen langen, dicken Querstrich in sein Tagebuchheft, zum Zeichen, dass etwas Neues beginnt, und schrieb den merkwürdigen Satz: Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, war er eines Morgens gefangen. Kafka strich die Worte »war« und »gefangen« durch und schrieb darüber »wurde« und »verhaftet«.
Neunzig Jahre danach hängen diese handschriftlichen Zeilen, mit denen Kafkas Roman Der Prozess beginnt, über meinem Schreibtisch. Es ist ein Faksimile des Originals. Ich habe es vor Jahren aus einer Zeitung ausgeschnitten und das Papier ist schon ziemlich vergilbt und verknittert. Noch immer aber ist die Faszination, die für mich von dieser krakeligen Handschrift ausgeht, ungebrochen. Es ist, als ob darin das Geheimnis von Kafkas Schreiben aufbewahrt ist. Als ob der Zustand der totalen Offenheit und Präsenz, der für Kafka beim Schreiben unverzichtbar war, darin konserviert ist. Und es steckt darin auch die Spannung zwischen dem Ursprung und dem, was daraus geworden ist.
Wer heute ein Buch von Franz Kafka zur Hand nimmt, weiß, dass er es mit Weltliteratur zu tun hat. Mehr noch: Er braucht das Buch nicht einmal selbst zu lesen, um zu wissen, dass Kafka große Literatur ist. Aber was ist das für ein Wissen? Es verlässt sich größtenteils auf ein Urteil, das sich über die Jahre verfestigt und Kafka zum klassischen Autor erklärt hat. Und muss nicht ein Autor wichtig und bedeutend sein, über den so viel geschrieben und nachgedacht worden ist, dessen Bücher verfilmt wurden und in dessen Erzählungen und Romanen eine so unvergleichliche Atmosphäre herrscht, dass man dafür sogar ein eigenes Wort erfunden hat: kafkaesk?
Dieser Bekanntheit steht entgegen, dass dieser Mensch zeit seines Lebens ein fast unbekannter Autor war, dass seine wenigen Bücher kaum Leser gefunden haben, dass nur ganz wenige seine Texte zu schätzen wussten und dass dieser Mensch ein ziemlich normales, zurückgezogenes Leben geführt hat. Kafkas Zeitgenossen wussten noch nicht, wen sie vor sich hatten. Waren sie einfach blind und dumm? Ich stelle mir oft vor, ich hätte zu dieser Zeit in Prag gelebt und Kafka gekannt, als Nachbar, als Arbeitskollege oder als Mitschüler. Hätte ich etwas Besonderes entdeckt an diesem immer freundlichen, etwas schrulligen Mann? Ich glaube nicht. Wäre ich darauf gekommen, dass die Texte, die er abends, nach seinen Bürostunden, in seine Schulhefte schrieb, einen besonderen Wert haben, gar Weltliteratur sind? Sehr unwahrscheinlich.
Dass Kafka zu Lebzeiten so wenig Aufsehen erregt hat, liegt nicht nur daran, dass er verkannt worden ist. Vielmehr lag Kafka nichts daran, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Mehr noch: Er hat eine größere Wirkung bewusst verhindert. Viele Texte hat er vernichtet, andere, wie den Prozess, hat er nie aus der Hand gegeben. Auch in seiner eigenen Einstellung zum Wert eines Buches spielen der Name, den sich ein Autor erworben hat, oder die Meinungen anderer keine Rolle. Für Kafka zählte der Moment des Schreibens, das fertige Produkt war dagegen eher nebensächlich. Und Lesen war für ihn nichts anderes, als die Kräfte, die beim Schreiben freigesetzt worden sind, noch einmal nachzuvollziehen. Bereits bestehende Urteile, auch die von Literaturexperten, sind dabei nicht von Belang. Die innere Wahrheit eines literarischen Textes, so schrieb er einmal, lasse sich niemals allgemein feststellen, sondern müsse immer wieder von jedem Leser oder Hörer von neuem zugegeben oder geleugnet werden.
Wenn das stimmt, dann sind die tausende von Aufsätzen und Büchern zwar nicht irrelevant, aber auch nicht entscheidend für eine Begegnung mit Kafka. Entscheidend ist, dass jeder Leser zu jeder Zeit die »innere Wahrheit« seiner Erzählungen leugnet oder anerkennt. Dabei können ihm letztlich keine Interpretationen und Analysen helfen, und auch der zeitliche Abstand, der uns von Kafka trennt, bringt keinen Vorteil. Vielmehr kommt es darauf an, wieder mit Kafka gleichzeitig zu werden, das heißt, alles zu vergessen, was man über ihn zu wissen meint, und sich wie zum ersten Mal der Wucht seiner Texte und seiner Gedanken auszusetzen.
Das gilt auch für Kafkas Leben. Obwohl es an äußeren Ereignissen arm war, hatte es doch eine »innere Wahrheit«, die man ebenfalls nicht allgemein feststellen kann, sondern die jeder, der dieses Leben betrachtet, für sich anerkennen oder leugnen muss. Diese Wahrheit steht nicht in großen Buchstaben über seinem Leben, sondern versteckt sich im unspektakulären Alltag des Prager Versicherungsangestellten. Diese Verborgenheit gehört wesentlich zu Kafka. Sie bedeutet nicht, dass sein Leben grau und langweilig war. Vielmehr weist sie darauf hin, dass die aufregendsten Wahrheiten ganz unscheinbar und harmlos daherkommen können, vielleicht sogar müssen. Kafka steht für die Entdeckung, dass gerade in der banalsten Normalität der explosivste Sprengstoff liegen kann.
Ein Buch über Kafka muss dieser Verborgenheit Rechnung tragen. Es sollte einen Blick auf Kafka ermöglichen, der ihn so zeigt, wie er selbst gesehen werden wollte: als korrekter Beamter, liebenswürdiger Kollege, schwieriger Sohn, aufmerksamer Freund, entscheidungsschwacher Rebell, unglücklicher Liebhaber und ewiger Junggeselle. Zugleich sollte deutlich werden, dass dahinter ein lebenslanger Kampf steht, ein Kampf darum, die radikalsten Forderungen an sich selbst und an andere zu verbinden mit einer lebbaren Realität.
Vielleicht wird auf diese Weise die elementare Kraft spürbar, die von Kafkas handschriftlichen Zeilen ausgeht. Vielleicht kann nur so ein Buch entstehen, wie Kafka es sich selber gewünscht hat. Ich glaube, hat er schon als Zwanzigjähriger an seinen Freund Oskar Pollak geschrieben, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie du schreibst? Mein Gott, glücklich wären wir eben auch, wenn wir keine Bücher hätten, und solche Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir zur Not selber schreiben. Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wilder verstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das glaube ich.
I. Prag, Niklasstraße 36, vierter Stock
Eigentlich sollte die Welt im Jahr 1910 untergehen. So jedenfalls prophezeiten es die Wahrsager. Und der Grund für diese düstere Prognose war der Halleysche Komet, der auf die Erde zuraste und den man Mitte Mai mit bloßem Auge würde sehen können. Gab es nicht schon Vorzeichen für die nahende Katastrophe? In Frankreich überflutete der Regen das Land und sogar der Eiffelturm in Paris stand im Hochwasser der Seine. In Deutschland legten Streiks das Land lahm und aufgrund der bedenkenlosen Rüstung verschärfte sich die Finanzkrise. Im April stürzten mehrere Ballons und Flugzeuge ab, das Reichsluftschiff Z II wurde von einem Sturm völlig zerstört, ebenso ein britisches Militärluftschiff, und die deutsche Fußballnationalmannschaft verlor ihr erstes Länderspiel gegen die Niederlande mit 2 : 4 Toren.
In Berlin gab es eine Postkarte zu kaufen, mit einer Karikatur zum bevorstehenden Weltuntergang. Auf einer Weltkugel eilen panische Menschen zu einem Luftballonverkäufer, der seine Ware zum Ausverkaufspreis von 50 Pfennig pro Stück anbietet. An den Ballons entschweben dann Männer und Frauen mit Koffern und Regenschirmen in der Hand in den Weltraum, weg von der dem Untergang geweihten Erde.
Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Die meisten Menschen amüsierten sich über die Ängste vor einem Weitende, und sie ließen sich nicht davon abhalten, an die Zukunft zu denken. Wie diese Welt von morgen aussehen wird, davon konnte man sich auf der Weltausstellung in Brüssel einen Eindruck verschaffen. Der belgische König Albert I. eröffnete am 23. März die gigantische Leistungsschau. Über 50 000 Menschen besuchten täglich das 100 Hektar große Gelände. Neben einem riesigen Volksfest präsentierten Länder aller Kontinente ihre neuesten Errungenschaften auf den Gebieten Forschung, Technik und Kultur. In der deutschen Abteilung stand eine riesige Kraftmaschinenhalle, darin lärmten Verbrennungsmotoren und Kompressoren zur Erzeugung von Pressluft. Und das Neueste war ein Kleinmotor, den der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel entwickelt hatte.
Die Welt Anfang des Jahres 1910 schien keineswegs an ihrem Ende. Vielmehr war der Glaube verbreitet, man stehe am Anfang einer goldenen Zukunft, auch wenn es zwischen den führenden europäischen Mächten Spannungen gab. Österreich hatte im Oktober 1908 Bosnien-Herzegowina annektiert und dadurch Russland, Italien, England und die Türkei gegen sich aufgebracht. Nur Deutschland stand in Nibelungentreue zu seinem Nachbarn. Österreich, das war seit 1867 ein Zusammenschluss von Österreich und Ungarn und immerhin das zweitgrößte Staatsgebilde in Europa nach Russland. Es reichte von Böhmen bis zur Balkanhalbinsel und von Tirol bis zur Bukowina und Siebenbürgen.
An der Spitze dieses Vielvölkerstaates stand der greise Kaiser Franz Joseph, zugleich König von Ungarn. Diese k.u.k. Doppelmonarchie wurde nicht nur durch die gemeinsame Außenpolitik in Schwierigkeiten gebracht. Auch der innere Zusammenhalt war durch die vielen Nationalitäten gefährdet. Zwar gab es in der österreichischen Reichshälfte ein Parlament, in dem die Deutschen, Italiener, Polen und Tschechen ihre Rechte vertreten konnten. Doch die Feindschaft zwischen den Volksgruppen war so unversöhnlich, dass es in der Volksvertretung zu regelrechten Raufereien kam und die Abgeordneten einander Tintenfässer an den Kopf warfen.
Besonders die Rivalität zwischen den Deutschen und den Tschechen bestimmte zeitweise die ganze Innenpolitik. Die in Böhmen zahlenmäßig überlegenen Tschechen waren stolz auf ihre Kultur und träumten von einem eigenen Nationalstaat. Die deutsche Minderheit betrachtete sich kulturell dem Deutschen Reich zugehörig und wollte diese Tradition aufrechterhalten. Dieser Streit führte auch zu blutigen Auseinandersetzungen, aber hauptsächlich wurde er auf dem diplomatischen Parkett ausgetragen. Zeitweise war der böhmische Landtag beschlussunfähig und musste sich nach Notverordnungen aus Wien richten. Am 15. April 1910 beschloss der Prager Gemeinderat, die Veröffentlichungen des Statistischen Amts nicht mehr in deutscher, sondern nur noch in tschechischer und französischer Sprache erscheinen zu lassen. Und am 27. April brachten die tschechischen Abgeordneten im Wiener Reichsrat einen Antrag durch, nach dem zukünftig nur zweisprachige Beamte eingestellt werden durften.
Der 28. April 1910 ist ein Donnerstag. Es ist früher Morgen in Prag, der »Hauptstadt des Königreichs Böhmen«. Über der Moldau liegt leichter Nebel und die vielen Türme der Altstadt stehen wie Schattenrisse in der Morgendämmerung. In einigen Kaffeehäusern und Suppenstuben drängen sich noch Nachtschwärmer. Für andere beginnt der neue Arbeitstag. Die ersten Passanten in den Gassen sind Bäckerjungen, Fleischergehilfen, Nachtwächter, Plakatankleber und Zeitungsausträger. Dienstmädchen schleppen Schüsseln und Eimer voll Wasser in die Häuser. Milchwagen sind unterwegs. Und vom Wenzelsplatz her zieht eine ganze Armee von Straßenkehrern mit ihren Besen durch die Stadt.
Auf dem Altstädter Ring, rund um die Mariensäule, stehen an die hundert Wagen mit vorgespannten Pferden. Bauern und Marktfrauen verkaufen hier Kartoffeln, Kohlköpfe, Salat, Obst, Pilze, Waldfrüchte und Gänse. Um diese Zeit ist alles billiger, weil bis sieben Uhr keine Marktgebühr verlangt wird. Punkt sieben Uhr rollen die letzten Wagen wieder davon und der Platz ist wie leer gefegt.1
Im Morgengrauen nehmen auch die elektrischen Straßenbahnen, die es schon seit über zehn Jahren gibt, ihren Dienst auf. Eine neue Linie fährt vom Großen Ring, dem zentralen Platz in der Altstadt, am Rathaus vorbei in die Niklasstraße, auf geradem Weg zur Moldau. Die Brücke, die hier über den Fluss führt, ist erst vor zwei Jahren fertig gestellt worden. Die Gegend am Flussufer gehörte früher zum Judenviertel. Die alten Slumbauten sind nach und nach abgerissen worden und an ihrer Stelle hat man mehrstöckige moderne Mietspaläste errichtet.
Direkt am Uferquai ist noch ein großer, leerer Bauplatz. Daneben, Niklasstraße 36, vor der Brücke, steht das Haus »Zum Schiff«. Die Familien, die hier wohnen, gehören schon zur besseren Gesellschaft. Die Wohnungen haben fließend Wasser und ein Bad, was in Prag wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist. Im Haus gibt es auch einen Aufzug. Daran ist ein Schild befestigt mit dem Hinweis, dass Kindern unter vierzehn Jahren der Besitz eines Fahrstuhlschlüssels verboten ist.2 Das Verbot ist auf Deutsch, mit Rücksicht auf die deutschen Mieter. Wenn man also einen Schlüssel hat, kann man hinauffahren bis in den vierten Stock. Dort wohnt die Familie Kafka.
Es ist nicht leicht zu sagen, welcher Bevölkerungsgruppe die Kafkas angehören. Die Eltern, Hermann und Julie Kafka, stammen beide aus jüdischen Familien. Aber die jüdische Religion und ihre Riten spielen in ihrem Leben keine große Rolle mehr. Hermann Kafka ist Geschäftsmann, er verkauft Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Handschuhe, Unterwäsche oder Knöpfe, eben alles, was die elegante Dame, der elegante Herr brauchen. Und dem Erfolg seines Geschäftes ordnet er alles unter. Er wird auch nicht gern daran erinnert, dass er einmal als armer tschechischer Jude aus einem kleinen Kaff nach Prag gekommen ist. Wer in Prag etwas werden will, muss sich Zugang zur deutschen Oberschicht verschaffen. In der Familie Kafka wird Deutsch gesprochen und die vier Kinder haben deutsche Schulen besucht.
Kurz nach sechs Uhr wird es in der Wohnung der Kafkas langsam lebendig. Ein Dienstmädchen bereitet in der Küche das Frühstück vor und deckt den Tisch in der Wohnstube. Als Erstes erscheint das jüngste Kind der Familie, die siebzehnjährige Ottilie, die alle nur Ottla nennen. Sie muss sich mit ihren älteren Schwestern Gabriele und Valerie, Elli und Valli genannt, ein Zimmer teilen. Aber während die beiden noch liegen bleiben dürfen, muss Ottla um Viertel nach sieben in der Zeltnergasse sein, um das Galanteriewaren-Geschäft ihres Vaters aufzuschließen und die Angestellten einzulassen. Hermann Kafka traut diesen Angestellen nicht, er nennt sie bezahlte Feinde3. Ihm ist es wichtig, dass immer jemand aus der Familie im Laden ist. Deshalb bleibt Ottla auch über Mittag dort, das Essen bringt man ihr, und erst nachmittags zwischen vier und fünf Uhr kommt sie wieder nach Hause.
Ottla ist meistens schon weg, wenn ihr Bruder aufsteht. Er heißt Franz wie der Kaiser und wird am 3. Juli schon 27 Jahre alt. Er wundert sich selbst am meisten darüber, dass er immer noch bei seinen Eltern wohnt. Er hat zwar sein eigenes Zimmer, aber das liegt ungünstig zwischen der Wohnstube und dem elterlichen Schlafzimmer. In diesem Durchgangszimmer ist es kalt. Franz braucht immer frische Luft, auch nachts und im Winter. Das gehört zu seiner Abhärtung. Seit einem Jahr »müllert« er auch, das heißt, er macht regelmäßig Turnübungen nach dem Lehrbuch des dänischen Gymnastiklehrers Johann Peder Müller, nackt und bei offenem Fenster.
Im Bad braucht Franz immer besonders lange. Ausführlich wäscht und rasiert er sich und kämmt sich die dichten, schwarzen Haare, die weit in der Stirn ansetzen. Zum Frühstücken bleibt nicht mehr viel Zeit. Viel isst er sowieso nicht. Brot, Milch und ein wenig Kompott. Franz ist es ganz recht, dass sein Vater erst später aufsteht und sich um halb neun Uhr auf den Weg in das Geschäft macht. Hermann Kafka kann es nämlich nicht mit ansehen, wie sein Sohn isst. Er selber braucht ein kräftiges Frühstück und bei den anderen Mahlzeiten trinkt er gern Bier und isst Wurst und Fleisch. Franz dagegen ist Vegetarier und auch ansonsten ein Asket. Er raucht nicht und trinkt keinen Alkohol, keinen Kaffee und keinen Tee. Für seine Mutter ist es kein Wunder, dass er so furchtbar mager ist. Über einen Meter achtzig lang ist er und wiegt dabei kaum über 60 Kilo. Sie ist überzeugt davon, dass Franz viel gesünder und lebensfroher wäre, wenn er mehr essen würde. Auch ins Büro nimmt er nur ein Brot mit, das hauchdünn mit Butter bestrichen ist.
Franz ist wie immer zu spät dran. Es ist schon kurz vor acht und um acht Uhr sollte er im Büro sein. Dort ist er bekannt dafür, dass er immer zu spät kommt. Er benutzt nicht den Fahrstuhl, sondern stürzt die Treppe hinunter, zum Schrecken derer, die gerade hinaufsteigen. Das sei, so meint er einmal, der einzige und von ihm selbst erfundene Sport, den er treibe.4
Mit weiten Schritten eilt er durch die Gassen der Altstadt. Ungefähr zehn Minuten braucht er bis zur Straße Pořič Nr. 7. Hier steht das Gebäude der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt für das Königreich Böhmen (AUVA) mit seiner prächtigen Fassade. Kafka oder Dr. Franz Kafka, wie man richtig sagen müsste, denn er hat an der Prager Karlsuniversität den Doktortitel im Fach Jura erworben, ist Angestellter der Anstalt seit dem 30. Juli 1908. Vorher war er bei einer anderen Versicherungsgesellschaft, der Assicurazioni Generali. Aber dort hat er es nur ein paar Monate ausgehalten. Für einen Hungerlohn musste er täglich oft neun Stunden und mehr arbeiten. Und abends, wenn er nach Hause kam, war er völlig erledigt. An seiner neuen Arbeitsstelle hat er »einfache Frequenz«, das heißt, er muss nur bis nachmittags um zwei Uhr im Büro bleiben. Dafür verdient er zwar weniger, hat aber den restlichen Nachmittag frei und kann machen, was er will.
Für Kafka ist heute ein besonderer Tag. Vor kurzem ist er zum Beamten und Konzipisten ernannt worden und aus diesem Anlass soll er heute zusammen mit anderen vom Präsidenten der Anstalt empfangen werden. Das ist eine große Ehre und deshalb hat Kafka auch seinen guten schwarzen Anzug an. Mit der Beförderung erhält er nicht nur ein deutlich höheres Gehalt, sondern auch eine erweiterte Stellung in der Betriebsabteilung. Diese neu geschaffene Abteilung kümmert sich um alles, was mit den Beitragszahlungen der versicherungspflichtigen böhmischen Betriebe zusammenhängt. Die Beiträge bemessen sich danach, wie hoch in den einzelnen Firmen das Unfallrisiko ist. Und zu Kafkas Aufgaben gehört es, jeden Betrieb in eine Gefahrenklasse einzuordnen und die anfallenden Beschwerden gegen diese Entscheidung zu bearbeiten. Darüber hinaus ist seinen Vorgesetzten aufgefallen, wie gewandt Kafka im Formulieren von Texten ist, und er wird nun zunehmend damit betraut, die schriftlichen Äußerungen der Anstalt wie Jahresberichte, Fachaufsätze und Reden zu verfassen.5
Zusammen mit zwei Kollegen, die auch befördert wurden, geht Kafka in das Büro des Präsidenten der Arbeiter-Unfall-Versicherung, Dr. Otto Pribram. Kafka weiß, dass er es diesem Mann zu verdanken hat, dass er als Jude überhaupt in die Anstalt aufgenommen wurde. Der Direktor persönlich hat sich für ihn eingesetzt, was damit zusammenhängt, dass Kafka mit dessen Sohn Felix in dieselbe Klasse ging und noch mit ihm befreundet ist. Als kleiner Angestellter nun dem Direktor gegenüberzustehen, das kommt Kafka vor, als hätte er eine Audienz beim lieben Gott – oder zumindest beim Kaiser. Und so mächtig und würdig sieht der Direktor auch aus mit seinem Monokel und dem langen weißen Bart.
Es gehört zum Ritual dieser Empfänge, dass man sich beim Direktor für die Beförderung mit ein paar Worten bedankt. Das übernimmt Kafkas älterer Kollege. Er hält eine kurze Rede und der Direktor nimmt sie entgegen wie ein Kaiser. Wie er dasitzt mit der geballten Faust auf dem Tisch und mit gesenktem Kopf, so dass sein weißer Bart auf der Brust abknickt. Kafka weiß, dass das alles ganz normal und üblich ist, aber beim Anblick des Direktors kann er nicht anders, er muss lachen. Es sind sozusagen nur kleine Lachanfälle, und man könnte meinen, dass er nur husten muss. Doch dann hebt der Direktor seinen Kopf und kann nun deutlich sehen, dass Kafka nicht hustet, sondern wirklich lacht. Kafka durchfährt ein Schrecken ohne Lachen6. Und er hätte vielleicht seine Fassung rasch wiedergefunden, wenn der Direktor nun nicht seinerseits angefangen hätte, eine Rede zu halten.
Kafka kommt es wieder so majestätisch vor, wie der Direktor redet, in tiefem Brustton und salbungsvoll, und alles, was er sagt, scheint so sinnlos und grotesk. Kafka muss einfach wieder lachen. Die Kollegen schauen ihn von der Seite an, aber das macht alles nur schlimmer. Der Direktor will nun die Situation entspannen und macht selber kleine Späßchen. Allerdings lacht Kafka nicht so respektvoll darüber, wie es sich gehört, sondern er lacht aus vollem Hals. Und das Schlimme ist: Er hat nun auch seine Kollegen angesteckt. Sie stehen da mit aufgeblasenen Wangen und müssen dagegen ankämpfen, einfach loszuprusten. Während sie aber noch über sich selbst erschrocken sind, scheint Kafka jede Hemmung verloren zu haben. Er hält sich nicht die Hand vor den Mund, wendet sich auch nicht ab, sondern er starrt dem Direktor völlig hilflos ins Gesicht und lacht. Natürlich lachte ich dann, so schreibt er darüber später, da ich nun schon einmal im Gange war, nicht mehr bloß über die gegenwärtigen Späßchen, sondern auch über die vergangenen und die zukünftigen und über alle zusammen, und kein Mensch wusste mehr, worüber ich eigentlich lache.7
Im Zimmer herrscht nun große Verlegenheit. Der Direktor fährt mit seiner Ansprache fort. Und man merkt, dass er schnell zum Ende kommen will, um diesen peinlichen Zwischenfall halbwegs anständig über die Bühne zu bringen. Wer weiß, was nun in Kafkas anderen Kollegen gefahren ist, der sich anscheinend ermutigt fühlt, auf die Worte des Direktors zu antworten, und anfängt, seine Meinungen zu verbreiten und läppisches Zeug daherzureden. Nun ist es für Kafka endgültig zu viel. Er verliert jede Haltung, und obwohl ihm vor Angst die Knie schlottern, muss er so herzlich und rücksichtslos lachen wie ein Schuljunge. Er schlägt sich mit der Hand auf die Brust und stammelt Entschuldigungen. Aber er kann sich gar nicht verständlich machen, weil immer wieder das Lachen aus ihm herausbricht.
Der Direktor macht noch ein paar Bemerkungen und tut so, als würde sich Kafka noch immer über einen seiner Witze amüsieren. Dann erklärt er eilig den feierlichen Empfang für beendet und schickt die drei beförderten Angestellten hinaus. Unbesiegt, mit großem Lachen, aber todunglücklich stolperte ich als Erster aus dem Saal, schildert Kafka später diesen Abgang.8
Kafka ist die Sache furchtbar peinlich. Und alles wird noch schlimmer dadurch, dass nun in der ganzen Anstalt die Geschichte von Kafka, der dem Direktor ins Gesicht gelacht hat, herumerzählt wird. Dabei hat er sich bisher nie etwas zu Schulden kommen lassen und ist nie groß aufgefallen. Er gilt als vorbildlicher Angestellter und ist bei allen beliebt, sogar bei den Putzfrauen und beim Portier. Manche nennen ihn auch »unser Amtskind«9, weil er so jung aussieht und weil er ein so kindliches Gemüt hat.
Um zwei Uhr ist für Kafka Dienstschluss. Wie immer kommt er später aus dem Versicherungsgebäude und muss sich wieder beeilen, um gleich eine Straße weiter zum Pulverturm zu kommen. Dort wartet wie jeden Tag sein Freund Max Brod auf ihn. Immer wenn er zu spät kommt, presst Kafka schon von weitem seine Hand aufs Herz und macht eine leichte Verbeugung, um zu sagen, dass es ihm Leid tue und er wirklich nichts dafür könne. Brod kennt seinen Freund, schon oft hat er auf ihn warten müssen. Kafka ist sehr aufgeregt und muss gleich von seinem missglückten Auftritt beim Direktor erzählen. Er will nun dem Direktor einen Entschuldigungsbrief schreiben, und beide verabreden sich für den späten Nachmittag, um gemeinsam an dem Brief zu feilem
Der ein Jahr jüngere Max Brod ist einen Kopf kleiner als Kafka und er ist auch nicht so gerade gewachsen. Man sieht ihm an, dass er als Kind sehr krank war. Erst machte er sämtliche Krankheiten von der Diphtherie bis zu den Masern durch und mit vier Jahren dann trat bei ihm eine Rückgratsverkrümmung auf. Die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben. »Was nicht leben kann, soll sterben«, hatte einer gesagt.10 Doch seine Mutter ließ sich nicht entmutigen und schleppte Max zu einem Schlosserlehrling nach Deutschland, der für das zierliche Kind ein eisernes Korsett schmiedete, das er noch als Gymnasiast tragen musste. Diese jahrelange Qual hat seiner Entwicklung nicht geschadet. Im Gegenteil, Brod ist sehr selbstbewusst und zu Frauen ist er alles andere als gehemmt oder schüchtern. Oft zieht er nächtelang mit Kafka durch die Prager Nachtlokale wie das »Trocadero« oder das »Eldorado«, um Frauenbekanntschaften zu machen. Und vor allem Kellnerinnen und Zimmermädchen sind vor ihm nicht sicher. Für seine erotischen Abenteuer hat er sich sogar ein eigenes Zimmer gemietet.
Im normalen Leben ist Max Brod bei der Prager Postdirektion beschäftigt. Ein Job, den er hasst. Der einzige Lichtblick für ihn ist, dass er wie Kafka nicht nachmittags arbeiten muss. Und wie Kafka hat er eine solche Stelle gesucht, um für seine literarischen Arbeiten Zeit zu haben. Anders als Kafka ist Max Brod ein bekannter Autor. Er hat schon mehrere Bücher geschrieben und ist gerade dabei, einen neuen Roman zu beenden. Er kennt Verleger und hat Kontakte zu einflussreichen Leuten in literarischen Kreisen.
Als sich die beiden im Frühjahr 1903 kennen lernten, wusste Brod lange nicht, dass auch Kafka schreibt. Erst nach Jahren las ihm Kafka etwas aus eigenen Texten vor. Einmal die Geschichte von einem jungen Mann namens Raban, der an einem regnerischen Nachmittag von seiner Arbeitsstelle zum Bahnhof geht, mit Bekannten redet und dann mit dem Zug aufs Land fährt, wo seine Verlobte auf ihn wartet. Obwohl in dieser Geschichte von den Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande kaum etwas passiert, war Brod davon begeistert, und er wollte seinen Freund dazu bewegen, seine Texte zu veröffentlichen. Unbegreiflich war ihm, dass Kafka sich so zierte und es ihm anscheinend gleichgültig war, ob sein Gekritzel auch gedruckt wurde. Es war schließlich auch Brod, der alle seine Beziehungen spielen lassen musste, um etwas von Kafka in Zeitschriften unterzubringen. Erst 1909 wurden in der angesehenen, aber sehr kurzlebigen Zeitschrift Hyperion Texte des unbekannten Prager Versicherungsangestellten abgedruckt. Und auch in der Prager Tageszeitung Bohemia erschienen erst vor kurzem kleine Prosastücke und davor ein Bericht über eine Flugschau, die Kafka zusammen mit Max Brod bei einer Italienreise besucht hatte.
Diese Veröffentlichungen wurden freilich kaum beachtet. Doch Brod hat sich vorgenommen, seinen Freund zu fördern, und das nächste Ziel muss für ihn ein Buch sein.
Max Brod nimmt gern einen Umweg in Kauf, um Kafka nach Hause zu begleiten. Sie haben viel zu besprechen, denn im Herbst wollen sie zusammen mit Max’ Bruder Otto eine Reise nach Paris machen. Noch lange bleiben sie redend vor dem Haus »Zum Schiff« stehen, bis Kafka endlich mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock fährt.
Laute Stimmen und das Scheppern von Tellern schlagen ihm entgegen, als er die Wohnungstür öffnet. Die Eltern sind schon seit halb zwei Uhr aus dem Geschäft zurück und haben bereits zu Mittag gegessen. Kafka hat eigentlich keinen Hunger, aber weil seine Mutter gleich wieder anfängt zu jammern, wie ungesund Franz lebt, isst er eine Kleinigkeit, aber nur aus Kindesliebe11.
Der Vater setzt sich nach dem Essen in den Schaukelstuhl, um ein kleines Schläfchen zu machen, bevor er und seine Frau wieder in das Geschäft gehen. Obwohl Hermann Kafka ein großer, breitschultriger Mann ist, macht ihm sein schwaches Herz zu schaffen. Besonders in letzter Zeit, seit die Geschäfte nicht mehr so gut gehen.
Nachdem die Eltern weg sind, wird es ruhiger in der Wohnung. Franz zieht sich zurück in sein Zimmer und legt sich auf sein Kanapee. Das ist sein Lieblingsplatz. Er schläft nicht richtig ein, sondern fällt in eine Art Halbschlaf, in dem er oft sehr intensive Träume hat. Es kommt vor, dass er stundenlang so liegt und dann von den Eltern wachgerüttelt wird, wenn sie um acht Uhr abends vom Geschäft nach Hause kommen.
Spätnachmittags macht sich Kafka auf zu seinem Freund Max. Der wohnt auch noch bei seinen Eltern, in der Schalengasse. Kafka ist gern bei den Brods. Mit Max’ Eltern ist es fast umgekehrt wie mit seinen. Hier ist die Mutter die Praktische, Leidenschaftliche, manchmal auch Unberechenbare. Der Vater, er ist stellvertretender Direktor der Prager Union-Bank, ist ein stiller und sanfter Mann. Beide aber verbindet die Liebe zur Musik, ein Talent, das Max von ihnen geerbt hat. Bei den Brods wird viel gesungen und über Kunst gesprochen und Max’ Eltern sind sehr stolz auf den literarischen Erfolg ihres Sohnes. Darum beneidet ihn Franz ein wenig. Denn sein Vater und seine Mutter interessieren sich nicht für Bücher, und seine eigenen Schreibversuche halten sie für einen kindischen Zeitvertreib, der von selbst aufhören werde, wenn er erst mal verheiratet sei und Kinder habe.
Kafka macht sich immer noch heftige Vorwürfe wegen seines Lachanfalls und Brod muss ihn trösten. Sie verfassen einen Entschuldigungsbrief an den Direktor, und Franz nimmt sich vor, mit seinem alten Schulfreund Ewald Felix Přibram, dem Sohn des Direktors, zu reden, damit der bei seinem Vater ein gutes Wort für ihn einlegt.
Als Kafka abends wieder nach Hause kommt, ist die Familie schon versammelt. In der Küche wird das Abendessen vorbereitet und im Wohnzimmer sitzt der Vater und liest Zeitung. Von seinem Erlebnis heute in der Versicherungsanstalt erzählt Franz lieber nichts. Das würde den Vater doch nur bestärken in seiner Meinung über den seltsamen Sohn. »Wie der Rudolf«, sagt Hermann Kafka oft, wenn er wieder Grund hat, sich über das Verhalten seines Sohnes zu wundern. Und das ist kein Kompliment. Denn Onkel Rudolf, der Halbbruder der Mutter, ist ein recht verschrobener Junggeselle, sozusagen der Narr der Familie und bekannt für seine Schrullen und eingebildeten Krankheiten.
Wenn Kafka offen mit jemandem aus seiner Familie reden kann, dann mit Ottla, seiner jüngsten Schwester. Oft sperren sie sich im Bad ein und erzählen sich dann ihre Geheimnisse. Ottla ist froh, wenn sie jemandem anvertrauen kann, wie es ihr im Geschäft mit den Eltern geht. Und Franz erzählt ihr von seinen Besuchen im Theater oder von den Filmen, die er im neuen Kino gesehen hat. Er kann so gut die Schauspieler nachmachen und bringt Ottla damit oft zum Lachen.
Gegen halb zehn wird zu Abend gegessen. Franz hat seinen eigenen Speisezettel. Am liebsten Bananen, Apfel, Trauben, Feigen und anderes Obst, dazu Nüsse aller Art. Er achtet darauf, das alles sehr lange und sorgfältig zu kauen. »Fletschern« nennt man das, nach dem amerikanischen Ernährungsexperten Horace Fletcher. Seitdem Kafka dessen Ratschläge befolgt und seine Ernährung umgestellt hat, ist es auch mit seinen Magenschmerzen besser geworden. Nur die Familie muss sich an seine Essgewohnheiten noch gewöhnen. Die Schwestern können sich das Kichern manchmal nicht verbeißen. Der Vater hält sich oft demonstrativ die Zeitung vors Gesicht.
Aber so ist er, der Vater. Er kann seine Gefühle nicht im Zaum halten. Immer sagt und zeigt er geradeheraus, was er fühlt und denkt. Elli, die älteste Tochter, nennt er »die breite Mad« und macht nach, wie sie plump und schwerfällig am Tisch sitzt.12 Elli schweigt dazu. Lange wird sie ohnehin nicht mehr in der Familie sein. Wie bei Töchtern in ihrem Alter üblich, hat man eine Heiratsvermittlung beauftragt, für sie einen Mann zu finden. Und es ist auch schon ein geeigneter Kandidat in Aussicht. Karl Hermann heißt er, ein Geschäftsmann aus kinderreicher Familie. Viel Geld wird er zwar nicht mit in die Ehe bringen, aber er sieht gut aus und ist ein Schwiegersohn, wie ihn sich Hermann Kafka nur wünschen kann. Karl Hermann will sich selbstständig machen und in Prag eine Fabrik aufbauen. Das ist ein unternehmerischer Elan, der Hermann Kafka imponiert und den er bei seinem Sohn vermisst.
Nach dem Essen kommt der gemütliche Teil des Abends. Es wird »Franzefuß« gespielt, ein Kartenspiel. Das ist Hermann Kafkas große Leidenschaft und bringt ihm die beste Entspannung nach einem langen Arbeitstag. Er fordert auch Franz auf mitzuspielen. Seit dessen Kindertagen will er, dass Franz sich am Kartenspiel beteiligt. Doch der hat immer abgelehnt.13 Höchstens, dass er mal dabeisitzt und die Gewinnpunkte aufschreibt. Franz ist das Kartenspielen einfach zu langweilig. Und vor allem verträgt er es nicht, wie sein Vater spielt. Er schreit und lacht, singt zwischendurch und pfeift durch die Zähne, fängt zu streiten an und hämmert die Karten auf den Tisch, dass die Gläser wackeln.14
Franz zieht sich lieber zurück in sein Durchgangszimmer. Dort liegt er im Dunkeln auf seinem Kanapee und betrachtet die Lichter und Schatten, die von den elektrischen Lampen auf der Straße und der Brücke in sein Zimmer geworfen werden. Die vorbeifahrende Elektrische bringt das Licht- und Schattenspiel in Bewegung und lässt die Gegenstände im Zimmer in merkwürdigem Licht erscheinen: der Wäschekasten, auf dem der Globus steht; der Schreibtisch mit dem Aufsatz und den Schreibheften und Papieren darauf; das Bett mit den dunklen breiten Bettposten.15
Es wird elf Uhr und später, bis die Eltern mit dem Kartenspielen Schluss machen. Das warme Wohnzimmer wird jetzt frei und Franz kann sich dort noch an den Tisch setzen. Der Vater steht auf dem Sofa und zieht die Wanduhr auf. Kurze Zeit später kommen die Eltern in ihren Schlafmänteln aus dem Bad. Franz wünscht ihnen gute Nacht, und sie schlurfen müde durch Franz’ Zimmer zu ihren Betten.
Diese Zeit, wenn er spätabends als Einziger noch wach ist und es still in der Wohnung wird, ist für Kafka die kostbarste des Tages. Jetzt ist er allein und kann in eines seiner Wachstuchhefte schreiben. Kafka kennt viele, die in ihrer Freizeit schreiben. Die Kaffeehäuser in Prag sind voll mit Ärzten, Anwälten oder Maklern, die nebenbei Erzählungen oder Gedichte schreiben. In Kafkas Freundeskreis haben fast alle literarischen Ehrgeiz. Sogar der Direktor seiner Versicherungsanstalt liest Gedichte, und er hat schon von Kollegen in seiner Abteilung gehört, die heimlich reimen.
Kafka fühlt sich nicht als Schriftsteller oder gar als Dichter. Es ist einfach nur so, dass er sich durch das Schreiben fester fühlt. Er hat Momente erlebt, in denen er ganz klarsichtig und ganz bei sich war, und in einem solchen Zustand kamen die Wörter und Sätze wie selbstverständlich aus ihm heraus. Leider sind solche Zustände nicht von Dauer. Sie sind viel zu selten. Und gerade in den letzten fünf Monaten fühlte Kafka sich wie ein Strohhaufen, der sich nicht anzünden lässt.
Kafka ist auf der Suche. Er ist mit seinem Leben unzufrieden, und er ist unzufrieden mit allem, was er bisher geschrieben hat. Manches hat er sogar verbrannt. Dabei weiß er genau, dass für ihn noch viel mehr möglich ist. Es ist nur wichtig, dass er sozusagen den erleuchteten Stunden ein wenig entgegenarbeitet. Darum hat er auch vor kurzem damit begonnen, ein Tagebuch zu führen. Das Tagebuch soll ihn dazu zwingen, jeden Tag zu schreiben, und sei es auch nur ein Satz. Vielleicht entzündet sich dann in den Aufzeichnungen über sich und seinen Alltag der Funke, der den Strohhaufen zum Brennen bringt. Er jedenfalls will bereit sein. Aber jeden Tag soll zumindest eine Zeile gegen mich gerichtet werden, schreibt er ins Tagebuch, wie man die Fernrohre jetzt gegen den Kometen richtet.16
II. Nackte Wahrheiten
Durch das Fenster in seinem Zimmer hat Kafka einen Blick auf den Fluss, auf die Čechbrücke und auf die Gärten und Spazierwege der Kronprinz-Rudolf-Anlagen auf der anderen Seite der Moldau. Links von der Brücke liegt die Zivilschwimmschule. Die Holzbaracken liegen auf dem Wasser und grenzen zum Ufer hin ein rechtwinkliges Stück Fluss ab, das als Schwimmbecken dient. Hier, im so genannten »Spiegel«, lernen die Anfänger das Schwimmen, von einem Lehrer gehalten an einer langen Stange. Außerdem ist die Zivilschwimmschule auch so etwas wie ein Fitnesszentrum. Hier gibt es verschiedene Turngeräte wie ein Trampolin, zwei Sprungbretter, einen Barren und ein Reck. Im Sommer verbringt Kafka viele Nachmittage in der Badeanstalt. Und an den arbeitsfreien Sonntagen liegt er oft stundenlang auf den sonnenerwärmten Brettern.
Kafka hat hier auch ein eigenes, schmales Boot liegen, einen so genannten »Seelentränker«, den er »Rudi« getauft hat. Oft rudert er damit die Moldau hinauf und lässt sich dann, im Boot lang ausgestreckt, mit der Strömung wieder zurücktreiben. Ein Kollege aus der Versicherungsanstalt hat ihn einmal so gesehen, als er auf der Brücke stand, unter der gerade der spindeldürre Kafka in seinem Boot hindurchschwamm. Wie komisch dieser Anblick war, hat er später ausführlich erzählt. Es kam ihm vor, so meinte er, wie kurz vor dem Jüngsten Gericht, wenn die Sargdeckel schon abgehoben sind, aber die Toten noch still daliegen.1
Seit Kafka rudert, schwimmt und turnt, macht es ihm nicht mehr so viel aus, sich nur in Badehose zu zeigen. Das ändert aber nichts daran, dass er sich meistens für seinen Körper schämt, ja manchmal über ihn verzweifelt ist. Solange er zurückdenken kann, war er sich unsicher, in jeder Hinsicht, und unsicher war ihm natürlich auch das Nächste, sein Körper. Ständig hatte er Angst, dass etwas damit nicht stimmt, er vielleicht krank wird, sein Rückgrat sich verkrümmt oder seine Verdauung nicht mehr funktioniert. Und die Angst davor genügte oft schon, um wirklich krank zu werden.
Und wie groß war die Angst davor, sich nackt zu zeigen, angestarrt zu werden. Nie wird er vergessen, wie ihn sein Vater früher in die Zivilschwimmschule mitgenommen hat. Sie zogen sich immer in einer Kabine um, und er, der kleine Franz, fürchtete sich schon vor dem Augenblick, wenn er neben seinem Vater im Badeanzug vor die anderen Leute treten musste. Wie groß, breit und kräftig kam ihm der Vater vor. Und wie klein, mickrig und klapprig fühlte er sich dagegen. In seiner Not hat er sich Ausreden ausgedacht, um allein in der Kabine Zurückbleiben zu können. Irgendwann musste er zwar doch hinaus, aber besser allein als neben seinem Vater.2
Aus Franz Kafka ist ein guter Schwimmer geworden, sogar ein leidenschaftlicher. Und noch lieber als in der zivilisierten Badeanstalt schwimmt er in Flüssen und Waldbächen. Wenn das Wetter am Wochenende schön ist, zieht es ihn hinaus in die Umgebung Prags, zu den Stromschnellen der Moldau, in das Sazawa-Tal oder an den Beraunfluss. Dann kann es sein, dass Max Brod am Samstag per Rohrpost eine Nachricht wie folgende bekommt: Mein lieber Max, stürze dich nicht in Kosten wegen einer Rohrpostkarte, in der du mir schreibst, dass du um 6.05 nicht auf der Franz-Josef-Bahn sein kannst, denn das musst du, da der Zug, mit dem wir nach Wran fahren, um 6 Uhr 05 fährt. Um ¾8 gehen wir den ersten Schritt gegen Davle, wo wir um 10 Uhr bei Lederer ein Paprika essen werden, um 12 Uhr in Stechowitz mittagmahlen, von 2 bis ¼4 Uhr gehen wir durch den Wald zu den Stromschnellen, auf denen wir herumfahren werden. Um 7 Uhr fahren wir mit dem Dampfer nach Prag. Überleg es dir nicht weiter und sei um ¾6 auf der Bahn.3
Meistens ist bei solchen Ausflügen auch Felix Weltsch mit dabei. Ihn kennt Kafka schon aus der Zeit im Altstädter Gymnasium, wo Weltsch eine Klasse unter ihm war. Weltsch hat auch Jura studiert und ist gerade dabei, einen zweiten Doktortitel in Philosophie zu machen. Ob sein Ehrgeiz ihm auch beruflich nützt, ist allerdings fraglich. Sein großer Traum ist, an der Universität Philosophie zu unterrichten. Doch die Chancen dazu stehen schlecht, und er muss sich darauf gefasst machen, als überqualifizierter Akademiker wie Kafka und Brod in irgendeinem schlecht bezahlten Job zu landen.
Frei von solchen Sorgen ist ein anderer Freund aus Prag, der im Sommer 1910 in den »Geheimbund froher Naturanbeter«4 eingeführt werden soll, der junge Franz Werfel, der kurz vor dem Abitur steht. Seinen Eltern gehört eine Handschuhfabrik und Werfel lebt ganz unbekümmert sein dichterisches Talent aus. Brod, Kafka und Weltsch nehmen ihn an einem Juliwochenende einmal mit zu den Stromschnellen des Sazawa, wo sie nackt im Wald herumlaufen und stundenlang baden. Der dickliche und hellhäutige Werfel ist aber das Leben in freier Natur nicht gewöhnt und holt sich einen schlimmen Sonnenbrand.
Franz Werfel passt auch besser in die Stadt als in die Natur. Täglich besucht er die Prager Kaffeehäuser, das »Corso«, das »Edison« oder das »Continental«. Am meisten Zeit verbringt er im »Café Arco«, wo sich die literarische Avantgarde trifft, junge deutschjüdische Autoren wie Otto Pick, Rudolf Fuchs oder der literaturbesessene Bankangestellte Ernst Pollak. Franz Werfel kann im Lärm und Zigarettenqualm des »Arco« seine Gedichte schreiben, und wenn er eines fertig hat, trägt er es gleich seinen begeisterten Zuhörern vor. Was Franz Kafkas Talent anbelangt, ist Werfel eher skeptisch. Max Brod hat ihm einmal einen Text von Kafka vorgelesen, und sein einziger Kommentar war gewesen: »Das kommt niemals über Bodenbach hinaus!«5 Und Bodenbach war der Grenzort zu Deutschland. Tiefste Provinz.
Auch Kafka ist öfter im »Café Arco«. Die verrauchten Räume des Kaffeehauses sind schon zur Mittagszeit voll von mehr oder weniger bekannten Literaten, die ihre Gedichte oder Erzählungen vorlesen und dann laut darüber streiten. Den Versicherungsangestellten Kafka kennt man dagegen als einen stillen Gast, der lieber zuhört und beobachtet als sich an den Gesprächen beteiligt. Offener wird Kafka erst im Kreis seiner engsten Freunde. Dazu gehört neben Max Brod und Felix Weltsch auch Oskar Baum. Vor ihm hat Kafka so großen Respekt, dass er ihn nicht zu duzen wagt. Obwohl Baum gleich alt ist wie er, hat er schon Frau und Kind, und seine Familie ernährt er als Organist und Musiklehrer. Nebenbei schreibt er auch noch Bücher – und das, obwohl er blind ist. Auf einem Auge hat er schon von Geburt an nichts gesehen. Das andere hat er verloren, als er als Elfjähriger in eine Schlägerei zwischen deutschen und tschechischen Schülern geraten war. Danach verbrachte er viele Jahre in einem Blindenheim, und von den bitteren Erfahrungen, die er dort gemacht hat, handeln auch seine Bücher.
Die vier Freunde treffen sich regelmäßig, meistens bei Oskar Baum, weil er der Einzige ist, der nicht mehr bei seinen Eltern wohnt und einen eigenen Haushalt hat. Dabei geht es immer recht lustig zu und natürlich wird von jedem erwartet, dass er etwas Selbstgeschriebenes vorliest. Nur Kafka ziert sich meistens. Er behauptet, nichts zu haben, was man vorlesen könne, oder jedenfalls nichts, was es wert wäre. Stattdessen liest er aus Werken seiner Lieblingsautoren, von Gustave Flaubert oder Heinrich von Kleist. Und Kafka kann sehr gut lesen. Er kann sich richtiggehend in einen Text, den er liebt, hineinverlieren und wird dabei von dem geheimen Wunsch getrieben, ganz mit dem Gelesenen eins zu werden. Manchmal gelingt ihm das auch, und es macht ihn glücklich, wenn er Zuhörer wie seine Schwestern zum Weinen bringt.
Was Kafka beim Vorlesen fremder Texte erlebt, das wünscht er sich auch für sich selbst. Er möchte es einmal so weit bringen, dass er alles, was ihn bewegt, wirklich restlos ausdrücken kann. Es kommt ihm so vor, als wäre das eine himmlische Auflösung und als würde er erst dann beginnen, richtig zu leben.
Nichts anderes bedeutet für Kafka Schreiben. Und er sieht es gerade als sein Unglück, dass er trotz aller Anläufe unfähig dazu scheint. Entweder er hat ein richtiges Gefühl, findet aber dann nur Wörter, die dieses Gefühl verschwinden lassen. Oder die Geschichten, die ihm einfallen, fallen ihm nicht von der Wurzel aus ein und er fühlt sich wie ein Akrobat auf einer Leiter, die auf wackeligem Grund steht und die nicht gegen eine Wand gelehnt ist, sondern frei in die Luft ragt.6
Doch obwohl Kafka oft verzweifelt darüber ist, wie wenig ihm das Schreiben gelingt, das ihm vorschwebt, kann er nicht einfach damit aufhören. Es ist wie ein innerer Befehl, dem er gehorchen muss. Und gleichzeitig ist es auch seine größte Sehnsucht. Kafka weiß, dass sich mit dem Schreiben sein Leben entscheidet und dass alles andere daneben nicht zählen sollte. Daher liest er auch so gern die Lebensgeschichten von Künstlern wie Gustave Flaubert oder Heinrich von Kleist, die sich gegen alle Widerstände behaupteten und Schriftsteller wurden.
Aber wie sieht es dagegen mit Franz Kafka aus? Er ist Ende zwanzig, arbeitet halbtags in einem Büro, wohnt bei seinen Eltern und ist dauernd den Erwartungen und Forderungen der Familie und des Büros ausgesetzt. Schon lange nimmt er sich vor, endlich eigenständig zu werden und Prag zu verlassen. Doch er schafft es einfach nicht. Prag lässt nicht los, hat er vor Jahren an einen Freund geschrieben. Dieses Mütterchen hat Krallen.7 Diesen Krallen entkommt er immer nur kurzzeitig.
Am 8. Oktober 1910 brechen Franz Kafka, Max Brod und sein Bruder Otto auf nach Paris. Sie haben sich gründlich auf diese Reise vorbereitet und sogar Französischunterricht genommen. Umso enttäuschender ist es für Kafka, dass sein Körper ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Kaum in Paris angekommen, plagen ihn Geschwüre auf dem Rücken. Widerstrebend sucht er Arzte auf, die ihm Pflaster auf die entzündete Haut legen. Kafka macht noch den halbherzigen Versuch, wenigstens die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt zu sehen. Er geht alleine los, um Max und Otto Brod nicht die Ferienstimmung zu verleiden. Doch als es mit seinen Beschwerden immer schlimmer wird, kehrt er am 17. Oktober nach Prag zurück.
Sein Rücken ist mit Geschwüren übersät und auf seiner Haut hat sich ein sehr schmerzhafter Ausschlag gebildet. Zu allem Überfluss hat er auch noch eine verstauchte Zehe, von der sein Fuß stark angeschwollen ist. Nun liegt er auf seinem Kanapee, den Körper fest eingewickelt in einen Verband, den Fuß hochgestellt.
Aber es hilft alles nichts – er muss wieder seinen Dienst im Büro antreten. Und zu Hause findet er auch nicht die Erholung, die er so dringend nötig hätte. Die ganze Familie ist in Aufruhr wegen Ellis Hochzeit, die am 27. November stattfindet. Die alte und die neue Verwandtschaft kommt und tagelang ist die Wohnung in der Niklasstraße voll mit laut redenden und lärmenden Leuten. In seinem Zimmer geht es oft zu wie in einem Zigeunerwagen.
Kafka kommt es sehr gelegen, dass er noch zwei Wochen Resturlaub hat. Wenigstens einen Teil davon will er fern von Prag verbringen. Eine Woche nach Ellis Hochzeit fährt er alleine nach Berlin. Seltsamerweise findet er gerade in der lauten Großstadt Ruhe und Erholung. Das liegt nicht so sehr an den Theatern, die er besuchen kann, oder an den vegetarischen Restaurants, die er so schätzt. Vor allem fühlt er sich hier völlig frei. In Berlin ist er ein Fremder, ein Niemand, ohne eine Vergangenheit, die ihn immer wieder einholt, ohne eine Zukunft, die ihn mit ihren Erwartungen erdrückt.
Wenn er Abstand hat zu Prag, wird ihm bewusst, wie oft andere über sein Leben bestimmt haben. Er wollte sich nicht jahrelang durch die Schule quälen, immer in Angst davor, nun endgültig zu scheitern. Er wollte nicht Jura studieren und er wollte schon gar nicht als Beamter in einer Versicherungsgesellschaft arbeiten. Und trotzdem hat er immer gemacht, was von ihm erwartet wurde.
Voller Trotz hat er in sein Tagebuch geschrieben: Wenn ich es bedenke, so muss ich sagen, dass mir meine Erziehung in mancher Richtung sehr geschadet hat.8 Er dachte dabei an seine Lehrer, seine Kindermädchen, seine Eltern, an ein Mädchen im Tanzunterricht, an alle eben, die durch kleine oder große Verletzungen es verhindert haben, dass sich seine guten Eigenschaften entfalten konnten. Und Kafka hat ein gutes Gedächtnis, wenn es um solche Verletzungen geht.
Er erinnert sich auch noch sehr genau an die magere und spitznasige Köchin, die ihn jeden Morgen in die erste Klasse der Volksschule bringen musste. Immer drohte sie ihm, dem Lehrer zu sagen, wie böse er zu Hause gewesen sei. Der kleine Franz wusste nicht, ob sie nur Spaß machte oder nicht. Und er war auch unsicher darüber, ob er nun wirklich böse gewesen war oder nicht. Aber je näher sie der Schule kamen, desto größer wurde seine Angst. Er bettelte die Köchin an, nichts dem Lehrer zu sagen, er bat sie um Verzeihung, und schließlich klammerte er sich an Haustüren und Ecksteinen fest, um nicht zur Schule zu müssen. Die Köchin blieb unerbittlich und schleppte ihn vorwärts mit der Versicherung, dem Lehrer auch noch von seinem unmöglichen Benehmen auf dem Schulweg zu erzählen. In der Schule sagte sie dann doch nichts. Aber die Angst blieb, dass sie es vielleicht das nächste Mal tun würde. Die Drohung allein war ihre Macht.9
Normalerweise ist Franz Kafka immer der Erste, der sich durch Gegenargumente widerlegen lässt und seine Vorwürfe zurücknimmt. Aber dieses Mal, in seinem Tagebuch, blieb er hartnäckig, und er schrieb, dass außer meiner Erziehung auch diese Widerlegungen in manchem sehr geschadet haben.
Die zweite Woche seines Urlaubs verbringt Kafka zu Hause in Prag. Berlin hat ihn wieder locker gemacht für seine gewohnte Umgebung. Er ist in guter Stimmung, und er freut sich schon darauf, in den vor ihm liegenden acht freien Tagen sich ganz seinen Sachen widmen zu können. Nachteilig ist nur, dass sein Vater krank ist und zu Hause bleiben muss. Und Hermann Kafka ist kein ruhiger Patient. Sogar wenn er in seinem Bett liegt, hört Kafka durch die Schlafzimmertür, wie er hustet, niest und schnarcht und wie das Bett knarzt, wenn er sich umdreht.
Auch diese Unruhe in der Wohnung ist daran schuld, dass seine freien Tage nicht so verlaufen, wie Kafka sich das erhofft hat. Am Ende der Woche ist er verzweifelt und würde sich am liebsten unter dem Tisch verstecken, um nicht wieder ins Büro zu müssen. Er schreibt an Max Brod und klagt ihm sein Leid: Wenn links der Frühstückslärm aufhört, fängt rechts der Mittagslärm an, Türen werden jetzt überall aufgemacht, wie wenn die Wände aufgebrochen würden. Vor allem aber die Mitte des Unglücks bleibt. Ich kann nicht schreiben; ich habe keine Zeile gemacht, die ich anerkenne, dagegen habe ich alles weggestrichen, was ich nach Paris – es war nicht viel – geschrieben habe. Mein ganzer Körper warnt mich vor jedem Wort, jedes Wort, ehe es sich von mir niederschreiben lässt, schaut sich zuerst nach allen Seiten um; Sätze zerbrechen mir förmlich, ich sehe ihr Inneres und muss dann aber rasch aufhören.10
Max Brod macht sich Sorgen um seinen Freund, zumal sich sein Zustand auch im neuen Jahr nicht bessert. Er kann nicht verstehen, warum Kafka mit allem, was er zu Papier bringt, so unzufrieden ist. Er macht ihm den Vorschlag, die ersten Einfälle zunächst mal stehen zu lassen, um nach einer Weile vielleicht doch etwas daran zu finden, worauf er aufbauen kann. Für dich passt das, für mich nicht, meint Kafka darauf nur, das hieße, diesen falschen Gefühlen die Oberhand geben.
Brod kann auch nicht verstehen, warum es Kafka so schwer fällt, seinen Beruf und seine Schreiberei unter einen Hut zu bringen. Ihm selbst gelingt das recht gut. Er hat wieder etwas Neues geschrieben, ein Drama mit dem Titel Abschied von der Jugend, aus dem er Kafka vorliest, wenn sie im »Café Savoy« sitzen. Brod verdient durch seine Bücher durchaus einiges Geld, aber für ein Leben als freier Schriftsteller langt es bei weitem nicht. Und bei Kafka ist erst recht nicht daran zu denken. Trotzdem beharrt er darauf, dass sein Beruf und seine Schreiberei unvereinbar sind und er verloren ist, wenn er sich nicht vom Büro befreien kann.
Kafka hat sich sogar einen Zeitplan auferlegt. Jeden Abend will er von acht bis elf Uhr am Schreibtisch sitzen. Sehr strikt hält er sein Pensum nicht durch. Er verbringt viele Abende im Theater, im »Café Savoy«, im Kabarett »Lucerna« oder er sitzt im Kunstgewerbemuseum und liest Zeitschriften. Sonntags macht er lange einsame Spaziergänge ohne Ziel, bis weit vor die Stadt. Was Brod beunruhigt, ist, dass Kafkas Stimmung oft von einem Extrem ins andere kippen kann. In Gesellschaft ist er lustig und witzig und kurz darauf versinkt er in düstere Abwesenheit. Als ihn Brod einmal fragt, was ihm denn fehle, antwortet er: Nichts fehlt mir, außer ich selbst.11
III. Ein schlechter Sohn
Der Zug verlässt den Prager Bahnhof Richtung Norden. In einem der mit Holzbänken ausgestatteten Coupés sitzt der Konzipist der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt, Herr Dr. Franz Kafka. Kafka reist nicht privat, sondern er ist dienstlich unterwegs. In seiner Abteilung sind ihm die Industriegebiete im deutschsprachigen Nordböhmen zugeteilt, und er muss ab und zu die dort ansässigen Betriebe aufsuchen, um Vorträge zu halten und in Gesprächen die strittigen Einstufungen in Gefahrenklassen zu klären.
Kafka sieht sich die Mitreisenden in seinem Coupé genau an. Da ist ein magerer Mann mit abstehenden Ohren, der Essen ausgepackt hat. Schinken, Brot und Würste. Die Haut der Würste kratzt er mit einem Messer durchsichtig. Während er isst, liest er Zeitungen mit einer Hitze und Eile, die Kafka sympathisch ist, die er aber nie nachmachen könnte.
Auch ein anderer Mitreisender liest Zeitung. Er ist ein noch ganz junger, rotwangiger Mann. Als er mit dem Lesen fertig ist, faltet er die Zeitung sorgfältig zusammen, als wäre es ein Seidentuch, drückt die Kanten von innen ein, klopft das Papier wieder und wieder fest und steckt schließlich das kleine dicke Paket in seine Brusttasche.
Kafka kann nicht anders als diesen jungen Mann bewundern für die Sicherheit und Ordnung, die in seinem
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: