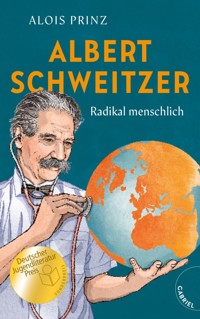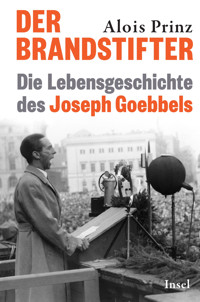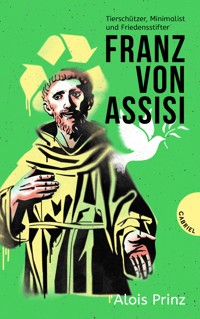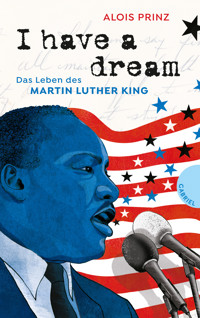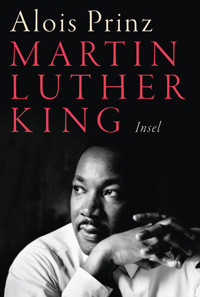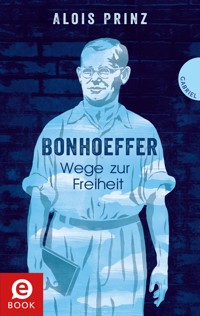11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Simone de Beauvoir kämpfte ihr Leben lang gegen Mythen, Vorurteile, Gewohnheiten. Dass man nicht als Frau zur Welt kommt, sondern dazu gemacht wird, ist der Satz, der sie berühmt gemacht hat. Doch Beauvoir ist selbst zum Mythos geworden: zur Ikone des Feminismus, zum Vorbild der modernen, emanzipierten Frau, zur Königin des Existentialismus, zur selbstbewussten Partnerin an der Seite Jean-Paul Sartres. Dabei wollte sie in ihrem Leben nichts verklären. Ihrer Überzeugung folgend, dass man nichts verheimlichen darf, alles offengelegen muss, hat sie sich nicht davor gescheut, auch Enttäuschungen und die dunklen Seiten ihrer Persönlichkeit zu zeigen. Simone de Beauvoir wollte vom Leben alles, Luxus und Entsagung, Stetigkeit und Wandel. Sie glaubte, dass wir Menschen an Hoffnungen und Versprechen festhalten müssen, die letztendlich unerfüllbar sind. Alois Prinz erzählt ihr Leben zwischen dem Verlangen nach Glück und der Treue zu einer Wirklichkeit, die keine Flucht erlaubt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Alois Prinz
Das Leben der Simone de Beauvoir
Mit zahlreichen Abbildungen
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des insel taschenbuchs 4950.
Erste Auflage 2022insel taschenbuch 4950© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2021Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Umschlagfoto: Jack Nisberg/Roger-Viollet/ullstein bild, Berlin
eISBN 978-3-458-77066-4
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Prolog
I Geworfen
II Löcher und Risse
III Vorbilder
IV Die Ruhelosen
V Freiheit
VI Die anderen
VII Amour fou
VIII Im kalten Licht
IX Ameise oder Mensch
X Wer ist mein Nächster?
XI Gefeiert und gehasst
XII Gesichter der Liebe
XIII Ein Fehler im System? Oder Rotwein und Coca-Cola
XIV Die schwarze Schranke
XV Sein Glück verteidigen
XVI Vorwärts leben
XVII »Hoch, Simone!« oder Bilder, überall
XVIII Knochen im Kopf
XIX Getäuschte Versprechungen?
Epilog Begegnungen mit Simone de Beauvoir
Quellennachweis
Prolog
I
Geworfen
II
Löcher und Risse
III
Vorbilder
IV
Die Ruhelosen
V
Freiheit
VI
Die anderen
VII
Amour fou
VIII
Im kalten Licht
IX
Ameise oder Mensch
X
Wer ist mein Nächster?
XI
Gefeiert und gehasst
XII
Gesichter der Liebe
XIII
Ein Fehler im System? Oder Rotwein und Coca-Cola
XIV
Die schwarze Schranke
XV
Sein Glück verteidigen
XVI
Vorwärts leben
XVII
»Hoch, Simone!« oder Bilder, überall
XVIII
Knochen im Kopf
XIX
Getäuschte Versprechungen?
Epilog Begegnungen mit Simone de Beauvoir
Verwendete Literatur
Werke von Simone de Beauvoir (nach dem Jahr der Erstveröffentlichung)
Artikel
Tagebücher
Briefe, Briefwechsel
Literatur von und zu Jean-Paul Sartre (Auswahl)
Literatur zu Simone de Beauvoir (Auswahl)
BILDNACHWEIS
Danksagung
Informationen zum Buch
Prolog
Am Morgen des 7. März 1944 rutscht der deutsche Hauptmann Ernst Jünger in Paris in der Avenue Kléber auf einer Apfelsinenschale aus. Er stürzt und verrenkt sich den Arm. Für den hochdekorierten Kriegshelden Jünger, der als Soldat schon auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs gekämpft hat, ist das ein peinlicher Ausrutscher. Aber Jünger ist nicht nur ein Soldat, er ist auch ein Dichter und Kunstliebhaber. Er stellt Überlegungen über den Zufall an. Als er nämlich kurz vorher sein Zimmer im Pariser Luxushotel Raphael verlassen hatte, fiel ihm auf der Treppe ein, dass er seine Schlüssel vergessen hatte, und er kehrte um. Hätte er seine Schlüssel nicht vergessen, wäre er eine Minute früher auf die Straße getreten und sicher nicht auf der Apfelsinenschale ausgeglitten. Jünger erschrecken solche Zufälle. Aber er ist kein Nihilist, der glaubt, dass alles nur Zufall sei. Er glaubt, trotz aller Zufälle, an ein Schicksal, an sein Schicksal. Ja, er sympathisiert sogar mit der religiösen Vorstellung von einer Vorsehung, die uns lenkt.1
Paris ist seit dem Juni 1940 von den Deutschen besetzt. Auf den Champs-Élysées, am Triumphbogen, auf dem Montmartre, im Invalidendom, in den Cafés und Restaurants – überall begegnet man den Deutschen in ihren feldgrauen und grünen Uniformen. Die deutsche Stadtkommandantur hatte an die Soldaten Stadtpläne verteilt mit allen Sehenswürdigkeiten und den Adressen von Bordellen, solchen für normale Soldaten und solchen für die »Herren Offiziere«. Ernst Jünger freilich findet man nicht an den üblichen Touristenorten. Er interessiert sich für das geistige Paris. Er besucht das Grab des Dichters Paul Verlaine, und er trifft sich mit Künstlern wie Jean Cocteau oder Pablo Picasso.
Mit der aufstrebenden Schriftstellerin Simone de Beauvoir trifft er sich nicht. Er kennt sie auch gar nicht. Und von einer neuen philosophischen Richtung des Existenzialismus hat er noch nie etwas gehört. Wenn der Zufall es wollte, dass sich die beiden begegneten, käme es vermutlich zu einer hitzigen Diskussion. Denn Simone de Beauvoir hasst die deutschen Besatzer, und sie hält nicht viel von Zufällen. Auch nicht von Schicksal und Vorsehung. Das sind für sie Konstruktionen, die man erfindet, um sich der Verantwortung für sein Leben zu entziehen. Wahrscheinlich würde sie Jünger für einen Ästheten halten, und Ästheten kann sie nicht ausstehen. Es sind für sie Menschen, die sich im Namen der Kunst oder der Dichtung über ihre Zeit stellen und daraus einen Genuss ziehen. Wirklichkeit wird für sie zu einem »Objekt der Betrachtung«. Echte Künstler dagegen stürzen sich für Beauvoir mitten ins Leben. Sie werden »ein Mensch unter Menschen« und teilen deren Glück und Leid.2 Befreit von Fremdbestimmungen, berufen sie sich nicht mehr auf Befehle, auf ein Ziel der Geschichte, auf die Verpflichtungen der Tradition, auf die Ehre einer Familie oder auf andere angeblich vorgegebene Werte. Sie nehmen ihre Freiheit ernst, und sie nehmen die Herausforderung an, jeden Augenblick ihres Lebens selbst entscheiden zu müssen, wer man sein will und wie man handelt.
Für Simone de Beauvoir sind solche Worte mit leidvollen Erfahrungen verbunden. Lange genug hat sie in Verhältnissen gelebt, in denen über sie bestimmt wurde. Lange genug war sie in einer Familie wie gefangen, in der sie vor lauter Vorschriften und moralischen Geboten schier zu ersticken drohte. Aus der »Tochter aus gutem Hause«, die täglich in die Kirche ging und lernte, wie man Knickse macht und sich in einer Teegesellschaft benimmt, ist eine andere geworden – eine Frau, die sich nicht mehr sagen lässt, wie sie sein soll, und der es gleichgültig ist, wenn anständige Bürger ihren Lebenswandel verurteilen. Sie würde zwar zugestehen, dass es Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können. Aber am wichtigsten ist es für sie, frei zu sein. Mit dem Einmarsch der Deutschen wurde ihr diese Freiheit genommen, oder zumindest eingeschränkt. Sie fühlte sich wie eine Sache im Spiel der Mächte und Kriegstreiber. Die Zukunft schien wie verstellt. Und eine Zukunft zu haben, das gehört zu einer Lebensform, die man jetzt »existenzialistisch« nennt.
Nun öffnet sich am Horizont wieder die Zukunft. Eine deutsche Niederlage scheint in Sichtweite. In Paris hat jemand eine Schnecke an die Wand gemalt, in den Farben der englischen und amerikanischen Flaggen, die an der italienischen Küste entlangkriecht. Englische und amerikanische Einheiten rücken unaufhaltsam auf Rom vor. Die Nachrichten verdichten sich, dass amerikanische Streitkräfte an der Westküste Frankreichs landen. Der Luftraum wird von den Alliierten beherrscht. Deutsche Städte wie Berlin, Hamburg und Köln sind verwüstete Steinlandschaften mit Tausenden von Toten. Auch Paris wird bombardiert. Ende April suchen die deutschen Offiziere im Raphael das erste Mal Schutz im Bunker unter dem Hotel. Nur Ernst Jünger nicht, der es vorzieht, im Bett zu bleiben. Beim nächsten schweren Bombardement begibt er sich sogar auf das Dach des Hotels und beobachtet, mit einem Glas Burgunder in der Hand, die brennenden Türme und Kuppeln. »Alles war Schauspiel«, schreibt er in sein Tagebuch, »war reine, von Schmerzen bejahte und erhöhte Macht.«3
Die Angriffe der Alliierten werden unterstützt von Anschlägen der französischen Widerstandsbewegung, der Résistance. Die Vergeltungsmaßnahmen der Deutschen werden immer menschenverachtender und sinnloser, je verzweifelter ihre Lage ist. Jedes Attentat auf die Besatzer wird mit der Erschießung von Geiseln beantwortet. Zur Abschreckung der Bevölkerung hängen an den Hauswänden und in den Gängen der Metro die Fotos von Widerstandskämpfern, die darauf »Terroristen« genannt werden und die »hingerichtet« wurden. Für Beauvoir sind es die Gesichter von Helden. Sie hat den Eindruck, dass die Deutschen bei ihren Racheaktionen völlig den Verstand verloren haben. In einem Brief, den man in Paris von Hand zu Hand reicht, wird geschildert, was sich in dem Ort Oradour-sur-Glane zugetragen hat. Die männlichen Bewohner waren von deutschen Soldaten zusammengetrieben und erschossen worden. Die Frauen und Kinder hatte man in die Dorfkirche gesperrt und das Gebäude angezündet. Wer zu fliehen versuchte, wurde erschossen. Flüchtlinge, die aus dem Süden nach Paris kommen, berichten von Kindern, die von den Deutschen an Fleischerhaken aufgehängt wurden.
Die sechsunddreißigjährige Simone de Beauvoir hat Kontakt zu Leuten der Résistance, ist aber keine aktive Widerstandskämpferin. Sie ist der festen Überzeugung, dass man durch Worte und Bücher auch Widerstand leisten kann. Obwohl ihr die Zukunft versperrt wurde, waren die Jahre des Krieges und der Besatzung doch keine verlorene Zeit. Sie hat ihr erstes Buch geschrieben, L'Invitée, deutsch: Sie kam und blieb. Und sie schreibt schon an einem zweiten. Außerdem hat sie ein Theaterstück verfasst, mit dem sie allerdings nicht sehr zufrieden ist. Simone ist nicht berühmt, noch nicht, aber man kennt jetzt ihren Namen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie die Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre ist. Sartre ist der aufsteigende Stern am literarischen und philosophischen Himmel. Er hat neben einem Roman und Theaterstücken ein dickbändiges philosophisches Werk verfasst, »L'Être et le Néant«, deutsch: »Das Sein und das Nichts«. Beauvoir und Sartre kennen sich schon seit Studienzeiten. Vor Jahren haben sie einen Pakt geschlossen. Sie wollten zusammenbleiben, ohne zu heiraten. Jeder sollte seine Freiheit behalten. Eine »notwendige Liebe« nennen sie das, im Unterschied zu einer zufälligen.
Für konservative Kreise in Paris ist dieses ungewöhnliche Paar ein Skandal. Skandalös ist es auch, dass Mademoiselle de Beauvoir aus dem Schuldienst entlassen wurde, weil sie angeblich ein intimes Verhältnis mit einer Schülerin hatte. Simone war nicht unglücklich darüber. Sie ist froh, den ungeliebten Beruf als Lehrerin endlich los zu sein. Sie schreibt jetzt Texte für den Rundfunk. Das interessiert sie nicht besonders. Sie wartet darauf, endlich als freie Schriftstellerin leben zu können. Denn das ist ihr Lebenstraum. Zu diesem Traum gehört es auch, unbürgerlich zu leben. Simone wohnt immer nur in Hotels. Zurzeit im Hotel Louisiane, in der Rue de Seine. Ihr Zimmer ist klein, kalt und ungemütlich. Die feuchten Wände sind rosa gestrichen und an der Decke sind hässliche Flecken. Ein Zimmer behaglich einzurichten, dazu fehlt ihr der Ehrgeiz. Auch Kochen mag sie nicht. Wenn möglich, isst sie in billigen Restaurants. Aber in Kriegszeiten ist die Versorgungslage schlecht. Und so bereitet sie sich in ihrem Zimmer notdürftig Nudeln oder Kartoffeln zu. Manchmal gibt es kein Gas und sie muss den Topf mit Zeitungspapier anheizen.
Die meiste Zeit verbringt sie in Cafés, denn dort ist es warm. Am liebsten sitzt sie im Café de Flore. Dort trifft sie auch ihre Freunde, die »Flore-Bande«. Seit Simone Bücher veröffentlicht, hat sich ihr Freundeskreis verändert. Viele Schriftsteller und Künstler suchen ihre Nähe. Zum Beispiel der Bildhauer Alberto Giacometti, an dessen Händen und Kleidern immer Gipsreste kleben. Simone bewundert ihn, weil er nur für seine Kunst lebt und Geld und Ruhm ihm gleichgültig sind. Er haust in einem Schuppen ohne Möbel und Vorhänge, mit Töpfen und Schüsseln am Boden, weil das Dach undicht ist und es hereinregnet. Seit kurzem kennt Simone auch den jungen Albert Camus. Simone mag ihn sehr, weil er so charmant ist und über Dinge und Menschen ohne Zorn und Eifer reden kann. Camus und seine Freunde drucken heimlich eine Zeitung der Résistance, immer ein Gewehr in Reichweite, falls sie von den Deutschen überrascht werden. Camus hat großen Erfolg gehabt mit einer schmalen Schrift, in der er unsere menschliche Situation vergleicht mit der antiken Gestalt des Sisyphos, der tagtäglich einen Stein auf einen Berg wälzt, der dann wieder hinunterrollt. Dessen Arbeit ist völlig sinnlos und trotzdem, so wird behauptet, müsse man sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das Leben, so wie es Camus darstellt, ist sinnlos, und trotzdem haben die Menschen ein Verlangen nach Sinn. Innerhalb der Absurdität des Daseins ergeben sich immer wieder Momente des Sinns, des Glücks.4
Dieses Bild trifft das Lebensgefühl der Zeit. Der Krieg hat alle widerlegt, die glauben, dass die Menschheit im Fortlauf der Geschichte klüger und kultivierter wird. Immer wieder gibt es Rückfälle in die Barbarei. Alle Anstrengungen, die Menschen zu verbessern, scheinen sinnlos. Gewalt, Unrecht, Krankheit und Tod, so könnte man glauben, behalten letztendlich doch die Oberhand. In Paris erleben die Menschen tagtäglich, wie schmal der Grat zwischen Leben und Tod, zwischen Sein und Nichts ist. Sie leben im Zustand ständiger Unsicherheit und Angst. Eine verirrte Kugel, ein falsches Wort können das Ende bedeuten. Nach der Sperrstunde, vor und nach Mitternacht, hört man die Schritte der Gestapo auf den Straßen. Jeder kennt einen Nachbarn, einen Freund, einen Bekannten, der abgeholt wurde und spurlos verschwand. »Sie haben ihn verhaftet«, flüstert man sich am nächsten Morgen zu, und jeder weiß, wer mit »sie« gemeint ist.5 Jeder kann der Nächste sein. Der Tod ist allgegenwärtig.
Und doch gibt es Menschen, die in dieser absurden Situation am Leben festhalten, ja, es feiern. Von manchen werden sie »Existenzialisten« genannt und sie verbinden damit verzweifelte, lebensmüde, gottlose und lustfeindliche Menschen. Simone und ihre Freunde beweisen das Gegenteil. Sie veranstalten große Feste. Sie treffen sich in einer Wohnung. Jeder bringt an Flaschen und Essen mit, was er nur irgendwie und irgendwo auftreiben konnte. Dann wird die ganze Nacht durchgefeiert. Es wird gegessen, getrunken, getanzt und gesungen. Es werden Gedichte deklamiert, kleine Theaterstücke improvisiert und Pantomimen aufgeführt. Keinem ist es peinlich, wenn er sich zum Narren macht und ausgelacht wird. Zwei gehen als Matador und Stier aufeinander los. Andere fechten mit Weinflaschen. Sartre dirigiert im Schrank ein unsichtbares Orchester. Und Camus schmettert auf Kochtöpfen einen Militärmarsch. Für Simone durchbrechen solche Feste den Alltag. Wer sich von der Lebenslust mitreißen lässt, der erlebt, dass der Tod in solchen Momenten keine Macht hat. Im Rückblick schrieb sie: »Ich war glücklich zu leben, und ich fand meine alte Gewissheit wieder, dass das Leben ein Glück sein kann und muss.«6
Dieses Leben kann schnell zu Ende sein. Beauvoir und Sartre erfahren, dass das Mitglied einer Widerstandsgruppe verhaftet wurde und Namen an die Deutschen verraten hat, vielleicht auch die ihren. Sie beschließen, eine Weile unterzutauchen, und fahren mit Bahn und Rad in einen Ort nördlich von Paris. Als sie erfahren, dass die Amerikaner schon Chartres erreichen, schwingen sie sich auf ihre Räder. Die Befreiung von Paris wollen sie auf keinen Fall versäumen. In Chantilly steigen sie in einen Zug, der schon nach kurzer Fahrt von einem Flugzeug beschossen wird. Simone wirft sich flach auf den Boden. Sie bleibt unverletzt, aber es gibt Tote und einer Frau wird das Bein abgerissen.
Ernst Jünger hat auf dem Montmartre einen letzten Blick auf die Stadt geworfen. »Die Städte sind weiblich und nur dem Sieger hold«, schreibt er in sein Tagebuch.7 Ob er weiß, dass auch für den Sieger von Paris nicht mehr viel übrig bleiben soll? Hitler hat befohlen, die Stadt bis auf den letzten Mann zu verteidigen und sie im Falle eines Rückzugs zu zerstören. An den Brücken über die Seine und an vielen Kulturstätten wie dem Eiffelturm, der Sacré-Cœur und an der Oper sind Sprengladungen angebracht. Jüngers Vorgesetzter, General Dietrich von Choltitz, wird den Befehl Hitlers nicht befolgen. Paris bleibt verschont. Aber immer noch weht die Hakenkreuzfahne auf dem Senatsgebäude. In der sommerheißen Stadt herrscht das blanke Chaos. Die sich zurückziehenden deutschen Soldaten schießen auf jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Von den Dächern herab feuern Scharfschützen auf wehrlose Passanten. Männer und Frauen laufen gebückt über Plätze oder kriechen auf allen vieren zu Hauseingängen. Ein alter Mann, der vor den Kugeln flieht und verzweifelt an eine Tür hämmert, die sich nicht öffnet, sackt tot zusammen.
Die Bewohner von Paris wollen nicht länger auf die alliierten Truppen warten und die Befreiung der Stadt selbst in die Hand nehmen. Von den Résistancekämpfern werden Frauen und Männer angewiesen, toten deutschen Soldaten die Gewehre, Pistolen und Munition wegzunehmen und sich damit zu bewaffnen. Barrikaden werden errichtet. Ein deutscher Lastwagen versucht, die Sperren zu durchbrechen, und fährt mit voller Geschwindigkeit durch eine Straße. Er wird beschossen, rast gegen die Eisengitter der Buchhandlung Perrin und geht sofort in Flammen auf. Ein deutscher Soldat, der aus dem brennenden Wagen krabbelt, wird von einem jungen Résistancekämpfer erschossen.8
Endlich, am Abend des 24. August 1944, rücken Einheiten der freien französischen Streitkräfte in Paris ein. Am nächsten Tag kapitulieren die Deutschen. Paris ist befreit. Die große Glocke von Notre-Dame läutet, gefolgt von den Glocken anderer Kirchen. Menschen singen die Marseillaise und rufen in Sprechchören »Libération!«. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre bummeln durch die Straßen, die überfüllt sind von festlich gekleideten Menschen. An jedem Haus hängt eine französische Fahne. Sogar auf dem Eiffelturm weht die Trikolore. Auf einer Straße wird ein Freudenfeuer entzündet. Simone und Jean-Paul reihen sich ein, als die Menschen sich an den Händen nehmen und singend um das Feuer tanzen. Simone hat das Gefühl, als hätte die Zeit zehn Jahre lang stillgestanden und als würden sich jetzt die Zeiger wieder vorwärts bewegen. Der Krieg hat für sie alles verändert. Sie spürt nun eine wunderbare Verbundenheit mit der Stadt und ihren Menschen. Auch sie hat sich verändert. Im Nachhinein ist für sie das Erlebnis der Befreiung »der beste Augenblick meines Lebens«9. Sie will nun die Enge ihres persönlichen Daseins überwinden und sich für die Belange ihrer Mitmenschen einsetzen. Kunst und Politik sollen keine Gegensätze mehr sein. Die Zukunft ist wieder offen. Alles ist möglich. In ihren Erinnerungen schreibt sie: »Die Welt und die Zukunft waren uns wiedergeschenkt, und wir stürzten uns hinein.«10
I
Geworfen
»Und Sie, Madame, sind Sie Existenzialistin?« Diese Frage stellt der Schriftsteller Jean Grenier Anfang 1943 im Café de Flore an Simone de Beauvoir und bringt sie damit in Verlegenheit.1 Denn sie weiß nicht, was mit dem Ausdruck »existenzialistisch« gemeint ist. Was sie weiß, ist, dass man die Lehren bestimmter Philosophen wie Martin Heidegger oder Søren Kierkegaard als »Existenz-Philosophie« bezeichnet und dass sich Jean-Paul Sartre auf diese beiden Denker beruft. Sartres philosophisches Werk, das ihn berühmt machen wird, ist noch nicht erschienen. Simone war an seinem Entstehen beteiligt. Sie hat ihn bestärkt, ihn kritisiert, über manche Fragen mit ihm lange diskutiert und sie hat das Manuskript wieder und wieder gelesen. Sie kann sich rückhaltlos der darin vertretenen Weltsicht anschließen. Sie hat sogar eine eigene Abhandlung über diese Ideen verfasst. Insofern könnte man sie durchaus als »Existenzialistin« bezeichnen.
Doch das ist nur ein Wort. Entscheidender ist, dass diese neue philosophische Richtung ein Lebensgefühl zum Ausdruck bringt, von dem sie von jeher erfüllt ist. Ja, es kommt ihr so vor, als hätte ihre ganze Lebensgeschichte sie auf diese Sichtweise vorbereitet. Mit Hilfe dieser Einsichten kann sie nun auch verstehen, was sie angetrieben hat und warum sie so geworden ist, wie sie ist. Hat sie nicht schon als Kind vertraut auf ihre Wünsche und ihren Eigensinn? Hat sie nicht mit zwölf Jahren beschlossen, nicht mehr an einen Gott zu glauben? War sie nicht schon als Teenager davon überzeugt gewesen, »dass es dem Menschen zusteht, und nur ihm allein, seinem Leben einen Sinn zu geben«?2 War sie nicht schon immer durchdrungen von dem Wunsch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen?
Ohne es zu wissen, war Simone eigentlich schon immer eine Existenzialistin. Nur kann sie jetzt ihr Verhalten verstehen und erklären. Mehr noch, sie hat aus ihren Erfahrungen eine Lehre entwickelt, von der sie glaubt, dass sie für die menschliche Wirklichkeit insgesamt gilt. Sogar ihre Geburt erscheint in dieser Lehre in einem besonderen Licht. Mit der Geburt beginnt für sie das »Drama eines jeden Existierenden«3. Dieses Drama besteht darin, dass jedes Kind hineingeboren oder, existenzialistisch ausgedrückt, »geworfen« wird in eine Welt, die ohne sein Zutun entstanden ist und die voller Erwartungen und Vorherbestimmungen ist. Gleichzeitig hat es einen natürlichen Drang, die Welt zu erforschen und eigene Bedürfnisse und Wünsche auszubilden. Das führt zu einem Konflikt, der schon in den ersten Kinderjahren zu spüren ist und der sich in späteren Jahren zu Kämpfen um die eigene Identität steigern kann.
Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir wird am 9. Januar 1908 in Paris geboren. Nach der erwachsenen Simone de Beauvoir sollten wir uns wundern, wie einfach und selbstverständlich für uns dieser Satz klingt.4 Denn wenn man genauer darüber nachdenkt, wie viele Zufälle zusammenkommen müssen, damit man geboren wird, kann einem schwindlig werden. Man müsste bis zum Anfang der Welt zurückgehen, um die unerschöpfliche Vielfalt der Verbindungen zu erfassen, von der die eigene Existenz abhängt. Das ist natürlich unmöglich. Es reicht schon, sich der langen Reihe der Vorfahren bewusst zu werden. Wie viele Wege mussten sich in den Geschichten dieser Familien kreuzen, welche politischen und gesellschaftlichen Ereignisse mussten auf sie einwirken, damit auch der eigene Vater, die eigene Mutter geboren werden konnten. Und wie viele Zufälle mussten mithelfen, damit sich die beiden begegneten, sich ineinander verliebten, heirateten und ein Kind zeugten.
Von außen betrachtet ist die eigene Geburt extrem unwahrscheinlich. Verstörend ist der Gedanke, dass man genauso gut hätte nicht geboren werden können. Niemand würde einen vermissen. Die Welt käme ohne einen aus. Die eigene Existenz ist nicht notwendig. Es gibt auch keine Berechtigung, auf die man sich berufen könnte. Man ist, so sagte es einmal Jean-Paul Sartre, wie ein Reisender in einem Zug, der kontrolliert wird und der keine Fahrkarte vorweisen kann.5 Trotz alledem ist man da. Und das erscheint einem ganz normal und alltäglich.
Mit Simones Geburt sind schon bestimmte Weichen für ihr Leben gestellt. Sie wird Französisch sprechen und in Paris aufwachsen. Sie ist nicht die Tochter von Handwerkern oder Bauern, sondern von Angehörigen der bürgerlichen Mittelschicht und also sozial privilegiert. Aller Voraussicht nach wird sie in bescheidenem Wohlstand, in einem städtischen Milieu aufwachsen, eine behütete Kindheit haben, eine gute Schulausbildung erhalten und irgendwann standesgemäß heiraten und Kinder haben.
Schon die Vornamen, die man ihr gibt, sind ein Teil der Welt, in die sie »geworfen« wird, Namen, mit denen Erwartungen verbunden sind. Auf »Simone« bestand der Vater, weil er sich von der Tradition abheben wollte und seine Tochter einen modernen Vornamen haben sollte. »Lucie« heißt die fromme Großmutter mütterlicherseits. »Ernestine« ist die weibliche Form von Ernest, dem Großvater väterlicherseits, der für den weit zurückreichenden Stammbaum der Familie Bertrand de Beauvoir steht. Und »Marie« verweist auf die Jungfrau Maria und die Nähe zur katholischen Kirche, die vor allem für die Mutter wichtig ist.
Françoise Brasseur, wie sie vor ihrer Heirat hieß, war in einer Klosterschule in ihrer Heimatstadt Verdun erzogen worden. Für sie ist es selbstverständlich, dass ihr erstes Kind im Geist der katholischen Kirche aufwachsen soll. Sie hat sich auch schon Broschüren besorgt, in denen genau beschrieben wird, wie eine junge katholische Mutter sich zu verhalten hat. Mit ihrer Einstellung steht Françoise de Beauvoir, wie sie jetzt heißt, gegen die gesellschaftliche Entwicklung in Frankreich. Seit drei Jahren regelt ein Gesetz die strikte Trennung von Kirche und Staat. Das richtet sich in erster Linie gegen den Einfluss der katholischen Kirche. Es gibt jetzt in staatlichen Schulen keinen Religionsunterricht mehr. Es wird keine Kirchensteuer erhoben und Ordensgemeinschaften sind aufgelöst.
Von alledem weiß die kleine Simone freilich nichts. Auch nicht, dass das Land, in das sie »geworfen« wird, vor fast vierzig Jahren einen Krieg gegen Deutschland verloren hat und durch die Reparationszahlungen an die Sieger in der wirtschaftlichen Entwicklung zurückgeworfen wurde. Für das nationale Selbstbewusstsein war es eine Genugtuung, dass die große Weltausstellung im Jahr 1900 nicht in Deutschland, das sich auch beworben hatte, sondern in Paris stattfand. Eine Bilanz des vergangenen Jahrhunderts wollte man den Besuchermassen darbieten und ihnen gleichzeitig einen Blick in eine fantastische Zukunft ermöglichen, in eine durch die Elektrizität völlig veränderte Welt, in der alles »per Knopfdruck« funktioniert. Die Besucher konnten auf Rolltreppen fahren, was bei manchen Übelkeit und Schwindelgefühle hervorrief. Die Pariser Nächte wurden von »elektrischen Sonnen« taghell erleuchtet und sogar der Eiffelturm war mit Tausenden von Glühlampen dekoriert. Diese spektakuläre Leistungsshow veränderte nachhaltig das Gesicht der französischen Hauptstadt. Neue Gebäude entstanden, das Verkehrsnetz wurde ausgebaut, und anlässlich der Weltausstellung wurde das neue U-Bahn-System, die Metro, eröffnet, mit der zehn Kilometer langen Strecke nach Vincennes.
Paris ist noch nicht der Lebensort für Simone de Beauvoir. Die Welt ist für die kleine Simone die elterliche Wohnung am Boulevard du Montparnasse, direkt über dem Café La Rontonde und gegenüber dem Café Dôme. Von der Wohnung nimmt Simone nur die Farben wahr, den roten Teppichboden, die roten Plüschvorhänge, die dunklen, schweren Möbel und den Flügel im Salon. Rot ist Wärme, Schwarz dagegen etwas, das auch Angst machen kann. Das schwarze, bauschige und steife Kleid der Mutter ist wie ein Hindernis, wenn Simone versucht, sie zu umarmen. Freundlich und weiß dagegen ist ihr Kinderbett im Zimmer von Louise. Sie ist das Dienstmädchen. Wie in allen großbürgerlichen Familien macht sie nicht nur den Haushalt, sondern ist auch für die Kinder zuständig. Simone schläft in Louises enger Kammer, sie wird von ihr gefüttert und von ihr im Kinderwagen im Park spazieren gefahren. Die Mutter ist von solchen Arbeiten befreit. Ihre Aufgabe ist es, über die Erziehung zu wachen und die Familie nach außen zu repräsentieren, besonders bei den Gesellschaften, die im Salon stattfinden.
Für Simone wie für alle Kinder in diesem Alter sind die Eltern »Götter«6. Sie sind das Maß aller Dinge. Ihnen kann man sich bedingungslos hingeben. Sie bestimmen, wer man ist. Schon ein Blick kann einem mitteilen, ob man etwas falsch oder richtig gemacht hat. Und durch Lob oder Tadel lernt ein Kind, was gut und was böse ist. In dieser Hinsicht ist Françoise de Beauvoir Simones großes Vorbild. Sie hat feste Grundsätze und gestaltet danach den Alltag ihres Kindes. Sobald Simone gehen kann, nimmt die Mutter sie mit in die Kirche Notre-Dame-des-Champs und zeigt ihr dort alle Bilder des Jesuskindes und der Jungfrau Maria. Einen Engel, der wie Louise aussieht, bestimmt sie zu Simones persönlichem Schutzengel. Zu Hause wird zweimal am Tag gebetet. Und wenn die Mutter sie darin unterweist, wie ein Mädchen aus gutem Hause sich zu benehmen hat, haben diese Verhaltensregeln auch etwas von göttlichen Geboten.
Der Vater ist für Simone eine undeutliche Figur. Morgens verlässt er das Haus mit einer Aktenmappe unter dem Arm. Abends kommt er wieder, und bevor Simone von Louise ins Bett gebracht wird, spielt er mit seiner kleinen Tochter, er singt ihr Lieder vor oder zaubert aus ihrer Nasenspitze ein kleines Geldstück hervor. Obwohl der Vater tagsüber nicht da ist und oft auch abends nicht nach Hause kommt, hat er in der Wohnung sein eigenes Zimmer. Er nennt es sein »Büro«. Schränke mit vielen Büchern stehen darin und ein riesiger Schreibtisch. Simone krabbelt oft darunter und fühlt sich dann geborgen wie in einer dunklen Höhle.
Georges Bertrand de Beauvoir, wie er sich nennt, geht jeden Morgen in das Palais, in den Justizpalast, oder in die Kanzlei, bei der er angestellt ist. Er ist Anwalt, aber seinen Pflichten geht er nur ungern nach. In seinem Element ist er, wenn er vor Gericht einen seiner Mandanten verteidigen darf. Dann fühlt er sich wie auf einer Bühne und kann sein theatralisches Talent ausleben. Georges wäre gern Schauspieler geworden, aber das war mit dem Ruf seiner Familie nicht vereinbar. Die Beauvoirs entstammen zwar nur dem niederen Adel, aber es gehört zum Selbstverständnis der Familie, ein möglichst aristokratisches Leben ohne einen Brotberuf zu führen. Georges' Vater Narcisse Bertrand de Beauvoir hätte ohne weiteres von seinem geerbten Vermögen leben können. Dass er bis zu seiner Pensionierung eine Stelle im Rathaus von Paris innehatte, ist eher seinem Pflichtbewusstsein und seiner Abneigung gegen nutzlose Müßiggänger zuzuschreiben. Sein eigentliches Leben führte er auf dem Landgut Meyrignac, wo er viele Stunden in seinem geliebten Garten verbringen konnte. In der luxuriösen Wohnung der Beauvoirs in Paris war Georges als jüngstes von drei Kindern aufgewachsen. Da sein älterer Bruder, Gaston, das Landgut des Vaters erben würde und seine Schwester für ihre Heirat mit einem Landadligen eine beträchtliche Mitgift benötigte, blieb für Georges nur ein kleines Erbe übrig. Er musste studieren und Jurist werden. Das reizlose Leben eines biederen Beamten zu führen, das konnte und wollte er nicht. In seiner Freizeit verkehrte er in den Salons und Varietés der Stadt, er galt als charmanter, gebildeter Unterhalter und Frauenheld und spielte leidenschaftlich gern bei Aufführungen von Laienschauspielern mit. »Nur im Salon und auf dem Parkett fühlte er sich wohl«, meinte Simone de Beauvoir später.7
Georges ging schon auf die dreißig zu, als sein Vater ihn drängte, endlich zu heiraten. Eine Agentur, die man beauftragte, fand eine sehr gute Partie für ihn: Françoise Brasseur aus Verdun. Die junge, zwanzigjährige Frau war nicht nur schön, sie kam aus einer reichen Familie. Der Vater, Gustave Brasseur, war ein angesehener Bankier. Irritiert war Georges nur von der Frömmigkeit und den starren moralischen Grundsätzen seiner zukünftigen Frau, aber angesichts ihrer Schönheit und der zu erwartenden Mitgift konnte er darüber hinwegsehen. An Silvester 1906 wurde geheiratet. Zwei Jahre später bekam das junge Paar sein erstes Kind: Simone.
Nun ist Georges de Beauvoir also ein Ehemann und Vater. Das ist nicht das Leben, das er sich erträumt hat, aber es hat auch Vorteile. Er hat eine junge, schöne Frau und eine reizende kleine Tochter. Und wenn er morgens die Wohnung verlässt, dann kann er das in der Hoffnung tun, dass er vielleicht schon bald nicht mehr zur Arbeit zu gehen braucht und sich den schönen und angenehmen Seiten des Lebens widmen kann. Die reiche Aussteuer, Möbel und Hausbedarf, hat Françoise schon nach Paris mitgebracht und mit der versprochenen Mitgift, sicher eine stattliche Summe, rechnet er jeden Tag.
Aus Verdun kommt im Sommer 1908 tatsächlich eine Nachricht. Es ist nicht die erhoffte frohe Botschaft, sondern ein verzweifelter Notruf. Françoise' Mutter Lucie und ihre Geschwister Hubert und Marie-Thérèse müssen weg aus Verdun und wollen nach Paris kommen. Die fassungslose Françoise erfährt erst allmählich, was geschehen ist. Die Bank ihres Vaters musste Bankrott anmelden, das Haus und das Vermögen der Familie wurden beschlagnahmt. Gustave Brasseur sitzt in Untersuchungshaft und seine Frau und seine Kinder müssen Verdun verlassen. Es ist ein riesiger Skandal und eine Katastrophe für die Familie Brasseur. Wenn Françoise darüber sprechen muss, bricht sie in Tränen aus. Glück im Unglück ist es immerhin, dass ihrem Vater eine längere Gefängnisstrafe erspart bleibt und er nach einem Jahr freikommt. Gustave Brasseur zieht mit seiner Frau und seiner Tochter nach Paris, in eine Wohnung nicht weit entfernt von der Familie Beauvoir. Anfangs stehen immer wieder Leute vor der Tür, die durch ihn ihr Geld verloren haben. Allmählich jedoch beruhigt sich die Lage und Gustave kann darangehen, sich eine neue Existenz aufzubauen. Trotz seines Bankrotts hält er sich für ein Finanzgenie, und er ist überzeugt davon, dass er durch einen großen Coup wieder ein reicher Mann werden wird.
Georges de Beauvoir hält nicht viel von den großartigen Ideen seines Schwiegervaters. Er muss sich damit abfinden, dass es mit der versprochenen Mitgift nichts wird und er weiter arbeiten muss. Diese Enttäuschung belastet auch seine Ehe. Er liebt seine Frau, aber er kann nicht vergessen, dass er sie auch aus finanziellen Gründen geheiratet hat und sich nun getäuscht fühlt. Und Françoise muss mit der Scham leben, einen verurteilten Betrüger zum Vater zu haben, und mit dem schlechten Gewissen, mit schuld zu sein an den zerstörten Hoffnungen ihres Ehemannes. Zu allem Überfluss ist sie wieder schwanger. Am 9. Juni 1910 bringt sie ihr zweites Kind zur Welt. Es ist ein Mädchen, Henriette-Hélène. »Gottes Wille geschehe«, kommentiert der Großvater Gustave, der sich einen Jungen als Enkelkind gewünscht hat, diese Geburt.8 Der Vater Georges weiß jetzt schon, dass er seinen zwei Töchtern nicht viel Geld wird hinterlassen können. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, werden sie selbst für ihren Unterhalt sorgen müssen oder froh sein, wenn sie einen Mann finden, der sie ohne Mitgift nimmt. Wenn sie alt genug sind, wird er ihnen diese traurige Wahrheit sagen.
Simone ist von all diesen Problemen unbehelligt. Ihre Eltern und Louise sind für sie weiterhin »übernatürliche Wesen«9, an deren Verhalten und Werten es nicht den geringsten Zweifel gibt. Ihre Welt hat sich nun erweitert. Sie hat eine kleine Schwester und Großeltern und eine Tante, die ganz in der Nähe wohnen. Jeden Donnerstag wird Simone zu den Großeltern gebracht und darf bei ihnen zu Mittag essen. Ihre Wohnung ist mit Möbeln, Bildern, Teppichen und allem möglichen Plüsch vollgestopft wie der Laden eines Antiquitätenhändlers. Sie darf auf der Schuhspitze des Großvaters reiten, und die Großmutter verwöhnt sie mit gebratenen Klößen und Pudding. Die beiden Alten sind ganz vernarrt in ihr Enkelkind, das so neugierig und temperamentvoll ist. Auch zu Hause lebt Simone ihre Launen, Freuden und Tränen unbesorgt aus. Auf ihre kleine Schwester ist sie nicht eifersüchtig. Sie ist froh, dass sie nun eine Spielkameradin hat, und von Anfang an ist klar, dass die kleine »Poupette«, wie sie alle wegen ihres puppenhaften Aussehens nennen, im Schatten ihrer großen Schwester steht.
Simone ist ein sehr lebhaftes Mädchen, und es stört sie, dass die Erwachsenen sie nicht für voll nehmen, nur weil sie körperlich noch unausgereift ist. Sie weiß nicht, wie sie es sagen soll, will aber den Erwachsenen begreiflich machen, dass auch ein Kind von wenigen Jahren schon eine eigene Person ist. Die erwachsene Simone hat sich an diese Erfahrung erinnert und behauptet, dass jedes Kind sich in einer zwiespältigen Lage befindet. Es nimmt die Werte der Eltern und Erzieher ohne Vorbehalte hin und gleichzeitig hat es schon eine eigene Vorstellung von sich selbst und entwickelt eigene Vorlieben und Eigenschaften. Das führt zu Widersprüchen, auf die es dann auf eine Art und Weise reagiert, die für Erwachsene oft unverständlich, ja ärgerlich ist.
Simone, die sonst ein »vergnügtes kleines Ding«10 ist, gibt ihren Eltern, Louise und den Verwandten Rätsel auf, weil sie manchmal wie aus heiterem Himmel einen Wutanfall bekommt. Sie wirft sich kreischend auf den Boden, windet sich wie eine Besessene und strampelt mit den Beinen. Oder sie hält die Luft an, bis ihr Gesicht violett anläuft. Einmal im Park ist sie ganz vertieft darin, Sandkuchen zu backen, als Louise ihr die kleine Schaufel wegnimmt und sie nach Hause bringen will. Simone, die aus dem Spiel gerissen wird, versteht absolut nicht, warum sie jetzt nach Hause muss. Sie stürzt von der »Fülle ins Leere«, bekommt einen Wutanfall und schreit so laut, dass alle Leute besorgt zu ihr hinsehen. Eine alte Dame, die denkt, dass sie geschlagen worden ist, will sie trösten. Als sie ihr ein Bonbon gibt und übers Haar streicht, gibt Simone ihr einen Fußtritt.11 Wenn Simone einen ihrer Wutanfälle hat, ist sie nicht zu bändigen und schon gar nicht zu beruhigen.
Es hilft auch nicht, dass man sie ausschimpft oder sie in die Besenkammer sperrt. Sie macht darin einen Höllenlärm, schreit wie am Spieß und schlägt mit den Füßen gegen die Tür. »Simone ist eigensinnig wie ein Maulesel«, sagt ihr Vater resignierend.12 Schon gar nicht kann sie es ausstehen, wenn Erwachsene sie herablassend behandeln. Wenn ihre Großmutter sie beim Kartenspiel gewinnen lässt oder der Großvater beim Essen mit seinem Glas gönnerhaft mit ihr anstoßen will. Dieses »herablassende Getue«13 kommt ihr unaufrichtig vor. Sie hat dann das Gefühl, dass die Erwachsenen ihre Arglosigkeit ausnutzen wollen, um sie zu beeinflussen.
Abgesehen von ihren Wutausbrüchen ist Simone ein kleines braves Mädchen. Ihr Vertrauen darauf, dass die Eltern alles richtig machen und sie unter dem »Schutzdach«14 der Familie vor allem Bösen bewahrt wird, ist unerschütterlich. Einverstanden ist sie natürlich auch damit, dass sie, die mittlerweile Fünfjährige, in eine besondere Schule gehen soll, in die Privatschule Cours Désir, benannt nach ihrer Gründerin Adeline Désir. Dass die Wahl dieser Schule auch mit der veränderten Situation der Familie zusammenhängt, ahnt sie nicht. Obwohl das Einkommen ihres Vaters ziemlich bescheiden ist, hält er an den Ansprüchen einer großbürgerlichen Familie fest. Eine staatliche Schule kommt nicht infrage. Eine Klosterschule ist zu kostspielig. Den Cours Désir kann sich Georges leisten, und vor allem ist ihm wichtig, dass diese Schule nur Mädchen aus vornehmen Familien aufnimmt. Sie sollen nicht mit den Kindern unterer Schichten in Berührung kommen. Und für die Mutter ist ausschlaggebend, dass die Schule eine katholische Einrichtung ist und Simone eine religiöse Erziehung erhält. Außerdem dürfen die Mütter im Unterricht anwesend sein.
Seit dem Skandal in ihrer Familie ist Françoise noch mehr darauf bedacht, alles richtig zu machen und nach außen das Bild einer makellosen Familie zu bieten. Ihre größte Angst ist es, dass eines ihrer Kinder, vor allem Simone, aus diesem Bild ausbrechen könnte. Am liebsten würde sie Simone keine Sekunde aus den Augen lassen. Noch muss sie sich keine Sorgen machen. Simone ist eine gehorsame Tochter und auf dem besten Weg, eine kleine Heilige zu werden. Doch irgendwann werden diese Bilder, die ihr Vater und ihre Mutter von sich und der Familie aufrechterhalten wollen, Risse bekommen. Les belles images wird einmal eines der Bücher von Simone de Beauvoir heißen: Die schönen Bilder. Hat sie schon als Kind gemerkt, dass mit diesen Bildern, die ihre Familie von sich entwirft, irgendetwas nicht stimmt? Als erwachsene Frau wird sie sich erinnern, dass sie gegenüber ihren Eltern immer ein seltsames Gefühl hatte: »[N]ichts war völlig wahr […]. Und ich wünschte doch so sehnlichst, die Welt in Freiheit zu sehen …«15
II
Löcher und Risse
»Ich fange jetzt mit etwas ganz anderem an«, schrieb die fast neunundvierzigjährige Simone de Beauvoir am 1. Januar 1957 an ihren Geliebten, den Schriftsteller Nelson Algren in Chicago, »Kindheits- und Jugenderinnerungen, wobei ich versuche, nicht nur zu erzählen, sondern zu erklären, wer ich war, wie ich die Person geworden bin, die ich bin, im Zusammenhang mit der Lage, in der sich die Welt, in der ich lebte, befand und befindet. Es ist interessant, die Sache zu versuchen, auch wenn es mir nicht gelingen sollte, sie zu vollenden.«1
Der Versuch gelang. Es entstand nicht nur ein Buch, sondern vier Bände, insgesamt fast dreitausend Seiten. Diese Schriften gehören zu den »umfangreichsten individuellen Lebensdokumentationen des 20. Jahrhunderts«2. Angesichts dieser ungeheuren Fülle an autobiographischem Material kann man sich fragen, warum man das Leben der Simone de Beauvoir noch einmal erzählen will. Hat sie es nicht besser und vor allem ausführlicher gemacht, als man es je könnte? Läuft man nicht Gefahr, nur zu wiederholen, was schon gesagt ist? Soll man ihre Deutung ihres Lebens übernehmen oder daran zweifeln?
Beauvoir hat einmal bekannt, den Wunsch gehabt zu haben, dass ihr ganzes Leben bis auf das kleinste Detail auf einem »gigantischen Magnetophon« aufgezeichnet werde.3 Später hat sie von dieser Vorstellung Abschied genommen. Was wäre denn auch eine solche Aufzeichnung im Maßstab 1:1 anderes als ein Durcheinander, ein Nebeneinander von Wichtigem und Belanglosem, Zufälligem und Gewolltem. Ein Abbild ihres Lebens wäre das nicht. Es fehlte die ordnende Hand, die Auswahl nach wichtig und unwichtig, bedeutend und bedeutungslos. Beauvoir musste sich also an die Aufgabe machen, ihr Leben zu beschreiben. Indem sie es in Sätze fasste, fand sie Zusammenhänge und gab ihm eine »klar umrissene Realität«4, die das Leben so nicht hat. Sie schuf also etwas Künstliches, aber es war für sie die einzige Möglichkeit, ihr Leben zu erfassen und es zu verstehen. Ebenso stellt jeder weitere Versuch, Beauvoirs Leben zu erzählen, eine kreative Verarbeitung eines vorhandenen Materials dar, mit neuen Fragen, anderen Blickwinkeln, veränderten Schwerpunkten, vorher nicht gewonnenen Erkenntnissen. Es ist eine Annäherung an eine Wahrheit, die man nie erreicht.
Simone sitzt in dem kleinen, dunklen Klassenzimmer des Cours Désir. Ihr Blick ist beflissen auf Mademoiselle Fayet gerichtet, die Lehrerin der ersten Klasse. Sie trägt einen bodenlangen Rock, eine Bluse mit steifem Kragen und eine schwarze Krawatte. Mademoiselle Fayet legt Wert darauf, dass sie nicht als Lehrerin angesehen wird, sondern als Erzieherin. Und die Erziehung richtet sich nach den Grundsätzen der katholischen Kirche. Gutes Benehmen und Fleiß sind wichtiger als Wissen. Im hinteren Teil des Klassenzimmers sitzen die Mütter der Mädchen auf Stühlen, strickend und stickend. Natürlich ist auch Françoise de Beauvoir darunter. Sie ist sehr stolz auf ihre Tochter, die sich in kurzer Zeit zur besten Schülerin entwickelt hat. Nicht nur fällt ihr das Lernen leicht, sie ist auch in ihrer Frömmigkeit ein Vorbild für die anderen. Vor dem Unterricht geht Simone mit ihrer Mutter in die Frühmesse, nachmittags machen sie zusammen die Hausaufgaben, und abends hält Françoise eine Gebetsstunde. Zweimal in der Woche versammelt Mademoiselle Fayet die Schülerinnen um einen großen Tisch und die Mütter geben ihren Töchtern dann Noten für ihr alltägliches Benehmen, die Mademoiselle Fayet in ein Buch einträgt. Françoise gibt ihrer Tochter immer eine Zehn, das ist die Bestnote. Etwas anderes käme für sie und auch für Simone nicht infrage. Die beiden sind verbunden in einer »frommen Gemeinsamkeit«5 – zum Leidwesen von Hélène, die sich angesichts dieser innigen Beziehung ihrer Mutter zu Simone wie ausgeschlossen vorkommt.
Von den Nöten ihrer kleinen Schwester merkt Simone nichts. Sie steht im Mittelpunkt, und Hélène fügt sich in die Rolle, die Simone ihr zuteilt. In ihren Spielen ist sie die Lehrerin und bringt ihrer kleinen Schwester Lesen und Schreiben bei. Die Familie ist für Simone ein Hort der absoluten Sicherheit. In dieser Welt ist alles geordnet und man weiß, was gut und was böse ist. Vor allem weiß man, dass man zu den guten Menschen gehört und dass man sich von bestimmten Leuten fernhalten muss.
Auch für ihre Mutter ist ein harmonisches Familienleben das Wichtigste. Die Erziehung der Kinder ist ganz ihr überlassen. Georges mischt sich nur selten ein. Françoise will ihre Aufgaben so gut wie möglich erfüllen. Und es ist eine Bestätigung für sie als gute Mutter, dass Simone so fleißig ist, ihrer Erziehung so bereitwillig folgt, nicht mehr launisch ist und auch keine Wutanfälle mehr hat. Simone ihrerseits hat ein übersensibles Gespür dafür entwickelt, ob ihre Mutter mit ihr zufrieden ist oder nicht. Ein Satz wie »Das ist ja lächerlich!«6 oder kleine Gesten der Enttäuschung können sie in die größte Unsicherheit stürzen und ihren Ehrgeiz, der Mutter zu gefallen, noch steigern. Ratlos ist Simone allerdings dann, wenn ihre Mutter ohne erkennbaren Grund die Fassung verliert, wenn sie zornig ist oder schreit. Das sind Momente, in denen etwas Fremdes an der Mutter aufblitzt, und das macht Simone Angst. Solche Momente werden immer häufiger, als die historischen Ereignisse die Verhältnisse der Familie Beauvoir durcheinanderbringen.
Am 3. August 1914 erklärt Deutschland Frankreich den Krieg und deutsche Truppen marschieren in Belgien ein. Das ist der Auftakt zum Weltkrieg, den man später den Ersten nennen wird. Simone ist mit ihrer Schwester auf dem Landgut Meyrignac des Großvaters, als die Meldung eintrifft und die Landgesellschaft in helle Aufregung versetzt. Simone kann sich unter »Krieg« nicht mehr vorstellen, als dass in solchen Zeiten die Menschen einander umbringen und die Gefahr besteht, dass Fremde in Frankreich eindringen. Was sie allerdings schnell lernt, ist, dass Krieg die Menschen um sie her in eine patriotische Stimmung versetzt. Und sie begreift, dass sich ihr hier eine Rolle bietet, die ihr noch mehr Anerkennung und Bewunderung einbringt.
Zurück in Paris, wird aus Simone eine glühende Patriotin. Die Deutschen sind für sie nur mehr »boches«, ein eigentlich unübersetzbares Wort, das so viel heißt wie »Holzköpfe«. Sie lässt sich von der Mutter einen kleinen Militärmantel schneidern und sammelt auf der Straße in dieser patriotischen Aufmachung für die belgischen Flüchtlinge. Mit Buntstiften schreibt sie »Vive la France!« auf die Mauern und trampelt auf einer Puppe herum, die allerdings ihrer Schwester gehört, nur weil darauf »Made in Germany« steht.7 Sie ist auch sehr stolz darauf, dass ihr Vater ein Soldat wird. Georges de Beauvoir ist zwar sehr national gesinnt, aber dass er nun sein Vaterland verteidigen soll, darüber ist er alles andere als glücklich. Er hat nämlich von Geburt an einen Herzfehler und hat fest damit gerechnet, daher dem Kriegsdienst zu entgehen. Gerade hat er noch auf der Bühne einer Laienspieltruppe brilliert, und nun soll er in Uniform auf Menschen schießen. Diese Rolle gefällt ihm gar nicht. Im Oktober wird er sogar an die Front versetzt, wo er prompt einen leichten Herzinfarkt erleidet. Nachdem er sich im Lazarett wieder erholt hat, schickt man ihn zurück nach Paris und weist ihm eine Stelle im Kriegsministerium zu. Jetzt ist er zwar außer Gefahr und mit der Familie vereint, aber seine Besoldung als Obergefreiter ist niedrig, und damit soll er das anspruchsvolle Leben seiner Familie bestreiten. Noch kommt er über die Runden, weil sein Vermieter keine Miete verlangt, solange Georges dem Vaterland dient. Aber seine finanziellen Reserven schmelzen dahin, und sein einziger Trost ist, dass er Geld in Aktien angelegt hat, wo es sich sicher vermehren kann.
In ihren Memoiren hat die erwachsene Simone de Beauvoir wenig Sympathie für das Kind Simone. Wie ein »kleiner Affe«8 kommt sie ihr in der Rückschau vor, wie ein artiges, überangepasstes Kind, das nach der Pfeife der Erwachsenen tanzt. Dabei ist ihr natürlich bewusst, dass sie mit dem Blick einer erwachsenen Frau auf dieses Kind schaut. Und sie weiß auch, dass das Verhalten der kleinen Simone ganz natürlich und verständlich ist. Wie jedes Kind sucht Simone ihren Platz in der Welt. Sie will gesehen und anerkannt werden. Aber da sie noch kein eigenständiges Selbstbewusstsein entwickelt hat, übernimmt sie das Bild, das die Erwachsenen von ihr haben. Sie sieht sich mit den Augen ihrer Eltern, von Louise und ihrer Lehrerin Mademoiselle Fayet. Alle vermitteln ihr, wie sie sein soll. Und zwischen der Simone, wie sie sein soll, und ihrer eigenen Vorstellung von sich selbst gibt es keinen Unterschied. Ihre Freiheit besteht sozusagen darin, das Bild von sich anzunehmen, das man ihr zuweist. »Man hat mich dazu erzogen, das, was sein soll, mit dem zu verwechseln, was ist«, schreibt Simone de Beauvoir im Rückblick.9
Dabei kommt es dem Kind Simone überhaupt nicht in den Sinn, dass ihre Eltern, Louise oder ihre Lehrerin anders sein könnten, als sie sind. Deren Verhalten, deren Werte sind absolut. Sie verkörpern die Wahrheit, sind unfehlbar. Und so lernt Simone, dass sie zu einer Elite der Guten gehört, für die Bildung und gute Sitten mehr wert sind als Geld. Sie lernt, dass der Blick Gottes immer auf sie gerichtet ist, dass er jede kleinste Verfehlung sieht, aber auch in der Beichte alle Sünden wieder wegwischen kann. Sie lernt von ihrer Mutter, dass Frauen, die sich schminken oder ihre Haare färben, »gewöhnlich« sind und der nackte Körper etwas Gefährliches ist und zur Sünde verführt. Zu Hause und im Cours Désir lernt sie, dass sie sich als Mädchen zurücknehmen muss und ihr zukünftiges Glück darin besteht, dass einmal ein Mann sie heiratet, der sie liebt und dem sie gehorchen muss. Das alles lernt Simone. Und alles Gelernte bildet eine feste, klare Welt, in der sie ihren Platz hat, geliebt und bewundert wird. Für die erwachsene Simone de Beauvoir ist die kleine Simone ein lebender Widerspruch. Sie ist ein »verfremdetes Wesen«10 und zugleich ein glückliches Kind.
Dieses Glück bekommt allerdings manchmal Risse. Oder anders gesagt: Es gibt Situationen, in denen Simone Erfahrungen machen muss, die nicht in ihre heile Kinderwelt passen. So zum Beispiel kann sie nicht verstehen, warum ihr Vater nicht in die Kirche geht, sondern am Sonntag lieber zum Pferderennen. Er nimmt auch nicht an den Gebetsstunden teil und macht sich lustig über die Leute, die zur Wallfahrtsstätte Lourdes pilgern, um von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Religion und Glaube sind für ihn etwas für Frauen und Kinder. Er hält es mit den von ihm hochgeschätzten Autoren, die alle Skeptiker und Atheisten sind. Simone bewundert ihren Vater, weil er Bücher liest. Wie kann aber ein Mensch, der so klug ist wie er und sich nie irrt, an Gott zweifeln, während es für sie und ihre Mutter das größte Unglück wäre, den Glauben zu verlieren? Sie kann diesen Widerspruch nur ertragen, indem sie annimmt, dass es eben zwei ganz verschiedene Bereiche im Leben gibt: einen Bereich des Glaubens und einen anderen, in dem es um Literatur, Kunst, Theater geht. Aber allein die Tatsache, dass ihre Eltern zu einer Sache so völlig verschiedene Ansichten haben, ist höchst verwirrend für Simone.
Verstörend ist auch, dass sie nun öfter, wenn sie im Bett liegt, ihre Eltern streiten hört. Sie hält sich dann die Ohren zu oder zieht sich die Decke über den Kopf. Manchmal schnappt sie jedoch Worte auf, die sie am liebsten nicht hören würde. Einmal steht sie dabei, als Louise im Treppenhaus mit anderen Bediensteten abschätzig über ihre Mutter redet. Simone kann es nicht fassen, dass gewöhnliche Menschen wie Louise oder die Tochter der Hausmeisterin über ihre Mutter herziehen, die doch ihr Vorbild und in allem perfekt ist. Simone weiß sich nicht anders zu helfen, als schweigend über solche störenden Erlebnisse hinwegzugehen. Als Kind, so wird sich Simone de Beauvoir einmal erinnern, habe sie den Eindruck gehabt, als sei jeder Erwachsene »eingeschlossen in seine eigenen vier Wände«. Manchmal habe sie unabsichtlich diese Wände durchstoßen, dann habe sie nichts Eiligeres zu tun gehabt, als diese Löcher rasch wieder zu stopfen. »[M]eine Schutzwälle«, so schreibt sie, »sollten nicht rissig sein.«11
Die Versorgungslage im Krieg wird von Jahr zu Jahr schlechter. In der Wohnung der Beauvoirs ist es kalt und meist gibt es nur eine dünne Suppe zu essen. Nachts heulen häufig die Sirenen und die Fenster müssen verdunkelt werden. Die Deutschen haben eine Wunderwaffe entwickelt, ein Monstrum von einer Kanone mit einem riesigen Rohr, das sie »Paris-Geschütz« nennen, weil man damit auch die weit entfernte französische Hauptstadt erreichen kann. Die Einschläge richten keinen großen Schaden an, aber sie verbreiten unter der Bevölkerung Angst und Schrecken. Großmutter Brasseur ist mit ihren Nerven am Ende und ihre Tochter Françoise nimmt sie bei sich auf. Sie bekommt Simones Zimmer, die nun mit Louise im Wohnzimmer schläft. Zu den Mahlzeiten kommen Großvater Brasseur und Tante Lili vorbei, was regelmäßig zu Streit und hitzigen Gesprächen führt. Gustave Brasseur hat seinen Bankrott längst hinter sich gelassen, er leitet jetzt eine Schuhfabrik und ist voller verrückter Ideen, wie er wieder Millionen verdienen wird. Er hat einen Goldbarren dabei und behauptet, ein Alchimist hätte dieses Gold vor seinen Augen aus einem Klumpen Blei gemacht. Er will, dass Georges in die Sache investiert, aber der lächelt nur, was wiederum seinen Schwiegervater zur Weißglut treibt und in der Wohnung alle durcheinanderschreien lässt.
Simone hat sich daran gewöhnt, dass es mit der vielbeschworenen Harmonie in der Familie nicht weit her ist. Sie zieht sich dann zurück in die Spiele mit ihrer kleinen Schwester oder versinkt in eines ihrer Bücher. Für kulturelle Bildung wie Theater oder Kino ist kein Geld da. Lesen ist noch das billigste Vergnügen und das kommt Simone entgegen. Sie liest alles, was ihr in die Finger kommt oder, richtiger, was ihre Mutter erlaubt, dass ihr in die Finger kommt. Je stärker aber ihre Neugier und ihr Wissensdrang zutage treten, desto enger wird ihr Verhältnis zu ihrem Vater. Georges gibt ihr Bücher aus seiner Bibliothek und spricht mit ihr über Literatur. Simone ist begeistert, dass ihr Vater sie wie eine Erwachsene behandelt. Für ihre Mutter ist sie noch ein Kind, und sie wacht streng darüber, dass Simone nichts liest, was in ihrem Kopf Schaden anrichten könnte. Bei manchen Büchern, die eigentlich völlig harmlos sind, steckt sie sogar mit einer Nadel jene Seiten zusammen, die ihrer Ansicht nach unschickliche Stellen enthalten. Simone wagt es nicht, die Nadeln herauszuziehen.
Manchmal kann Françoise doch nicht verhindern, dass Simone auf ein Wort stößt, das Fragen in ihr auslöst. Ausgerechnet in einem Marien-Gebet bleibt Simone an dem Ausdruck von der »Frucht des Leibes« hängen und fragt ihre Mutter danach. Die zeigt mit einem Stirnrunzeln oder indem sie ihre Lippen verzieht, dass sie darüber nicht reden möchte und es sich um eine ungehörige Sache handelt. Daraufhin behält Simone in Zukunft solche Fragen lieber für sich. Als ungehörig gilt es auch, sich zu lange im Spiegel zu betrachten oder zu viel Haut zu zeigen. Wenn sie ihre Unterwäsche wechselt, darf sie sich nie ganz ausziehen.