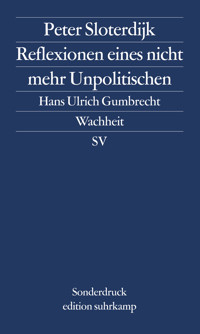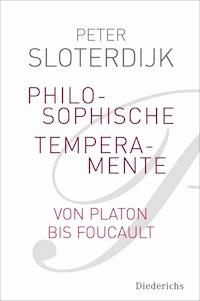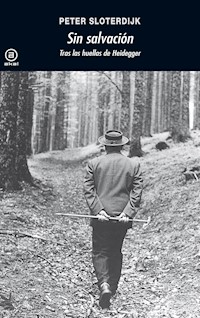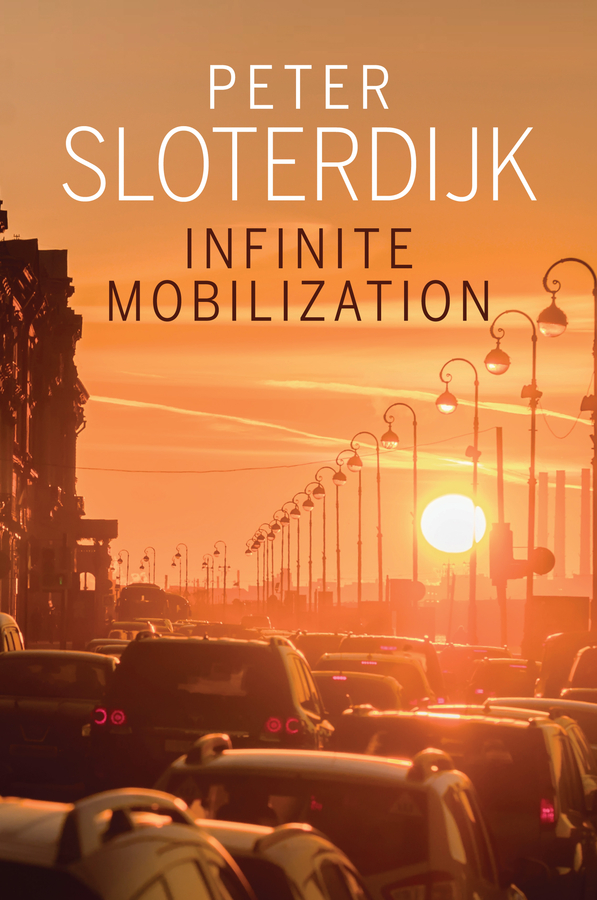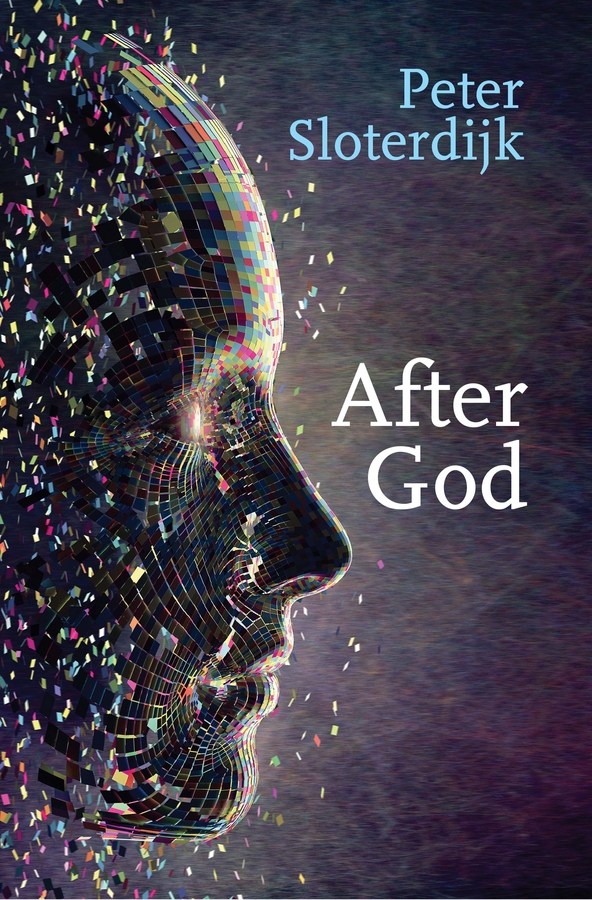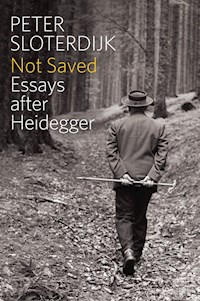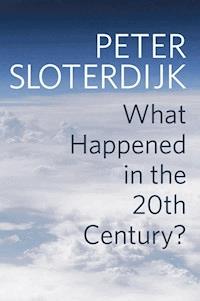9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die selbst gestellte Frage, wie man sein Werk am knappsten charakterisieren könne, beantwortete Peter Sloterdijk mit dem Hinweis, er sei ein »philosophierender Schriftsteller«. Damit ist der Erfolg seiner Bücher erklärt. Seine Überlegungen, seine Reflektionen und Analysen sind von einem einzigartigen Stil durchdrungen: Sie plausibilisieren durch die geschliffene Form, die Formulierung, die treffende Metapher, die ironische Übertreibung. Diese Art des Philosophierens hat ihre Ursprünge in Frankreich. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn die Kapitel seines Werkes, in denen er sich mit Frankreich, dem Land und seinen Denkern auseinandersetzt, besonders fulminant sind. Der vorliegende Band versammelt Betrachtungen Peter Sloterdijks zur französischen Geschichte und Philosophie vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, von Voltaire bis Derrida, von der Französischen Revolution bis Sarkozy, und er erklärt, warum die Erbfeinde Deutschland und Frankreich sich politisch und kulturell immer weiter voneinander entfernen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Die selbstgestellte Frage, wie man sein Werk am knappsten charakterisieren könne, beantwortete Peter Sloterdijk mit dem Hinweis, er sei ein »philosophierender Schriftsteller«. Damit ist der Erfolg seiner Bücher erklärt. Ihre Überlegungen, seine Reflexionen und Analysen sind geprägt durch einen einzigartigen Stil: Sie plausibilisieren durch die geschliffene Form, die Formulierung, die treffende Metapher, die ironische Übertreibung.
Solche Art des Philosophierens hat ihren Ursprung in Frankreich. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn die Kapitel seines Werkes, in denen er sich mit Frankreich, dem Land und seinen Denkern auseinandersetzt, besonders fulminant sind.
Der vorliegende Band versammelt Betrachtungen Peter Sloterdijks zur französischen Geschichte und Philosophie vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, von Voltaire bis Derrida, von der Französischen Revolution bis in unsere Tage, und er erklärt, warum die Erbfeinde Deutschland und Frankreich sich politisch und kulturell immer weiter voneinander entfernen.
Peter Sloterdijk, geboren 1947, ist Professor für Ästhetik und Philosophie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und deren Rektor.
Zuletzt sind im Suhrkamp Verlag erschienen: Du mußt dein Leben ändern (st 4210), Scheintod im Denken (eu 28), Zeilen und Tage.
Peter Sloterdijk Mein Frankreich
Suhrkamp
Zusammenstellung: Raimund Fellinger
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
© dieser Zusammenstellung Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Suhrkamp Taschenbuch Verlag
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil desWerkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie,Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner,Michels, Zegarzewski
Umschlagfoto: Basso Cannarsa/Agence Opale
eISBN 978-3-518-75770-3
www.suhrkamp.de
Mein Frankreich
Inhalt
Descartes
Pascal
Jean-Jacques Rousseau
Mme de Warens
Voltaire, Die Prinzessin von Babylon
Nationalversammlung
Alexis de Tocqueville, L’Ancien régime et la révolution
Wenn eine Revolution nicht genügt
Die Botschaft von Monte Christo
Jules Verne und Hegel
Marxistische Elegie: Althusser und der »Bruch« in Marx
Paul Valéry
Theorie der Nachkriegszeiten
Von wo an Lacan sich irrt
Sartre
Der selbstlose Revanchist. Notiz über Cioran
Pariser Buddhismus. Ciorans Exerzitien
Erwachen im Reich der Eifersucht. Notiz zu René Girards anthropologischer Sendung
Foucault
Derrida ein Ägypter. Über das Problem der jüdischen Pyramide
Latour, Ein Philosoph im Exil – oder: Der Mann, der die Wissenschaften liebt
Jean-Pierre Chevènement La France – est-elle finie?
Ein Interview
Drucknachweise
Descartes
Es gibt wenige Epochen in der Geschichte des Denkens, die den Zeitgenossen so fremd geworden sind wie jenes 17. Jahrhundert, das von den Geschichtsbüchern als Gründerzeit der neuzeitlichen Philosophie dargestellt zu werden pflegt. In der Tat ist es für die Spätergeborenen und Späterdenkenden kaum noch möglich, sich in eine Zeit zu versetzen, in der Gestalten wie Francis Bacon, René Descartes und Thomas Hobbes Neue Philosophen waren. Geblendet von der Geschichtsmächtigkeit der Impulse, die sich mit dem Namen dieser Größen verbunden haben, will es uns kaum gelingen, mit unbefangenem Blick in die Epoche zurückzugehen, in der das, was man später das Projekt der Moderne zu nennen beliebte, kaum mehr war als ein animierter Briefwechsel zwischen einigen Dutzend Korrespondenten.
Die optischen Täuschungen der Historie lassen das, was anfangs nur eine anspruchsvolle Vorahnung vom inneren Zusammenhang zwischen Macht und Methode war, als Aufbruch ins Zeitalter der technologischen Machtergreifung erscheinen. Zu den Merkwürdigkeiten jenes 17. Jahrhunderts gehört auch die halbmythische Qualität seiner eminenten Autoren; ihnen wurden ihre Versuche als Grundlegungen und ihre Programme als Epocheneinschnitte angerechnet. Dieser mythologische Habitus wurde von den konservativen Feinden der Neuzeit bald eifrig übernommen, so daß der Name Descartes’ zum Symbol für die frivole Abweichung einer allzu selbstbewußten Menschheit von der gottgewollten Ordnung der Dinge werden konnte. Nicht umsonst hat die Restauration des 19. Jahrhunderts Descartes – dessen Werke seit 1663 auf dem Index der katholischen Kirche standen – zu den ferneren Vätern der Französischen Revolution rechnen wollen, als wären es von der Grundlegung des Denkens im Prinzip des Cogito bis zur Auflösung aller Dinge nur zwei oder drei Schritte. Descartes’ Welt freilich ist nicht die der bürgerlichen Revolution, sondern die der Konfessionskriege. Das Pathos, mit dem er in seinen Grundlegungsschriften die Unterscheidung von Gewißheiten und Wahrscheinlichkeiten betrieb, war auch gespeist vom Anschauungsunterricht, den der religiöse Bürgerkrieg den Zeitgenossen lieferte. Denn was war der Dreißigjährige Krieg der Konfessionsparteien (der ganz in Descartes’ wache Lebenszeit fiel) anderes als der Kampf der bloßen Wahrscheinlichkeiten, die aus den theologischen Seminaren auf die Schlachtfelder gesprungen waren?
Gegen diese Waffendienste des Wahrscheinlichkeitsfanatismus setzte Descartes sein Bekenntnis zur absoluten Evidenz und zur sicheren und friedlichen Gangart seiner Methode. Wo Methode und Evidenz die Oberhand gewonnen hatten, dort müßten – wie der Philosoph zu verstehen gab – bewaffneter Glaubenseifer und Positionsanmaßung das Feld räumen, und was nach dem Ende des Krieges der Ungenauigkeiten zurückbliebe, könnte idealiter nichts anderes sein als das friedliche Vorrücken aller wahrheitsliebenden Geister auf den sichergemachten Straßen regulierter und verbindender Vernunft: Descartes’ große Idee war es, das Denken in einen streitlosen Raum zu versetzen.
Es gibt in der Geschichte des Denkens wohl keinen zweiten Autor, bei dem das Wort Methode mit soviel Verheißungen beladen wurde wie bei Descartes. In den Obertönen des neuen Präzisionsgedankens klingen pazfistische Schwingungen deutlich vernehmbar mit; er steht für Selbstsicherheit und Solidarität, Großzügigkeit und Unternehmungsgeist in einem. In seinem Begriff von Methode hat Descartes seine Absage an den dogmatischen Ballast der aristotelischen Universitäten allgemein bekannt gemacht. Elegant und antiautoritär wies die cartesische Reflexion die Ansprüche der Tradition und ihrer Professoren zurück: Wer die Kraft hat, neu zu beginnen, muß keine Dialoge mit den Toten mehr führen; wer die neue Seite aufschlägt, ist vom Gespräch mit der Geschichte fürs erste befreit. Bei solcher Gesinnung fand der neue Philosoph keinen Geschmack mehr an den Argumentationsturnieren einer ohnmächtigen und selbstbezüglichen Sorbonnekultur, die längst den Zusammenhang mit den Künsten, den Werkstätten und den Konturen verloren hatte. Mit dem Wort Methode stieß Descartes die Fenster zur Gegenwart auf, und es erwies sich, daß dies eine Zeit war, in der das erstarkte menschliche Können danach verlangte, auf eine neue logische und moralische Grundlage gestellt zu werden. Es war, als habe Descartes damit neben dem alten Blut- und Schwert-Adel und der jüngeren noblesse de robe einen eigenständigen Methoden-Adel geschaffen, der seine Mitglieder in allen Schichten rekrutierte, sofern seine Angehörigen den Eid auf Klarheit und Deutlichkeit zu leisten bereit waren. An dem anti-feudalen Charakter dieser Gruppe von neuen Könnenden bestand von Anfang an kein Zweifel. Auch wenn der philosophierende Edelmann Descartes nie einen Zweifel an seinem doppelten Adelsbewußtsein aufkommen ließ, dem ererbten und dem selbst geschaffenen, so erkannten doch die nachfolgenden Generationen bürgerlicher Intelligenz in ihm ihren natürlichen Verbündeten. Aus dem cartesischen Kompetenz-Adel entstand jene Klasse der vorurteilslos selbst denkenden Geister, die von der frühen Neuzeit an das kritische Ferment der europäischen Intelligenz gebildet haben. Noch heute beruft sich, nicht ganz ohne Grund, der Mythos vom rationalistischen Nationalcharakter der Franzosen auf die cartesianischen Privilegien der Deutlichkeit.
Das theoriegeschichtliche Ereignis Descartes bezeichnet eine radikale Währungsreform der Vernunft. In einer Epoche galoppierender Diskurs-Inflation – ausgelöst durch hemmungslose allegorische Mechanismen und Wucherungen der Theologensprachspiele – hat Descartes ein neues Wertkriterium für sinnvolle Reden geschaffen, aufgebaut auf dem Goldstandard der Evidenz. Die notwendige Knappheit dieses Werts ergibt sich aus der Bedingung, daß aus wahren Sätzen immer einerseits gute Gesinnungen, andererseits nützliche Maschinen folgen müssen. »Keinem nützen heißt soviel wie nichts wert sein«, wird der Verfasser des Discours de la méthode erklären.
Wenn der Name Descartes’ durch Epochen hindurch umstritten blieb, dann vor allem deswegen, weil er wie kaum ein anderer den Sieg der Ingenieure gegen die Theologen symbolisiert. Er hat einem Denken den Weg geebnet, das sich vorbehaltlos öffnet für die Epochenaufgabe: Maschinenbau. Die nicht-maschinenbauenden Formen der Intelligenz fühlen sich daher zu Recht durch die cartesischen Impulse entwertet oder desavouiert. Als Schöpfer des analytischen Mythos hat Descartes gleichsam die Metaphysik des Maschinenbaus geschaffen, indem er alles Seiende in einfache kleinste Teile zu zerlegen begann und die Regeln bekanntzumachen suchte, die deren Zusammensetzungen regieren. Indem er das Denken ganz auf das Hin und Her von Analysis und Synthesis verpflichtete, machte er die Vernunft selbst ingenieursförmig und nahm die alte kontemplative Muße von ihr. Nun werden Gedanken zu verinnerlichten Formen von Arbeit, und das Leben des Geistes selbst wird auf den Weg gebracht zur Herstellung nützlicher Dinge. Gleichwohl wäre es falsch, zu glauben, Descartes’ mechanistische Grundüberzeugung habe zu einem Bruch mit der theologischen Überlieferung führen müssen. Gerade beim methodischen Neubeginn des wissenschaftlichen Denkens erweist sich das Fundieren als die eigentlich metaphysische Tätigkeit. Weil aber im großen philosophischen Rationalismus nur Gott das Fundament der Fundamente liefern kann, bleibt die moderne Philosophie cartesischen Typs charakteristisch in der Schwebe zwischen Theologie und Maschinentheorie. Nicht umsonst haben die großen Systemarchitekten des Deutschen Idealismus in Descartes ihren Vorgänger gefeiert. Für sie war wie für den großen Franzosen das Grundlegen die Frömmigkeit des Denkens. Daß nun aber Bewußtsein in die Funktion des Grundlegenden gebracht worden war, das machte die Modernität des transzendentalen Ansatzes aus. Erst mit der Auflösung der bewußtseinsphilosophischen Grundstellung im 20. Jahrhundert ist das cartesische Universum ganz historisch geworden. Descartes’ Werk bleibt aktuell als Zeugnis für jene Verschränkung von Wissenschaft und Besinnung, die heute mehr denn je dem philosophischen Denken seine prekäre Würde verleiht.
Pascal
Wer durch Autoren wie Goethe und Nietzsche erzogen worden ist zu einem Denken in Wahlverwandtschaften und Wahlfeindschaften über Epochen hinweg, für den präsentiert sich die Pascal-Renaissance des 20. Jahrhunderts als eines der stimmigsten Rezeptionsereignisse der jüngeren Geistesgeschichte. Vom Naheliegenden zum Notwendigen ist es nur ein Schritt, und es konnte nicht ausbleiben, daß die Denker des christlichen wie des nicht-christlichen Existentialismus während der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in Pascal die verwandte Seele witterten. Haben seine Verstimmungen nicht die unserer Zeit vorweggenommen? War seine Melancholie nicht auch schon die einer aufklärungsmüden späteren Moderne? War seine Rede über den Menschen nicht schon kongenial mit der Selbsterfahrung einer Zivilisation, die in diesem Jahrhundert wie in keinem zuvor die Menschen das Fürchten gelehrt hatte: vor sich selbst wie vor der Entartung ihrer hochzielenden Projekte?
Wenn Pascal in einer unvergeßlichen Prägung vom Menschen als einem denkenden Schilfrohr sprach – wer hätte dies nicht als Emblem für unsere neuerlebte Zerbrechlichkeit verstehen müssen? Und wenn er vom Menschen handelte als einem entmachteten König, wer hätte nicht an die soziopolitischen Großprojekte unserer Zeit gedacht und an das Ende der demiurgischen Überspannungen? Zu den Charaktermasken unserer Zeit gehören der entthronte Geschichte-Macher und der bloßgestellte Phyturg (Naturschöpfer) – zwei Figuren, die wie aus Pascals anthropologischen Sentenzen entstiegen scheinen. Pascals erstaunliche Zugänglichkeit – zumindest in manchen Partien seines Werks – läßt sich aber nicht nur darauf zurückführen, daß dessen protoexistentialistische Töne projektive Aneignungen durch spätere Wahlverwandte leichtmachen mußten.
Pascal kommt auch ins Blickfeld radikaler revisionistischer Interessen, denen es darum zu tun ist, das Gesamtverhängnis der platonisch-christlichen Ideengeschichte von vitalistischen oder subjekt-kritischen Grundstellungen aus dekonstruktiv zu überdenken. Nietzsche hat vorgemacht, wie dieses wahlfeindschaftliche Verhältnis gerade vor den Größten der alten Welt nicht haltmacht: Mit einer Kraft zur Vergegenwärtigung, die an Gewaltsamkeit grenzt, hat der Erzdekonstruktivist Nietzsche die Gründer der moralisierten metaphysischen Weltanschauung, Sokrates, Paulus und Augustinus, auf einem überepochalen Kampfplatz zum Duell gefordert. In diesem Kampf der Titanen wird Pascal als Mitkombattant aufgerufen, weil Nietzsche in ihm die höchste Wiederverkörperung des augustinischen Genies auf neuzeitlichem Boden wahrnimmt. Pascal repräsentiert wie sein großer Vorgänger einen Typus von Intelligenz, der stolz genug ist, um für Demütigungen zugänglich zu sein. Erst von einer gewissen Höhe des Anspruchs an wird der Geist anfällig für die Erfahrung des Scheiterns an sich selbst. Von augustinischen Einsichten in die menschliche Gebrochenheit inspiriert, hat Pascal mit einer Neuvermessung des Umfangs von menschlicher Größe und menschlichem Elend begonnen. Nicht nur hat er hierbei die bis in aktuelle Diskurskonstellationen lebendige Korrelation von Erkenntnis und Interesse ursprünglich aufgedeckt, sondern er hat auch die Dialektik von Könnenssteigerung und anschwellender Ohnmachtserfahrung klassisch exponiert. Er ist hierin, tiefer und diskreter als Descartes, zum Ahnherrn der Moderne geworden. Aber während Descartes seine Leser eher in morgendlicher Stimmung und in programmatischen Aufbrüchen anspricht, ist Pascal ein Autor für nächtliche Lektüren und ein Komplize unserer intim gebrochenen Nach-Gedanken.
Nietzsches hingezogene Aversion gegen den melancholischen christlichen Mathematiker stellt den Stärken dieses Autors ein so beredtes wie (in Grenzen) gerechtes Zeugnis aus. An Pascal entdeckt Nietzsche, was bei einem geistigen Menschen am höchsten zu schätzen ist: jenen Sinn für intellektuelle Redlichkeit, der sich auch gegen die eigenen Interessen zu wenden vermag: fiat veritas, pereat mundus. Doch er bemerkt an ihm zugleich, worin er die größte Gefahr erkennt: die Neigung zum Miserabilismus und zum Sich-sinken-Lassen in eine affirmative Schwäche. Will der Nicht-Christ vom paradoxen Christen sich belehren lassen, dann vor allem dort, wo dieser sein letztes Wort über die condition humaine ausspricht: Hat nicht tatsächlich Pascal Nietzsches Theorem vom Willen zur Macht mit seiner Rede vom désir de dominer im 14. Provinzialbrief vorweggenommen?
Wenn es aber darum geht, für den Menschen der Zukunft die Möglichkeiten einer metaphysisch unvergifteten Selbstliebe zurückzugewinnen, dann ist Pascal kein Alliierter, sondern ein lehrreicher und schätzenswerter Gegner. Ein unverzichtbarer Verbündeter bleibt er für alle, die das Selbstverstehen der Selbstliebe vorangehen lassen wollen. Mit fast archaischer Heftigkeit verkörpert Pascal den Grundkonflikt der neuzeitlichen Welt: den Widerspruch zwischen dem operativen und dem meditativen Geist. Könnte das moderne Wissenschaftssystem so etwas wie Gewissen haben, Pascal müßte sein schlechtes Gewissen sein, denn sein Werk bezeugt, wie der scharfe und der tiefe Sinn vereint sein konnten. Zusammen mit Thomas Hobbes, mit Jean Baptiste Racine, mit John Milton steht Pascal als dunkle, von Bedenken zerklüftete Portalfigur am Eingang zur modernen Welt. Die Schatten seiner Nachdenklichkeit hatten Zeit, über die Nachgeborenen zu fallen. Seine Paradoxe haben der französischen Literatur bis in die Gegenwart ihr Zeichen aufgeprägt; wenn noch Sartre darauf beharrte, sich zu mißfallen, um sich vom eigenen trägen Sosein loszureißen, oder wenn Michel Leiris sich zu dem Glück bekannte, sein Unglück auszusprechen, so bewegen sich solche Äußerungen und Haltungen in einem Raum, den Pascals generöse Dialektik mitgeschaffen hat. Wäre die Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte ein Bericht von den Konjunkturen des Absurden: Pascals Platz in ihr wäre für immer gesichert. Er ist der Erste unter den philosophischen Sekretären der modernen Verzweiflung.
Jean-Jacques Rousseau
Die zweite Urszene in der Entfaltung des europäischen Freiheitsbegriffs spielt auf Schweizer Boden, und zwar im Herbst 1765. Durch ihren einzigen Zeugen, der zugleich die Hauptperson im Geschehen darstellt, besitzen wir von ihr eine relativ ausführliche Kenntnis. Längst hatte die Schweiz zu dieser Zeit eine Schlüsselrolle in der Geschichte des erneuerten republikanischen Freiheitsgedankens inne, doch sollte sie, wie gleich zu zeigen ist, eine ebenso bedeutende Rolle in der zu jenem Zeitpunkt an Fahrt aufnehmenden Geschichte der modernen Subjektivität erhalten. Der Held der Geschichte ist niemand anderes als der aus Genf gebürtige Jean-Jacques Rousseau, in jenem Jahr dreiundfünfzig Jahre alt, ein Mann auf der Flucht. Seit seinem vierzigsten Lebensjahr eine europäische Berühmtheit, nachdem er im Jahr 1750 den Preis der Lyoner Akademie gewonnen hatte, war er zu Anfang der sechziger Jahre – nach Veröffentlichung von Erfolgsbüchern wie Julie oder die Neue Héloïse (1761) (nahezu einhundert Auflagen bis 1800), dem Contrat social (1762) und dem Émile (1762) – in den Rang einer Skandalperson aufgestiegen. In heutiger Terminologie würde man sagen: Er hatte die Beförderung vom Star zum Superstar geschafft. Insbesondere hatte das faszinierendste Stück aus dem Émile, das »Glaubensbekenntnis des savoyardischen Vikars«, das als Manifest einer pantheistischen Herzensreligion gelesen wurde, dem Verfasser die Feindschaft des hohen Klerus von Paris und die des Genfer Establishments eingebracht; es waren Haftbefehle ergangen und Aufenthaltsgenehmigungen widerrufen worden. In der Nacht vom 6. auf den 7. September 1765 bewarf anonymer Pöbel das Wohnhaus Rousseaus in Môtiers im damals preußischen Kanton Neuchâtel mit Steinen – ein Ereignis, das der Autor noch zwölf Jahre später als »Steinigung« (lapidation) beschrieb.1 Erstaunlicherweise kam ihm nie in den Sinn, diese Angriffe durch sein eigenes Auftreten provoziert zu haben, hatte er sich in Môtiers doch im Kostüm eines reisenden Armeniers, mit schlafrockartigem Kaftan und kecker Pelzmütze, präsentiert. Das erinnert an andere Medienstars des letzten Jahrhunderts und auch der Gegenwart, denen jede Verkleidung recht ist, um ihre Andersheit hervorzukehren. Man kann wohl resümierend sagen, Rousseau hat die Gesetze moderner Prominenz nie begriffen. Ein Ehrenplatz in der Geschichte der beginnenden Massenkultur kommt ihm dennoch zu. Er war nicht der erste Weltberühmte, der seine Laufbahn in Verbitterung beschloß. Ein noch größerer Ehrenplatz gebührt ihm in der Geschichte der Psychologie: Er war der Kronzeuge der Erkenntnis, daß es Paranoiker gibt, die wirklich verfolgt werden.
In seiner bedrängten Lage faßte Rousseau den Entschluß, sich gemeinsam mit seiner ihm unentbehrlichen, ihn tyrannisch bewundernden Lebensgefährtin Marie-Thérèse Le Vasseur auf eine fast menschenleere Insel inmitten des Bieler Sees zurückzuziehen. Fleißige Biographen haben die Daten seines Aufenthalts auf der Île St. Pierre vom 12. September bis zum 25. Oktober 1765 präzise ermittelt – die Insel wurde schon bald zu einem Wallfahrtsort der Rousseau-Verehrung. Diese Tage sind ideengeschichtlich von hoher Bedeutung, weil sich an ihnen so etwas wie der Urknall der modernen Subjektivitätspoesie ereignete, die unmittelbar in Freiheitsphilosophie überging – sofern man dem Bericht des Autors in den Träumereien eines einsamen Spaziergängers von 1776/77 Glauben schenken darf. Den Ausdruck Urknall muß ich allerdings sofort zurücknehmen, da es sich in Wahrheit nicht um ein explosives, sondern um ein fast unmerkliches Geschehen von eher implosivem oder kontemplativem Charakter handelte. Rousseau hat die Szene in dem legendären Fünften Spaziergang der Träumereien anschaulich wiedergegeben. An manchen sonnigen Herbsttagen war der verfolgte Autor, inzwischen zur Ruhe gekommen und vom Charme der stillen Insel bezaubert, mit einem Ruderboot auf den See hinausgefahren. Irgendwo weit draußen ließ er die Ruder sinken und legte sich rücklings auf den Boden des Boots, um sich seiner liebsten Beschäftigung hinzugeben. Er überließ sich einem inneren Driften, das der Autor mit dem Wort rêverie, Träumerei, umschrieb. Man könnte dieses seelische Fließen, das an keinem Thema haftet, auch als ungegenständliche Meditation bezeichnen – im europäischen, nicht im fernöstlichen Sinn des Ausdrucks. Rousseau sagt selbst, mitunter habe er sich stundenlang treiben lassen, dabei sei er in Träumereien versunken, die keinen eigentlichen Gegenstand hatten und ihm doch hundertmal süßer waren als alles, was man gemeinhin die Freuden des Lebens nennt.2 Des öfteren näherte er sich dem Punkt, an dem er bereit war zu sagen: »Ich wollte, dieser Augenblick währte für immer.« In seinem absichtslosen Driften entdeckte er die reine psychische Dauer, in der die gewöhnliche ablaufende Zeit mit ihren Erinnerungen und Vorwegnahmen verschwindet, um einer strömenden Sukzession von Jetzt-Momenten Platz zu machen, die durch keinen Mangel korrumpiert und durch keine Vorstellung von Abwesendem gestört werden.
Es lohnt sich, dem Autor das Wort zu geben, um von ihm zu hören, wie er seine Selbstentdeckung auf der Schwelle zwischen Selbstverlust und Selbstinbesitznahme kommentiert. Es gelingen ihm hierbei kühne Verallgemeinerungen, die für die Geschichte der modernen Subjektivität und eo ipso die der modernen Freiheitstendenzen bedeutsam werden sollten.
»Was eigentlich genießen wir in solcher Lage? Nichts, was dem eigenen Selbst äußerlich wäre, nichts außer sich selbst und die eigene Existenz. Solange dieser Zustand anhält, genügt man sich selbst wie Gott. Das Existenzgefühl als solches, von allen anderen Affekten entkleidet, ist durch sich selbst ein wertvolles Empfinden von Frieden und Zufriedenheit, und bereits dies allein würde genügen, diese Existenz demjenigen lieb und teuer zu machen, dem es gelänge, die sinnlichen und irdischen Eindrücke fernzuhalten, die uns sonst unablässig von ihr abziehen.«3
Der heutige Leser hat wahrscheinlich Mühe, die stille Sensation nachzuvollziehen, die sich in diesen Zeilen manifestiert. Den Zeitgenossen blieb sie nicht verborgen. Sie vermitteln nicht weniger als das Debüt eines Begriffs von Existenz, in dem das moderne Individuum auf die Bühne tritt. Dieses Individuum stellt sich zugleich als ein neues Subjekt der Freiheit vor. An dieser Urszene des Existenz-Denkens ist abzulesen: Die junge Freiheit von 1765 ist noch keine Freiheit für Unternehmer, für Entdecker und Autoren. Ausdrücklich betont der Autor, er habe in situ von der Lizenz zur literarischen Aussprache des eigenen Inneren zunächst nichts wissen wollen. (Rousseau beteuert später, er habe auf der Île St. Pierre nicht einmal eigenes Schreibzeug besessen, so daß er, wenn es doch einmal etwas zu notieren gab, die Feder des Inselpächters ausleihen mußte; allzugern habe er das Schreiben über dem träumerischen Bei-sich-Sein vergessen.) Sie ist die Freiheit eines Träumers im Wachzustand. Das diskret Sensationelle von Rousseaus Fünftem Spaziergang zeigt sich darin, daß hier vermutlich zum ersten Mal auf europäischem Boden eine Freiheitserfahrung zum Ausdruck kommt, bei der das Subjekt der Freiheit sich ausschließlich auf seine gespürte Existenz beruft, jenseits aller Leistungen und Verpflichtungen, auch jenseits möglicher Ansprüche auf Anerkennung durch andere. Der Autor behauptet nicht, er sei Gott nahe gewesen oder in den dritten Himmel entrückt worden. Das erste Wort des Subjekts ist eine Selbstanzeige. In dieser gibt es bekannt, daß es sich in einer Ekstase des Bei-sich-Seins selbst entdeckt hat – und daß es darüber hinaus nichts zu sagen hat. Indem es das Gefühl der puren Existenz erfährt, glaubt es, einen souveränen Seinstitel erworben zu haben.
Um diese Beobachtungen in bei Hegel entliehene Ausdrücke zu übersetzen, könnte man sagen: Inmitten des weltweit herrschenden unglücklichen Bewußtseins (das Stoikern, Buddhisten, Juden, Christen, Muslims, Sozialisten, Entwicklern, Therapeuten und Konsultanten Arbeit gibt) entdeckt Rousseau – obschon episodisch doch exemplarisch – einen zeitgenössischen Zugang zu einem glücklichen Bewußtsein. In diesem Moment nimmt der Begriff Freiheit unwillkürlich eine neue Bedeutung an – eine Bedeutung, die allem widerspricht, was je zuvor mit diesem Begriff verbunden wurde (Freiheit als Recht auf Unbehelligtsein von Willkürherrschaft, als Rechtsgenossenschaft in der polis, als individuelle Autarkie, als Kultfreiheit, als Herrenprivileg, als Freiheit des Christenmenschen usw.). Er bezeichnet einen Zustand erlesener Unbrauchbarkeit, in dem der einzelne ganz bei sich ist, und zugleich weitgehend losgelöst von seiner alltäglichen Identität. In der Freiheit der rêverie ist der einzelne von der »Gesellschaft« weit abgerückt, doch auch losgelöst von der eigenen, ins soziale Gewebe verstrickten Person. Er läßt beides hinter sich, die Welt der kollektiven Sorgenthemen und sich selbst als Teil von dieser. Frei ist demnach, wem die Eroberung der Sorglosigkeit gelang. Freiheit im aktuellsten Sinn erfährt, wer eine sublime Arbeitslosigkeit in seinem Inneren entdeckt – ohne sich gleich bei einer Vermittlungsagentur zu melden. Wahrhaft frei dürfte sich künftig nur nennen, wem die Zuwendung zu sich selbst in der Weise gelingt, daß die Quelle des Gefühls der Existenz in ihm zu strömen beginnt – nicht im Modus der Langeweile wie bei Heidegger, nicht im Modus des Ekels wie bei Sartre, sondern mit der Klangfarbe einer leisen Euphorie, die eine ungegenständliche Bejahung der Gesamtlage vor jeder artikulierten Zustimmung zu diesem und jenem manifestiert. Das Entscheidende an diesen Entdeckungen ist das Fehlen jedes Bezugs auf Leistungen. Das Subjekt des Fünften Spaziergangs ist weder ein Erkenntnissubjekt noch ein Willenssubjekt, noch ein Unternehmenssubjekt, noch ein politisches Subjekt. Es ist nicht einmal ein künstlerisches Subjekt. Es hat nichts zu sagen, es hat keine Meinung, es drückt sich nicht aus, es hat kein Projekt. Es ist weder kreativ noch progressiv, noch gutwillig. Seine neue Freiheit zeigt sich in seiner ekstatischen Unbrauchbarkeit zu allem. Der freie Mensch nach Rousseau macht die Entdeckung, daß er der unnützeste Mensch der Welt ist – und er findet das vollkommen in Ordnung.
1
Jean-Jacques Rousseau, Träumereien eines einsamen Spaziergängers, Stuttgart 2003, S. 84. Vgl. auch Les Confessions, 12. Buch.
2
Jean-Jacques Rousseau, Träumereien, a.a.O., S. 88.
3
Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Paris 2010, S. 97f., eigene Übersetzung.
Mme de Warens
Mme de Warens hielt sich in Les Charmettes bei Chambéry ab 1737 neben dem jungen Rousseau einen zweiten Liebhaber, einen gewissen Wintzenried, den die Literatur sehr zu Recht als ihr Fucktotum bezeichnet. Man könnte sich fragen, wieso Rousseaus Paranoia nicht schon während seiner unfreiwilligen Beteiligung an dieser ménage à trois zum Ausbruch gelangte. Vermutlich hat der freimütige Umgang der Dame mit der prekären Situation bewirkt, daß Rousseau sich nur zurückgesetzt, nicht hintergangen fühlte. Zudem war er zu jener Zeit noch ein Niemand, und Niemande sind vor Verfolgung besser geschützt als etablierte Persönlichkeiten. Rousseau mußte ein berühmter Jemand werden, um wahnsinnig werden zu können.
Ob es eine altersbedingte Abrüstung von Aversionen ist oder eine Wirkung meiner wiederholten Lektüre der Rêveries, deren listige Genialität sich nur nach und nach erschließt: ich beobachte jedenfalls, wie der Anti-Rousseau-Affekt bei mir sich allmählich abschwächt. Obwohl es keinen Grund gibt, die Reserven hinsichtlich seiner Person und die Anklagen gegen seine fatalen Wirkungen zu widerrufen, erscheint er als Autor heute weniger abstoßend als früher, und wäre es auch nur, weil ich mit schwindendem Widerwillen zugebe, daß Kant und Goethe, die beide Rousseau verehrten, unmöglich ganz ins Leere gegriffen haben können. An Rousseau ist Goethe aufgegangen, wie ein Schriftsteller zu einer höheren Gewalt werden kann.
VoltaireDie Prinzessin von Babylon
Lese über dem Atlantik Voltaires kleinen Roman Die Prinzessin von Babylon von 1768. Der Ansatz des Erzählers ist alles andere als romantisch, wenn er auch den Helden seiner Geschichte in einer von sechs Einhörnern gezogenen Kutsche reisen läßt. Das Märchengenre kommt der philosophischen Satire entgegen. Bei einem Buch dieser Art kann man den Rat befolgen, irgendwo in der Mitte zu beginnen, da die Handlung hier wie anderswo zumeist für das unintelligente Element der Literatur steht.
Hübsch ist die Rom-Satire, in der sich der Erzähler darüber mokiert, wie der Papst mit zwei Fingern die Stadt und den Erdkreis umfassen will und wie die vatikanischen Würdenträger den hübschen Jüngling Amazon unter che-bel-fanciullo-Rufen mit den Augen verzehren – bis er zuletzt die schwülen Herren in Violett zum Fenster hinauswirft. So schnell er kann, reist der Junge aus der seltsamen Stadt ab, wo man dem Papst die Füße küssen soll, »als ob er die Wange am Fuß hätte«.
Frappierend, mit welcher Bedenkenlosigkeit Voltaire den klugen Despoten seiner Zeit schmeichelt, der Zarin Katharina, Friedrich dem Großen, dem Kaiser von China Chi-Au Long, 1737-1796, bei dem er das Prinzip der Meritokratie entdeckt haben will.
Nationalversammlung
Hat man sich davon überzeugt, daß der modus vivendi, das heißt der Entwicklungsrhythmus, der modernen »Gesellschaft« auf einem Doppeltakt beruht – der Auseinanderlegung der sozialen Konglomerate in individuierte komplexe Einheiten und deren Rekombination in kooperativen Ensembles –, so springt ins Auge, wie sehr sich in der Formel vom »Eintritt der Massen in die Geschichte« auch eine architektonische Problematik artikuliert. Dem neu gelockerten Aggregatszustand ihrer Symbionten entsprechend, müssen sich die modernen Kollektive der Aufgabe stellen, die Raumverhältnisse hervorzubringen, in denen hier die Vereinzelung der Individuen, dort die Zusammenfassung der Einzelnen zu vielköpfigen Kooperations- oder Kontemplationsensembles ihre Unterstützung finden. Dies fordert neue Einsätze für Architektur.
Schon während der Französischen Revolution war manifest geworden, daß die Aktivisten des Umsturzes für ihre Zusammenkünfte ausschließlich auf die Gebäude des ancien régime oder den öffentlichen Raum der Städte, insbesondere die Plätze vor großen Gebäuden, zurückgreifen konnten. Was man eines Tages mit dem irreführenden Terminus »Revolutionsarchitektur« belegen würde,1 war in den anregendsten Teilen schon vor 1789 entworfen worden – man denke an das umstrittene Haus der Flurwächter (Maison des gardes agricoles) von Claude Nicolas Ledoux, das zwischen 1768 und 1773 datiert wird, den Newton-Kenotaph von Etienne-Louis Boullée aus dem Jahr 1784 oder das Haus eines Kosmopoliten von Vaudoyer, 1785. Daß diese Projekte ohne Ausnahme im Papierstadium verblieben, war nicht so sehr auf widrige Umstände zurückzuführen, sondern entsprach ihrer eigenen spekulativen Logik – noch war die Zeit für die Emanzipation der skulpturalen Raumauffassung und der geometrischen Formalismen nicht reif.2
Die umstürzenden Vorgänge der Großen Tage spielten sich also in Gebäuden und auf öffentlichen Plätzen ab, die zu den Ereignissen, die sie beherbergten, in keinem Bezug standen. Bekanntestes Beispiel: die Tagungen der von Louis XVI einberufenen Generalstände in Versailles. Hier waren Anfang Mai 1789 in den Flügeln des Schlosses einige Säle für die Zusammenkünfte der zunächst getrennt tagenden Stände umgerüstet worden. Als die fast sechshundert Deputierten des Dritten Standes, die sich inzwischen den offen aufrührerischen Titel »Nationalversammlung« beigelegt (und für diese das Vorrecht der Steuerbewilligung reklamiert) hatten, am 20. Juni die ihnen zugewiesene Salle Menus-Plaisirs verschlossen fanden (vermutlich wegen der Vorbereitungen für die geplante große gemeinsame Sitzung der Stände unter dem Vorsitz des Königs zum 23. des Monats), verlegten sie ihre Beratungen, einem Hinweis des Abgeordneten Guillotin folgend, kurzerhand in das nahe Jeu de Paume, ein Gebäude, das wie sein Vorgänger bis dahin ganz seiner Bestimmung im Dunstkreis fürstlicher Plaisirs gewidmet war. Sie legten dort den berühmten Schwur ab, nicht eher auseinanderzugehen, als bis die Verfassung des Königreichs ausgearbeitet sei und auf festen Grundlagen ruhe. An diesem Gelöbnis, dem ersten Sprechakt der bürgerlichen Machtergreifung, ist bemerkenswert, daß er die Einschwörung der Versammelten auf die Versammlung als solche zum Gegenstand hatte; er konnte keinen Zweifel lassen am Vorrang des politischen Inhalts (der gerade erst in Formung begriffen war) vor der lokalen und architektonischen Form (die von Fall zu Fall zu bestimmen oder zu errichten blieb): »Die Nationalversammlung … beschließt, niemals auseinanderzugehen und sich überall, wo die Umstände es gebieten, zu versammeln …«3 Zur Souveränität der ersten Assemblée , die ihre Arbeit bis zum 30. September 1791 fortsetzte (um von der Gesetzgebenden Versammlung abgelöst zu werden, welche ihrerseits vom 20. September 1792 an dem Konvent weichen sollte), gehört von Anfang an die Freiheit zur ad-hoc-Bestimmung des Tagungslokals – ein Vorgang, der in der Terminologie der Subversiven im 20. Jahrhundert Umfunktionierung heißen wird. Von ihr muß schon wenige Tage später Gebrauch gemacht werden, als der Tiers Etat eine Zusammenkunft in der Kirche des heiligen Ludwig zu Versailles improvisierte – es ist die historische Sitzung, auf welcher sich ein großer Teil des Klerus mit dem Dritten Stand vereinigte; dann von neuem im Herbst 1789 mit dem Umzug der Nationalversammlung in die Pariser Salle du Manège, die Reitschule der Tuilerien, die hastig für die Bedürfnisse der Konstituante hergerichtet wurde. Im Mai 1793 übersiedelte die Versammlung, jetzt als Konvent, ins Schloß der Tuilerien, wo inzwischen nach den Plänen des Künstlers Gisors ein Sitzungssaal in der Form eines halbelliptischen Amphitheaters mit 700 Sitzen für die Abgeordneten und 1400 Plätzen für Zuschauer eingerichtet worden war. In derselben Zeit war die Planungsphantasie der Architekten nicht untätig: von 1789 an wurden zahlreiche Entwürfe für würdige Tagungsgebäude der Nationalversammlung angefertigt, in der Regel aus Anlaß von akademischen Wettbewerben, die meisten im heroisch-klassizistischen Stil, nicht wenige bereits in monumentalen Dimensionen,4 als könne sich die Republik formal nur im Dekor eines römischen Imperiums erklären – die Linie, die von Etienne-Louis Boullée zu Albert Speer führt, läßt übrigens an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig; wie insgesamt die politischen Liturgien, deren die europäischen Faschismen sich bedienten, in nahezu allen Details – die radiophonen Techniken der Massenerfassung ausgenommen – von Praktiken, Projekten und stilistischen Mustern der Französischen Revolution präfiguriert wurden.
Man könnte im Blick auf diese Vorgänge ein »revolutionäres« Geschehen als etwas definieren, das »statt«findet, obwohl es sich nach Lage der Dinge zunächst ausschließlich an ungeeigneter Stätte ereignen kann. Die Versammlungen der neuen politischen Aktionsgrößen, der ersten Assemblée nationale, der Gesetzgebenden Versammlung und des Konvents und ihrer Ausschüsse auf der einen Seite, der Clubs und Parteien, der Sektionen und Diskussionsgesellschaften auf der anderen, übersetzten sich in ebenso viele revolutionäre Raumforderungen, die fürs erste nur die Verlegenheit gemeinsam hatten, daß sie sich in der Bausubstanz der Alten Ordnung einnisten und dieser eine heterodoxe Funktion abgewinnen mußten. Exemplarisch für eine Unzahl analoger Vorgänge sind die Schicksale eines leerstehenden Klosters der Dominikaner, die im Volksmund Jakobiner hießen, in der Pariser rue Saint Honoré, aus dem nach dem Umzug der Deputierten von Versailles in die Hauptstadt das Versammlungslokal des Bretonischen Clubs, nachmals »Gesellschaft der Verfassungsfreunde«, wurde – das Ideenkraftwerk des patriotischen Radikalismus und Mutterzelle Hunderter von Ablegern in der Provinz, über deren explosive Verbreitung Camille Desmoulins schon im Februar 1791 schreiben konnte: »In der Verbreitung des Patriotismus, d.h. der Philanthropie, scheint … der Klub oder die Kirche der Jakobiner, zum selben Primat berufen zu sein wie die Römische Kirche in der Ausbreitung des Christentums …«5 Daß sich die hier entstandene Machtgruppierung alsbald aktiv wie passiv mit dem Namen ihrer Tagungsstätte identifizierte, verrät etwas von der Macht der Ortsgeister über die Versammelten; umgekehrt stellt es die Unabhängigkeit der neuen Kräftekonstellationen von überlieferten Lokalsemantiken vor Augen. Allenfalls dürfte man sagen, daß es hier wie an zahllosen anderen Orten zu einer Autoritätsübertragung vom Klerus auf die eloquentesten Volksvertreter kam, besser noch: zu einer Überbietung des christlichen Eifers durch den Elan der menschheitstrunkenen Patrioten.
Analoge Mechanismen wirkten vorübergehend zugunsten der gemäßigten Kräfte um Barnave, als sie sich im Juli 1791 vom Jakobinerclub lossagten und sich zur Bekräftigung ihrer Sezession in dem benachbarten Kloster der Feuillants etablierten – wie das Jakobinerkloster nur wenige Schritte von der Salle du Manège entfernt. Als der Populist und Sparta-Schwärmer Jean-Paul Marat am 13. Juli 1793 durch Charlotte Corday ermordet worden war, bereiteten ihm Mitglieder des Konvents und die Angehörigen des »revolutionären Geschlechts«, der Frauen von Paris, eine prunkvolle Totenfeier. Nach seiner Aufbahrung in der Kirche der Franziskanermönche, im Volksmund Cordeliers genannt, wurde sein Herz in den Gewölben des Klosters separat bestattet, indessen der Körper im Jardin des Cordeliers beigesetzt wurde (von wo er wenig später ins Pantheon überführt wurde); diese kirchlichen Gebäude hatten seit April 1790 der »Gesellschaft der Freunde der Menschen- und Bürgerrechte« als Clubhaus und Parteizentrale gedient; die Herz-Vase verschwand nach dem Ende der terreur unter ungeklärten Umständen.
Wie immer man das symbolische Gewicht solcher Einquartierungen und Okkupationen traditionellen Raums bewerten möchte, gewiß ist jedenfalls, daß die Ereignisse wie die Diskurse und Gebärden zwischen 1789 und 1795 in keiner Hinsicht dem konstruktivistischen Phantasma eines Neubeginns auf einer tabula rasa nahekamen: Es gab zu keiner Zeit einen leeren »republikanischen Raum«, in dem sich die Männer der Stunde wie Geschöpfe aus einer zukünftigen Welt hätten bewegen können. Wenn in der Revolution fast nichts beim alten blieb, so doch im alten. Die operativen Qualitäten des Umbruchs manifestierten sich durchwegs in Form von Neubesetzungen, Subversionen und Umfunktionierungen gegebener Bestände. Dem entspricht die Beobachtung, daß die Revolution fast nichts gebaut, aber fast alles umbenannt hat.6 Mit diesen politischen Sprechakten, von denen naturgemäß keiner so folgenreich war wie die Umbenennung und Umwandlung der Generalstände in die Nationalversammlung, gehen oft reale und einschneidende Umwidmungen einher, von denen die beiden symbolpolitisch anspruchsvollsten die Einrichtung eines nationalen Pantheons in der Votivkirche der heiligen Genoveva bewirkten – einer Art von Nationalarchiv für die Asche und den Nimbus großer Männer;7 ferner die Umwandlung des Louvre in das erste nationale Großmuseum, in dem befreite (vulgo geraubte) Kunstschätze aus aller Welt nebeneinander zur letzten Ruhe gebettet werden sollten.8 Immerhin fallen auf dem Gebiet des Abschaffens einige Innovationen auf: Nachdem bereits 1790 die Sklavenfiguren am Sockel der Statue Ludwigs XVI. auf der Place des Victoires in Paris entfernt worden waren, wurde nach dem Volksaufstand des 10. August 1792 die Statue selbst beseitigt.9 Auf dem Höhepunkt der Jakobinerherrschaft wird der »öffentliche Raum« von den Personendenkmälern der Monarchie leer geräumt; sie werden vorübergehend durch Freiheitsstatuen und republikanische Allegorien ersetzt; an zahlreichen Orten verweisen improvisierte Altäre des Vaterlands, nebst den obligaten Freiheitsbäumen, auf die martialische Zivilreligion des Jakobinismus, die ihren Adepten die Pflicht zum Selbstopfer so energisch auferlegte, wie eine monotheistische Missionsreligion es kaum auf dem Höhepunkt ihres Expansionselans vermocht hätte.
Mit der nationweiten Umfunktionierung feudaler und klerikaler Säle für die Versammlungsbedürfnisse der Vertreter des Dritten Standes (allein Paris mit seinen revolutionären 48 Sektionen meldete einen enormen Bedarf an Tagungsstätten, Beratungskabinetten, Gerichtssälen, Verwaltungszimmern und Gefängnissen an) waren die Raumforderungen des nouveau régime keineswegs erfüllt. Schon im ersten Jahr der Revolution wurde die Notwendigkeit erkennbar, große Versammlungsstätten zu schaffen, in denen sich nicht allein die Repräsentanten treffen konnten, sondern auch die Repräsentierten, die Volksmasse selbst, die Gelegenheit erhalten sollten, sich bei festlichen Anlässen als aktuell präsentes Plenum der neuen »Gesellschaft«, das heißt als souveränes Nationalvolk, in wohlgeordneten Formen physisch zu versammeln. Daß dies angesichts der demographischen und geographischen Verhältnisse Frankreichs, das damals circa 25 Millionen Menschen zählte, bestenfalls auf der Ebene der größeren Städte und dort nur approximativ zu verwirklichen gewesen wäre, konnte dem Ideal des republikanischen Massenplenums nichts von seiner mobilisierenden Wirkung nehmen. Die Bürgernation, die sich als erhabene Adresse vor sich selbst aufgerichtet hatte, wollte zumindest okkasionell auch gleichsam vollzählig festlich an einem einzigen Ort bei sich und unter sich sein – ohne Rücksicht auf die Tatsache, daß die moderne Gesellschaft asynodisch verfaßt ist: Es ist ihr erstes und wichtigstes Merkmal, daß sie keine versammlungsfähige Einheit mehr bildet. Dies unterscheidet sie radikal von der antiken Demokratie, die ganz von der Forderung durchdrungen war, die Polis müsse eine versammelbare Größe bleiben (bei Ausschluß von Frauen, Kindern und Sklaven).
Unter der Wirkung des Versammlungsenthusiasmus kamen – man möchte meinen unvermeidlich – die antiken Modelle von Bauwerken für Großversammlungen umgehend wieder suggestiv ins Gespräch: Mit dem Amphitheater der Griechen sowie dem Zirkus oder der Arena der Römer stellte die europäische Antike zwei bewährte Großversammlungskonzepte zur Verfügung, deren formale Perfektion auch nach einer Unterbrechung von mehr als 1500 Jahren eine Wiederaufnahme gestattete. Es wirkt im Rückblick wie eine prophetische Vorübung, wenn die Pariser Akademie schon zu Beginn der achtziger Jahre Wettbewerbe für öffentliche Festgebäude ausschrieb: 1781 für eine Fête publique; 1782 für einen Zirkus, 1783 für eine Menagerie mit einer Arena; ähnliche Motive lagen den Wettbewerben der Jahre 1789 und 1790 zugrunde – wobei auch zu dieser Zeit an eine Realisierung kaum gedacht war. (Immerhin hatte das ancien régime mit der antiken Arena als absolutistischer Festkulisse kokettiert: 1769 wurde anläßlich der Hochzeit des Dauphins mit Marie-Antoinette am Rond Point auf den Champs Elysées ein riesiges Gebäude im Stil des Kolosseums aufgeführt, das ein Jahrzehnt lang als populäre Vergnügungsstätte diente, ehe es wegen Baufälligkeit abgerissen werden mußte.) Die akademischen concours bewegten sich noch ganz im Bann spätabsolutistischer Volks-Regie-Phantasmen. Sie genossen die Lizenz, mehr oder weniger folgenlos von großen Behältern für die passiv-jubilatorische Zusammenballung der Untertanen angesichts spektakulärer Macht- und Kunstrepräsentationen des Königtums zu träumen.