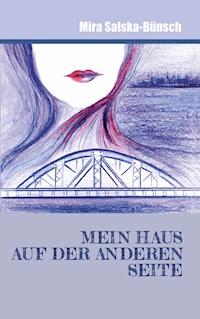
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Roman "Mein Haus auf der anderen Seite" liefert eine spannende Migrantenstudie, in der die Autorin auch eigene Erfahrungen verarbeitet hat. Anna, die Hauptfigur, schildert das Ankommen aus ihrer Sicht. Intensive, emotionelle, zum Teil poetisch geprägte Beobachtungen führen zu einer schnellen Annäherung oder gar Identifikation der Leser mit Anna. Migranten, die nach Deutschland gekommen sind, bestätigt die Lektüre des Romans ihre Erlebnisse. Wer dieses Thema nicht aus eigener Erfahrung kennt, bekommt einen eindringlichen Einblick in ein Labyrinth aus Konflikten und Schwierigkeiten, denen Ausländer ausgesetzt sind, die versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen. Für beide Seiten beleuchtet das Buch die neuralgischen Punkte des interkulturellen Miteinanders und kann somit zum Verständnis beitragen. Das Buch ist flüssig geschrieben: Wer einmal mit dem Lesen begonnen hat, mag nicht mehr aufhören.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Hellmut
Inhalt
Die andere Welt
Die Grenze
Das Amt
Eine Frau aus dem Imbiss
Seltsamer Vogel
Das Erstaunen
Das Labyrinth der Stadt
Alltägliche Orte
Inka
Der Vagabund
Das Konzert
Der Wandel
Alles auf einmal
Die Feder
Eine dokumentarische Fiktion
Alles und nichts
Ein blauer Elefant
Kamerablitz
Auf der Spitze
Die Feder
Die wiederkehrende Welle
Die Ente auf der Alster
Chaos und Ruhe
Die Brise vom See
Die Stimme aus der Ferne
Die Angst
Das Wochenende
Erkundung des Steins
Die Bilder
Die Ausstellung
Ballett
Die Schirmmütze
Der Himmel über der Stadt
Die Fensterscheiben
Vogel und Pierrot
Ansiedlung
Die Sprache
Die Phantasie
Die Oase
Sich die Stadt vertraut machen.
Verschollene Häuser
Das Kino
Ein gut geschnittener Anzug
Ausrutschen
Der Obdachlose
Zusammennähen
Der Keller
Die Wanderung
Zitate
I. Die andere Welt
Die Grenze
Mit großer Mühe versuchte sie aufzuwachen, langsam öffnete sie die Augen. Durch die heruntergelassenen Rollos schimmerte ein sanftes, grünliches Licht. Sie schaute sich in dem unbekannten Schlafzimmer um. Alles war ihr hier fremd. Die schräge Decke sollte in dem Raum eine kuschelige Ecke erschaffen, für sie war sie aber wie ein Sarkophag, dessen Wände auf sie zu kippen drohten. Es war offensichtlich, sie wachte in einem ihr unbekannten Haus auf – konnte ja weder die Straßenbahnen oder Autos noch Gelächter, das Schieben der Stühle und das Klirren des Geschirrs bei den Nachbarn hören – den gewöhnlichen Lärm des Hochhauses von früher.
Dieser hatte sie schon immer begleitet.
Dafür aber drangen das Rauschen der Bäume und das Donnern des Flugzeugs hinein. Langsam kehrte die Erinnerung an das Rattern des Zuges zurück, mit dem sie viele Stunden gefahren war, bis sie die Grenze erreicht hatte.
Das ist mein erster Tag in dem fremden Land – dachte sie langsam. Gestern bin ich hier angekommen. Sie zog die Vorhänge zurück und schaute aus dem Fenster. Bäume, Büsche, Blumen, wie ein grünes Meer, wo alles zusammenwuchs – der Wald mit dem Garten. Das hatte einen anderen Charakter als in ihrem Land – da waren entweder Wälder oder Gärten. Hier war alles vermischt und bildete eine andere grüne Konfiguration. Einige Gärten gingen flüssig in andere über und breiteten sich aus.
Ein seltsamer Anblick, alles miteinander vermischt, wie mein eigener Weg, auf dem zwei verschiedene Welten existieren, so als ob ich zweimal lebte. Sie schaute auf die Rabatte vor dem Haus. Es gibt Vögel, Bäume, sie sind so wie bei uns, oder ich kann keinen Unterschied sehen … Aber man sieht keine Spatzen.
Es ist so, als ob ich in einer anderen Welt aufgetaucht wäre. Indem ich mein Land verlassen hatte, trennte ich mich von allem, was ich da gemacht hatte, wer ich da geworden war.
Anna erinnerte sich an ein Fragment aus »Durch den Spiegel und was Alice dort fand«, ihrem Lieblingsbuch aus der Kindheit.
»Im nächsten Augenblick war Alice durch und leichtfüßig in den Spiegelsalon hinab gesprungen. (…) Dann fing sie an sich umzusehen und stellte fest, dass, was vom alten Raum aus gesehen werden konnte, ganz gewöhnlich und uninteressant war, aber dass alles andere so verschieden wie möglich davon war.«1 Ich bin auf die andere Seite des Spiegels geraten. Ich bin hier, aber wo? Die Stadt kannte sie nicht. Was werde ich jetzt tun? Sie ist zum Spiegel gegangen. Die Frau mit den Gesichtsfalten, dem durchschnittlichen Aussehen und mit ihrer Welt, die ist hier nicht präsent; sie eignet sich nicht gut für die Rolle in einem Roman, die Heldinnen sind meistens junge Mädchen. Frau Bovary war über dreißig Jahre alt und man konnte sie nicht mehr glaubwürdig für eine Liebesgeschichte besetzen.
Anna wandte sich von dem Spiegel ab, sie konnte im Moment nicht zu viel Selbstanalyse gebrauchen. Sie fühlte sich dieser Alice von der anderen Spiegelseite näher als Frau Bovary.
Alice wollte nicht nur in einer anderen Welt sein, sondern auch wissen, wie diese funktionierte und wie sie selbst sich dort verhielte. Sie beschäftigte sich mit dem Rätsel von »Schebberroch«, spielte Krocket mit Flamingos, vertieft in die Geheimnisse kultureller Organisation der Welt oder in die Regeln des Schachbretts. Es drohte ihr, dass die Königin sie köpfen würde, wenn sie nicht die richtige Antwort gefunden hätte. Alice wusste, wie sie sein sollte:
»Königinnen haben auf ihre Würde zu achten, nicht wahr! Deshalb stand sie auf und ging umher – anfangs noch ziemlich ungelenk, da sie befürchtete, die Krone könnte herab fallen: aber sie beruhigte sich mit der Überlegung, dass niemand sie sehen konnte, ›und wenn ich wirklich Königin bin‹, sprach sie, indem sie sich wieder setzte, ›werde ich schon zur rechten Zeit im Stande sein, ganz richtig damit fertig zu werden.‹« 2
Bisher bin ich wie aufgedreht herumgelaufen, jede Sekunde musste verplant sein, dachte Anna, und jetzt ist es, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Irgendwo in der Tiefe des Hauses hörte sie das Ticken der Uhr. Es war wie in einem leeren Ballon, sie hatte Angst, lauter zu treten.
Die einfachen Dinge schienen ihr fremd zu sein. Wollte sie sie als etwas Bekanntes betrachten, wandten sie sich von ihr ab. Der Tisch war zu hoch, und die Stuhllehne neigte sich zu weit nach hinten. Sie stolperte über unbekannte Bücherschrankfüße, die Kommode wollte sich nicht schließen lassen, und Anna brach sich die Fingernägel ab. Die Sachen ließen ständig an sich erinnern.
Ich bin wie Gulliver, der in einem fremden Land gelandet ist und sich ständig wundert, dass er seinen eigenen Platz nicht finden kann.
Wie kann man die Erfahrung aus der alten Welt in dieser »fremden Welt« anwenden? In der »eigenen Welt« lebt man intuitiv, fast automatisch, weil wir das Wissen darüber von der Kindheit an sammeln. Damals wusste ich, wer ich war, weil ich das in Augen aller, die mich seit der Kindheit gekannt hatten, sah. Hier kenne ich niemanden, außer Michael, ihn aber auch nicht gut.
»Jetzt bist du mit mir zusammen, Anna«, sagte Michael, und es gab keinen Zweifel daran, die Vögel sangen berauschend in den letzten Sonnenstrahlen des Abends. Er war jetzt die einzige Person, in deren Augen sie sich finden konnte. Am Morgen, als er wegging und sie noch in im Halbschlaf war, sagte er:
»Auf Wiedersehen, erinnerst du dich daran, dass ich heute nicht zurückkomme? Ich fahre für eine Woche nach München.«
Sie war noch nicht wach, aber überrascht, dass er das in einer fremden Sprache sagte, er war ihr so nahe, sprach aber fremd, irgendwie existiert man in eigener Sprache anders als in fremder Sprache.
Sie schaltete das Radio ein. Die Geräusche, die aus dem Hörer dröhnten, erinnerten an diejenigen, die sie aus den Kriegswochenschauen kannte. Sie zappte durch die Kanäle und lauschte dem Radio, es redete etwas die ganze Zeit, aber sie verstand nur wenige Worte dieser Sprache, die ihr einst beigebracht worden war, um sie als Feindsprache erkennen zu können. So hatte es sich ergeben, nachdem sie so viele Kriegsfilme geschaut hatte. Das steckte noch im Gedächtnis vieler Leute aus ihrem Land. Keiner von ihnen – auch Anna und Michael nicht – hatten Schuld daran, dass sie aus verschiedenen Kulturen stammten und dass das, was zunächst das Gleiche zu sein schien, sich als etwas ganz Anderes erweisen konnte.
Sie schaltete das Radio aus, und die Stille dröhnte in ihren Ohren. Sie öffnete die Terrassentür. Der Garten bildete für sie eine grüne, sichere Höhle. Zwei Drosseln liefen ihr entgegen, als ob sie ihnen schon lange bekannt wäre. Die Kinderstimmen aus der Nachbarschaft waren auch fremd, aber auf eine sanfte, angenehme Art. Das beruhigte sie. Nichts begrenzt mich mehr, dachte sie, und ich kann alles von Neuem anfangen. Aber »alles« – das war zu viel, sie wusste nicht, wo anfangen, und was hier überhaupt für sie möglich war.
Im Garten stand der Rasenmäher, an der Wand fand sie eine Steckdose. Ich fahre ein wenig durch das Gras, ich mag den Duft des gemähten Rasens, es wird wie auf der Wiese sein. Langsam bewegte sie das Gerät, und unter ihren Füßen zeichnete sich ein Streifen des gemähten Grases ab, die erste selbstständige Arbeit hier. Hinter den Bäumen zeigte sich plötzlich eine Nachbarin.
»Guten Tag«, fing Anna an, und versuchte zaghaft, sich in der Sprache der Nachbarin vorzustellen. Die Frau sah sie sehr aufmerksam an. In ihren Augen wuchs Verwunderung an. Anfangs noch aufgeschlossen, wurde sie langsam misstrauisch.
Sie hat gerade entdeckt, dass ich Ausländerin bin, dachte Anna. Ich spreche so wie Kinder oder ungebildete Menschen. Ich mache Fehler, die ungehobelt klingen.
»Sind Sie Michaels Frau? Gefällt es Ihnen hier?«
»Ja, doch, der Garten braucht aber viel Arbeit. Überall das Unkraut …«, redete sie in einer Sprache, die nicht ihre eigene war, die sie bloß in der Schule gelernt hatte. Sie sprach und kontrollierte sich ständig. Konzentriert auf die Worterkennung, konnte sie kaum die Intention verstehen. Sie ahnte nur, dass etwas nicht in Ordnung war, und ihr war, als ob sie gleich enttarnt werden sollte.
»Woher stammen Sie?«, horchte die Nachbarin sie aus.
Anna sagte den Namen ihres Landes und der Stadt. Die Nachbarin wurde für eine Weile still, als ob sie andere Themen suchte, schließlich erwiderte sie:
»Wissen Sie, dass um diese Zeit kein Rasen gemäht werden darf?«
»Entschuldigung, aber ich mag den Duft des gemähten Rasens so sehr, und deswegen …«
»Also ich möchte Sie auf jeden Fall informieren, dass Ihre Bäume und Büsche außerhalb zugelassener Grenzen wachsen.«
Ȇber welche Grenze sprechen Sie?
»Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche!«
Die Nachbarin wandte sich ab und ging weg, vielleicht hatte sie übel genommen, dass Anna das alles nicht wusste.
Anna ging zurück ins Haus. Das war mein erstes Gespräch hier, dachte sie, als die Tür zuschlug. Nun, man kann mit ihr nicht reden. Das Ganze ging aber ins Leere, weil wenn sie sich in der fremden und nicht in der eigenen Sprache äußerte, war alles nicht wirklich.
Anna fühlte sich unbehaglich, als ob sie in der Schule wäre, als ob sie Theater spielte oder löge. Das war nicht ernst, irgendeiner (hochnäsigen, überheblichen, selbstherrlichen) Nachbarin konnte sie sich mit ihrer ganzen Vergangenheit nicht einfach so vorstellen. Dass sie auch jemand ist! Die Andere musste das überhaupt nicht tun. Sie war hier jemand, sie wohnte hier seit Jahren und wusste alles, was jeder hier wissen sollte.
Mein Land verbinden sie mit Diebstahl und Chaos, dachte Anna weiter. Ich bin von vornherein angeklagt. Sie weiß damit schon alles über mich, und sie denkt vielleicht sogar, dass sie mich meiden sollte – eine gefährliche Person als Nachbarin.
All diese Vorwürfe konnten ihre Erfindung sein – oder es waren nur die Vorurteile gegenüber ihrem Land, die in der Luft schwebten und in solcher Situation wie diese ganz real wurden. Eigentlich wusste die Nachbarin nichts über sie und wollte auch nichts wissen, und Anna konnte sich ihr nicht aufdrängen, und das auf Grund eines anderen Stereotyps. In dieser nördlichen Stadt war es wichtig, Distanz zu halten, nicht zudringlich zu sein, nicht zu stören, vornehm zu sein. Hier war es üblich, dem Eindringling zu sagen: Geh einen Schritt zur Seite, weil es frisch gestrichen ist. Ein Quälgeist kann jemand aus einer anderen Stadt sein, und sie stammt aus einem anderen Land, das außerdem keinen guten Ruf hat.
Anna fühlte sich damit wie im Fangnetz. Ich komme aus diesem Land, wo die Leute sich nicht waschen, wo sie klauen, sind chaotisch und zu emotionell. Ich weiß ja, dass es nur ein Klischee ist und nicht alle hier so denken. Es war für sie aber sehr schwer zu verstehen, was sie eigentlich dachten.
Sie ging zurück ins Haus. Hier fühlte sie sich wohler.
Ich muss planen, was ich heute machen werde. Was werde ich machen? Die Frage klang hier verkehrt. Was konnte sie nämlich hier machen? Sie hatte eine Pritsche und ihr Essen, aber sie existierte in einer Leere, voller Angst, nach draußen zu gehen.
In ihrer Heimat war sie immer sehr beschäftigt, hatte nie frei. Manchmal legte sie die Aktivitäten zusammen – zum Beispiel in einer langen Warteschlange im Laden analysierte sie die zu ihrem Vortrag benötigten Lektüren für die Studenten und machte sich auf der Einkaufsliste ein paar Notizen dazu. Ihre Zeit war völlig verplant. Nun träumte sie davon, sich für eine Weile zu setzen und dem Ticken der Uhr zuzuhören und so, wie in der Kindheit, kurz nichts zu machen und einfach nur zu sein. Jetzt lag die Zeit vor ihr wie ein Ozean, bewegte sich, ohne voranzukommen, der Tag hatte keine Form. Es bestand keine Notwendigkeit, etwas zu tun.
Ticktack, ticktack, die Uhr erinnerte sie lästig daran, dass sie nicht wusste, was sie mit sich selbst anfangen sollte.
Ich könnte die Sprache lernen oder die Zeitung lesen – oder ich schalte den Fernseher ein. Aber das würde bedeuten, dass wieder das Fremde sich öffnet und mich überschwemmt. In der Kindheit hatte sie einen fantastischen Roman über einen Mann gelesen, der nach vielen Jahrzehnten aufgetaut worden war. Das musste ein Schock für ihn gewesen sein. Er hatte weder moderne Gegenstände noch die Sitten oder Regeln gekannt. Er konnte nicht so denken, wie die »Anderen«. Es ist so, wie in der Kindheit, wenn ein Mensch seine Umgebung langsam erforscht, die Bekanntschaft seiner Verwandten macht, die Gefahren zu erkennen lernt und Menschen sucht, die ihm nahe stehen. Ein Kind ist jedoch offen, besitzt kein besonderes Vorwissen und verfügt über keine Klischees. Aus Neugier beobachtet es gerne, ist aber nicht argwöhnisch. Neigt nicht zu übertriebenen Analysen, weil diese es nur am Laufen hindern würden. Es ist völlig dabei und die Neugier treibt es weiter an. Es gibt kein Nachdenken, auch wenn die Nase dabei bluten könnte.
Ein Ersatz für eine Begegnung mit dem Unbekannten sind für die Erwachsenen Reisen. Früher bin ich viel gereist, dachte Anna. Das war aber etwas anderes. Eine Reise bedeutet meistens nur einen Wechsel der Landschaft, der Umgebung. Wir sind innerlich weiterhin mit unserer Welt unterwegs. Wir möchten uns nicht ändern, weil – wofür auch? Wir kehren ja wieder zurück.
Von hier, wo sie nun war, konnte Anna nicht plötzlich aussteigen und wieder in die bekannten Landschaften zurückkehren, wo keine unbequemen Fragen gestellt werden.
Für »diesen Ort« findest du in dir kein Vorbild, und alles von hier, was du mit dort vergleichen wirst, wird dich nur an das Verlorene erinnern, und du wirst dich danach sehnen und dann vielleicht weglaufen wollen und dorthin zurückkehren, warnte sie eine Bekannte, die auch emigriert war.
Ich möchte hier leben, also muss ich für das Neue Platz machen, für die Orte, Menschen, auch für mich selbst, weil ich hier auch ganz anders als in meinem Land reagiere.
Hier scheint mich alles zu attackieren, so wie diese Nachbarin, dachte sie, während sie Armstrongs »On the sunny side of the street« hörte. Von welchen Grenzen hat die Nachbarin gesprochen, warum sollten wir unsere Bäume schneiden, warum kann man um diese Zeit keinen Rasen mähen? Weil er austrocknet, oder? Vielleicht ist diese Nachbarin doch nicht so schlimm.
Zuerst muss ich in Ruhe auf die Straße gehen und mich mit der Gegend vertraut machen.
Rote Pflastersteine führten zwischen Backsteinhäusern, alle waren in ähnlichem Stil, weiter hinten fing die Region weißer Villen an, noch weiter kamen die Backsteinhäuser zurück – alle in Gärten. Der Bürgersteig wurde in jeweilige Zonen für Fußgänger und Fahrradfahrer aufgeteilt, die Einfahrten zu den Häusern hatten einen anderen Belag.
Sie sprang schnell auf den Bürgersteig, weil die Fahrräder ihr hinterher bimmelten. Alles war so rational und vernünftig geplant, die Pflastersteine farblich ausgewählt, aber keine Kinder spielten Himmel-und-Hölle auf der Straße, wie es in ihrem Land üblich war, malten nicht mit Kreide darauf – dafür waren die Gärten und Parks gedacht. Es waren überhaupt sehr wenige Kinder, sie wurden nur manchmal gesehen, wenn sie in den Autos zur Schule oder zu ihren Freunden gefahren wurden.
Als sie auf der Straße lief, reagierte niemand auf sie. Keiner zeigte sich erstaunt, sie zu sehen, obwohl man sie ja als eine Neue in dieser kurzen Familienhäuser-Straße durchaus hätte bemerken müssen.
Das Amt
Ich muss jemanden ansprechen, sonst werde ich wahnsinnig. Ich kann nicht wie eine Pflanze vegetieren. An der Haltestelle traf sie einen schwarzen jungen Mann, den sie direkt fragte, obwohl sie wusste, dass es hier nicht üblich war:
»Woher stammen sie?«
»Ich bin aus Ghana.«
Er redete in gebrochenem Deutsch, aber wie ein Wasserfall, auch er vermisste wohl ein Gespräch.
»Accra? Die ist wunderschön, und du bist auf der Straße nicht gefährdet, obwohl du die Straßenregeln nicht so befolgen musst, wie hier. Die Leute schleichen zwischen den Autos, aber es gibt keine Unfälle, weil alle das locker nehmen.«
»Ich fühle mich hier nicht frei«, wiederholte er immer wieder.
Sie versuchte wirklich, ihn in dieser kurzen Zeit zu verstehen, konnte aber nicht, sie sah nur sein schwarzes Gesicht und dass er sie überzeugen wollte, ein gleicher Mensch zu sein.
Er merkt überhaupt nicht, dass ich auch nicht von hier bin. Sie fürchtete, dass er ihr gleich ein Angebot macht, ihr Drogen zu verkaufen. Sie lächelte ihn an, aber heimlich dachte sie, dass sie sich Ghana nicht vorstellen konnte, auch nicht deren Sonne, Autos, das Gebrüll in den Straßen. Sie schaute sich im Bus unruhig um, während alle gleichgültig nach vorne blickten. Nur sie und der junge Mann sprachen miteinander, in dieser schrecklichen deutschen Sprache und so laut, dass wahrscheinlich alle mithören mussten, aber zu gut erzogen waren, um das zu zeigen. Sie beruhigte sich, als er plötzlich aufgesprungen war, ohne sich zu verabschieden.
Anna ging zur Ausländerbehörde, um sich eine Aufenthaltserlaubnis zu holen. Sie hat früher nie gedacht, dass man ohne ein Recht zu bleiben sein kann. Das Haus, in dem sie geboren wurde, gehörte ihrer Familie, und sie brauchte sich sonst keine Gedanken darüber zu machen. Das Amt hier sollte ihr eine Aufenthaltsgenehmigung erteilen.
Die Ausländerbehörde befand sich in einem großen Gebäude – an einer lebhaften Kreuzung. Ein enger Eingang und auf dem Betonpodest ein Sicherheitsposten. Man musste der uniformierten Wache mit selbstsicherer Stimme »Guten Tag« sagen, sonst konnten sie einen anhalten und Fragen stellen. Schließlich zeigten sie das gesuchte Zimmer, setzten aber auch ein Signal, dass du nicht zu Hause bist und die Regeln lernen musst, zum Beispiel darfst du dich nicht herumtreiben, und vor dem Zimmer solltest du in der Schlange warten.
Das Gebäude war wie ein vierstöckiges Labyrinth. Die Betonkorridore verzweigten sich aus seinem Inneren heraus, aus einer Senkrechten mit dem Treppenhaus und dem Fahrstuhl. Sie führten im Halbrund durch das Gebäude, und an keiner Stelle konnte man ihr Ende sehen. An manchen Türen gab es Schilder mit einer Nummer und dem Namen des Beamten oder der Beamtin.
Sie suchte das ihr zugewiesene Zimmer auf eigene Faust, ohne die Wache zu fragen. Ein Flur war mit Metallstäben verriegelt. Sie hielt an, wollte nicht riskieren, sich nachher bei den Beamten entschuldigen zu müssen. Sie fuhr ein Stockwerk weiter, suchte ein Fenster, aber es war nur ein Korridor. Noch einen Stock höher, und sie fand die entsprechende Tür. Überall drängten sich die ethnisch gemischten Petenten. In der Luft hing der Geruch von Ausländern, eine Mischung aus Alkohol, Angst und verborgener Hoffnung, dass vielleicht diesmal etwas gelingt, weil es ohne diese Hoffnung kein Leben gab. Die Männer rauchten, junge Mütter wickelten ihre Kinder. Mit den Nummern in der Hand warteten alle daran, an die Reihe zu kommen. Nur wenige redeten, man spürte die nervöse Atmosphäre und eine versteckte Feindseligkeit. Anna begab sich in die Menge, und als die Tür sich öffnete, wurde sie zusammen mit anderen Frauen an die Wand gepresst, aber dann fischte der Beamte sie als die einzige Weiße aus der Menge der Frauen heraus. Sie überlegte, ob sie dankbar sein oder sich all diesen Frauen gegenüber schämen sollte, die müde mit ihren heulenden Bündeln warteten. Für ihren Platz waren sie zu viele, also zeigte sie keine mutige Geste.
Anna ging in das Zimmer und hielt vor dem Arbeitstisch des Beamten an. Ein junger, sportlicher Mann blätterte in den Dokumenten, die Formulare stapelten sich auch in den Schränken. Er zeigte ihr den Stuhl und schaute sie unwillig an. Sie fühlte sich ihm gegenüber so dankbar, dass sie nicht mehr aufmerksam war, was auf einem Amt doch notwendig ist.
»Zuerst bekommen Sie die Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr …«
»Warum, ich bin doch mit einem Deutschen verheiratet?«
»Es gibt viele Scheinehen, wir versuchen, diese Machenschaften einzuschränken.«
»Aber das nötigt ja zu einem provisorischen Leben! Die Leute müssen sich einbürgern, arbeiten …«
»Liebe Frau, wir zwingen niemanden, hierherzukommen. Vorläufig dürfen Sie nicht arbeiten. Wenn Sie die Daueraufenthaltserlaubnis bekommen, können Sie sich um die Arbeitserlaubnis kümmern.«
»Aber ich arbeite sowieso zu Hause.«
»Was machen Sie?«
»Ich schreibe verschiedene Artikel und ein Buch über die Migration.«
»Das dürfen Sie nicht machen. Sie dürfen keine Artikel und kein Buch schreiben, bis Sie eine Arbeitsgenehmigung bekommen!«
»›Ich weiß nicht, was Sie meinen‹ , sprach Alice ( …). ›Wenn ich ein Wort gebrauche‹ , sprach Humpti Dumpti in ziemlich höhnischem Ton, ›bedeutet es genau, was es nach meinem Belieben bedeutet soll – nicht mehr und nicht weniger.‹ ( …)
›Die Frage ist‹ , sprach Humpti Dumpti, ›wer Herr im Haus ist – das ist alles‹«.3
Anna schaute auf den gut gebildeten Beamten, einen jungen Mann, der mit der Macht seines Amtes ihr zu schreiben verbot. Wieso sprach ich mit ihm so offen, machte sie sich Vorwürfe. Hatte mir das Leben in meinem Land nichts beigebracht? Oder vielleicht hat sie von dort die Illusion mitgeschleppt, dass es im Westen anders sei, dass man mit der Ausländerbehörde ganz normal sprechen könne.
Es hatte keinen Sinn, das Gespräch fortzuführen, er wusste genau, was er sagte und wozu. Ich bin nicht daheim, und jeder hat das Recht, mir etwas zu sagen, und ich kenne ihre Sprache zu wenig, um treffend zu kontern. Sie fühlte sich hundsmiserabel. In dem Flur waren immer noch sehr viele Leute. Sie fühlte sich solidarisch mit ihnen.
Sie setzte sich für eine Weile hin und sah ihnen zu. Entweder schrumpfte die Zahl der Wartenden, oder echte Kerle spielten plötzlich Spaßvögel, und die Frauen versuchten entzückend zu sein, aber ihr Eifer verglühte vor der geöffneten Tür, hinter welcher ein sportlicher Beamter saß, der sie wie gebrauchte Socken ansah. Ihre Gesichter wurden schnell blass und resigniert. Man sollte viel Geduld haben, wenn man auf einen neuen Termin wartet, der die Sache vielleicht vorwärtsbringt.
In der S-Bahn-Station verkaufte ein Obdachloser das Straßenmagazin »Hinz & Kunzt«. Sie gab ihm zwei Euro, um sich besser zu fühlen. Er war noch tiefer gefallen, weil er seinen Platz bereits akzeptiert hatte.
»Schönes Wetter heute, nicht wahr?«, sagte sie mit starkem Akzent.
»In der Nacht war es heute besonders schön«, antwortete der Obdachlose. »Wissen Sie, ich möchte nicht mehr in einem Haus wohnen. Ich würde ersticken, in der Nacht muss ich immer aufstehen und in die Sterne schauen.«
»Ihnen muss ich keine Einheimische vorspielen.«
Er schaute sie an, aber er verstand sie nicht.
Sie war von der Ausländerbehörde noch nicht weit entfernt. Hier fingen die engen Gassen mit alten, dicht nebeneinander geparkten Autos an. Mit diesen Autos waren viele von denen gekommen, die in den Fluren des Gebäude-Labyrinths saßen. Sie lebten in diesem Land schon so lange, dass sie sich ein Auto leisten konnten, aber zitterten noch weiter, ob sie doch nicht abgeschoben werden.
Eine kleine Döner-Kebab-Kneipe. Im Fenster nicht nur Verkauf vom Essen, sondern auch eine Info, dass es drinnen einen Kopierer gibt, dass man dort Türkisch und Arabisch spricht, und auch ein Plakat: »Alle Leute sind auf der Erde als Ausländer geboren«.
Sie ging dort hinein und blieb neben einem Tisch stehen. Ein junger Kellner kam zu ihr.
»Ich hätte gern einen Kaffee.«
»Heute gibt es keinen Kaffee, wir haben Feiertag.«
»Aber die Anderen trinken …«
»Andere sind was Anderes …«, sagte er und wusch energisch die Tischplatte ab.
»Warum sagen Sie das?«
»Gehen Sie in das Lokal gegenüber, da bekommen sie etwas zu trinken«, antwortete der Bursche.
Er zeigte ihr ein kleines Geschäft am Ende der Straße, rot angestrichen. Sie ging geistesabwesend dahin, traurig, dass man sie auch hier nicht haben wollte. Sie ging in das Lokal hinein, ohne den komisch aussehenden, dunklen Saal näher zu betrachten. Erst als sie pornografische Bilder sah, überkam sie ein Unbehagen. Nachdem sie sich schon an die Dunkelheit gewöhnt hatte, kam ein widerlicher Kerl auf sie zu und fragte sie:
»Junge Dame, suchst du einen geilen Kerl? Wir haben hier viele – und mit Gummi!«
Wie verscheucht sprang sie auf und lief die kleine Straße hinab. Sie atmete auf, als sie das Gebäude des Hauptbahnhofs wieder erkannte. Das graue Betongebäude wirkte diesmal sehr gemütlich. Sie fand ihren Bahnsteig und wurde langsam ruhiger.
Eine Frau aus dem Imbiss
Zu Hause fand sie auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht von Michael vor, dass er in München gut gelandet sei, und dass er dort noch bis zum Wochenende bleiben müsse.
Das Abendbrot aß sie vor dem Fernseher, sich durch die Kanäle durchzappend. Es waren ein paar hundert, manche verschlüsselt. Sie hoffte danach auf Schlaf, aber ihr Traum wiederholte erschreckend die Realität.
Sie kletterte in der Dämmerung schnell auf ein Baugerüst. Aber die da unten sahen sie, drohten ihr mit den Händen, grinsten und verspotteten sie, versammelten sich in den Ecken, um miteinander zu flüstern …
Ihre Hände wurden von Metallkälte durchdrungen. Sie hatte Angst. Sie wusste, dass sie noch schneller und noch höher klettern musste. Sie war außer Atem und die ganze Zeit in Panik, sie versuchte, Stützen für Hände und Füße zu finden, sie rückte nach oben vor, ohne ihr Ziel zu kennen, immer müder werdend. Obwohl sie sich so viel Mühe gab, schaffte sie es nicht, sich zu entfernen.
Sie stieg noch schneller hinauf, aber sie hörte noch ihre Stimmen. Das Gerüst wackelte immer mehr. Sie konnte nicht mehr nach unten schauen.
Und schließlich stürzte das Baugerüst zusammen. Es fielen Bücher, Enzyklopädien, Notizzettel, irgendwelche Dissertationen, Berge von Karteikarten auf sie herunter … Plötzlich stürzte sie auf eine grüne Wiese, und vor ihr öffnete sich ein weiter Raum. Endlich konnte sie aufatmen.
Michael war nicht zu Hause, also musste sie sich den ganzen Tag selbst einrichten. Sie hatte noch niemanden von hier kennen gelernt, konnte nicht einfach irgendwohin gehen und sich zwischen den Leuten erwärmen. Sie schaute in die Zeitung, um einen Kinobesuch zu planen. In großen Städten gehen viele Leute alleine ins Kino, dort dürfte sie sich wohl fühlen.
Sie hatte sich für »Montag Morgen« von Otar Iosseliani entschieden. Auch er kannte die Emigration. Die Hauptperson, Vincent, flieht vor seinem täglichen Leben in Reisen und Abenteuer. Er fährt nach Venedig. Das ist nur eine Spritztour, die meistens etwas Wunderbares ist. Er gerät zufällig an eine Migrantengruppe aus seinem Land: Verkleidet in alte Uniformen, stellen sie sich selbst in der Vergangenheit dar. Der falsche Marquis zeigt dabei sein »Vorfahren-Portrait«, das er bei einem Straßenverkäufer erworben hat. Iosselianis Film demonstrierte verschiedene Posen, keine passte aber zu ihr.
Nach dem Kino ging Anna zum türkischen Imbiss, Kebab zu kaufen. Dort lernte sie Yeter kennen, die dort Verkäuferin war. Yeter sprach sehr wenig Deutsch, aber sie konnten sich dennoch verständigen. Yeter war in Annas Alter, sie trug kein Kopftuch, aber sie versuchte auch niemanden zu überzeugen, dass sie in diese Welt hineingehörte.
Das Lokal wurde zu Annas erstem Orientierungspunkt in der Stadt. Sie besuchte den Imbiss meistens nach dem Kino, welches das beste Filmprogramm in der Stadt hatte, aber sich in einem verrufenen Stadtviertel befand. Anna empfand es als gemütlich, weil dieses Stadtviertel sie an die Gegend erinnerte, in der sie früher gewohnt hatte. Die Frau aus dem Imbiss begrüßte sie bald wie eine gute Bekannte und versuchte oft mit ihr ein paar Worte zu wechseln, weil sie mittlerweile gemerkt hatte, dass auch Anna eine Ausländerin war.
Anna beschäftigte sie später als Putzfrau. Sie konnte sich das leisten. Michael war es wichtig, dass sie sich nicht als »Putzfrau« in seinem Haus fühlte. Es war schön hier, aber sie empfand das Haus nicht als ihr eigenes. Das war der Grund, Yeter zu beschäftigen. Seit Anna Yeter beschäftigte, musste sie genau überlegen, was zu Hause in Ordnung gebracht, was renoviert und aufgeräumt werden sollte. Auf die Weise lernte sie das Haus besser kennen, und langsam wurde es zu ihrem Haus. Eine Putzfrau zu haben, gab ihr auch ein gutes Gefühl. Die Nachbarin, die sie am Anfang so angemacht hatte und später ignorierte, merkte schnell, dass eine Türkin zum Putzen kam, während sie selbst keine solche »Perle« hatte.
Yeter hatte sich selbst als Putzfrau angeboten. Sie brauchte Geld, also würde sie gerne Anna helfen. Auf die Weise glich sich ihr Verhältnis aus. Anna wurde Frau »so und so«, bei der Yeter putzte, aber sie trafen sich manchmal auch privat.
Einmal hatte Yeter Anna sogar zum Kaffee eingeladen.
»Ich habe Kinder und einen zweiten Mann.«
»Wie ist es bei euch möglich?«, fragte Anna.
»Weißt du, hier ist alles anders. Ich werde sowieso nicht in die Türkei zurückkehren«, lachte Yeter.
Sie sprachen über dieses und jenes.
»Weißt du was, mein echter Vorname ist anders als der im Ausweis. Mein wahrer Name ist Ayten. Im Ausländeramt haben sie ihn geändert, weil sie nicht verstehen konnten, wie man ihn schreibt, und so steht es in allen meinen Papieren – Yeter! Ayten – ist ein sehr schöner Name, bedeutet Haut, wie im Mondlicht, und Yeter nur so lala.«
Anna fühlte sich sehr wohl mit ihr, weil sie schon sehr lange in dieser fremden Welt wohnte, und obwohl Yeter die einheimische Sprache nicht gut beherrschte, konnte man mit ihr sehr gut kommunizieren – mit Worten, Gesten, manchmal auch Zeichnungen. In der hiesigen Welt ertrug sie mit Geduld viele Demütigungen, aber in ihrer Umgebung, unter ihren kurdischen Landsleuten, hatte sie ihren Wert. Sie wusste Geld zu verdienen, sich um ihre drei Kinder und auch um ihren zweiten Mann zu kümmern. Aber nach der Einwanderung ist sowieso alles anders, und einige sind da fanatisch.
Anna beobachtete Yeter beim Putzen, weil diese seit langem in dieser Branche arbeitete und die neuesten Putzmittel zu kaufen wusste, sie kannte spezielle Lappen für Fenster und Spiegel, und sie kannte sich mit solchen Staubwedeln aus, die mit Perfektion den Staub abwischten, ohne sie ständig abklopfen zu müssen. Das war eine ganze Wissenschaft. Yeter ließ Anna spezielle Chemikalien kaufen, besondere Mittel fürs Glas und für die Dusche, andere für die Spüle und wieder andere für den Herd.
Für Yeter-Ayten war Anna wiederum eine Fremde wie sie selbst, aber auch eine Dame »von hier«, und weil sie sich auch irgendwie angenähert hatten, machte es ihr Mut, dass man mit »denen von hier« doch zusammen leben konnte.
Sie saßen in dem Kebab-Lokal zusammen und unterhielten sich. Für Yeter war es wichtig, dass die Anderen es hören konnten – dass sie mit der Frau, bei der sie putzt, Deutsch spricht, und dass sie ebenbürtig sind. In dem Lokal saßen überwiegend Männer. Es zeigte sich, dass es nicht nur Türken, sondern auch Kurden waren, und das störte niemanden. Sie tranken Kaffee zusammen und wahrscheinlich redeten sie über ihre Geschäfte. Hier musste man sich gegenseitig helfen, um zu überleben, eine alte Feindschaft war nicht sinnvoll. Anna konnte sie nicht voneinander unterscheiden. Sie wollte aber niemanden danach fragen, um nichts kaputt zu machen. Zu lange vermisste sie eine gemütliche Höhle in der Stadt. Hier musste sie niemandem beweisen, dass sie den anderen gleichwertig war.
Am Anfang wollten die türkischen Einwanderer sich den Einheimischen annähern, wünschten sich, Anerkennung in dem fremdem Land zu bekommen, obwohl sie manchmal solche Arbeiten ausführten, die niemand hier übernehmen wollte. Aber es war ihnen nicht gegeben, die Wärme zu spüren, die sie vermissten. Sie hörten auf, danach zu verlangen. Ihre Frauen zogen Kopftücher über, fingen an, andere Sitten zu demonstrieren, und wollten sich nicht mehr integrieren.
Eines Tages ging Yeter Anna beim Verlassen des Kebabs hinterher, schaute sich unruhig um, fasste Anna am Ellbogen und hielt sie an der Tür an.
»Hast du diesen älteren Mann im Lokal gesehen? Das ist Ali, ein Türke. Seine Nichte ist mit einem Jungen aus ihrer Klasse, einem Jungen, der von hier ist, in die Disco gegangen. Als sie nach Hause zurückgekommen war, brach der Onkel ihr einen Finger, um sie zu bestrafen. So ist es bei ihnen. Das Mädchen lief von zu Hause weg, wahrscheinlich wohnt sie in so einem »Haus für Frauen in Not«, oder versteckt sie sich anderswo.«
Danach verabschiedete sich Yeter herzlich von Anna. Diese fragte sich, ob Yeter ihr spontan Vertrauen zeigte, oder ob es eine Warnung war, dass sie trotz aller Freundlichkeit in Gesprächen nicht zu weit gehen dürften. Türkische Mädchen, obwohl hier geboren, werden nur dann rechtlich geschützt, wenn sie von zu Hause fliehen. Sehr oft es ist dann zu spät. Es ist vorgekommen, dass ihre Väter, Brüder oder Cousins sie mit Gewalt dazu zwangen, nach Hause zurückzukommen. Wenn ein Mädchen vor einer arrangierten Ehe flüchtete, war es dann die Sache der Ehre, es zurück zu bringen, auch mit Gewalt, mit Schlägen, mit der Bereitschaft, es zu töten. Manchmal passierte sogar das Schlimmste.
Yeter war eine Kurdin, geschieden, ohne familiäre Beziehungen, sie war auf sich selbst angewiesen. Sie baute eigene schützende Fassade. Offiziell, für andere, hatte sie ihren Mann in der Türkei, der irgendwann nachkommen würde. In Wirklichkeit war ihr Mann irgendwo in Europa, aber hatte seit langem keinen Kontakt mehr zu ihr oder zu seinen Kindern. Viele Einwanderer verbargen etwas. Die alten Beziehungen lasteten sehr oft auf der neuen Lebenssituation, was auch ein Zeichen der Entwurzelung war.
Anna wollte sich nicht verstecken, so wie ihre andere Bekannte es machte. Maria, eine Ukrainerin mit deutschem Pass, hatte die Sprache, all die Ausdrücke und grammatischen Formen perfekt gelernt, aber die östliche Melodik der Stimme verriet sie stets. Maria war Annas nächster Anhaltspunkt in der Stadt. Sie hatte einmal laut »Hallo« zu Anna gerufen, als sie Einkäufe am Gemüsestand gemacht hatte. Wahrscheinlich hatte sie gemerkt, dass Anna manche Bezeichnungen nicht bekannt waren und sie sich mit den Händen behelfen musste. Sie hatte auf Anna gewartet und sich ihr vorgestellt. Sie hatten darüber geredet, was sie machten, wo sie wohnten und über ihre erwachsenen Kinder. Sie waren sich schnell nahe gekommen.
Einmal hatten sich beide in der Nische eines Cafés versteckt und kommentierten die neuesten Ereignisse: Synagogen waren überfallen worden, ein schwarzhäutiger junger Mann auf dem Weg nach Hause war getötet worden – er hatte zwei Kinder hinterlassen. Ganz diskret riet Maria ihr ab, in diesem Land zu bleiben, wo ein Mensch heimlich eine Null war, nur weil in seinen Adern nicht das deutsche Blut floss und er deshalb nie als gleich anerkannt würde.
»Und das ist paradox, weil meine Familie rein deutsch ist, aber seit vielen Jahren in den ›Sowjets‹ lebt, was man an meiner Sprache leider merken kann.«
Maria hatte einen echten deutschen, wenn auch verarmten, Freiherrn geheiratet, der Sonnenbatterien verkaufte, dessen Manieren aber sehr vornehm waren. Maria, die aus einem kommunistischen Land stammte, war von seiner unbeabsichtigten, natürlichen Kultiviertheit fasziniert. Sie fühlte sich manchmal verloren, weil sie, der Meinung ihres Mannes nach, gelegentlich leider kein Gespür dafür hatte. Also stand sie zu Hause öfter auf verlorenem Posten. Sie versagte in sehr einfachen Momenten: Mal holte sie für den Kuchen Essbesteck heraus, mal legte sie die Servietten auf die rechte Seite, und zwischen den Gläsern für Bordeaux und für Burgunder konnte sie auch nicht unterscheiden. Der Baron machte kein Problem daraus, er pflegte zu sagen: »Maria macht schon wieder Revolution, aber sie bessert sich«. Es war für ihn sehr wichtig, dass seine Frau äußerlich immer klassisch wirkte. Das erforderte jahrelang gemeinsame Einkäufe, damit sie nicht schon wieder intuitiv Klamotten wie vom russischen Markt wählte. Am Ende gab Maria es auf, ihre Kleidung selbstständig zusammenstellen, weil das meistens »ohne Pfiff« war. Sie kaufte Kleidung nur in Blau, Beige und Weiß, und jede Farbe trug sie separat. Als sie eines Tages ihren Charme mit einer bunten, glitzernden Kette betonen wollte, war sie auch nicht erfolgreich. Auch das ging daneben.
»Maria trägt heute afrikanischen Flitterkram«, hatte er gesagt und sie zärtlich von ihrem Schmuck befreit.
Um ihr Familienleben zu vereinfachen, ließ er jede noch so geringe Ausgabe in den Computer eintragen, was vom Excel sofort addiert wurde. Maria war dafür sehr dankbar, weil sie die Zahlen nur mühsam behalten konnte.





























