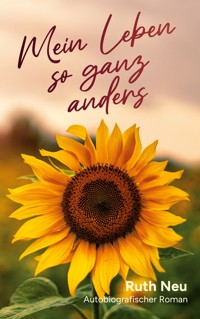
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mein Leben als Pflegerin und Geschwisterkind Ruth Neu wuchs in einer Familie mit drei Schwestern und einem Bruder auf. Als ihre Eltern sich trennten, war sie elf Jahre alt. Ihr Vater, der 72 Jahre alt war, lebte weit entfernt, und Ruth übernahm die aufopferungsvolle Pflege seines Haushalts. Die Anforderungen waren enorm, aber die herausfordernde Situation machte sie nur stärker. Zuhause jonglierte sie zwischen dem Kochen für ihre Geschwister Barbara und Christian, dem Haushalt und ihren schulischen Verpflichtungen. Diese Erfahrungen führten zu ihrem Berufswunsch in der Altenpflege. Zusammen hielten sie zusammen, egal was das Leben brachte. Dieses Buch erzählt Ruths bewegende Geschichte – von der Kindheit bis zum Verlust ihres Vaters im Alter von 18 Jahren. Es ist ein berührender Einblick in das Leben einer starken Frau, die sich den Herausforderungen des Lebens mutig stellte und dabei ihre Familie nie aus den Augen verlor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Enkelin Zoe
Du bist mir in vielerlei Hinsicht so unglaublich ähnlich.
Deine Energie und Lebensfreude sind inspirierend.
Inhalt
1. Wie alles begann
2. Claudia
3. Die neue Wohnung
4. Trauriger Besuch
5. Weihnachten
6. Heimweh
7. Zäsur
8. Immer neue Pflichten
9. Eva-Maria heiratet
10. Zwölf und irgendwie schon sehr erwachsen
11. Herr Kube
12. Ruhe vor dem Sturm
13. Unheimliche Begegnung
14. Aus Kindern werden Leute
15. Konfirmation
16. Vatis 79. Geburtstag
17. Ein denkwürdiger Tag
18. Erste Schritte ins Berufsleben
19. Endlich achtzehn!
20. Für immer fort
21. Komplizierte Familienverhältnisse
22. Das Leben geht weiter
23. Große Überraschung
24. Der Herr ist mein Hirte
25. Rauswurf
26. Erste eigene Wohnung
27. Rendezvous mit Claus Bremer
28. Ricarda und Thomas
29. Prüfungsstress
30. Warmer Regen
31. Ein toller Käfer
32. Kindheitserinnerungen
33. Neuer Mitbewohner
34. Doppelter Abschied
35. Schulbankdrücken – Klappe, die dritte!
36. Miss Schönheits Läuterung
37. Lieber Besuch
38. Getrennte Wege
39. Ab in den Süden!
40. Der Alltag hat uns wieder
41. Er liebt mich, er liebt mich nicht …
42. Schwesternliebe
43. Elisabeth feiert Einweihung
44. Schon wieder umziehen …
45. Agnes’ Geburtstagsparty
46. Neue Liebe, neues Glück?
1
Wie alles begann
Hallo, ich bin Ruth, 61 Jahre alt und seit 36 Jahren glücklich verheiratet. Unsere Tochter heißt Catharina, mein Ehemann Eduard. Gemeinsam mit meinem Mann lebe ich im sonnigen und schönen Grömitz an der Ostseeküste.
Ich habe vier Geschwister. Mein Vater wurde im Jahr 1901 geboren, meine Mutter 1933. Der Altersunterschied zwischen meinen Eltern betrug also 32 Jahre. Hinzu kam, dass sie nicht verheiratet waren, was für die damalige Zeit doch eher ungewöhnlich, wenn nicht gar gesellschaftlich verpönt war und sie immer wieder vor neue Herausforderungen stellte.
Meine Geschwister und ich haben alle biblische Namen. Meine älteste Schwester heißt Elisabeth und ist gelernte Krankenschwester. Danach kommt Eva-Maria, die eine Ausbildung zur Schuhverkäuferin begann, dann aber mit siebzehn ihr erstes Kind bekam und die Ausbildung abbrach. Als meine Neffen zur Schule gingen, machte sie eine Umschulung zur Altenpflegerin. Mit beinah dreißig Jahren erlernte Barbara, meine dritte Schwester, den Beruf der Kinderkrankenschwester. Und dann ist da noch mein Bruder Christian, der erst eine Bäckerlehre absolvierte, später aber, als sein Leben in Schieflage geriet, Theologie studierte und heute Pastor ist.
Meine Schwestern sind weit verstreut und leben in Vancouver, Italien und Salzburg, mein Bruder wohnt in Hamburg und ich wie gesagt an der Ostsee.
Mein Leben lief von Anfang an nicht so, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Am Tag meiner Geburt hatte meine Mutter wie immer alle Hände voll zu tun. Barbara wollte ihre Haferflocken nicht essen, Christian hatte seine Windel vollgemacht, Elisabeth und Eva-Maria spielten mit ihren Puppen und sangen laut.
Mein Vater las wie jeden Morgen seine Zeitung, als meine Mutter draußen die Wäsche aufhängte und plötzlich Wehen bekam. Zunächst schenkte sie dem keine Beachtung, aber als sie beinah fertig war, schrie sie so laut auf vor Schmerz, dass mein Vater die Zeitung beiseitelegte, meine Mutter über den Rand seiner Brille hinweg ansah und meinte, dass es wohl losgehe.
»Nein, schon wieder besser, war wohl nur der schwere Wäschekorb«, erwiderte meine Mutter.
Die Tasche für das Krankenhaus war schon seit längerer Zeit gepackt. Mein Vater war schließlich schon 61 Jahre alt. Ein Telefon oder Auto hatten wir nicht, sodass mein Vater am späten Nachmittag zum Nachbarn hinüberlief, der gerade im Garten beschäftigt war.
Es vergingen noch ein paar ruhige Stunden, in denen die Wehen abnahmen, aber dann setzten sie heftiger und in immer kürzeren Abständen wieder ein.
Meine Mutter kannte den Ablauf sehr genau, aber dieses Mal war es irgendwie anders. Sie gab meinem Vater noch ein paar Anweisungen und dann kam auch schon das Taxi. Der Taxifahrer sah die aufgerissenen Augen und den kugelrunden Bauch meiner Mutter und kombinierte schnell, dass es wohl zum Krankenhaus gehe.
»Oh ja, ganz schnell bitte! Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit. Sie müssen wissen, das ist mein fünftes Kind«, stieß meine Mutter atemlos hervor.
Der Taxifahrer verstand und gab Gas. Meine Mutter versuchte, sich zu beruhigen und die Wehen wegzuatmen. Aber das war leichter gesagt als getan.
»Ich heiße Werner«, meinte der Taxifahrer, wohl um sie abzulenken, aber das half meiner Mutter auch nicht weiter. Jede Ampel war rot. Und das Warten machte meine Mutter unruhig.
»Wir haben’s gleich geschafft«, redete der Taxifahrer freundlich auf sie ein, doch sie hatte plötzlich sehr starke Wehen und stöhnte so laut auf, dass er etwas zu ruckartig anfuhr und sie meinte, das Baby würde gleich kommen.
»Was?!« Nun gab Taxifahrer Werner noch mehr Gas und überfuhr so manche Ampel bei Gelb.
Endlich am Krankenhaus angekommen, sprang er aus dem Auto und schrie: »Ein Baby, ein Baby! Schnell, sonst erblickt es noch in meinem Taxi das Licht der Welt!«
Eine Krankenschwester kam herbeigelaufen, verschaffte sich einen Überblick über die Situation, beruhigte meine Mutter und half ihr vorsichtig aus dem Taxi.
Kaum lag meine Mutter auf einer fahrbaren Trage, verstärkten sich die Wehen. »Es geht los!«, rief sie.
»Da könnten Sie recht haben.« Die Krankenschwester nickte.
Froh darüber, dass ich nicht in seinem Taxi zur Welt gekommen war, wünschte Taxifahrer Werner meiner Mutter alles Gute und brauste davon.
Die Krankenschwester lief, so schnell sie konnte, zum Krankenhaus, während sie den Arzt anrief.
Im Kreißsaal blieb keine Zeit mehr, meine Mutter auszuziehen. Hebamme, Arzt und Krankenschwester schafften es gerade noch, mich kleines Baby gesund auf die Welt zu bringen. Da war ich nun: acht Pfund schwer und 49 Zentimeter groß.
»Wieder ein Mädchen!«, rief meine Mutter. »Jetzt habe ich vier Mädchen und einen Jungen.«
Eigentlich hätte ich ein Junge werden sollen – ein Spielkamerad für Christian. Aber das Schicksal hatte es offenbar anders gewollt. Am 6. Juni 1962, um 18 Uhr, erblickte ich das Licht der Welt.
Während meine Mutter und ich im Krankenhaus lagen, hatte mein Vater mit meinen Geschwistern alle Hände voll zu tun. Am allerschlimmsten fand er es, die langen Haare der Mädchen und die dichten Locken meines Bruders zu kämmen und all die vielen Kletten zu entwirren. Außerdem musste er die Betten machen, Essen kochen, die Rasselbande an- und umziehen und so weiter. Seinen Erzählungen nach ging es sehr turbulent und laut zu.
Nun wollte mein Vater mich auch unbedingt sehen und brachte Elisabeth und Eva-Maria zu unserer Nachbarin Lieselotte Richter, die meine Schwestern nach Strich und Faden verwöhnte. Sie selbst war kinderlos geblieben und genoss es, sich um meine Geschwister zu kümmern. Frau Richter konnte ganz ausgezeichnet kochen und backen und die Nachbarskinder durften alles bei ihr. Sie setzte ihnen keine Grenzen.
Mein Vater bedankte sich. »Es wird nicht lange dauern. Meine Frau ist schon seit drei Tagen im Krankenhaus und heute werde ich sie und unser Baby nach Hause holen. Barbara und Christian nehme ich mit.«
»Herzlichen Glückwunsch«, gratulierte Frau Richter.
»Danke«, antwortete mein Vater.
Barbara und Christian freuten sich, erst mit der Bahn ins Krankenhaus – wir wohnten nämlich in Hamburg-Barmbek und dann mit einem Taxi wieder nach Hause zu fahren.
Als mein Vater und meine Geschwister im Krankenhaus ankamen, waren alle drei sehr aufgeregt. Ganz leise öffnete mein Vater die Zimmertür meiner Mutter und auf Zehenspitzen schlichen die drei zum Bett. Meine Mutter hielt ihre Wange für ein Küsschen hin und ließ mich von meiner Schwester und meinem Bruder bewundern.
»Wie heißt denn unser Baby?«, wollte Barbara wissen.
»Ruth«, antwortete meine Mutter.
»Ah …« Meine Schwester strahlte. »Das kann ich schon sagen. Duth.«
Meine Eltern mussten beide über Barbaras niedliche Aussprache lachen.
»Wir fahren mit dem Taxi nach Hause«, erklärte sie stolz. »Weißt du das, Mama?«
»Ja«, erwiderte unsere Mutter. »Gleich geht’s los. Ich warte nur noch auf meine Entlassungspapiere.«
Mein Bruder Christian war ein Jahr alt, saß am Fußende des Krankenbetts und schaute vorsichtig zu mir herüber.
Endlich kam der Arzt, übergab unserer Mutter die Entlassungspapiere und gratulierte unserem Vater. »Oh, da sind ja schon zwei. Und so brav. Wie heißt ihr denn?«
»Barbara und Christian«, antwortete mein Vater an ihrer Stelle.
Der Arzt lächelte Barbara an, weil sie nur »Baba« sagen konnte. Die vielen »Rs« waren noch zu schwierig für sie.
»Was für ein schöner Name«, meinte er.
»Und das ist unser neues Baby Duth«, erklärte Barbara, was der Arzt mit einem amüsierten Lächeln quittierte. Dann wünschte er uns noch alles Gute und verließ das Zimmer.
Unten in der Empfangshalle bestellte mein Vater ein Taxi für uns. So kamen wir freudig nach Hause und holten Elisabeth und Eva-Maria bei unserer Nachbarin Frau Richter ab.
Frau Richter drückte meiner Mutter etwas in die Hand, erhaschte einen schnellen Blick auf mich und fragte natürlich nach meinem Namen.
»Die Kleine heißt Ruth«, sagte meine Mutter stolz.
Meine Eltern bedankten sich bei Frau Richter, dass sie meine Geschwister gesittet hatte, und Elisabeth und Eva-Maria erzählten, dass es Kakao und leckere Kekse zu essen gegeben hat
»Und vorgelesen hat Lotti uns auch.« Elisabeth und Eva-Maria sollten sie so nennen, das sei einfacher, hatte Frau Richter gesagt.
Nun beäugten mich Elisabeth und Eva-Maria neugierig und begrüßten mich mit einem freudigen »Hallo«.
Zu Hause angekommen, entschuldigte sich unser Vater, wie unordentlich es bei uns sei.
»Ach«, erwiderte meine Mutter. »Jetzt sind wir ja alle wieder da und die Großen können schon etwas helfen.«
Und so wuchsen wir als Großfamilie zusammen – sehr zum Missfallen meiner Schwestern übrigens, die mich ab und zu im Kinderwagen spazieren fahren oder auch einmal wickeln mussten.
2
Claudia
Abgesehen davon, dass ich mit einem Jahr so starken Keuchhusten hatte, dass ich beinahe daran erstickt wäre, und meine Eltern sich große Sorgen um mich machten, verlief meine Entwicklung ganz normal.
Mit vier Jahren freundete ich mich mit der Nachbarstochter Claudia an. Sie hatte ein wunderschönes Zimmer und alle Spielsachen, die ein Kinderherz begehrte. Zu Hause spielten wir mit Wäscheklammern und meine Schwester Barbara und ich mussten uns eine Puppe teilen. Es gab Knetmasse, Buntstifte und Papier zum Malen.
Da Not bekanntlich erfinderisch macht, habe ich mir einen kleinen Puppenwagen aus einem Schuhkarton gebastelt und ein Frotteehandtuch hineingelegt. Mit einem Dosenöffner machte ich ein Loch in den Karton, stibitzte meiner Mutter einen langen roten Wollfaden und zog den Puppenwagen durch unsere Wohnung.
Jeden Morgen rief Claudia: »Ruthchen!«, anstatt an unserer Haustür zu klingeln, und wenn ich rauskam, strahlte sie über das ganze Gesicht. Claudias Mutter steckte mir immer ein Milchbrötchen zu. Ihrer Meinung nach war ich vermutlich zu dünn.
Aber am schönsten waren all die tollen Spielsachen in Claudias Zimmer: sprechende Puppen, Autos mit Batteriebetrieb, drei(!) Barbies und haufenweise Kleider, Accessoires und traumschöne Abendroben. Oft vergaß ich beim Spielen die Zeit und wurde erst wieder in die Gegenwart zurückgeholt, wenn Claudias Mutti den Kopf zur Tür hereinsteckte und fragte, ob wir etwas zu knabbern haben wollten. Zu meinem Unmut verneinte Claudia beinahe jedes Mal, denn ich hatte immer Hunger und hätte am liebsten Ja gerufen. Bei all den tollen Spielsachen wäre etwas zu naschen die sprichwörtliche Kirsche auf dem Sahnehäubchen gewesen.
Eines Tages klingelte es bei Claudia und meine große Schwester Elisabeth stand vor der Tür. »Ruthchen, du hast wohl die Zeit vergessen. Wir müssen los. Zu Hause wartet Mama mit dem Mittagessen auf uns.«
Auf dem Heimweg erzählte ich meiner Schwester, dass Claudias Mutter uns gerade einmal wieder etwas zum Knabbern angeboten habe, ich aber leer ausgegangen sei, weil Claudia abgelehnt habe.
»Gut so!«, erwiderte Elisabeth. »Schließlich warten zu Hause alle mit dem Mittagessen auf uns.«
»Hast du gesehen, wie schön da alles ist?« Aufgeregt hüpfte ich von einem Bein auf das andere. »Claudia hat sprechende Puppen.«
Beinah unverständlich murmelte sie: »Wir müssen trotzdem nach Hause.«
»Und Autos, die von allein fahren können. Vielleicht sollte Christian mal mitkommen«, ignorierte ich ihren Einwand und plapperte munter weiter.
»Nein, Ruthchen«, schalt sie mich. »Du kannst doch nicht deine ganze Familie mitbringen. Das gehört sich nicht!«
Doch ich ließ mich davon nicht beeindrucken. »Ich frag mal Claudias Mutti …«
»Das lässt du schön bleiben!«, unterbrach mich meine große Schwester.
»Wieso denn?«, wollte ich wissen. »Die ist richtig nett. Wirklich! Die schenkt mir immer Milchbrötchen.« Nach einer kurzen Pause fügte ich hinzu: »Warum darf Claudia denn nicht mal bei uns spielen?«
In der Zwischenzeit waren wir zu Hause angekommen und meine Schwester blieb mir eine Antwort schuldig. Da sie sechs Jahre älter ist als ich, ging sie damals schon zur Schule und wusste, wie es bei uns daheim ablief.
So verging ein wunderbares Jahr, doch kurz vor meinem fünften Geburtstag durfte ich nicht mehr jeden Morgen zu Claudia zum Spielen gehen. Stattdessen sollte ich mich gemeinsam mit meinem Bruder Christian auf die Schule vorbereiten. Mein Vater formulierte kurze Sätze, in denen immer ein Wort fehlte, und wir sollten den Satz vervollständigen. Außerdem übte er mit uns leichte Rechenaufgaben, allerdings immer nur bis zu der Zahl zehn, da wir so beim Abzählen unsere Finger zu Hilfe nehmen konnten. Christian war schon etwas besser und half mir.
Umso mehr freute ich mich, wenn ich wieder zu Claudia zum Spielen gehen konnte. Ihre Mutter war so glücklich, mich wiederzusehen, dass sie mich in den Arm nahm und fest drückte. Auch Claudia freute sich sehr, als ich wiederkam, und versprach mir: »Dein Milchbrötchen wartet schon auf dich. Und nachher können wir auch noch was naschen.«
»Das darfst du aber nicht meinen Schwestern erzählen, wenn sie mich abholen«, bat ich schnell. »Ich habe nämlich immer Hunger.«
»Nein, das bleibt unser Geheimnis«, erklärte Claudia und zwinkerte mir verschwörerisch zu. »Das erzählen wir niemandem aus deiner Familie.«
Und so verbrachten wir vergnügliche Stunden zu zweit und erzählten meinen Schwestern, die mich abwechselnd abholten, kein Wort von den Süßigkeiten, die ich von Claudia und ihrer Mutter bekam.
Wenn ich wieder nach Hause kam, streichelte mein Vater mir über den Kopf und fragte mich jedes Mal, wie es bei Claudia gewesen sei. Und immer lautete meine Antwort: »Sehr schön.«
»Geh dir die Hände waschen, damit wir Mittagessen können«, pflegte er mich dann aufzufordern. Wenn ich Glück hatte, gab es mein Lieblingsessen: Wurzelgemüse mit Frikadellen und Kartoffeln.
Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, dass es bei Claudia zu Hause anders zuging als bei uns. Klar, sie hatte viel tollere Spielsachen, und es gab immer leckere Süßigkeiten, aber da war noch etwas anderes … Bei Claudia war es immer viel ruhiger, und das lag nicht nur daran, dass sie nicht so viele Geschwister hatte wie ich. Es herrschte irgendwie auch ein anderer Ton und ihre Eltern gingen besonders liebevoll miteinander um.
An meinem fünften Geburtstag erfuhr ich von meinen Eltern, dass wir in der kommenden Woche umziehen würden.
»Warum …? Wieso denn das?«, fragte ich geschockt. »Und Claudia? Die kann nicht mitkommen, oder?«
»Ach was!«, erwiderte meine Mutter. »Natürlich nicht. Die muss bei ihren Eltern bleiben.«
Ich war verzweifelt und mir kullerten die Tränen über die Wangen.
Mein Vater nahm mich in den Arm und versuchte, mich damit zu trösten, dass unsere neue Wohnung viel größer und schöner sei, aber in diesem Moment brach für mich eine Welt zusammen. Fortan sollte es also keine Milchbrötchen und Leckereien mehr geben und ich würde auch nicht mehr mit meiner besten Freundin in ihrem Kinderparadies spielen. Es hieß Abschied nehmen!
»In der neuen Umgebung findest du bestimmt schnell wieder eine Freundin«, meinte meine Mutter, doch ich hielt dagegen: »Ich will keine neue Freundin. Ich will Claudia!«
»Na, du kannst sie ja mal besuchen«, lenkte meine Mutter da ein und sofort hellte sich meine Miene auf.
»Ich muss gleich zu ihr und ihr das erzählen«, rief ich aufgeregt.
Mein Vater nahm meine Mutter zur Seite und raunte ihr ins Ohr: »Das hättest du Rutchen nicht sagen sollen. Sie ist doch so ein aufgewecktes Kind.«
Was das bedeutete, habe ich in diesem Moment aber nicht so recht verstanden – aufgeweckt hin oder her.
Als ich bei Claudia ankam, erfuhr ich, dass sie bereits Bescheid wusste. Meine Schwester Barbara hatte ihr die Neuigkeiten schon erzählt. Meine Freundin war sehr traurig und musste sich beherrschen, um nicht sofort wieder in Tränen auszubrechen. Auch ihre Mutti wirkte sehr betrübt. »Wir haben was Schönes für dich, Ruthchen«, versuchte sie, mich aufzumuntern, und überreichte mir eine batteriebetriebene Puppe, die sowohl sprechen als auch weinen konnte. Dazu gab es außerdem noch passende Kleidung – ein Sommer- und ein Winteroutfit.
»Freust du dich, Ruthchen? Vielleicht heitert dich die Puppe ein wenig auf«, meinte Claudias Mutti lächelnd.
»Vielen Dank! Ich freue mich riesig über die schöne Puppe«, gab ich zurück. »Wenn ich damit spiele, denke ich an dich, Claudia«, wandte ich mich an meine Freundin. »Und ich werde ihr den Namen Claudia geben.«
Da schimmerten Tränen in den Augen von Claudias Mutti und sie blinzelte sie schnell weg.
Schnell fasste ich mir ein Herz und fragte: »Darf mein Bruder Christian auch mal zum Spielen mitkommen? Claudia hat so tolle Autos und eine Carrera-Bahn. Da würde Christian sich sehr freuen, denn so schöne Spielsachen haben wir nicht.«
»Natürlich. Wenn’s weiter nichts ist«, antwortete Claudias Mutter lächelnd. »Die letzte Woche könnt ihr gern zu zweit zum Spielen herkommen.«
Später begleiteten mich Claudia und ihre Mutter nach Hause. »Soll ich mit reinkommen?«, erkundigte sich meine Freundin.
»Nein, das geht nicht«, gab ich schnell zurück. »Meine Mutter möchte das nicht. Sie ist ganz anders als deine Mutti … Sie küsst mich auch nicht so viel mein Vater, weißt du? Der ist ganz anders.«
Nachdem ich mich verabschiedet und unsere Wohnung betreten hatte, berichtete ich Christian als Erstes von den tollen Neuigkeiten. Als unsere Mutter das hörte, wollte sie gleich wieder Einwände erheben, doch unser Vater winkte ab. »Wenn Claudias Mutter das erlaubt, ist es doch in Ordnung, wenn Christian mit zum Spielen geht. Ist ja auch nur noch für eine Woche.«
Als das geklärt war, schnappte ich mir Barbara. »Warum erzählst du Claudia, dass wir wegziehen? Das hätte ich ihr lieber selbst gesagt.«
»Jetzt stell dich mal nicht so an«, tat meine Schwester empört. »Claudia hat draußen Ball gespielt und ich bin da vorbeigelaufen und hab’s ihr erzählt. Was ist schon dabei?!«
Mein Vater hörte unsere Auseinandersetzung, ließ uns aber gewähren. Na gut, der Klügere gibt nach. Und meistens war ich das.
Christian hingegen konnte sein Glück gar nicht fassen. Voller Freude umarmte er mich.
»Was ist denn hier los?«, wollte meine Mutter wissen.
»Christian freut sich, dass er mit mir zu Claudia darf und mit ihren vielen Spielsachen spielen kann«, erklärte ich ihr.
Und so gingen mein Bruder und ich am nächsten Morgen Hand in Hand zu meiner Freundin. Das Strahlen in Christians Augen zu sehen war dabei für mich das Schönste. Natürlich bekam auch er ein leckeres Milchbrötchen von Claudias Mutti. Zufrieden aß er es, während wir gemeinsam spielten und er die vielen tollen Spielsachen bestaunte. Am Ende bedankte er sich brav und fragte, ob er am folgenden Tag wiederkommen dürfe. »Na klar!«, antwortete Claudia. »Welches Spielzeug hat dir denn am besten gefallen?«
»Das große elektrische Feuerwehrauto«, erklärte er strahlend.
Als wir gemeinsam nach Hause liefen, sagte er mir, dass er auch gern einen so tollen Freund hätte, fügte dann aber betrübt hinzu, dass wir ja bald in einen anderen Stadtteil ziehen würden und er hoffe, dass ich dort wieder eine so tolle Freundin wie Claudia finden würde.
Ich erzählte ihm, dass Mama meinte, ich könnte Claudia ja ab und zu noch einmal besuchen, doch er sah mich nur vorsichtig
von der Seite an. Vermutlich wollte er meine Hoffnungen nicht zunichtemachen und erwiderte deshalb nichts.
Unsere letzte wunderbare Woche verging wie im Flug, und Christian dankte mir mehrfach, dass ich an ihn gedacht und ihn mit zu Claudia genommen hatte. Auch unser Vater honorierte das und meinte, er fände es toll, dass wir Geschwister so zusammenhielten.
Am letzten Tag bei Claudia nahm ich meine Puppe mit, die ich geschenkt bekommen und vor lauter Aufregung immer wieder bei Claudia vergessen hatte. Christian bekam zum Abschied das große elektrische Feuerwehrauto. »Was? Das ist für mich?«, konnte er sein Glück nicht fassen und vor lauter Freude kullerten ein paar Tränen über seine Wangen.
Auf unser Drängen hin brachten uns Claudia und ihre Mutti mit unseren Geschenken nach Hause. Mama sollte gar nicht erst auf die Idee kommen, wir hätten die Spielsachen einfach so mitgenommen, und uns am Ende noch ausschimpfen.
Vor unserer Haustür hieß es dann endgültig Adieu zu sagen. Wir bedankten uns für die Gastfreundschaft und die tollen Abschiedsgeschenke, und Claudias Mutti erklärte unserer Mutter, welch ein Glück ihr beschert sei, so tolle Kinder zu haben. Einen Moment war meine Mutter sprachlos, dann fand sie ihre Stimme wieder und bedankte sich.
3
Die neue Wohnung
In aller Frühe am nächsten Morgen kam der Möbelwagen. Christian und ich waren froh, dass unsere Mutter gut gelaunt war. Im Flur standen viele gepackte Kartons herum. Gern wären wir noch einmal kurz zu Claudia gelaufen, aber unsere Mutter hielt das für keine gute Idee. Geknickt gingen wir in unser Zimmer, als unser Vater uns entdeckte und meinte: »Wenn ihr euch beeilt, dürft ihr Claudia noch schnell Tschüss sagen.«
»Danke, Papa!«, riefen Christian und ich im Chor und rannten los.
Nachdem Claudias Mutti uns für die Fahrt noch Bonbons überreicht hatte und wir uns zum wiederholten Male Abschiedsküsschen gegeben hatten, gingen wir wieder heim. Begrüßt wurden wir von unserer missgestimmten Mutter und dem bereits auf uns wartenden Taxi. Wir stiegen ein, teilten die Bonbons unter uns auf und ignorierten unsere Mutter, die in einer Tour vor sich hin meckerte. Als ich die an uns vorbeifliegenden Häuser betrachtete, überlegte ich fieberhaft, wann wir wohl in unserem neuen Zuhause ankämen. Irgendwann drosselte der Taxifahrer die Geschwindigkeit, und ich entdeckte einige Kinder, die mit Kreide Figuren auf die Gehwegplatten malten, ein Mädchen mit einem Springseil und ein anderes mit einem Hula-Hoop-Reifen. Ich war so aufgeregt, dass ich für einen Moment sogar meine Freundin Claudia vergaß. Der Taxifahrer fuhr auf einen Parkplatz und hielt an. Der Möbelwagen war bereits eingetroffen. Als wir ausstiegen, schauten wir in viele neugierige Kindergesichter.
Mein Vater war mit dem Umzugswagen mitgefahren. Der eine Möbelpacker war sehr groß, hatte wie mein Vater einen dicken Bauch und lachte so breit, dass man all seine Zähne sah. Der andere Möbelpacker war klein und dünn, konnte aber trotzdem ordentlich zupacken. »Na, Kleine, willst du mithelfen?«, sprach er mich an. »Hier ist ein Lederranzen. Schaffst du es, den zu tragen?«
Ich gab mir alle Mühe, verlor jedoch das Gleichgewicht und fiel mitsamt Eva-Marias Ranzen zu Boden. Zum Glück eilte Christian mir zu Hilfe und brachte den Ranzen hinauf in unsere neue Wohnung.
Nach einer Stunde treppauf, treppab schwitzten und schnauften die Möbelpacker ordentlich, aber der dicke lachte trotzdem bei jeder Gelegenheit. Dabei nannte er mich immerzu »Zwerg«. Die Kinder schauten in den Umzugswagen und wunderten sich, dass so viele Leute nur so wenig Möbelstücke besaßen.
Das neue Haus hatte vier Stockwerke, unsere Wohnung lag auf der dritten Etage und hatte vier Zimmer.
»Dürfen wir spielen gehen?«, traute ich mich zu fragen.
»Auf keinen Fall! Ihr zwei werdet schön mithelfen.« Ja, unsere Mutter war sehr streng.
Sehnsüchtig sahen Christian und ich zu den Kindern hinüber und fragten uns, ob sie uns mögen würden, wenn sie uns erst kennenlernten.
»Wohnt ihr jetzt hier?«, rief uns eine Junge zu.
»Ja«, antwortete mein Bruder. »Wir ziehen gerade ein. Wie heißt du?«
»Ich bin Andreas, aber alle nennen mich Schnaki.«
Schmunzelnd erklärte mein Bruder: »Ich heiße Christian und das ist meine Schwester Ruth.«
Da kam Schnakis Schwester angelaufen und stellte sich als Petra – von allen nur Pedi genannt – vor.
»Hier spielt die Musik, ihr zwei!«, ertönte da die Stimme unserer Mutter.
»Tut uns leid, wir müssen helfen«, entschuldigten wir uns unisono und liefen zu unserer Mutter. Doch die Möbel und Kartons konnten wir nicht hinauftragen. Entweder waren sie zu groß, zu schwer oder zu unhandlich. Deshalb wurden wir losgeschickt, zehn Brötchen zu kaufen. Da wir uns in der neuen Gegend nicht auskannten, fragten wir Schnaki nach dem nächsten Bäcker. »Den findet ihr nie. Ich komme mit und zeige euch, wo er ist«, bot er netterweise an. Gesagt – getan.
Als wir wieder zurückkamen, hatte er uns alles Wichtige in unserem neuen Viertel gezeigt. Wir liefen hinauf in unsere neue Wohnung und dann gab es erst einmal heiße Würstchen mit Senf und ein Brötchen mit Butter. Patent wie unsere Mutter war, hatte sie alle wichtigen Lebensmittel sowie einen Kochtopf, Kaffee, Tee und Kaffeefilter in einen speziellen Karton gepackt. Elisabeth und Eva-Maria hatten in der Zwischenzeit den Tisch gedeckt, weil mein Vater vom vielen Rauf- und Runterlaufen total erschöpft war. Bis zu unserer Wohnung waren immerhin vierzig Stufen zu bewältigen.
Christian und ich freuten uns, so schnell schon neue Freunde gefunden zu haben, und als wir mit dem Essen fertig waren, ging es daran, die Möbel aufzustellen. Da in der neuen Wohnung genug Platz war, konnten unsere Hochbetten nebeneinanderstehen. Wir Mädchen zogen in das eigentliche Wohnzimmer, das Schlafzimmer wurde zum Wohnzimmer und Christian als einziger Junge bekam das kleinste Zimmer. Im letzten Raum wurde das Elternschlafzimmer eingerichtet. Mir war das egal. Hauptsache, ich würde bald wieder meine Puppe Claudia in den Armen halten. Tatsächlich schaffte es unser Vater, alle Betten noch am selben Tag aufzubauen, und das, obwohl er kein Handwerker war. Irgendwann war es so weit und unsere Betten standen alle nebeneinander, jeweils durch ein Nachtschränkchen voneinander getrennt. Inzwischen war es dunkel geworden.
»Die zwei Kleiderschränke muss ich morgen aufstellen, Kinder.« Unser Vater war sichtlich erschöpft und genau wie wir sehr müde.
Meine älteren Schwestern lasen mir noch eine Geschichte vor und in null Komma nichts war ich eingeschlafen. Auch ohne meine Puppe.
Am nächsten Morgen ging es hektisch bei uns zu, denn Elisabeth, Eva-Maria und Barbara mussten in ihre neue Schule. Meine Mutter weckte mich und Christian ebenfalls, da wir auf dem Rückweg von der Schule mit zum Einkaufen sollten. Zum Frühstück gab es Pfefferminztee und Bauernbrot mit Marmelade. Währenddessen war unsere Mutter dabei, Butterbrote zu schmieren und einzupacken.
»So, jetzt putzt euch die Zähne, damit wir loskönnen«, sagte sie, sobald wir aufgegessen hatten.
»Warum müssen wir denn mit?«, fragte ich Christian.
»Weil wir uns die Schule ansehen und hinterher mit einkaufen sollen«, erklärte er mir.
»Genau, und Papa baut in der Zwischenzeit die Kleiderschränke auf«, ergänzte unsere Mutter.
Als wir endlich an der Schule ankamen und ich die trostlosen grauen Blöcke betrachtete, dachte ich: Die gefallen mir überhaupt nicht! Unsere Mutter musste noch ins Sekretariat, und wir verabschiedeten uns von unseren Schwestern, denen ob der neuen Umgebung ganz schön mulmig zumute war.
Endlich beim Aldi-Markt angekommen, holte meine Mutter ihren Einkaufszettel heraus. Christian und ich durften uns beide »ein Teil Süßkram« aussuchen, wie unsere Mutter es nannte. Irgendwann war der Einkaufswagen so voll, dass man ihn kaum noch schieben konnte. Wie kriegen wir das nur alles nach Hause? schoss es mir durch den Kopf. Doch meine Mutter war offenbar zuversichtlicher als ich. »Ihr seid doch schon groß und kräftig. Gemeinsam schaffen wir das schon.«
Nachdem wir die Einkäufe auf mehrere Tragetaschen aufgeteilt hatten, ging es wieder nach Hause. Der Weg dorthin war wegen der schweren Taschen recht beschwerlich, und als wir den dritten Stock und unsere Wohnung erreicht hatten, waren wir alle außer Atem.
»Hallo, Papa!«, begrüßte ich unseren Vater, als er uns die Tür öffnete.
Lachend hob er mich hoch. »Mann, Ruthchen, du bist aber kräftig. Was habt ihr denn alles eingekauft?«
»Ja, immer diese Einkäufe. Wir brauchen halt so viele Lebensmittel«, entgegnete unsere Mutter, die immer noch außer Puste war.
»Willst du gar nicht wissen, was ich in der Zwischenzeit alles geschafft habe?«, fragte unser Vater vergnügt. »Mit Hilfe unseres Nachbarn hab ich sowohl die Kleiderschränke der Kinder als auch den großen Wohnzimmerschrank aufgebaut.«
Christian und ich freuten uns über diese Nachricht, aber unsere Mutter entgegnete: »Mit dem Nachbarn? Muss der nicht bezahlt werden?«
»Ach was!«, gab unser Vater leicht gereizt zurück. »So was nennt man Nachbarschaftshilfe.« Dann wandte er sich an mich. »Ruthchen, geh mal zu Herrn Freitag ins Erdgeschoss und bring ihm zwanzig Mark. Als Dankeschön für seine Unterstützung. Dann kann er sich ein paar Zigaretten kaufen.« Er machte eine kurze Pause, bevor er unserer Mutter erklärte: »Ich hab ihm übrigens erlaubt, auf unserem Balkon zu rauchen.«
Unsere Mutter rümpfte die Nase und murmelte etwas Unverständliches vor sich hin. Wir Kinder kannten das schon.
Ich folgte der Aufforderung meines Vaters und lief die Treppe hinunter. Das Treppenhaus war sehr sauber und hatte ganz weiße Wände. Kein Wunder, denn das Haus war erst neu gebaut worden. Nachdem ich geklingelt hatte, öffnete Herr Freitag die Tür. »Na, sind noch mehr Möbel aufzustellen?«, fragte er freundlich.
»Nein, ich soll Ihnen bloß Danke sagen und Ihnen das hier geben.« Ich streckte unserem netten Nachbarn den Zwanzigmarkschein entgegen. »Dafür können Sie sich Zigaretten kaufen.«
»Aber das wäre doch nicht nötig gewesen«, versicherte Herr Freitag. »Ich hab gern geholfen. Bitte gib deinen Eltern das Geld zurück. Und wenn ich noch etwas für euch tun kann, sagt einfach Bescheid.«
Ich lief also wieder nach oben und überreichte meiner Mutter den Geldschein. Ärgerlich steckte sie die zwanzig Mark in ihr Portemonnaie. Vermutlich war sie sauer, dass Herr Freitag unser Geschenk zurückgewiesen hatte.
Heute sollte es Kohlrabi mit Bratwurst und Kartoffeln zum Essen geben. Ich durfte den Kohlrabi umrühren. Die Bratwürste wendete meine Mutter selbst in der Pfanne, weil das Fett so spritzte. In der Zwischenzeit musste Christian den Tisch decken.
Geknickt kamen Elisabeth, Eva-Maria und Barbara nach Hause. Allen dreien gefiel es nicht so gut in der neuen Schule, aber davon wollte unsere Mutter nichts wissen. Zum Glück tröstete unser Vater meine Schwestern und versicherte ihnen, dass sie sich schon noch einleben würden. »Nun lasst mal nicht die Köpfe hängen. Das war euer erster Schultag. Es ist alles neu für euch – die Mitschüler, die Lehrer, der neue Lehrstoff. Habt ein wenig Geduld.«
Sonntags ging es immer in die Kirche zum Gottesdienst und hinterher gab es leckeres Essen mit Fleisch und Soße. Mein Vater machte ein kleines Mittagsschläfchen, meine Mutter wusch ab und eine meiner Schwestern musste abtrocknen. Danach wurde Mensch ärgere Dich nicht gespielt und es gab ein Stück Kuchen.
Alle anderen Tage liefen nach der immer gleichen Routine ab. Unsere großen Schwestern gingen in die Schule, während Christian und ich viel im Haushalt helfen mussten. Mittags aßen wir dann alle zusammen. Wenn die Hausaufgaben erledigt waren, durften wir alle spielen.
Irgendwann forderte mein Vater mich auf, ihm nach dem Frühstück die Zeitung vorzulesen. Das sei gut für meine sprachliche Entwicklung, meinte er. Am Anfang habe ich ziemlich lange gebraucht und viel herumgestottert. Schließlich musste ich mir jedes Wort erarbeiten und es lernen. Aber nach einem halben Jahr hatte ich schon riesige Fortschritte gemacht, sodass ich bereits flüssig lesen konnte, als ich mit sechs eingeschult wurde. Mein Vater war mächtig stolz auf seine jüngste Tochter.
Gebetet wurde bei uns zu Hause viel – vor jeder Mahlzeit und vor dem Zubettgehen. Das Gebet sprachen wir Kinder abwechselnd, so wie etwa: Danke, lieber Gott, dass wir zu essen haben und dass ich eine Freundin gefunden habe. Bitte, lieber Gott, pass auf mich auf, weil ich schon sehr wild rennen und hüpfen kann.
Unsere finanziellen Mittel waren begrenzt, daher bekam jedes Kind morgens und abends jeweils eine Scheibe Brot. Da Christian immer hungrig war, gab ich ihm meist eine halbe Scheibe ab, sodass auch mir oft der Magen knurrte. Wenn der Monat sich dem Ende neigte, gab es oft Arme Ritter – altes Brot mit warmer Milch, meist ohne Eier.
Kurz vor seiner Einschulung musste mein Bruder einen Test machen. Als er ihn bestanden hatte, sprachen meine Eltern bei der Schulleitung vor. Da ich ebenfalls dabei war, fragte meine Mutter die Direktorin, ob ich nicht gleich mit eingeschult werden könne, schließlich sei ich bereits sechs Jahre alt. »Ein Abwasch«, meinte sie.
»Dann wollen wir mal schauen, ob du schon schultauglich bist.« Freundlich lächelte die Schulleiterin mich an. »Wie heißt de denn?«
»Ruth«, antwortete ich pflichtbewusst.
»Kannst du denn auch malen?«
»Oh ja, ich male sehr gern.«
»Dann setz dich mal hier auf den Stuhl und mal mir ein schönes Bild«, forderte die Direktorin mich auf.
Meine Mutter machte schon Anstalten, mir zuzurufen, welches Motiv ich wählen solle, aber die Schulleiterin meinte: »Das schafft Ihre Tochter schon ganz allein.« Aufmunternd zwinkerte sie mir zu.
Als Erstes brachte ich eine große Sonne auf das Papier, danach ein rotes Haus auf einer großen grünen Wiese mit vielen Blumen und sieben Person, die sich an den Händen hielten. Zufrieden blickte ich auf.
»Na, dann wollen wir uns dein Bild mal genauer anschauen«, sagte Frau Knief, die Direktorin. Sie war sehr hübsch, trug das Haar hochgesteckt und hatte ein elegantes grünes Kleid an, das die Farbe ihrer Augen betonte. »Wer sind denn all die vielen Personen?«
»Meine Familie«, antwortete ich nicht ohne Stolz.
»Du hast aber vergessen, die Ohren zu malen, Ruth.«
»Nein, wir Mädchen haben lange Haare, da kann man sie nicht sehen«, erklärte ich. »Mein Bruder hat Locken, deshalb kann man die Ohren nur zum Teil sehen, darum hab ich ihm kleine Ohren gemalt. Und mein Vater hat einen Hut auf, weil er immer einen trägt, wenn er aus dem Haus geht.«
»Du bist aber schlau«, lobte mich Frau Knief. »Probier mal den Ranzen von deinem Bruder auf.«
Ich tat wie mir geheißen, brach unter der Last aber beinah zusammen.
»Oje, dann wird es wohl doch noch nichts mit der Einschulung«, meinte Frau Knief und wandte sich an meine Mutter. »Frau Wolter, Ihre Ruth ist wirklich plietsch, aber leider auch sehr dünn, beinah unterernährt. Sie sollten mal zum Amtsarzt mit ihr gehen.«
»Nein«, gab meine Mutter zurück, »das ist nicht nötig. Dann wird sie halt nächstes Jahr und erst mit sieben eingeschult.« Meine Eltern und ich verließen die Schule, holten uns Brötchen, gingen nach Hause und frühstückten erst einmal. Ich habe mich riesig gefreut, noch ein ganzes Jahr zu Hause bleiben zu dürfen. Mein Vater teilte meine Freude und herzte mich. Nur meine Mutter hatte wieder etwas zu nörgeln. »So ein Quatsch! Amtsarzt! So dünn ist Ruth ja nun auch wieder nicht!« Das war mal wieder typisch für sie. Anstatt sich zu freuen, dass sie ihre Jüngste noch ein Jahr länger um sich herum haben würde, musste sie herummeckern.
4
Trauriger Besuch
Eines Vormittags, nachdem wir die Hausarbeit erledigt hatten und ich meinem Vater aus der Zeitung vorgelesen hatte, wirkte er plötzlich sehr beunruhigt. »Ich mache mir Sorgen um Oma«, sagte er zu meiner Mutter. »Nach dem Mittagessen werde ich mal zu ihr fahren und nach dem Rechten sehen.« Dann sah er mich an. »Möchtest du mit zu Oma?«
»Ja, gern, Papa«, antwortete ich strahlend, während meine Mutter sich nur ein »Tu, was du nicht lassen kannst, Walter« abringen konnte.
Seit zehn Jahren lebte meine Oma nun schon in dem Altenheim in Bad Bramstedt. Da das nicht eben um die Ecke war, besuchten wir sie bloß ein-, höchstens zweimal im Monat. Jedes Mal forderte sie meinen Vater auf, unter ihre Matratze zu greifen, wo sie unser Taschengeld zu deponieren pflegte. Ihre finanzielle Unterstützung half meinen Eltern sehr und sie brauchte im Heim ja auch kein Geld mehr.
Wenn unsere Mutter selbstgebackenen Rosinenkuchen oder auch mal einen eingelegten Bismarckhering mitbrachte, freute meine Oma sich immer diebisch und ließ sich das Mitbringsel auf der Stelle schmecken. »Die klauen hier wie die Raben!«, lautete dann stets ihre Erklärung.
Als mein Vater und ich schließlich im Bus saßen, bekam ich einen Zitronenbonbon, der nicht nur aussah wie eine Zitrone, sondern ebenso sauer schmeckte. Trotzdem lutschte ich ihn tapfer, denn Süßigkeiten gab es bei uns zu Hause nur samstags. Entweder eine Tafel Schokolade für alle – da blieb für den Einzelnen natürlich nicht viel übrig – oder auch mal eine kleine Schale Chips. Und wenn wir Kinder uns stritten, nahm unser Vater denjenigen, der am lautesten weinte, mit ins Schlafzimmer. Dort gab es aber keine Standpauke, sondern ein kleines Trostpflaster in Form von Bruchschokolade mit ganzen Nüssen, die mein Vater in einer Dose im Schrank aufbewahrte.
Am besten hatte Barbara den Dreh heraus und wickelte unseren Vater ein ums andere Mal um den Finger. Nach einem ordentlichen Stück Bruchschokolade strahlte sie jedes Mal über das ganze Gesicht und entschuldigte sich bei uns, ohne dass mein Vater sie dazu aufgefordert hätte.
Als wir im Altenheim eintrafen, ging mein Vater erst einmal allein zu meiner Oma, während ich im Aufenthaltsraum wartete. Nach einer Weile lugte ich immer wieder um die Ecke, um nachzusehen, wo mein Papa blieb. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und schlich zum Zimmer meiner Oma. Die Tür war nur angelehnt, sodass ich hören konnte, was drinnen gesprochen wurde. Offenbar unterhielt sich mein Vater mit einer Altenpflegerin namens Erika. Plötzlich fiel mein Name, denn mein Vater berichtete, dass er nicht allein gekommen sei und ich im Aufenthaltsraum auf ihn warten würde. Er bat die Pflegerin, nach mir zu schauen, damit er bei seiner Mutter bleiben könne, die sicher jeden Moment friedlich in seinen Armen einschlafen würde.
»Kein Problem, Herr Butschkau. Ich schaue mal nach Ihrer Tochter und gebe ihr ein Stück Kuchen. Dann kann sie zusammen mit den anderen Bewohnern fernsehen.«
Schnell lief ich zurück in den Aufenthaltsraum. Wenige Augenblicke später erschien auch schon Schwester Erika und begrüßte mich fröhlich. »Hallo, Ruth, du kannst gern ein bisschen fernschauen. Ich habe dir Kuchen und einen Tee mitgebracht.«
Ich zögerte. Durfte ich das annehmen? Erika begriff und versicherte mir: »Das geht schon in Ordnung. Dein Papa hat’s erlaubt.«
Ich bedankte mich artig und Schwester Erika verließ den Raum. Nach einer Weile – ich hatte den Kuchen längst verputzt und den Tee ausgetrunken – kam mein Vater um die Ecke. »Na, Ruthchen, hoffentlich habe ich dich nicht zu lange warten lassen, aber deine Oma ist heute leider sehr müde.«
Als wir wieder im Bus saßen und auf dem Rückweg nach Hause waren, wirkte mein Vater sehr nachdenklich und traurig. Ich kuschelte mich an ihn und fragte ganz vorsichtig, warum er so lange am Bett meiner Oma gesessen habe. Ich hätte sie auch so gern in den Arm genommen. »Ist Oma für immer eingeschlafen?«, fragte ich ihn.
»Wie kommst du darauf, Ruthchen?« Irritiert sah er mich an. »Hast du an Omas Tür gelauscht?«
»Ja, ich war da und habe gehört, wie du mit Schwester Erika gesprochen hast«, gab ich zu.
Mein Papa nahm mich ganz fest in den Arm. »Du hast recht. Oma ist für immer eingeschlafen.« Er machte eine kurze Pause, Tränen schimmerten in seinen Augen. »Ich bin so froh, dass du mitgekommen bist. Ohne dich an meiner Seite wäre das alles noch viel schwerer zu ertragen.«
Betrübt drückte ich meinem Vater einen Kuss auf die Wange.
Zu Hause erzählte mein Vater meiner Mutter bei einer Tasse Kaffee, wie froh er sei, dass er die Eingebung gehabt habe, an diesem Tag bei Oma vorbeizuschauen. So habe er sich wenigstens von ihr verabschieden können und sei bei ihr gewesen, als sie diese Welt verlassen habe.
Wir waren alle sehr traurig, auch wenn meine Oma das stolze Alter von 99 Jahren erreicht hatte. Ihre langen Haare stets zu einem Knoten hochgesteckt, war sie eine lebensbejahende, lustige und tüchtige Frau gewesen, die immer hart gearbeitet hatte. Auch wenn sie am Ende dünn und zerbrechlich gewirkt habe, sei sie früher eher mollig gewesen, da sie gern gegessen habe, wusste mein Vater zu berichten.
Auf ihrer Beerdigung waren wir Kinder alle mit dabei und lernten weitere sechs Brüder unseres Vaters kennen. Für ihn war dies ein sehr trauriger Tag. Doch in unseren Erinnerungen sollte unsere Oma weiterleben, denn wir sprachen oft von ihr.
5
Weihnachten
In der Vorweihnachtszeit haben wir immer Plätzchen gebacken. Das erste Mal am 2. Advent und später noch einmal am 4. Advent, weil die Kekse von uns Kindern dann immer schon alle aufgegessen waren.
Bis zu meinem zehnten Lebensjahr waren die Weihnachtsfeste bei uns zu Hause immer sehr schön. Meine Eltern taten geheimnisvoll, tuschelten leise miteinander und irgendwo schien immer Geschenkpapier zu rascheln. Wir Kinder wurden ermutigt, uns gegenseitig kleine Geschenke zu basteln oder eine Handarbeit anzufertigen.
Am Heiligabend war es Tradition, nach dem Frühstück eine große Runde mit unseren Schlitten spazieren zu fahren. In meiner Erinnerung hat es Weihnachten nämlich früher immer geschneit. Unser Vater zog uns alle fünf auf unseren Schlitten hinter sich her. Wenn wir durchgefroren wieder nach Hause kamen, gab es Haferflocken in heißer Milch, und danach wurde sich eine Stunde ausgeruht, bis es Zeit für den Gottesdienst war. Elisabeth und Eva-Maria durften in der Zeit lesen. Nach unserer Mittagsruhe zogen wir Mädchen eine weiße Strumpfhose, ein Kleid und einen dunkelblauen Mantel an. Wann ich welchen Mantel von wem auftragen musste, habe ich vergessen – mal von Barbara, mal von Eva-Maria. Auf jeden Fall wurde der Mantel gekürzt, umgenäht und auf meine Figur angepasst. Um die Weihnachtsgeschichte zu sehen, gingen wir dann alle pünktlich in die Kirche.
In diesem Jahr hatte ich von meinem Taschengeld – ich bekam damals eine Mark in der Woche – ordentlich etwas angespart. Daher war ich in der Lage, Wolle zu kaufen und für meine Mutter und Schwestern Topflappen zu häkeln. Nur für Barbara häkelte ich eine Hose für ihren einzigen Teddy. Häkeln hatte Eva-Maria mir beigebracht, und wenn ich irgendetwas nicht wusste, half auch Elisabeth mir gern weiter. Für meinen Vater kaufte ich zwei etwas teurere Zigarren und für Christian ein tolles Kartenspiel.
Wie immer waren wir Kinder sehr gespannt, was der Weihnachtsmann uns dieses Jahr unter den Baum legen würde. Unsere Aufregung wurde vermutlich noch dadurch befeuert, dass das Wohnzimmer ab dem dreiundzwanzigsten Dezember tabu für uns war. In der ganzen Wohnung roch es einfach himmlisch – nach unseren selbstgebackenen Keksen, Nüssen, Mandarinen und Äpfeln. Heiligabend drang obendrein noch der Duft von leckerer Ente mit Rotkohl, Soße und Knödeln aus der Küche. Ich war bestens vorbereitet, nur Christian brauchte noch Hilfe beim Einpacken seiner Geschenke.
Als wir in der Kirche saßen, dachte ich darüber nach, was ich wohl geschenkt bekäme. Ob mir der Weihnachtsmann die heiß ersehnte Jeansjacke mit Teddyfell bringen würde? Meine Mutter hatte mir nämlich versichert, die sei vergriffen, und meine Geschwister und mein Vater hatten mir auch nichts verraten. Am schwersten fiel es Barbara, den Mund zu halten. Sie hätte mir liebend gern verraten, dass ich die Jacke doch bekäme, aber sowie sie irgendwelche Andeutungen in diese Richtung machte, wurde sie sofort gerügt. »Wehe, wenn du das Ruth erzählst.« Den Zorn unserer Mutter wollte Barbara lieber nicht heraufbeschwören und hielt vorsichtshalber den Mund.
So saßen wir also in der Kirche, lauschten dem Pastor, hörten die Weihnachtsgeschichte und sangen viele Weihnachtslieder, darunter: Alle Jahre wieder, O Tannenbaum und Ihr Kinderlein, kommet. Nach der Segnung und dem Vaterunser sangen alle Besucher beim Rausgehen O du fröhliche.
Der Heimweg zog sich, leise rieselte der Schnee und es war bitterkalt. Mein Magen schlug Purzelbäume – vor Hunger, aber auch vor Aufregung. Vor unser Haustür trafen wir unseren netten Nachbarn Herrn Freitag, der gerade dabei war, Schnee zu fegen, und eine alte Dame, die ihren Müll wegbrachte. Brav, wie wir Kinder erzogen worden waren, sagten wir »Frohe Weihnachten« oder »Gesegnete Weihnacht«. Mein Vater winkte Herrn Freitag zu und rief: »Liebe Grüße an Ihre Frau Gemahlin.« So war unser Vater. Immer Gentleman der alten Schule.
Unsere Stiefel waren alle mit Schnee bedeckt. Daher mussten wir sie auf einem Feudel abstellen. Dann hieß es: Hausschuhe anziehen, Hände waschen. »Wenn ich das Glöckchen läute, könnt ihr ins Wohnzimmer kommen«, sagte unsere Mutter. Doch da alles nach dem immer gleichen Ritual ablief, wussten wir Kinder bereits Bescheid. Als endlich das erlösende Läuten ertönte und wir ins Wohnzimmer stürmten, erblickten wir einen großen, bunt geschmückten Tannenbaum mit roten Wachskerzen. Neben dem Tannenbaum stand wie jedes Jahr ein Zehn-Liter-Eimer Wasser, falls Kerzenwachs tropfen oder die Tanne gar in Brand geraten sollte. Wir Kinder stellten uns vor dem Christbaum auf und sangen Weihnachtslieder. Es roch nach Tanne, Äpfeln und Plätzchen. Leider ging es noch immer nicht ans Auspacken, denn erst mussten wie der Reihe nach ein Gedicht aufsagen. Während meine Geschwister also mehr oder weniger gekonnt rezitierten, warf ich einen Blick auf die Geschenke und versuchte herauszufinden, welche für mich wären. Doch es waren einfach zu viele und so fügte ich mich in mein Schicksal und sagte das Gedicht von Knecht Ruprecht auf. Ich liebte dieses Gesicht, ging richtig in den Worten auf, die Knecht Ruprecht mit seinen verfrorenen Händen und der roten Nase beschrieben, und so gelang meine Darbietung wesentlich professioneller als die meiner Geschwister.
Endlich war auch ich fertig, und es herrschte ein paar Sekunden gespannte Stille, bis unsere Mutter verkündete: »Jetzt könnt ihr eure Weihnachtsgeschenke auspacken.«
Ganz rote Wangen hatte ich vor Aufregung. Auch meinen stechenden Hunger vergaß ich.
Alle riefen durcheinander: »Oh, wie toll, oh, wie schön!«
Mein Vater saß in seinem Sessel und schaute in unsere freudigen und zufriedenen Kindergesichter. Und ich bekam tatsächlich meine Jeansjacke mit Teddyfell, die ich den ganzen Abend über nicht mehr auszog.
Am Ende gab es einen großen Berg mit buntem Geschenkpapier, aber unsere Geschwistergeschenke mussten noch bis nach dem Essen warten.
Der Tisch war festlich eingedeckt. Neben dem einzig wertvolle Geschirr, das wir besaßen und das aus der Familie meines Vaters stammte, schmückte eine kleine Tanne mit goldenen Kugeln die Tafel, die perfekt zum Goldrand der Teller passten. Außerdem hatten wir Kinder jeder einen bunten Teller mit Naschereien bekommen, über den wir uns sehr freuten, denn wir bekamen das Jahr über nur wenig Süßigkeiten.
Meine Mutter schlich sich leise in die Küche, um den Entenbraten, den Rotkohl, die Knödel und zu guter Letzt die Soße aufzuwärmen. Endlich! Ich war am Verhungern.
Mein Vater hatte seinen Cognac ausgetrunken und wir setzten uns an den Tisch. Nachdem wir gebetet – Komm, Herr Jesu, sei unser Gast, und segne, was du uns bescheret hast. Amen! – und uns artig für unsere Geschenke bedankt hatten, ließen wir uns das Festmahl schmecken.
Nach dem Essen saßen wir gemütlich zusammen und tauschten unsere kleinen Geschenke untereinander aus. Danach tranken meine Eltern und meine beiden größeren Schwestern noch einen Kaffee. Meine Mutter spülte das Geschirr für den nächsten Tag vor und wir machten uns über unsere bunten Teller her. Wie jedes Jahr hatte Christian seinen als Erster praktisch leergefuttert. Die Plätzchen waren noch da, aber seine Schokokringel kämpften bereits mit der Ente, dem Rotkohl und den Knödeln in seinem Magen. Kein Wunder also, dass er Bauchweh bekam.
Heiligabend durften wir immer so lange aufbleiben, wie wir wollten, was wir natürlich in vollen Zügen genossen. Wir bestaunten gegenseitig unsere Geschenke, probierten neue Brettspiele aus oder lasen in unseren neuen Büchern. Ich liebte damals die Hanni und Nanni-Reihe.
Nachdem wir uns die Zähne geputzt hatten, fielen wir alle todmüde, aber glücklich und zufrieden ins Bett.
Am ersten Weihnachtstag stand meine Mutter früh auf und schlich sich in die Küche, um abzuwaschen. Doch obwohl sie versuchte, leise zu sein, wurde ich trotzdem wach. Ich stand auf und ging zu ihr. »Frohe Weihnachten, Mama!«, begrüßte ich sie.
Meine Mutter erschrak, weil sie so früh noch niemanden erwartet hatte. »Was machst du denn hier, Ruth?«, lautete ihre etwas schroffe Antwort. »Sei leise, wir wollen die anderen nicht wecken!«
Also griff ich schweigend nach einem Geschirrhandtuch und begann, meiner Mutter zu helfen, allerdings nicht, ohne vorher noch einmal ermahnt zu werden, ja mit dem guten Geschirr aufzupassen. Ein Lob, dass ich ihr freiwillig zur Hand ging, hatte ich zwar nicht erwartet, war aber doch ein wenig enttäuscht von ihrer Reaktion. »Soll ich dir noch beim Frühstück helfen?«, fragte ich anschließend.
»Nein, leg du dich noch mal hin«, gab meine Mutter kurz angebunden zurück. Kein Dankeschön, kein Lob – nichts! Mich erfasste ein wenig Wehmut, denn obwohl ich ständig um die Anerkennung meiner Mutter buhlte, hatte ich das Gefühl, dass mir diese doch fortwährend verwehrt blieb.
6
Heimweh
Da das Geld bei uns immer knapp war, fuhren wir nie richtig in den Urlaub. Stattdessen schickte unsere Mutter uns Geschwister öfter auf Fahrten mit dem Reisebus. Die waren aber keineswegs luxuriös, sondern ausschließlich für Kinder sozial schwacher Familien gedacht. Wir durften uns weder aussuchen, wohin die Reise gehen sollte, noch, in welcher Konstellation wir losfuhren. Unserer Mutter war das auch herzlich egal, Hauptsache, wir waren für eine Weile weg von zu Hause. Sie steckte uns ein wenig Taschengeld zu und verabschiedete uns, ohne eine Miene zu verziehen.
Einmal waren Barbara und ich zusammen in Springe. Zwar sahen die Betreuer es nicht so gern, wenn Geschwister mitkamen, aber meine Schwester fand schnell Anschluss bei gleichaltrigen Mitreisenden, auch bei den Jungs. Ich tat mich da etwas schwerer und brauchte immer ein paar Tage, um aufzutauen. Auch sah ich das Ganze pragmatisch. Die drei Wochen würden schon vorübergehen und dann wäre ich wieder bei meinen Freunden zu Hause. Also überbrückte ich die Zeit mit den Mädchen, die mir am sympathischsten waren. Mal mit einer lustigen Yvonne, dann wieder mit einer ruhigen und eher schüchternen Isabel. Trotzdem hatte ich immer ziemlich starkes Heimweh.
Besonders schlimm war das auf meiner ersten Klassenfahrt ins Schullandheim nach Schneverdingen. Ich war damals zehn und litt unter schrecklichem Heimweh – nicht nach meinen Geschwistern oder meiner Mutter, sondern nach meinem geliebten Vati.
Nach der Klassenfahrt holte Vati mich vom Bus ab und ich heulte wie ein Schlosshund. Erst dachte er, jemand hätte mich geärgert, aber unser Lehrer versicherte ihm, dass ich erst zu weinen begonnen hätte, als ich ihn gesehen hätte. Sofort schloss er mich in die Arme und tröstete mich. »Nun bist du ja wieder da, Ruthchen. Kein Grund zu weinen.«
Meine Mutter schüttelte nur ungläubig den Kopf und holte meinen Koffer. Sie konnte oder wollte mich einfach nicht verstehen.
7
Zäsur
Wie meine Schwester Elisabeth stets zu betonen pflegte, war ich ein pflegeleichtes Kind und obendrein auch eine gute Schülerin. Wenn ich nach der Schule nach Hause kam, sprang ich immer auf den Schoß meines Vaters und berichtete, was ich alles erlebt hatte. Auch mein Bruder Christian buhlte um die Liebe unserer Mutter, mutierte zu einem wahren Musterschüler und sollte sogar eine Klasse überspringen. Trotzdem bekam er zu Hause grundsätzlich für alles die Schuld. Irgendwie war er das schwarze Schaf der Familie. Oft nahm ich etwas auf meine Kappe, um ihn vor einer Bestrafung zu bewahren, doch meist vergeblich. Prügel – und das nicht wenig – bezog hauptsächlich er. Als Christian das realisierte, hörte er auf, so viel zu lernen. Ich versuchte, ihn zu trösten und zu motivieren, vor allem aber abzulenken. Oft war ich mit ihm und seinen Freunden auf dem Bolzplatz.
Als ich eines Tages aus der Schule kam, war der Sessel, in dem mein Vater sonst immer saß, plötzlich leer. Na, dann wird er wohl zur Toilette gegangen sein, dachte ich, nichts ahnend, was sich in meiner Abwesenheit Schlimmes zugetragen hatte. Seltsam war nur, dass meine Mutter ausgesprochen fahrig und nervös wirkte. Sie rief nach Christian und forderte uns auf, Platz zu nehmen. Barbara hatte noch Unterricht und wollte anschließend zu einer Freundin. Elisabeth lebte zu dem Zeitpunkt bereits im Schwesternheim, da sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester begonnen hatte. Und Eva-Maria war auf Klassenfahrt. »Wir sind von jetzt an allein. Euer Vater lebt nun woanders«, ließ meine Mutter die Bombe platzen.
»Okay. Kann ich jetzt gehen?«, fragte mein Bruder wenig beeindruckt.
»Ja«, erwiderte meine Mutter und wandte sich an mich. »Hast du noch Fragen, Ruth?«
Fassungslos starrte ich sie an. »Wie …? W…was soll das heiße, dass Papa jetzt … jetzt … wo…woanders wohnt?«, stammelte ich. »Wo ist er? Wo hast du ihn gelassen?«
»Du spinnst wohl!«, fuhr meine Mutter mich an.
Doch ich ließ mich nicht einschüchtern. »Wenn du mich nicht sofort zu Vati bringst, werde ich jedem erzählen, dass du ihn weggebracht hast!« Außer mir vor Wut stampfte ich mit dem Fuß auf und brach in Tränen aus. »Ich will meinen Papa wiederhaben. Sofort!«, schrie ich sie an.
Mit einer solch heftigen Reaktion hatte meine Mutter offenbar nicht gerechnet, denn sie ruderte zurück. »Okay, wir fahren zu ihm. Möchtest du vorher noch was essen?«, fragte sie leise. »Nein! Ich kann doch jetzt nichts essen!«, brüllte ich trotzig. Ich war nicht länger das liebe, brave Kind. Wie auch? Man hatte mir meinen Vater genommen, den ich über alles liebte. Für mich war eine Welt zusammengebrochen. Und das wurde meiner Mutter offenbar erst in diesem Moment bewusst.
Als wir auf den Bus warteten, trat ich nervös von einem Bein auf das andere. Ich konnte es gar nicht erwarten, meinen Papa in die Arme zu schließen. Im Bus und während der anschließenden S-Bahn-Fahrt redeten meine Mutter und ich nur das Nötigste. Nach einer gefühlten Ewigkeit fragte ich: »Wie lange dauert das denn noch?«
»Wir sind gleich da«, beschwichtigte sie mich.
Eine Weile später liefen wir auf ein rotes Backsteingebäude zu. »Wo sind wir hier? Was ist das?«, wollte ich wissen.
»Ein Altenheim«, flüsterte meine Mutter.
»Was?«, entfuhr es mir entgeistert. »Das ist nicht schön. Papa gefällt es bestimmt auch nicht. Wir nehmen ihn doch wieder mit nach Hause, oder?«
Meine Mutter wurde kreidebleich, war nicht in der Lage, mir zu antworten. Wir betraten das Gebäude durch eine Glastür, steuerten direkt auf den Empfangstresen zu und fragten nach meinem Vater.
»Walter Butschkau? Dritter Stock«, erklärte der Mann an der Anmeldung.
Wir nahmen den Aufzug, und als wir in der dritten Etage ausstiegen, kam eine Schwester mit raspelkurzen Haaren auf uns zugelaufen. Mein braunes Haar war lang und ich trug es meist zu Zöpfen geflochten. Ebenso hatte ich braune Augen, so wie mein Vater.
»Zu wem wollen Sie denn?«, fragte uns die Schwester, während ich neugierig in eins der Zimmer lugte, in der Hoffnung, meinen Papa zu entdecken. Aber dort lagen nur ein paar alte Männer in ihren Betten. Sie stöhnten und riefen Dinge, deren Bedeutung mir damals nicht klar war. Langsam ließ die Schwester den Blick zwischen mir und meiner Mutter hin und her wandern.
»Zu Walter Butschkau«, antwortete meine Mutter.
»In welchem Verhältnis stehen Sie denn zu Herrn Butschkau?«, erkundigte sich die Schwester.
»Er ist mein Papa«, kam ich meiner Mutter zuvor.
»Na ja …« Die Schwester zögerte kurz. »Herr Butschkau war klar bei Verstand und wollte nicht bleiben. Wir konnten ihn nicht gegen seinen Willen hier festhalten.«
»Dann müssen wir wohl wieder nach Hause fahren, Ruth.« Das war alles, was meine Mutter dazu sagte.
»Auf keinen Fall!«, protestierte ich.
»Aber Ruth, sei doch vernünftig. Wo sollten wir denn nach ihm suchen?«
»Sag du es mir! Schließlich hast du ihn einfach hergebracht und jetzt weißt du nicht weiter …« Verzweifelt brach ich ab.
»Ich werde nicht nach deinem Vater suchen«, beharrte meine Mutter.
»Dann such ich ihn eben allein«, erwiderte ich trotzig.
Schweigend hatte die Schwester uns zugehört, räusperte sich und entschuldigte sich mit der Erklärung, dass sie jetzt weiterarbeiten müsse.
Meine Mutter versuchte, an meine Vernunft zu appellieren. »Hör mal, Ruth, Christian ist ganz allein zu Hause und du hast doch bestimmt Hunger …«
»Ich will nichts essen. Wenn wir Papa nicht finden, esse ich nie wieder was!« Allmählich bekam ich Panik, denn wir hatten keine Ahnung, wo wir meinen Vater suchen sollten.
»Okay, ich habe eine Idee«, sagte meine Mutter, nahm mich bei der Hand und führte mich zum Aufzug.
Im Erdgeschoss angekommen, steuerte sie direkt wieder auf die Anmeldung zu und fragte den Mitarbeiter, ob er wisse, ob Papa ein Taxi gerufen habe und wohin er gefahren sei. Gelangweilt sah der Mann uns an, und es dauerte eine Weile, ihn davon zu überzeugen, nachzufragen, welches Taxi-Unternehmen meinen Vater gefahren hatte.
Mir ging es schrecklich und ich musste weinen.
»Was hast du denn?«, fragte der Mitarbeiter verständnislos. »Dein Opa wird schon wieder auftauchen.«
»Das ist mein Papa, nicht mein Opa!«, gab ich gereizt zurück.
Der Mann setzte seine Brille auf, führte mehrere Telefonate und hatte endlich den Taxifahrer in der Leitung, der meinen Papa von diesem schrecklichen Ort weggebracht hatte. Er notierte die Adresse, an der der Taxifahrer meinen Vater abgesetzt hatte, auf einem Zettel und reichte ihn meiner Mutter. »Poppenbüttel«, hörte ich sie sagen. »Das ist weit. Eine ganze Stunde bräuchten wir dorthin.«
»Ist doch egal«, meinte ich. »Wenn du Papa nicht hergebracht hättest, müssten wir ihn jetzt nicht suchen.«
Meine Mutter begriff, wie ernst es mir war. Also gingen wir wieder zur S-Bahn-Haltestelle und nahmen die nächste Bahn nach Poppenbüttel. Während der ganzen Fahrt herrschte eisiges Schweigen zwischen uns.
Als wir endlich in Poppenbüttel ankamen, wusste meine Mutter komischerweise genau, wo wir hinmussten. Das machte mich stutzig und misstrauisch zugleich. Ich entdeckte das prunkvolle Haus mit dem schmiedeeisernen Tor davor. Auf dem Klingelschild aus Messing stand ein Doppelname. »Kennst du die Leute, die hier wohnen?«, wollte ich von ihr wissen.
»Frag nicht so viel!«, rügte sie mich, drückte auf die Klingel und holte tief Luft. Inzwischen war es Abend geworden. Plötzlich knackte es in der Gegensprechanlage, und jemand fragte, zu wem wir wollten.
»Ist Herr Butschkau heute hier gewesen?«, lautete die Antwort meiner Mutter.
Einige Sekunden lang passierte nichts, dann setzte sich das große Tor in Bewegung, wir traten hindurch und liefen auf das große Haus zu. Bis wir die Haustür erreichten, schien eine kleine Ewigkeit zu vergehen, so lang war die Auffahrt. Ein vornehmer Herr öffnete uns. »Wie war doch gleich Ihr Name?«, wollte er wissen.
»Ich bin Herrn Butschkaus Frau«, stellte meine Mutter sich vor.
»Ach, dann bist du wohl Walters Tochter.« Der Mann sah mich an. »Du bist deinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.«
Meine Mutter stieß einen erschrockenen Laut aus.
»Wo ist denn mein Vater?«, ergriff ich das Wort.
»Er war heute hier und wäre auch gern geblieben, aber das ging leider nicht. Das habe ich ihm auch erklärt«, antwortete der Mann. »In jungen Jahren hat er mir mehr als einmal geholfen und war ein guter Freund. Deshalb habe ich ihm wenigstens mit einem guten Batzen Geld ausgeholfen.«
Nun musste ich schon wieder weinen. Ich riss mich zusammen und sagte: »Ich will meinen Papa wiederhaben. Meine Mutter hat ihn in ein Heim gegeben, aber da hat es ihm nicht gefallen und er ist gegangen …«
»Ruthchen, das will der Herr sicher alles gar nicht hören«, unterbrach mich meine Mutter, doch ich ließ mich nicht beirren und begann, laut loszubrüllen. Das schien den Mann so sehr zu irritieren, dass er sich verabschiedete und uns die Tür vor der Nase zuschlagen wollte, doch ich hatte bereits einen Fuß auf die Schwelle gestellt und sah ihm direkt in die Augen, wollte ihm klarmachen, wie wichtig mir das Ganze war. »Sie müssen doch wissen, wo mein Vater hinwollte.«
Plötzlich ertönte eine Frauenstimme aus dem Inneren des Hauses. »Hermann, wer sind diese Leute und was wollen sie von uns?«
Der Mann schenkte mir ein Lächeln. »Du bist genau wie dein Vater. Du weißt, was du willst. Deine Beharrlichkeit wird dich weit bringen im Leben.«
Mühsam kam eine Frau in einem Rollstuhl an die Tür. Sie wirkte sehr zerbrechlich. »Ich habe Stimmen gehört und ein weinendes Kind«, sagte sie.
»Keine Sorge, Gerlinde, ich klär das«, erwiderte Hermann, dann wandte er sich wieder an uns. »Sehen Sie, genau das ist der Grund, warum Walter nicht bei uns bleiben konnte. Ich pflege meine Frau. Sie leidet unter Muskelschwund und braucht rund um die Uhr Unterstützung.«
»Natürlich, das verstehen wir.« Meine Mutter nickte. »Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.« Sie warf mir einen strengen Blick zu. »Komm, wir gehen, Ruth.«
Doch da sagte Gerlinde: »Kindchen, möchtest du vielleicht etwas trinken?« Dann sah sie ihren Mann an. »Hermann, weißt du, wo dein Freund hinwollte? Hast du ihm einen Tipp oder eine Adresse gegeben?«
Hermann nickte. »Ja. Ein paar Straßen weiter gibt es ein Seniorenheim. Es heißt ›Sonnenschein‘.« Er drehte sich um, lief ins Haus und kam kurz darauf mit einem Zettel, auf dem die Adresse des Altenheims stand, und einem Glas Wasser für mich zurück.
Sonnenschein? Das klang in meinen Ohren doch sehr seltsam.
Schnell trank ich das Wasser und bedankte mich artig, bevor wir uns von dem netten Ehepaar verabschiedeten.
Wieder zurück auf der Straße, starrten wir auf den Zettel und versuchten, uns zu orientieren. Auf dem Weg





























