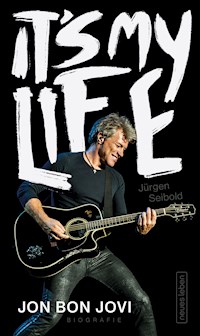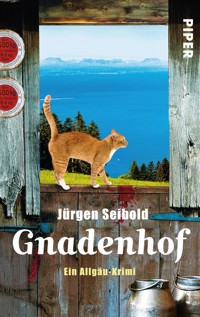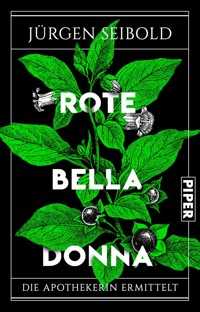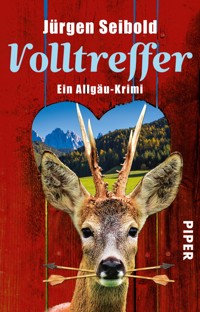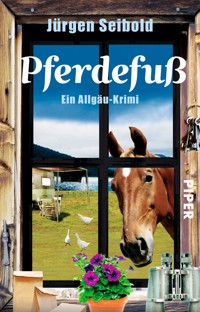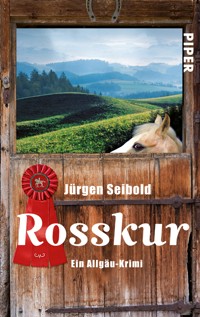9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Höher, schneller, weiter? Nicht mit Daniel, der so gar nichts von Selbstoptimierung und Motivationsparolen hält. Ganz im Gegenteil: Er genießt sein unaufgeregtes Leben als ewiger Student, zelebriert die gepflegte Langeweile und ist glücklich damit. Doch als ihm seine Eltern zum 30. Geburtstag den Geldhahn zudrehen, hilft alles nichts: Er braucht einen Job. Blöd nur, dass er selbst bei den einfachsten Tätigkeiten nicht einmal den Probetag übersteht. In seiner Not beschließt er, einen Ratgeber zu schreiben, über das, was er am besten kann: Nichtstun. Eine Idee mit ungeahnten Folgen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Mein perfektes Ich kann mich mal« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für alle, die ihr Ziel auf krummen Wegen erreichen.
Manchmal muss viel schiefgehen, bis man ankommt, wo man hingehört.
Die Kapiteltitel und einige andere gekennzeichnete Textpassagen sind Zitate aus dem Ratgeber »Powerboring« von Daniel Birchert und wurden vom Autor für diesen Roman freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Weitere Infos zum Ratgeber finden Sie auf www.powerboring.de
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Kapitel 1
Tu erst einmal … nichts
Kapitel 2
Zu spät kommst du auch morgen noch
Kapitel 3
Ja, ja, gleich Irgendwann
Kapitel 4
Hast du Ziele? Das gibt sich
Kapitel 5
Erst die zweite Maus bekommt den Käse
Kapitel 6
Wer nichts macht, macht nichts falsch
Kapitel 7
Prioritäten? Lass einfach alles liegen
Kapitel 8
Wer nicht A sagt, kann auch B lassen
Kapitel 9
Atmen, einfach nur atmen
Kapitel 10
Dringend bin nur ich
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Kapitel 1
Tu erst einmal … nichts
Ich mag den Winter nicht. Selbst als Student verlässt du an manchen Tagen das Haus im Dunkeln und kehrst auch erst im Dunkeln zurück. Heute war offenbar wieder so ein Tag. Der Wecker drückte mir die Stimme eines übertrieben gut gelaunten Radiomoderators ins Ohr, und es war zappenduster.
Als ich nach der Uhrzeit sehen wollte, fiel mir auf, dass ich die Augen noch geschlossen hatte, danach wurde es zwar heller, aber nicht besser. Die Sonne stand genau zwischen den beiden Hochhäusern auf der anderen Straßenseite an einem klaren Himmel und flutete mein Zimmer mit grellen Strahlen. Der Sweater auf der Stuhllehne warf einen langen Schatten quer durchs Zimmer, über die Jeans und die Socken hinweg, die ich auf dem Weg zum Bett verloren hatte, bis zur Tür. Links und rechts davon tanzten Staubflusen im Sonnenlicht, und in den beiden Gläsern im Bücherregal hatten sich die Rotweinpfützen über Nacht als dunkle Ränder festgesetzt.
Zwei Gläser … Ich dachte vorsichtig nach, um das leichte Hämmern in meinem Kopf nicht zu verschlimmern. Nach einer Weile hatte ich den Verlauf des Abends wieder rekonstruiert, nur meine Freundin Shari selbst war weg. Ich schob die Hand unter der Decke zur anderen Seite des Bettes. Alles kalt, sie war wohl schon vor Stunden gegangen. Im Dunkeln, vermutlich. Scheißwinter.
Ich schwang die Beine über die Bettkante und verschaffte mir trotz der frühen Uhrzeit einen groben Überblick über den Tagesplan. Die ersten beiden Vorlesungen waren schon vorbei, zum Tutorium würde ich es gerade noch schaffen, wenn ich mich beeilte. Aber ich hatte auch vorgestern keine Lust gehabt, mich zu beeilen, also würden mir für die heutige Einheit ohnehin die Grundlagen fehlen. Deshalb war noch Zeit für ein gemütliches Frühstück im Bogey. Ich ging gern dorthin, aber heute blieb mir sowieso keine andere Wahl, weil es in meinem Viertel nirgendwo sonst nach fünfzehn Uhr noch Frühstück gab.
Die anderen sah ich schon von Weitem am großen Tisch beisammensitzen, und keiner von ihnen sah wacher aus, als ich mich fühlte. Ich zog mir einen Stuhl heran, gab der Bedienung das übliche Zeichen und machte es mir zwischen Frans und Hoby gemütlich.
»Auch schon aus dem Bett gefallen«?, fragte Frans zwischen zwei Bissen Croissant und zwinkerte mir gutmütig zu. Er war ein hagerer Typ mit ungesund fahler Gesichtsfarbe, und aus seiner Heimatstadt Rotterdam hatte er einen holländischen Akzent und erstaunlicherweise ein Faible für die Fußballer von Bayern München mitgebracht.
»Mpfbrmm…«, brummte Hoby und kaute weiter an seinem dick belegten Sandwich mit viel Wurst und wenig Grünzeug. Seinem unstillbaren Hungergefühl verdankte er die dicken Backen und die Wampe, seiner Mutter drei ungeliebte Vornamen und den sperrigen Familiennamen Hommel-Büsenreither. Den hatte auch sein Vater annehmen müssen, weil die Hommel-Büsenreither’sche Linie sich auf einen Kaufmann zurückverfolgen ließ, der vor knapp fünfhundert Jahren eine große Nummer in der Hansestadt Lübeck gewesen war. (Als ich spaßeshalber mal recherchierte, fand ich heraus: Hobys Urahn war mit schuld daran, dass Lübeck im 16. Jahrhundert seinen Ruf als »Königin der Hanse« verlor. Hoby hat das köstlich amüsiert, aber er hat sich bis heute nicht getraut, seiner Mutter die Geschichte zu erzählen.)
Mir gegenüber lümmelten Gerry und Seb auf ihren Stühlen. Gerry war ein Jahr nach seinem Schulfreund Frans in die Stadt gekommen. Er hatte sich mit Gelegenheitsjobs einen zehnmonatigen Aufenthalt in Australien und Neuseeland finanziert und arbeitete auch während seines Studiums; für einen Sicherheitsdienst drüben im Gewerbegebiet schob er zwei-, dreimal die Nacht Wache auf dem Gelände eines Messebauers. Seb wiederum stammte aus meiner Gegend, er arbeitete als Techniker für eine kleine TV-Klitsche und hatte erst vor ein paar Monaten ein Zimmer in einer WG bezogen, direkt über Hobys großzügiger Junggesellenbude. Das Haus gehörte natürlich den Hommel-Büsenreithers.
»Musst du nicht arbeiten?«, fragte ich Seb, weil er als Einziger in der Runde einen geregelten Tagesablauf hatte.
»Gestern Abend kam ein Motivationsguru ins Studio, der so gut drauf war, dass wir gleich sechs Zwanzigminüter mit ihm in einem Rutsch aufgenommen haben. Mach dein Leben zu deinem! – das wird eine Serie mit Lifehacks und so. Die Aufnahmen gingen bis halb vier, danach hat die Producerin dem Team für heute freigegeben.«
»So nett hast du bisher noch keine deiner Chefinnen beschrieben.«
»Na ja, eigentlich standen für heute nur die Lifehack-Folgen drei bis sechs auf dem Plan, und die hatten wir ja schon im Kasten.«
»Und, hast du was gelernt fürs Leben?«
»Nichts, das ich nicht schon wusste. Bleib dir und deinen Zielen treu, sei hartnäckig, nimm auch mal Umwege in Kauf, wenn es sein muss – so was halt. Du merkst schon: Auch dieser Typ hat das Rad nicht neu erfunden, aber seine Bücher verkaufen sich gut, da will sich die Produktionsfirma dranhängen.«
»Und dafür sucht ihr jetzt einen Sender?«
»Der Geschäftsführer hat wohl schon einen an der Angel.« Seb nannte einen kleinen Privatsender und zuckte mit den Schultern. »Damit wollen sie wohl den Fuß in die Tür bekommen. Und mir wär’s natürlich recht, wenn’s klappen würde. Ich habe inzwischen einen ganz guten Stand in dem Laden, aber das nützt mir nur etwas, solange die nicht dichtmachen müssen.«
»Wird schon gut gehen«, sagte ich und prostete ihm mit meiner Tasse zu.
»Ja, wird’s schon. Bis dahin beherzige ich die zentrale Regel unseres Gurus: Ich fahre vollen Einsatz in allem, was ich anpacke.«
Ich winkte ab.
»Das wär nichts für mich«, versetzte ich lachend.
Die anderen hatten sich munter unterhalten, aber plötzlich wurde es still am Tisch. Hoby stieß mich an und deutete zum Eingang, durch den gerade zwei schlanke, groß gewachsene junge Frauen das Bogey betraten. Die beiden plapperten und lachten in einem fort und schienen niemanden um sich herum wahrzunehmen. Eine der beiden war Shari. Sie hatte mich schon gesehen und mir kurz zugenickt.
»Kennst du die beiden etwa«?
Hoby war fassungslos.
»Nur die mit den schwarzen Locken«, sagte ich. Hier am Tisch wusste niemand, dass ich seit einiger Zeit mit Shari zusammen war, und ich sah auch jetzt keine Notwendigkeit, es den Jungs auf die Nase zu binden. Die vier konnten peinlich sein, und Hoby tat alles dafür, diesen Ruf zu untermauern. Er starrte wie hypnotisiert zum Tresen hinüber, und sein Blick zielte sicher nicht auf die blank polierte Kaffeemaschine.
Shari und ihre Freundin erklärten dem Barista, wie sie ihren Coffee to go gern hätten. Hoby schluckte und machte keine Anstalten, seinen Blick von ihren Rückseiten zu lösen. Und weil er das auch nicht rechtzeitig schaffte, als die beiden bezahlten und sich umdrehten, erntete er ein spöttisches Grinsen, das auf Sharis hübschem Gesicht noch ein bisschen frecher aussah als auf dem ihrer Begleiterin. Dann kamen die beiden langsam zu unserem Tisch. Hoby wurde mit jedem ihrer Schritte kleiner und begann zu schwitzen. Die beiden blieben stehen und sahen auf ihn hinunter. Hoby schluckte trocken und wusste gar nicht, wohin mit seinen Blicken.
»Mal davon abgesehen«, setzte die Brünette schließlich an, »dass es nicht besonders höflich ist, Frauen auf den Arsch zu starren: Jetzt könntest du dir alles aus der Nähe anschauen.«
Sie hatte freundlich geklungen, ein bisschen amüsiert und nicht verärgert, aber Hoby war die ganze Situation so peinlich, dass er sich am liebsten in Luft aufgelöst hätte. Die anderen feixten, Shari zwinkerte mir zu, blieb aber auf Abstand. Ich hatte ihr schon von den Jungs an diesem Tisch erzählt, und sie war schnell mit mir einer Meinung darüber gewesen, dass sie nichts von unserer Beziehung wissen mussten.
»Ich bin Jennifer, das ist meine Freundin Shari – und du heißt?«
Hoby musste sich zweimal räuspern, bis er seinen Spitznamen verständlich hervorbrachte.
»Schön, Hoby«, sagte Jennifer und streckte ihm die Hand hin. Hoby ergriff sie zögernd. »Falls du mir gleich wieder auf den Hintern starrst, wenn ich mit Shari den Kaffee hole und wir diesen Laden verlassen …«
»Mach ich nicht, versprochen«, sagte er schnell.
»… dann hast du wenigstens einen Namen für deine Fantasien, Hoby. Und das nächste Mal: erst vorstellen, dann starren, okay?«
Hoby nickte und schwitzte. Jennifer zwinkerte ihm lächelnd zu, dann wandten sich die beiden Frauen ab, nahmen am Tresen ihren Kaffee in Empfang und gingen auf die Straße hinaus.
Es dauerte eine ganze Weile, bis Hoby wieder sprechen konnte.
»Und du kennst die eine?«, fragte er.
»Ja, Shari.«
»Wow!«, keuchte er noch, dann schaute er zur Straße hinaus. Der Rest seines Sandwiches blieb lange unangetastet.
Mit Shari hatte ich mich für Donnerstag verabredet, heute Abend hatte sie Spätschicht in Tonne’s Tresen. Dieses Lokal war – anders als der bescheuerte Name mit dem überzähligen Apostroph vermuten ließ – eine ziemlich hochpreisige Nobelbar ein paar Straßen weiter, und Shari finanzierte mit ihrem Job dort ihr Studium. Ich hatte sie an unserem ersten gemeinsamen Abend zu ein paar Drinks in einer nicht ganz so teuren Kneipe eingeladen und nur ganz beiläufig erwähnt, dass ich nicht neben dem Studium arbeiten musste und mich deshalb ganz auf meine Vorlesungen und Klausuren konzentrieren konnte. Zum Glück kamen wir erst nach dem dritten bunten Getränk darauf zu sprechen, und Shari vergaß deshalb nachzuhaken. Denn das mit dem konzentrierten Studieren war so eine Sache, nach bald fünfzehn Semestern ohne Bachelor bewegte ich mich in Gesprächen zu diesem Thema auf ziemlich dünnem Eis. Irgendwann erzählte ich ihr natürlich trotzdem von meinem eher gemütlich organisierten Studium, und obwohl sie mit mehr Eifer zur Uni ging, tolerierte sie meinen mangelnden Ehrgeiz offenbar.
Hoby hatte nach einiger Zeit seinen Appetit wiedergefunden und sich die Backen vollgestopft, die anderen machten sich gutmütig über ihn lustig, und wir tranken nach dem Kaffee noch das eine oder andere Kaltgetränk, bevor wir darüber diskutierten, ob wir uns später Fast Food bei einem von uns daheim oder Pasta beim Italiener schmecken lassen würden.
Um es kurz zu machen: Wir hatten einen ganz normalen Mittwochnachmittag.
Nachdem ich am Donnerstag fast drei Stunden in Vorlesungen und Tutorien verbracht hatte und danach ziemlich lange mit Shari zusammen gewesen war, beschloss ich, am Freitag mal blauzumachen. Am Abend war ich ohnehin eingeladen: Meine Mutter wollte mich zu meinem dreißigsten Geburtstag gebührend bekochen, und weil ich ja so einen stressigen Alltag an der Uni hatte, sollte das große Essen mit der Familie erst gegen zwanzig Uhr beginnen, damit ich auch ohne Hetze rechtzeitig eintreffen konnte. Da reichte es noch gut, wenn ich ausschlief, erst gar nicht zur Uni fuhr, stattdessen im Bogey frühstückte und dann am frühen Nachmittag den Schnellzug nahm.
Es funktionierte auch alles, und das hätte mich – wenn ich heute so an diesen Tag zurückdenke – eigentlich stutzig machen müssen. Das Wetter war trocken und nicht zu windig. Im Bogey erwischte ich einen ruhigen Ecktisch und ergatterte sogar noch ein Exemplar der aktuellen Tageszeitung. Der ICE kam pünktlich und bot einen freien Platz im Bordrestaurant, wo ich mir zwei Tassen Cappuccino schmecken ließ. Selbst der Umstieg in die S-Bahn klappte ohne große Wartezeit, und als ich kaum meinen Zielbahnhof hinter mir hatte, klaubte mich ein früherer Nachbar auf und nahm mich in seinem Wagen die eineinhalb Kilometer bis zu der Straße am Stadtrand mit, in der ich aufgewachsen war.
Vor dem Reihenhaus meiner Eltern, das nach all den Jahren dringend einen neuen Verputz brauchte, sah ich einige bekannte Fahrzeuge. Den alten Kombi meines Vaters und den etwas weniger alten Kleinwagen meiner Mutter. Meine Schwester Yvonne war gekommen, und ich hoffte inständig, dass sie im Van höchstens ihren nervigen Mann Robert und nicht auch noch die anstrengenden Blagen mitgebracht hatte, deren Namen in knallbunter Comicschrift die Heckklappe zierten. Der Jeep mit dem Aufkleber »Jäger retten Leben« gehörte meinem Patenonkel Erwin, der zwar wegen seiner kaputten Hüfte seit Jahren nicht mehr auf die Pirsch konnte, aber den Geländewagen trotzdem mit großer Begeisterung über die Waldwege der Umgebung jagte. Und der verbeulte Corolla war die Rostlaube von Tante Lydie, die eigentlich mit keinem von uns verwandt war, aber nie auf einer Familienfeier fehlte, und von der niemand mehr wusste, warum sie das erste Mal eingeladen worden war.
Nur den flaschengrünen Jaguar, der quer vor der Garageneinfahrt stand, konnte ich nicht zuordnen.
Als ich vor die Haustür trat, wackelte am Küchenfenster eine Gardine, und noch bevor ich meinen Schlüssel aus dem Rucksack nesteln konnte, wurde die Tür aufgerissen und meine Mutter stand mit umgebundener Schürze und ausgebreiteten Armen vor mir. Ihr Lächeln war fast so breit wie immer, aber ihre Augen lächelten nicht mit. Ihre gute Laune wirkte aufgesetzt, doch ich konnte gar nicht nach dem Grund fragen, weil sie mich nach der ersten Umarmung nicht mehr losließ, mich unterhakte und mit sich in den Flur zog.
»Schaut mal, wer da ist!«, rief sie ins Wohnzimmer hinein, und dort wandten sich mir nun alle zu und hoben die Gläser. Tante Lydie brauchte fürs Umdrehen etwas länger, dafür krähte sie wie aus der Pistole geschossen: »Wir singen!«
Und schon setzte sie zu Happy Birthday an, und die meisten anderen fielen nach und nach mit ein. Die Kids meiner Schwester waren offenbar wirklich nicht mitgekommen, aber ihr Mann sang falsch für drei. Es war so peinlich wie immer, allerdings fiel mir auf, dass der wacklige Bass meines Erzeugers fehlte. Vater stand stumm und mit verschränkten Armen neben der Terrassentür und musterte mich.
Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht, und auch wenn sich mein Vater sehr um eine freundliche Miene bemühte: Ich war mir schon in diesem Moment ziemlich sicher, dass der heutige Besuch unangenehme Folgen haben würde. Tante Lydie kommandierte die anderen noch in ein dreifaches »Hoch soll er leben!«, dann kamen sie alle auf mich zu, umarmten mich, schüttelten mir die Hände und klopften mir die Schultern platt. Auch mein Vater gratulierte mir, aber zurückhaltender als sonst, und als er mir die Hand gedrückt hatte – er hielt sie etwas fester und länger, als ich es von ihm kannte –, drehte er sich um und deutete auf die Zimmerecke, die ich bisher nicht beachtet hatte. Auf dem kleinen freien Platz zwischen Klavier und Buchregal stand mein alter Schulfreund.
»Mensch, Tommi!«, rief ich und stürmte auf ihn zu. »Was machst du denn hier?«
Wir waren seit der fünften Klasse die dicksten Kumpel gewesen. Wir hatten miteinander Streiche ausgeheckt, im Lager des Getränkehändlers unser erstes Bier probiert und zur Not sogar Mathe und Physik zusammen gebüffelt. Nachdem ich mich an der Uni eingeschrieben hatte, trafen wir uns noch eine Weile regelmäßig, aber dann packte ihn der Ehrgeiz: Tommi hatte nur noch sein Studium im Kopf, er legte zwei Auslandssemester ein, und schließlich verlief unsere Freundschaft irgendwie im Sand.
Er klatschte mich ab, gratulierte und gab mir eine sündhaft teuer aussehende Flasche Whisky. Ich stellte das Geschenk auf dem Klavier ab und betrachtete ihn. Er strotzte nur so vor Kraft, Gesundheit und Selbstbewusstsein, und so schick und leger zugleich, wie er gekleidet war, gehörte ihm wohl auch der Jaguar vor der Garageneinfahrt. So also konnte man auftreten, wenn man ein Studium zügig und erfolgreich hinter sich brachte, denn etwas anderes konnte ich mir in Tommis Fall nicht vorstellen. Dass ich mit meiner Vermutung richtiglag, bestätigte er mir, als ich ihn fragte, wie es ihm in den vergangenen Jahren ergangen war: Bachelor, Master, eine Doktorarbeit summa cum laude obendrauf und jetzt einen sehr lukrativen Beraterjob in der Finanzbranche – das alles erzählte er mir, ohne damit zu protzen.
Mein Vater hatte sich zu uns beiden gesellt, und er hörte sich alles mit einem wehmütigen Gesichtsausdruck an. Ab und zu nickte er beifällig, und als ich ihm einen Seitenblick zuwarf, wurde er ernst und konzentrierte sich plötzlich sehr auf das Sektglas in seiner Hand.
»Und du?«
Tommis Gegenfrage klang ganz harmlos, und doch sah ich aus den Augenwinkeln, wie sich mein Vater etwas anspannte und seine Miene eine Spur eisiger wurde.
»Läuft nicht schlecht«, erwiderte ich. »Allerdings lasse ich mir mit dem Studium deutlich mehr Zeit als du. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern, nicht wahr, Papa?«
Ich lachte und schaute meinen Vater an, der seinen Mund aber nur zu einem gequälten Lächeln verzog. Ich versuchte, seinen Blick aufzufangen, aber seine Augen wichen mir aus, und er wirkte sehr erleichtert, als uns meine Mutter zu Tisch rief. Tommi hatte den Platz direkt neben mir, meine Eltern saßen an den Kopfseiten der Tafel, und dazwischen flogen die Gespräche hin und her. Mein Schwager tat wie immer furchtbar wichtig wegen der jüngsten Aufträge für seine jämmerliche Werbeagentur, Yvonne rollte dazu mit den Augen, weil sie die faden Geschichten wohl schon oft hatte anhören müssen. Tante Lydie legte ihm immer wieder die Hand auf den Unterarm und grätschte mit schlecht erzählten Witzen in seinen Monolog, doch nach jeder misslungenen Pointe lachte Robert nur gekünstelt und setzte seine Geschichte danach ungerührt an der Stelle fort, an der er unterbrochen worden war. Manchmal spulte er auch ein bisschen zurück wie die Fernsehsender, die durch Wiederholungen die Filmlänge strecken und damit die zulässige Werbezeit etwas ausbauen.
Onkel Erwin sagte nicht viel, sondern stopfte sich einen Knödel und einen Fleischhappen nach dem anderen in den Mund und hielt meiner Mutter zwischendurch das Weinglas zum Nachfüllen hin. Schließlich gab Lydie auf, ließ sich ebenfalls nachreichen und spülte jeden zweiten Bissen mit einem großen Schluck Rotwein hinunter. Irgendwann war Robert fertig, und es legte sich eine bleierne Stille über den Tisch, weil alle von der Geschichte ermattet und vom guten Essen und Trinken etwas schläfrig waren. Robert war sehr mit sich zufrieden, und als er Anstalten machte, seine Meinung zur aktuellen Politik hinauszuposaunen, fuhr ihm meine Mutter mit der Frage in die Parade, wer noch Lust auf Nachtisch, Schnaps und Kaffee habe. Dessert nahmen alle, Kaffee ließen Yvonne und meine Mutter weg, und nach Schnaps verlangten nur Tante Lydie und Onkel Erwin, die den Obstler schnell kippten und sich gleich Nachschub sicherten.
»Wir werden uns künftig vielleicht häufiger sehen«, sagte Tommi nach einer Weile, und mir war es, als würde mein Vater uns mit Argusaugen beobachten.
»Echt? Das wäre ja super! Wie kommt’s«?, fragte ich.
»Ich habe einen neuen Job, seit ein paar Wochen. Die Firma ist gar nicht weit weg von deiner Uni.«
»Cool, dann können wir ja mal um die Häuser ziehen! Das wird auch wieder höchste Zeit, das fehlt mir schon lange.«
»Das machen wir. Tut mir übrigens leid, dass ich bisher noch gar nicht die Zeit gefunden habe, dich in deiner WG zu besuchen. Ich hatte es aber fest vor, und ich habe auch schon deinen Vater nach der Adresse gefragt. Ich war etwas überrascht, dass du seit damals nicht umgezogen bist.«
»Warum sollte ich? Mir geht’s gut dort, das Viertel ist in Ordnung, und zur Uni habe ich es auch nicht weit.«
»Zur Uni, hm …«
Dass mein Vater sich knurrend zu Wort meldete, irritierte mich, aber als ich ihn fragend ansah, machte er keine Anstalten, mehr zu sagen. Stattdessen wechselte er einen schnellen Blick mit Tommi, und der nippte erst an seinem Glas, bevor er fortfuhr.
»Wir haben übrigens zwei gemeinsame Bekannte.«
»Ach was! Wen denn?«
»Ich bin seit zwei Jahren mit Jennifer zusammen, sie ist mit mir in deine Stadt gezogen.«
Ich ging beide Jennifers durch, die mir in diesem Moment in den Sinn kamen, aber beide hatten erzählt, dass sie Singles seien. Die eine war in der Nähe der Uni aufgewachsen und jobbte inzwischen in einem Fitnessclub, die andere stammte aus Thüringen oder Sachsen, daran konnte ich mich nicht mehr genau erinnern, und sie war vor eineinhalb Jahren in die Stadt gezogen, nicht wie Tommis Freundin vor ein paar Wochen. Mein Schulfreund ließ mich ein wenig zappeln und wartete grinsend ab, bis ich zu Ende nachgedacht hatte.
»Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich beleidigt sein soll oder froh, weil Jenny bei dir offenbar keinen großen Eindruck hinterlassen hat. Groß … schlank … lange blonde Haare …«
Er ließ hinter jedem Detail eine kurze Pause und hob die Stimme, als handle es sich um Quizfragen. In meinem Magen begann es, zu rumoren, und das lag nicht an Mamas Essen.
»Ihre beste Freundin heißt … Shari.«
Jetzt wusste ich, wer Tommis blonde Freundin war, und die kleine Pause vor Sharis Namen machte mir klar, dass er mich auf die Probe gestellt hatte. Ein Blick auf meinen Vater wischte auch den letzten Zweifel beiseite: Tommi und er hatten sich über mich unterhalten, vielleicht schon ein paarmal, seitdem er nach meiner Adresse gefragt hatte. Und ganz sicher hatte mein Schulfreund auch davon berichtet, was er durch Shari und Jenny über mich und meinen Tagesablauf erfahren hatte. Ich versuchte, mich fieberhaft daran zu erinnern, was ich Shari erzählt hatte. Ich sprach nie schlecht von meinen Eltern, aber es kam schon vor, dass ich einen flapsigen Spruch darüber machte, wie wenig ich mich an der Uni anstrengte und wie rührend ich dafür von zu Hause finanziert wurde. Meinem Vater war anzusehen, dass ihm Tommis Bericht über mich nicht gefallen hatte. Und was er nach einer unangenehm langen Pause hervorpresste, verhieß nichts Gutes.
»Heute ist zwar dein Geburtstag, aber es wäre schön, wenn du nach dem Essen ein bisschen Zeit für deine Mutter und mich hättest. Wir müssen reden.«
Onkel Erwin musste von meinem Vater geweckt werden, dann bugsierte Papa ihn sowie Tante Lydie zur Haustür, und als die beiden draußen ins Taxi gestiegen und damit alle Gäste des Abends gegangen waren, entkorkte meine Mutter eine neue Flasche Rotwein. Ich würde in meinem alten Zimmer übernachten und nach einem gemütlichen Frühstück im Lauf des Vormittags zur S-Bahn laufen, also konnten wir gut noch ein bisschen beisammensitzen. Wenig später standen drei gefüllte Gläser auf dem Esstisch. Mein Vater schnupperte übertrieben gründlich am Wein, hielt das Glas ins Licht, prostete uns zu und konzentrierte sich sehr darauf, dem ersten kleinen Schluck lange nachzuschmecken. Meine Mutter lächelte dünn, räusperte sich schließlich und wartete darauf, dass mein Vater den Blick von seinem Glas hob und endlich zu sprechen begann.
»Tommi hat uns erzählt, wie es ihm so ergangen ist.«
Mein Vater war nicht gerade der König des Small Talks, aber ich nippte von meinem Wein und ließ ihm auf dem Sprung zum eigentlichen Thema den Anlauf, den er offenbar brauchte.
»Er hat das Studium schnell und sehr erfolgreich abgeschlossen, verdient inzwischen einen Haufen Geld.«
Ich musste mich beherrschen, dass ich nicht mit den Augen rollte. Wie ich befürchtet hatte, würde es wieder einmal darum gehen, dass ich mein Studium endlich abschließen und nicht weiterhin unnötig viel Zeit an der Universität vertrödeln sollte. Warum nur verstanden meine Eltern nicht, dass gerade in einem Studium Sorgfalt vor Schnelligkeit ging und dass es weder gesund noch angenehm sein konnte, wenn man völlig überdreht von einer Prüfung in die nächste taumelte. Ich war nun mal nicht der hektische Typ, vertrug Stress nicht gut und ging ihm deshalb lieber schon vorsorglich aus dem Weg.
Genervt von dem schon so oft aufgewärmten Thema, hörte ich gar nicht mehr hin. Stattdessen hing ich dem Gedanken darüber nach, was ich morgen unternehmen und ob ich Shari dazu überreden könnte, mich zu begleiten. Mir kamen einige gute Ideen, und ich nahm mir vor, sie gleich nachher zu fragen, ob sie Lust auf das Programm hatte, das ich ihr vorschlug. Vor allem musste der morgige Abend irgendwo enden, wo wir in Ruhe darüber reden konnten, was sie ihrer Freundin Jennifer oder womöglich Tommi direkt über mich erzählt hatte. Deshalb fiel mir auch erst mit einiger Verzögerung auf, dass mein Vater inzwischen aufgehört hatte, auf mich einzureden. Er sah mich stumm an, als warte er auf eine Antwort, und ich versuchte, mich fieberhaft daran zu erinnern, was er mich gerade gefragt hatte.
»Was denn?«, gab ich mich unleidig, und mein Vater seufzte, er sah verärgert aus.
»Wenn du in deinen Vorlesungen auch so gut zuhörst wie jetzt gerade, dann habe ich eigentlich keine Fragen mehr!«
Seine leicht vibrierende Stimme verhieß nichts Gutes, und meine Mutter legte ihm besänftigend eine Hand auf den Arm.
»Jetzt sag’s halt noch einmal«, bat sie ihn.
»Als würde das was bringen«, knurrte er nur und nahm einen großen Schluck.
»Schau, Daniel«, setzte an seiner Stelle nun meine Mutter an, »wir unterstützen dich nun schon so lange, und wir tun das ja auch gern.«
Vater schnaubte und fing sich dafür einen strengen Blick seiner Frau ein.
»Wir wollten immer, dass es dir mal besser geht als uns«, fuhr sie fort. »Papa wollte ursprünglich etwas ganz anderes arbeiten, aber er hat sich mit seinem Job arrangiert, damit wir als Familie durchkommen. Inzwischen macht er sich aber schon auch Sorgen, weil er nicht weiß, wie es mit seiner Firma weitergeht. Und sollte er eines Tages auf der Straße stehen, ist er zu alt, um problemlos etwas Neues zu finden.«
»Lass das doch«, unterbrach er sie. »Jammern bringt uns nicht weiter.«
»Aber wenn es doch so ist? Dein Auto macht’s nicht mehr lang, am Haus muss dringend einiges repariert werden, und ich kann auch nicht ewig Zeitungen austragen!«
Mein Vater presste die Lippen zusammen, und auf seinem Gesicht lieferten sich Ärger und Zweifel ein Duell. Nach einer kurzen Pause stellte sich heraus, dass der Ärger gewonnen hatte.
»Um es kurz zu machen, Daniel: Wir wollen, dass du es dir nicht länger auf unsere Kosten gemütlich machst. Du darfst gern studieren, so lange du willst – aber du wirst ab sofort das Geld, das du dafür brauchst, selbst verdienen. Du wirst deine Miete, dein Essen, deine Bahnkarte und alles andere künftig selbst bezahlen.«
Ich war überrascht. Schon oft hatten wir über dieses Thema diskutiert, doch am Ende hatte ich meine Eltern immer breitschlagen können. Aber diesmal sah ich der Miene meines Vaters an, dass ich mir meine sonstigen Beteuerungen und Betteleien sparen konnte. Meine Mutter wirkte weniger verärgert, als ich sie fragend ansah, zuckte sie allerdings nur entschuldigend mit den Schultern.
»Und wie soll das gehen?«, unternahm ich einen lahmen letzten Versuch. »Soll ich Vorlesungen ausfallen lassen, soll ich durch Prüfungen rasseln, weil ich keine Zeit mehr zum Lernen habe?«
Auf der Stirn meines Vaters bildeten sich ein paar zusätzliche Falten, und einen Moment lang sah er aus, als würde er mir an die Gurgel wollen. Mutter legte ihm eine Hand auf den Arm, und er atmete tief durch, bevor er aufstand.
»Nein, du musst nicht noch mehr Vorlesungen ausfallen lassen, als du es ohnehin schon tust«, versetzte er mit leicht vibrierender Stimme. »Wenn du an all den Tagen, die du an der Uni blaumachst, nur zwei, drei Stunden jobbst, müsstest du finanziell sehr gut hinkommen.«
Damit war der Abend beendet. Ich schlief erst spät ein, und die Gedanken an Tommi, die mich bis dahin beschäftigten, waren nicht sehr freundlich.
Auch der nächste Abend verlief nicht so angenehm wie erhofft, obwohl ich ihn mit Shari verbrachte. Wir waren essen gegangen, und sie hatte offenbar ein schlechtes Gewissen, denn sie sagte mir, ich sei eingeladen, noch bevor ich das Thema, das mir unter den Nägeln brannte, überhaupt angesprochen hatte.
Nach der Vorspeise erzählte sie mir von Jennifer, die sie während eines Auslandsaufenthalts vor ein paar Jahren kennengelernt hatte. Und als ihre alte Freundin ihr schrieb, dass sie in dieselbe Stadt wie Shari ziehen würde, waren beide ganz aus dem Häuschen und feierten seither immer mal wieder gemeinsam in den Clubs der Stadt. Eines Abends war Tommi mitgegangen, und irgendwie waren sie auf mich als Sharis neuen Freund zu sprechen gekommen – und als der sich als alter Kumpel von Tommi entpuppte, gab es ein großes Hallo … und leider auch viel über alte und aktuelle Zeiten zu besprechen. So erfuhr Tommi von meinem locker gehandhabten Studium und meinem zurückhaltend kalkulierten Pensum, und mein ehrgeiziger »Freund« wusste nichts Besseres, als sich unter dem Vorwand, meine Adresse zu erfragen, darüber mit meinem Vater auszutauschen.
»Du weißt schon«, beschwerte ich mich nach einer Weile, »dass du mir damit ordentlich Probleme eingebrockt hast, oder?«
»Wie man’s nimmt. Die Probleme hast du dir, im Grunde genommen, selbst zuzuschreiben. Ein bisschen mehr könntest du dich an der Uni tatsächlich anstrengen, das musst du zugeben.«
»Pfff! Dank Tommis Geschichten über mich haben mir meine Eltern den Geldhahn zugedreht. Nun soll ich arbeiten, um meine eigene Kohle zu verdienen.«
»Ja, und? Findest du das so ungebührlich? Wir müssen alle arbeiten für unser Geld. Auch Tommi, auf den du jetzt sauer bist.«
Irgendwann stand ich auf, verabschiedete mich kaum von Shari und ging allein nach Hause. Auf dem Weg in meine WG dachte ich darüber nach, wo ich am leichtesten das nötige Kleingeld verdienen konnte, um mein bisheriges Leben möglichst unverändert weiterführen zu können. Statt einer Idee fand ich einen Zettel vor. Edgar, der Hauptmieter meiner WG, hatte mir den Wisch an die Tür zu meinem Zimmer geklebt.
»Miete ist fällig. Heute kam das Geld nicht. Der Dauerauftrag ist gekündigt.«
Meine Eltern machten offenbar Nägel mit Köpfen.
Kapitel 2
Zu spät kommst du auch morgen noch
»Guten Morgen, Daniel.« Die Stimme meiner Mutter klang aufgekratzt. »Das war natürlich alles nur Spaß. Wir haben dir gestern wieder Geld überwiesen, und du kannst dich gern weiter auf dein Studium konzentrieren.«
»Danke«, sagte ich – und wachte davon auf.
Ein paar Minuten lang blieb ich noch liegen, hielt die Augen fest geschlossen und versuchte, in den Traum zurückzukehren. Doch die freundliche Stimme meiner Mutter blieb verschwunden, dagegen sah ich Vaters finstere Blicke vor meinem geistigen Auge, und daneben hing Edgars Zettel wegen der fälligen Miete. Schließlich gab ich auf und schlurfte in die Küche, obwohl es kaum zwölf Uhr durch war. Pappiges Müsli, dünner Kaffee und eine halbe Stunde in der stickigen Luft der Straßenbahn, die durch die Kurven auf der Fahrt hinaus ins Gewerbegebiet ordentlich durcheinandergewirbelt wurde – dann stand ich vor einem hässlichen Gebäudeblock. Hier arbeitete Seb als Techniker für diese Fernsehklitsche, deren Namen ich mir noch nie hatte merken können.
Eine verlebte Magersüchtige mit schlechter Laune, noch schlechter toupierten und unfassbar schlecht blondierten Haaren saß auf einer Bierbank und nuckelte an einer kleinen Plastikflasche mit Wasser. Ein nicht mehr ganz junger Typ mit grau meliertem Wuschelkopf stand vor ihr und redete unablässig auf sie ein, und ein paar Meter von den beiden entfernt lehnten zwei Männer in Cargohosen und Shirts an der Wand, ließen sich dick belegte Schrippen schmecken und machten sich über irgendetwas lustig. Zwischendurch schauten sie immer wieder kurz zu der Magersüchtigen hinüber, stießen sich danach an und prusteten noch heftiger los als zuvor.
Zwischen der Bierbank und den Cargohosen stand eine zweiflügelige Stahltür offen. Ich ging langsam darauf zu. Dahinter sah man im Licht einiger Scheinwerfer Männer und Frauen emsig durchs Blickfeld eilen. Kommandos waren zu hören, es wurde gehämmert und getackert, und als es scharf ratschte, als würde dicker Stoff reißen, wurde das Geräusch gefolgt von mehrsprachigem Fluchen.
Seb sah müde aus, als er durch die Tür ins Freie trat. Er warf der Magersüchtigen einen genervten Blick zu und wollte sich eben den beiden Cargohosen zuwenden, als er mich bemerkte. Seb blinzelte überrascht, schaute kurz auf seine Armbanduhr und kam mir auf halbem Weg entgegen.
»Hi, Daniel, was machst du denn hier?«
»Und dann noch so früh«, entgegnete ich und deutete lachend auf seine Uhr.
»Eben. Ist was passiert?«
Ich erzählte ihm vom Gespräch mit meinen Eltern und dessen Folgen. Natürlich hatte ich meine Rolle darin ein wenig aufgehübscht, aber Seb konnte ich damit offensichtlich nicht täuschen.
»Wäre ich dein Vater, hätte ich dir den Geldhahn schon vor langer Zeit zugedreht«, sagte er gut gelaunt.
»Danke auch. Dann geh ich mal lieber wieder.«
Ich war kurz davor, tatsächlich beleidigt zu sein. Seb grinste breit.
»So schnell beleidigt?«, neckte er mich. »Na, dann bist du hier aber falsch.«
Ich sah ihn fragend an.
»Na, falls du hier anheuern willst, meine ich.«
»Woher weißt du das?«
»Das ist ja nun nicht schwer zu erraten. Du kommst hier rausgefahren, stehst um ein Uhr nachmittags leidlich wach vor der Produktionshalle – da wirst du mich ja wohl nicht um eine Kippe bitten wollen, oder?«
»Ich rauche nicht.«
»Eben, das auch noch. Was kannst du denn?«
Ich zuckte mit den Schultern.
Was wird man schon können müssen, wenn man in einer solchen Klitsche jobbt?
Seb grinste noch breiter.
»Hast wohl gedacht, in dieser Klitsche sind sie froh, wenn überhaupt jemand für sie arbeiten will, stimmt’s?«
»Nö«, schwindelte ich und fragte mich, ob Seb Gedanken lesen konnte. Das beherrschte ich schon mal nicht, und anschließend ging ich die Liste meiner Fähigkeiten durch. Das war schnell gemacht, und ich war auf nichts Außergewöhnliches gestoßen.
»Egal«, sagte Seb, legte mir einen Arm um die Schulter und bugsierte mich in Richtung der Stahltür. »Wir werden schon was für dich finden.«
Der Wuschelkopf hatte sich inzwischen in Rage geredet, und die Frau auf der Bierbank sah nun nicht nur mager und verlebt aus, sondern war obendrein zu einem blondierten Häufchen Elend zusammengesunken. Sogar ihre Frisur schien sich unter der Standpauke zu ducken.
Im Inneren des Gebäudes war die Stimmung nicht besser. Techniker saßen abseits und blickten mürrisch drein, auf einem Klappstuhl mit Sitz und Lehne aus beigefarbenem Stoff lümmelte eine Mittdreißigerin in Outdoor-Klamotten, die sich immer wieder die kurzen Haare zu verstrubbeln versuchte, während vor ihr zwei junge Frauen und ein älterer Mann standen und ihr Vorschläge machten, die ich nicht verstand. Eine der Frauen wurde auf Seb und mich aufmerksam, als wir nur noch ein paar Schritte entfernt waren, und als sie uns ins Visier nahm, wandte sich die Mittdreißigerin auf ihrem Klappstuhl zu uns um. Ich blieb stehen und schaute fragend zu Seb, aber die Frau im Stuhl gab uns mit einer unwilligen Geste zu verstehen, dass wir näher kommen sollten.
»Außerdem wäre es schön, wenn ich mir wegen euch beiden nicht den Hals verrenken müsste.«
Ihre Stimme war rau und befehlsgewohnt. Sie wedelte zu ihren drei bisherigen Gesprächspartnern hin, und die rückten daraufhin ein wenig zur Seite, um uns Platz im Blickfeld der Sitzenden frei zu machen. Die Frau auf dem Klappstuhl musterte mich von oben bis unten, dann wandte sie sich an Seb.
»Kann er sprechen?«
Hält die mich für blöde?
Seb warf mir ganz kurz einen warnenden Seitenblick zu, also verkniff ich mir fürs Erste den Kommentar, der mir auf der Zunge lag.
»Geht so«, sagte Seb. »Kein Sprachfehler, kein Akzent, aber unseren Dialekt hört man durch – er stammt aus derselben Gegend wie ich.«
Die Sitzende verdrehte die Augen, dann nickte sie mir zu.
»Dann sag mal was?«
»Was wird das hier?«, blaffte ich sie an. »Versteckte Kamera?«
Einen Moment lang blieb sie regungslos sitzen, dann legte sich ein Lächeln auf ihr Gesicht. Ihre Hand beschrieb einen Halbkreis, die Geste sah beneidenswert lässig aus.
»Na ja, zumindest sind sie nicht besonders gut versteckt.«
Sie wurde ernst und wandte sich an Seb.
»Gefällt mir, netter Kerl. Aber du hast recht: sein Dialekt …«
Sie schüttelte sich, und die beiden jungen Frauen kicherten pflichtschuldig.
»Seb«, fuhr sie ungerührt fort, »hol mal die Kleiderpuppe aus der Garderobe. Vielleicht hat sie heute einen guten Tag, und wir bekommen die Ansage noch irgendwie in den Kasten. Und nimm deinen Freund mit, zum Licht am besten. Hier steht er nur im Weg rum.«
»Danke«, sagte Seb, und mir war nicht im Ansatz klar, wofür er sich bedankte. Die dumme Kuh hatte mich taxiert und für ungeeignet befunden, sie hatte ihn über mich befragt, obwohl ich direkt vor ihr stand, und nun sollte ich auch damit aufhören, im Weg herumzustehen – wirklich: vielen Dank auch!
»Lief doch ganz gut«, raunte Seb mir zu, als wir weit genug von der Vierergruppe entfernt waren. »Du machst heute mal den Helfer für unseren Best Boy. Wenn du dich bis heute Abend einigermaßen gut anstellst, solltest du kein Problem mehr damit haben, deine WG-Miete bezahlen zu können.«
Ich verstand kein Wort, hoffte aber, dass Seb mir schon rechtzeitig alles erklären würde. Und ich war baff, dass ich offenbar einen Job im Filmteam ergattert hatte – welchem Umstand ich das auch immer verdanken mochte.
Seb eilte zwischen allerlei Gerätschaften hindurch und einen schmalen Gang entlang, der weiter ins Innere des Gebäudes führte. Durch eine offen stehende Tür flitzte er in einen Raum mit mehreren Sitzgarnituren, einer Kaffeemaschine, einigen weiß lackierten Tischen an einer Wand und großen Spiegeln an einer anderen. Es roch nach belegten Brötchen, Kaffee, diversen Parfums und Schweiß, und nahe der Tür saßen sich zwei Personen gegenüber: ein junger Mann, der mit einer hübschen jungen Frau flirtete, während sie gelangweilt wirkte und nur einsilbig antwortete, als sei es diese Unterhaltung nicht wert, ihr aufwendiges Make-up dafür zu ruinieren.
»May«, sagte Seb, »Vea will dich vor der Kamera haben.«
Die junge Frau sprang auf und trat vor den Spiegel, noch bevor Seb den Satz beendet hatte. Der junge Mann blieb sitzen und warf Seb böse Blicke zu, die mein Freund aber nicht beachtete. Sekunden später baute sich May vor Seb auf und strahlte ihn an.
»Was meinst du: Könnte es so gehen?«
Sie war umwerfend schön, soweit das unter der dicken Make-up-Schicht zu erkennen war, und allein ihre volle, leicht angeraute Stimme sorgte dafür, dass sich meine Nackenhaare aufstellten. Aber sie nahm offenbar nur Seb wahr, und kaum hatte der genickt, war auch er abgehakt. Sie eilte aus dem Raum und machte sich auf den Weg zur Kamera.
»Und du kommst auch gleich mit«, forderte Seb den jungen Mann auf. »Kannst deine Traumfrau ins rechte Licht setzen.«
Der junge Mann erhob sich umständlich.
»Daniel wird dir zur Hand gehen«, erklärte Seb im Hinausgehen und deutete auf mich. Damit war klar, dass ich von meinem Freund keine Tipps zu erwarten hatte.
»Daniel, ja?«
Die Stimme des jungen Mannes klang dünn und genervt. Ich nickte. Er machte keine Anstalten, mir die Hand zu geben. Dafür zog er, während er meinen Namen geradezu ausspuckte, ein Gesicht, als hätte ihm ein Hund ans Bein gepinkelt.
»Mal sehen, vielleicht nenn ich dich Dan. Kannst du verkabeln?«
Ich zuckte mit den Schultern, er seufzte.
»Was ist in diesem Laden auch anderes zu erwarten … Kannst Rip zu mir sagen.«
Damit war die Unterhaltung beendet. Er drückte sich an mir vorbei und stiefelte zum Studio zurück. Ich hielt mich hinter ihm, dachte darüber nach, aus welchem amtlichen Vornamen sich wohl ein solcher Spitzname ableiten ließ, und wartete auf Anweisungen. Die fielen ziemlich knapp aus. Mehr als »Das dort!«, »Hier rein!« und »Erst abrollen!« rang er sich nicht ab. Immerhin schien er halbwegs mit meiner Hilfe zufrieden, denn allmählich wurde sein Ton etwas weniger ungnädig.
Ende der Leseprobe