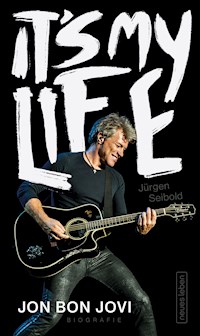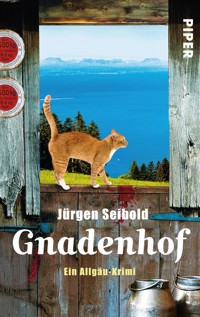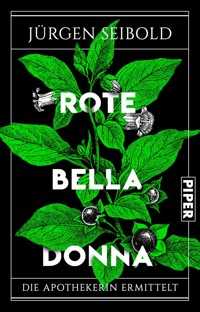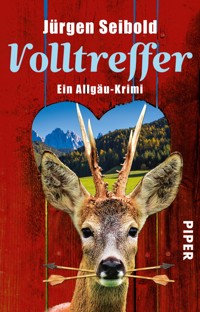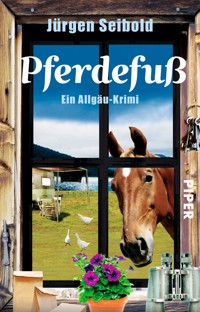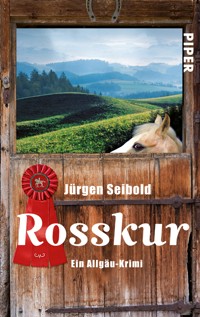8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Achtung! Lesen ist gefährlicher, als Sie denken … Der zweite Fall für Buchhändler Robert Mondrian Nach der Aufklärung des »Schneewittchen-Mordes« hofft Buchhändler Robert Mondrian auf ruhige Stunden, um sich endlich seiner literarischen Passion zu widmen. Doch prompt stellt ein neuer Mord ihn vor ein Rätsel: Auf einer Frauenleiche findet die Kripo einen Zettel mit einem Shakespeare-Sonett. Mondrian wird als Experte hinzugezogen und erkennt, dass die gereimten Zeilen vertauscht wurden. Sieht er Gespenster, oder will der Mörder ihm eine verschlüsselte Botschaft zukommen lassen? Handelt es sich womöglich um jemanden aus seinem früheren Leben bei Deutschlands geheimstem Geheimdienst? Ein Mord, ein mysteriöses Shakespeare-Gedicht und ein Buchhändler in Bedrängnis – nach »Schneewittchen und die sieben Särge« ein neuer packender Fall für Robert Mondrian. »Ein gelungener Auftakt zu einer vielversprechenden neuen Krimireihe. Ein wahrhaft märchenhafter Krimi, der spannend und humorvoll zugleich ist.« Ruhr Nachrichten über »Schneewittchen und die sieben Särge«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Sein oder Totsein« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
Covergestaltung : FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Alamy Stock Foto / eye35 und Motive von Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
1 – Während sich zuletzt …
Prolog
Die freien Tage bis zum nächsten Auftrag verbrachte er damit, auszuschlafen, essen zu gehen und das Konzert einer Band aus der Umgebung zu besuchen. Die Gruppe war gut, sie spielte eine Zugabe nach der anderen, und weil er noch am Tresen saß, als die meisten anderen Zuschauer schon nach Hause gegangen waren, konnte er noch auf ein Glas mit den Musikern anstoßen, die sich backstage geduscht hatten und nun eine Kleinigkeit zu essen serviert bekamen.
Erst weit nach Mitternacht schlenderte er bester Dinge durch die Straßen. Bis nach Hause war es zu Fuß keine halbe Stunde, genau die richtige Strecke, um durchzuatmen und müde zu werden. Ein kurzer Regenguss hatte Gehwege und Fahrbahnen nass hinterlassen, und hier und da spiegelte sich eine Laterne in einer kleinen Pfütze. Nur ab und zu fuhr ein Wagen vorbei, und in der Seitenstraße, in die er abbog, herrschte überhaupt kein Verkehr.
Die Schritte hinter sich hatte er allerdings auch schon entlang der Hauptstraße gehört. Er musste sich nicht umdrehen, um seine Verfolger einschätzen zu können. Hinter ihm auf dem Gehweg, etwa fünfundzwanzig Meter entfernt, gingen zwei Männer, einer trug Sneakers und hatte einen etwas schlurfenden Gang, der andere trat mit seinen schweren Stiefeln recht selbstbewusst auf. Die beiden gingen im selben Rhythmus, wobei der Stiefelmann wohl das Sagen hatte, denn der andere machte an jeder Biegung einige zusätzliche Schritte, um seine Gangart anzupassen. In der Nebenstraße wurden nun auch die Tritte der beiden anderen Männer hörbar. Sie bewegten sich auf der anderen Straßenseite und waren etwa auf gleicher Höhe wie die beiden hinter ihm.
Es wäre ihm ein Leichtes gewesen, die vier Männer abzuschütteln, aber er hatte es noch nie gemocht, vor anderen davonzurennen. Also wechselte er zunächst die Straßenseite und warf nur kurz einen Blick über die Schulter, wie um sich zu vergewissern, dass kein Auto kam. Drei der vier Männer waren muskulös, der vierte, der Schlurfer, war ein dünner Kerl mit fieser Visage, der eine Hand in der Jackentasche hielt – vermutlich war darin eine Waffe verborgen. Mit dem Quartett konnte er es leicht aufnehmen, aber er würde ihnen noch eine Chance geben.
Er nahm die nächste schmale Seitengasse, hörte die anderen ihm folgen, und als ihm nach vierzig, fünfzig Metern eine Mauer den weiteren Weg versperrte, blieb er mit dem Rücken zu den anderen stehen, bis diese auf zehn Meter herangekommen waren. Dann wandte er sich langsam um und musterte die vier Männer mit ruhigem Blick. Zwei von ihnen gingen an der jenseitigen Hauswand an ihm vorbei und postierten sich in seinem Rücken, nun war er von den vier Typen eingekreist.
»Kohle her!«, knurrte der Muskelprotz, der direkt vor ihm stand.
»Leute, lasst es gut sein. Ich hatte einen schönen Abend und mag mich mit niemandem streiten. Ihr lasst mich in Ruhe, ich gehe nach Hause, und über das hier muss keiner mehr ein Wort verlieren.«
Der Muskelprotz zwinkerte irritiert, schaute kurz zu dem Hänfling neben sich und pumpte dann seinen stattlichen Brustkorb noch ein bisschen stärker auf.
»Hast du einen an der Waffel?«, herrschte er ihn an. »Ich will deine Kohle haben, und zwar zackig!«
Er machte einen Schritt nach vorn, verharrte aber, als der andere nicht zurückwich, sondern nur beschwichtigend die Hände hob.
»Leute, lasst das lieber, ich meine es ernst. Ich hab schon verstanden, dass ihr vier mich ausrauben wollt. Und auch wenn ich nicht mehr viel Geld bei mir habe, mich das Ganze also gar nicht viel kosten würde, mag ich es nicht, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe.«
Der Hagere nahm die Hand aus der Tasche und ließ mit einem Knopfdruck eine Messerklinge hervorschnellen.
»Kohle her, du Spinner, sonst machen wir dich alle!«
Seine Stimme war so unangenehm wie sein Gesicht.
»Leute, es ist ja außerdem nicht gerade fair.«
Der Hagere lachte hämisch.
»Nicht fair? Ach so, weil wir vier sind und du nur einer.«
»Nein, weil ihr nur vier seid.« Er warf dem Hänfling einen mitleidigen Blick zu. »Oder eher dreieinhalb.«
Ein kurzer Seitenblick zum Hageren, und dann stürmten alle vier gleichzeitig auf ihn zu. Das vermeintliche Opfer nickte noch anerkennend, weil das Quartett immerhin wusste, wie es seine Überzahl ausspielen konnte. Danach wurde es hässlich. Und wenige Minuten später lagen drei bewusstlose Muskelprotze auf dem Boden, und an der Mauer lehnte der Hänfling und starrte jammernd auf die Messerklinge, die in seinem linken Unterarm steckte. Schließlich hob er den Blick, denn der Mann, den sie hatten ausrauben wollen, trat vor ihn. Das Licht der Laterne, die hinter ihm leuchtete und seine Umrisse aus der Nacht schälte, ließ den Mann noch größer und furchterregender wirken, als er ihn eben noch erlebt hatte.
»Du bleibst hier, ich ruf dir einen Krankenwagen. Denk dir eine Geschichte aus wegen des Messers – von mir werden sie nichts erfahren.«
Der Hänfling nickte.
»Und lasst solchen Blödsinn künftig, verstanden?«
Der Mann nickte erneut, diesmal hastiger, und der andere wandte sich ab und ging durch die Nacht davon.
Robert drehte sich zur Seite und hob sofort seinen Arm, als er gegen etwas Weiches stieß. Er blinzelte ins Morgenlicht. Neben ihm lag Sonja Fischer, die das Obstgeschäft neben seiner Buchhandlung betrieb, und schnaufte hörbar. Früher wäre er von jedem leisen Atmen in seiner Nähe sofort wach geworden, und dass er jetzt schlafen konnte, während neben ihm eine Frau schnarchte, deutete er als gutes Zeichen. Offenbar war er in seinem neuen, ruhigeren Leben angekommen. Auch die Träume hatten sich verändert. Nach wie vor drängten Erinnerungen an früher hoch, aber immer seltener musste er die Jobs als Agent von Deutschlands geheimstem Geheimdienst SG7 noch einmal durchleben – dafür spielten sich harmlosere Erlebnisse vor seinem geistigen Auge ab, wie heute Nacht der Überfall vor einigen Jahren, der für ihn weit glimpflicher ausgegangen war als für seine Angreifer.
Er stützte sich auf den Ellbogen und betrachtete die Frau in seinem Bett. Sie war schön, attraktiv, begehrenswert, und dass sie nun schon eine Zeit lang so etwas wie eine Beziehung hatten, gefiel ihm. Sonja hatte noch ihre eigene Wohnung, und Robert machte keine Anstalten, daran etwas zu ändern. Zum einen liebte er es, in seinen Räumen auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen – zum anderen sahen er und Sonja sich nicht täglich, und sie schien auch Wert darauf zu legen, dass sie ihre Freiheiten hatte.
Sein Blick schweifte durchs Zimmer. Gestern Abend hatte es schnell gehen müssen, die Kleider bildeten eine Spur vom Wohnzimmer bis vors Bett, und der kleine Hocker, der auf Sonjas Seite den Nachttisch darstellte, lag umgekippt auf halbem Weg zur Wand. Die Bilder der vergangenen Nacht vor Augen ließ er seine Fingerspitzen zärtlich über Sonjas Oberarm wandern, der auf der Decke lag. Ihre Haut war warm und weich und verströmte einen anregenden Duft, aber sie atmete so friedlich und ruhig, dass er es nicht übers Herz brachte, sie zu wecken. Vorsichtig schlug er die Decke zurück, stand auf und ging kalt duschen.
1
Während sich zuletzt eine lässige Bluesnummer zurückhaltend unter die Gespräche gemischt hatte, war nun Gone Dead Train zu hören, sehr gut zu hören, denn Wirt Richie drehte die Anlage ordentlich auf.
»Oje, nach dem nächsten Nazareth-Stück muss ich aber wirklich nach Hause«, sagte Robert Mondrian, und das lag nicht daran, dass er die schottische Hardrockband nicht gemocht hätte. Doch Richie McCafferty, der den Scottish Pub in der Remslinger Altstadt betrieb und wie einige Gründungsmitglieder von Nazareth aus Dunfermline stammte, hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, zu jeder vollen Stunde ein Lied seiner Landsleute zu spielen – und Robert saß nun schon seit drei Nazareth-Songs mit Klaus Neher zusammen. Den Kommissar der hiesigen Kripo hatte er kennengelernt, als Sonja Fischer verdächtigt worden war, einen ihrer Lieferanten mit einem vergifteten Apfel der Sorte »Schöner von Winsley« getötet zu haben. Und seit er der Kripo geholfen hatte, den Fall zu lösen, fachsimpelte Neher gelegentlich mit ihm über Aspekte von aktuellen Fällen – natürlich nur so vage, dass es Datenschutz und Dienstgeheimnis halbwegs zuließen. Diesmal allerdings hatte er angedeutet, dass er Robert etwas zeigen wollte, das am Fundort eines Mordopfers gelegen hatte.
»Es ist natürlich nur ein Foto des Originals«, schränkte Neher ein, als er jetzt endlich zu den letzten Gitarrenakkorden von Nazareth ein Papier entfaltete, vor Robert auf den Tisch legte und glatt strich. »Aber vielleicht können Sie mir sagen, woraus diese Textpassage stammt – oder ob sich das unser Täter selbst ausgedacht hat.«
Das Foto zeigte ein vergilbtes Pergament, das auf einer weißen Tischplatte lag. Die Ränder des Blattes hoben sich vom Tisch ab, als wäre das Pergament einige Zeit aufgerollt gewesen. Mit schwarzer Tinte hatte jemand in sorgfältiger Handschrift vierzehn Zeilen eines Gedichts in altertümlichem Englisch daraufgeschrieben. Robert erkannte, dass es sich um ein Sonett von William Shakespeare handelte – allerdings schienen die Textpassagen völlig durcheinandergewirbelt zu sein. Er wusste nicht auswendig, um welches Sonett es sich handelte, aber ein markanter Vers – ’Tis better to be vile than vile esteem’d – hatte sich ihm ebenso eingeprägt wie ein zweiter: All men are bad, and in their badness reign. Nur, dass er sie auf diesem Pergament nicht am Anfang und am Ende des Gedichts vorfand wie im Original, sondern an anderer Stelle – und obendrein waren die Verse halbiert, und jede Hälfte stand in einer anderen Zeile. Er erläuterte dem Kommissar, welche Unterschiede zum Original ihm auf den ersten Blick aufgefallen waren, und zeigte ihm anhand von zwei Beispielen, wie das auch das Schema der von Shakespeare vorrangig verwendeten Paarreime zerstörte. Neher nickte immer mal wieder, dann runzelte er die Stirn und maulte: »Echt? Shakespeare hat tatsächlich ›blood‹ auf ›good‹ gereimt?«
»Das braucht Sie jetzt nicht zu stören«, tadelte Robert ihn. »Aber vielleicht ist es ein Hinweis für Sie, dass die Zeilen geteilt und die Teile ziemlich wild hin und her geschoben wurden.«
»Und was soll das für ein Hinweis sein?«
»Na ja, ein bisschen Arbeit darf ich Ihnen schon noch übrig lassen, oder?«
Robert lachte und prostete dem anderen zu, aber Neher verzog das Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen.
»Sie haben sich mehr erwartet?«, lenkte Robert ein und wurde wieder ernst. »Ich schau mir den Text daheim gern noch etwas genauer an, und ich finde für Sie auch heraus, um welches von Shakespeares Sonetten es sich handelt. Vielleicht hilft Ihnen das ja weiter.«
»Gut, danke.«
»Das Pergament auf dem Foto: Ist das denn alt?«
»Nein, das können Sie so in jedem Schreibwarenladen kaufen. Es ist vor allem für selbst geschriebene Gutscheine beliebt. Auch die verwendete Tinte ist handelsüblich, und zum Schreiben wurde ein Füllfederhalter genommen, der ebenfalls überall erhältlich ist.«
»Lässt die Schrift auf Merkmale des Täters schließen?«
»Unsere Kriminaltechniker sind dran, und die Schriftexperten vom BKA helfen ihnen. Fingerabdrücke wurden nicht auf dem Pergament gefunden, DNA zwar schon, gleich von mehreren Personen – aber solange wir keine Vergleichsproben haben, bringt uns das nicht weiter. Die können vom Täter stammen, aber auch von einer Verkäuferin, die das Pergament ausgepackt, umgeräumt oder über die Ladentheke gereicht hat. In der BKA-Datenbank ergab jedenfalls keine der Proben einen Treffer.«
»Sie sagten, dass das Pergament am Fundort einer Leiche lag. Konkreter können Sie nicht werden?«
Neher räusperte sich und sah sich um. Am Tresen saß ein schlanker Mann mit langen schwarzen Haaren, ein Gitarrist, den Neher vor einiger Zeit mal mit einer hiesigen Soulband auf der Bühne gesehen hatte. Doch der Musiker tippte Textnachrichten auf seinem Smartphone, nippte zwischendurch vom frisch gezapften Bier, das vor ihm stand, und drehte nebenbei seelenruhig Zigaretten. Richie hatte eine Weile Gläser poliert und räumte nun einige Flaschen um, die auf Regalen über und hinter ihm standen. Sonst war außer ihnen beiden niemand im Gastraum. Der Kommissar beugte sich ein wenig nach vorn.
»Eigentlich nicht, aber …«
»Ich weiß das nicht von Ihnen, schon klar.«
»Genau. Sie haben von der Toten gehört, die Samstagfrüh neben der Siechenhauskapelle gefunden wurde, drüben in der Beinsteiner Straße?«
»Ja, eine Frau Ende zwanzig, erstochen, Identität unbekannt – so kam es im Radio, so stand es in der Zeitung. Mein Mitarbeiter raunte noch etwas von seltsamen Umständen, keine Ahnung, woher er das hat. Genaueres wusste er allerdings nicht zu berichten – deshalb habe ich nicht viel darauf gegeben, denn Alfons wittert überall Verschwörungen.«
»Diesmal liegt er gar nicht so falsch, obwohl es mich ärgert, dass er davon Wind bekommen hat, wenn auch nur vage.«
»Wovon?«
Noch ein schneller Blick in die Runde, dann erzählte Kommissar Neher: von der Stichwunde mitten ins Herz, von dem Pergament, das mit einer Sicherheitsnadel am Oberteil des Opfers befestigt war, und von dem Achat, der obenauf lag.
»Ein Achat?«
»Ja, Sie wissen schon. So ein Schmuckstein, den Sie im Internet für fünfundzwanzig Euro das Kilo bekommen, glatt geschliffen und poliert.«
»Ich weiß, was ein Achat ist, nur …«
»Nur was?«
»Ach, nichts. Und warum lag der Stein Ihrer Meinung nach auf dem Pergament?«
»Vielleicht wollte der Täter damit das Pergament beschweren, damit es nicht wegfliegt, und dann hat er oder sie gemerkt, dass ein drei mal vier Zentimeter kleines Steinchen dafür nicht ausreicht – so kam die Sicherheitsnadel ins Spiel.«
Robert sah aus, als wollte er widersprechen, doch nach kurzem Zögern zuckte er nur mit den Schultern.
»So wird es vermutlich gewesen sein«, brummte er. »Wissen Sie immer noch nicht, wer die Tote ist?«
»Doch, wir kennen ihren Namen inzwischen, aber den wollen wir noch nicht rausgeben. Ich will’s mal so ausdrücken: Sie hat prominente Verwandtschaft, und weil sich bisher aus ihrem familiären Umfeld noch kein Motiv für einen Mord ergeben hat, sehen wir derzeit keine Notwendigkeit, mit dem Familiennamen unnötig Staub aufzuwirbeln.«
»Okay …« Robert sah Neher an, ob der vielleicht doch noch mit dem Namen rausrücken wollte, aber der Kommissar schüttelte nur den Kopf. »Ist Ihren Kollegen an der Stichwunde etwas Ungewöhnliches aufgefallen?«
»Warum fragen Sie?«
»Einfach so«, wich Robert aus. »Ich möchte mir halt ein Bild machen, vielleicht ergibt das noch einen zusätzlichen Aspekt, unter dem ich mir das Gedicht genauer anschauen sollte.«
Neher blinzelte und musterte sein Gegenüber. Sein Blick ließ offen, ob er nicht doch vermutete, dass Robert einen konkreten Grund für seine Frage hatte.
»Wenn Sie es so für sich behalten wie alles andere, was ich Ihnen anvertraue, kann ich es Ihnen gern erzählen«, fuhr er schließlich fort. »Der Frau wurde von hinten ins Herz gestochen. Es erfolgte nur ein Stich, und die Tatwaffe verblieb einige Zeit in der Wunde. Vermutlich wollte der Täter oder die Täterin, dass möglichst wenig Blut austritt. Der Fundort war nicht der Tatort. Wo die Frau starb, wissen wir noch nicht. Für den Transport zur Siechenhauskapelle wurde sie wahrscheinlich in eine Plastikfolie eingewickelt, das legen Spuren am Leichnam und am Fundort nahe.«
»Nur ein Stich …«
»Und der ging direkt ins Herz und verletzte keine Rippe.«
»War die Frau irgendwie fixiert?«
»Gefesselt war sie nicht, als sie erstochen wurde, aber es gab ein leichtes Hämatom an der linken Schulter.«
Neher unterbrach sich und schaute Robert erwartungsvoll an. Der tat ihm den Gefallen und zog denselben Schluss wie zuvor wohl auch die Kripo.
»Also dürfte sie von einem Rechtshänder erstochen worden sein, der sie mit der linken Hand an der Schulter packte, um den Stich sauber ausführen zu können.«
»Genau.«
»Und der Täter muss schnell gehandelt haben und hat einen solchen Stich vermutlich nicht zum ersten Mal ausgeführt.«
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte Neher, und seinem Grinsen war anzusehen, dass er Spaß an seinem kleinen Test für Robert hatte.
»Wenn Sie jemand an der linken Schulter packen würde, wäre Ihr erster Reflex doch sicher, sich um- oder mindestens wegzudrehen, oder?«
»Vermutlich. Und was wäre Ihr erster Reflex, Herr Mondrian?«
Nun grinste Robert und zuckte mit den Schultern. Der Kommissar musterte ihn.
»Ich komme schon noch dahinter, was Sie vor Ihrer Zeit als Remslinger Buchhändler beruflich gemacht haben.«
»Lieber nicht«, versetzte Robert und nahm einen Schluck Bier.
»So schlimm?«
»Es gibt Dinge, die muss man nicht wissen. Vielleicht können wir es dabei belassen.«
Einen Moment lang wirkte Neher, als wolle er trotzdem nachfassen, dann seufzte er und dachte nach.
»Müsste die Frau ihren Mörder dann nicht auch gekannt haben? Schließlich befanden sich beide im selben Raum oder im Freien nah beieinander, und so sauber, wie der Stich ausgeführt wurde, kann die Frau kaum darüber erschrocken sein, dass sie jemand an der Schulter anfasst.«
»Außerdem ist es auch für Geübte nicht leicht, mit einem solchen Stich keine Rippe zu beschädigen. Wenn das kein Zufall war, könnte der Täter den Rücken des Opfers vorher abgetastet haben, um den Zwischenraum genau zu treffen. Das hätte sich die Frau vielleicht gefallen lassen, wenn sie die Berührung für ein Streicheln hielt.«
»Hm.«
»Gibt es etwas zum Stichkanal zu sagen?«, fragte Robert, als Neher nicht weitersprach, sondern nachdenklich in sein Glas starrte.
»Die Tatwaffe drang praktisch waagrecht ein, also war der Täter vermutlich etwas größer als das Opfer. Aber das hilft uns auch nicht allzu sehr weiter: Die Tote ist etwa einen Meter fünfundsechzig groß, und etwa ein Meter fünfundsiebzig oder achtzig Körpergröße sind nicht gerade ein außergewöhnliches Merkmal, vor allem, wenn der Täter ein Mann war. Außerdem kann er oder sie genauso gut auch kleiner sein und etwas erhöht gestanden haben.«
»Okay, und sonst?«
»Die Klinge der Stichwaffe war dünn und hatte einen dreieckigen Querschnitt.«
Robert runzelte die Stirn.
»Ein Stilett hat meistens eine solche Klinge«, merkte er an.
Neher nickte.
»Und das Stilett kam im sechzehnten Jahrhundert auf und war zu Shakespeares Zeit in Mode.«
Neher nickte erneut.
»Sie haben schon gewusst, dass der Text auf dem Pergament von Shakespeare ist, stimmt’s?«
»Ich wäre nicht darauf gekommen, ich lese eher Fachliteratur, aber ein Kollege aus der Kriminaltechnik hat wohl eine Schwäche für William Shakespeare, und ständig streut er Zitate ein, wie Sein oder Nichtsein oder Den besseren Gründen müssen gute weichen. Das kann nerven, glauben Sie mir.«
»Na ja, wenn er in der Kriminaltechnik arbeitet, sollte er sich vielleicht an andere Shakespeare-Sprüche halten. Behauptung ist nicht Beweis zum Beispiel. Oder: Wenn man nicht weiß, wohin man will, so kommt man am weitesten.«
»Die hat er sicher auch schon gebracht, ich kann mir das ohnehin nicht merken. Und fangen Sie jetzt bitte nicht auch noch damit an!«
»Schon gut«, gab Robert gutmütig zurück und prostete dem Kommissar zu. »Und Sie wollen mir den Namen der Toten wirklich nicht verraten?«
»Nein, tut mir leid. Warum interessiert er sie denn?«
»Ich hätte online ein bisschen herumstöbern können, vielleicht wäre ich auf etwas gestoßen.«
»Das machen meine Kollegen natürlich längst.«
»Trotzdem, Herr Neher, ich bin ganz gut in so was.«
»Nicht nur darin, wie mir scheint«, entgegnete Neher, trank sein Bier aus und erhob sich. »Ich muss jetzt auch los, derzeit sind Überstunden angesagt, nicht nur wegen der Leiche an der Kapelle.«
Er deutete zu der Wanduhr, die über der Ausgangstür des Pubs hing.
»Außerdem ist es schon wieder Viertel vor Nazareth.«
Robert hatte die Fenster aufgerissen, sobald er aus dem Pub nach Hause gekommen war. Doch das alte Haus war nicht besonders gut isoliert, und in einem heißen Juli wie diesem – schon dem dritten hintereinander, seit er in Remslingen lebte – hätte er bereits am frühen Morgen für ordentlich Durchzug sorgen müssen, um am Abend mit weiterem Lüften eine leidlich kühle Wohnung zu erreichen. Jetzt war es schon spät, aber die Außentemperatur würde die ganze Nacht hindurch nicht unter zwanzig Grad sinken, und so war die warme Nachtluft nur ein schwacher Hauch, als er sich in der Küche an den Tisch setzte.
Müde genug war er zum Schlafen, aber was Neher ihm im Pub erzählt hatte, ließ ihm keine Ruhe. Ein Stich ins Herz, ausgeführt von einem Täter, der darin vermutlich Übung hatte. Das konnte natürlich ebenso gut jemand sein, der sich für diesen einen Mord eingehend damit beschäftigt und sich die Anatomie genau eingeprägt hatte. Früher hatte Robert allerdings mehr mit Leuten zu tun gehabt, die ihre Übung anderen Morden verdankten, die sie zuvor begangen hatten. Und dann der Achat … Warum lag dieser kleine Schmuckstein auf der Leiche? Wenn es dem Täter wichtig war, dass das Gedicht wirklich auf der Leiche gefunden wurde, konnte er nicht riskieren, dass ein Windstoß das Pergament samt dem Steinchen wegwehte. Deshalb hatte der Plan wohl von vornherein eine Sicherheitsnadel vorgesehen – also konnte der Achat nicht zum Beschweren des Blatts gedacht gewesen sein. Wozu aber dann?
Als Glücksbringer hatten schon die alten Ägypter solche Steine geschätzt. Später wurde dem Achat die Eigenschaft zugeschrieben, seinen Träger unsichtbar oder ihm das Lügen unmöglich zu machen. Robert beugte sich nach vorn und drückte auf eine Stelle an der Frontseite der Eckbank, etwas unterhalb der Sitzfläche. Mit einem leisen Klicken wurde ein Fach entriegelt, das dort verborgen war. Er zog die schmale Schatulle hervor, legte sie auf den Tisch und klappte den Deckel zur Seite. Es war ihnen oft eingeschärft worden, keine Erinnerungen an Aufträge oder überhaupt an den Dienst aufzubewahren, aber er war vermutlich nicht der Einzige, der sich nicht daran hielt. Ohnehin waren es nur wenige Kleinigkeiten, die er behalten hatte, Details, die nur Eingeweihten etwas über ihn verraten konnten. Und mit denen hatte er nichts mehr zu tun. Seit seinem Weggang sollte auch keiner von ihnen mehr einen Grund dafür haben, ihn aufzusuchen. Ihn zu verfolgen. Ihm Zeichen zu geben. Ihn womöglich zu bedrohen.
Eigentlich.
Nachdenklich drehte er den schmalen Ring zwischen seinen Fingern. Ein unauffälliges Schmuckstück von geringem materiellen Wert. Der Ring war aus Gold, das schon, aber den Stein, der eingearbeitet war, konnte man überall für ein paar Euro bekommen.
Der Achat war damals ein Zeichen gewesen. War er das diesmal wieder?
Am nächsten Morgen kam Robert Mondrian völlig übermüdet in die Buchhandlung. Er hatte schlecht geschlafen, erst wegen der Grübeleien, später wegen der warmen Nacht. Was er jetzt brauchte, war ein starker Kaffee, auch wenn es ihn durchaus schon etwas wacher machte, dass ihn die Kakadus wie jeden Morgen mit lautem Geschrei begrüßten. Alfons hatte Sherlock und Watson in ihrem Käfig auf dem üblichen Platz neben dem Regal mit den Romanklassikern in englischer Originalausgabe platziert und war nun damit beschäftigt, den aktuellen Werbeaufsteller auf dem Pflaster hin- und herzuschieben, bis er einen leidlich sicheren Stand hatte.
Eine Kundin betrat den Laden, die altertümliche Türglocke ertönte, und die Kakadus imitierten deren Geräusch verblüffend echt, wenn auch deutlich lauter. Robert erkannte Dorothee von Meier, die pensionierte Deutschlehrerin, die sicher wieder auf der Suche nach einem Autor war, den sie günstig für das Programm der Remslinger Kulturlese engagieren konnte. Schnell schlüpfte Robert in die kleine Teeküche hinter der Buchhandlung, gerade noch rechtzeitig, bevor die resolute Dame ihn erspähen konnte.
»Na, ihr beiden?«, flötete sie in Richtung der Kakadus. »Wo ist denn der Chef? Wo denn?«
Einer der beiden Kakadus plusterte sich etwas auf, aber er bemerkte wohl Roberts warnenden Blick und sank ohne einen Laut wieder in sich zusammen. Und dann hatte Alfons die Kundin auch schon erreicht und belegte sie mit Beschlag.
So konnte er den Kaffee in Ruhe trinken und nebenbei ein paar Unterlagen durchsehen, und als sich Frau von Meiers Stimme dem Ausgang näherte und schließlich die Türglocke bimmelte, ließ er sich eine zweite Tasse aus der Maschine und ging nach vorn.
»Ist es gestern spät geworden?«, fragte Alfons und zwinkerte seinem Chef schelmisch zu. Er wusste, dass aus Roberts heimlicher Schwärmerei für die Obsthändlerin nebenan inzwischen mehr geworden war, und seit er Sonja Fischer eines Morgens aus dem Hintereingang von Robert Mondrians Haus hatte kommen sehen, leistete er sich ab und zu eine entsprechende Anspielung. »Frau Fischer hat ihren Laden heute früh auch erst um zehn nach acht aufgesperrt.«
»Da muss ich dich enttäuschen, Alfons, gestern Nacht waren wir nicht zusammen. Und jetzt lass den Blödsinn und sag mir lieber, was Frau von Meier wollte.«
»Angeblich sucht sie Lesestoff für eine Nichte, aber wenn Sie mich fragen, Chef, das war nur vorgeschoben. Sie braucht noch einen Schriftsteller, den sie für die nächste Brückenlesung einladen kann – und der möglichst nicht viel Honorar verlangt.«
Für diese neueste Veranstaltungsreihe des Vereins Remslinger Kulturlese stellten sich Autoren auf die Brücke, die vom Bädertörle hinüber zu den Wiesen an der Rems führte. Und während von oben vorgelesen wurde, saß das Publikum unten in Ruderbooten und ließ sich Trauben, Käse und heimischen Wein schmecken. Bei schönem Wetter fand das großen Anklang.
»Dachte ich mir’s doch. Und, konntest du ihr einen Tipp geben?«
»Ja, ich kenn mich doch ganz gut aus mit Krimis, wie Sie wissen, auch mit solchen aus der Region«, sagte Alfons. »Ich könnte da auch für Sie einige interessante Titel zusammenstellen, wenn Sie möchten.«
Was Robert von dem Vorschlag hielt, konnte er dessen genervter Miene leicht entnehmen.
»Ist gut, Chef, ich habe verstanden«, lenkte Alfons sofort ein. »Ich höre ja auch schon auf damit.«
Er drehte sich um und hielt ihm kurz darauf die Lokalzeitung unter die Nase. Robert konnte das Datum vom Montag erspähen.
»In dieser Ausgabe von vorgestern«, sagte er, »wurde erstmals von der Toten berichtet, die neben der Siechenhauskapelle gefunden wurde. Die Polizei, hieß es, wisse nicht, um wen es sich handle – und seither wurde immer noch nichts darüber veröffentlicht, wie das Opfer heißt und wer die Frau erstochen haben könnte. Ist das nicht eigenartig?«
Robert zuckte mit den Schultern.
»Ich habe Ihnen ja schon gesagt, Chef, dass mich dieser Mord sehr interessiert – schließlich wurde die Leiche ja nur ein paar Hundert Meter von mir daheim entfernt aufgefunden.«
Dich interessiert jeder Mord, dachte Robert, wo auch immer die Leiche gefunden wurde. Er schwieg aber und ließ seinen Mitarbeiter fortfahren.
»Und Sie wissen, dass ich die Augen und Ohren in diesem Fall offen halte, aber bisher … Viel habe ich noch nicht herausgefunden. Frau Heberle hat von einer Bekannten aufgeschnappt, dass an der Toten ein Zettel oder so etwas befestigt war. Es soll ein Gedicht daraufgestanden haben.«
»So, das hat Frau Heberle aufgeschnappt? Dieselbe Nachbarin, die den toten Lieferanten hinter Frau Fischers Vitaminoase gefunden hat?«
»Ja, dieselbe. Sie interessiert sich eben für alles, was in ihrer Stadt vor sich geht.«
»Das kann man wohl sagen …«
»Aber im Ernst, Chef: Ein Gedicht auf einer Leiche – ist das nicht genau der richtige Fall für Sie, für Book…«
Robert hatte drohend den Zeigefinger erhoben, und Alfons verstummte mitten im Wort und ging ans Schaufenster, wo er ganz plötzlich dringend etwas in Ordnung bringen musste.
»Ein Fall für Bookman … so weit kommt’s noch!«, brummte Robert und schüttelte sich. Natürlich hatte die Tote an der Kapelle sein Interesse geweckt, natürlich wollte er dem Fall auf den Grund gehen, und natürlich wollte er herausfinden, was für eine Botschaft sich in der Inszenierung des Opfers verbarg – und für wen sie gedacht war. Aber er hatte wirklich keine Lust, seinen Gehilfen in die Recherchen miteinzubinden. Denselben Gehilfen, der ihm nach dem Tod von Sonjas Lieferanten eher hinderlich als hilfreich gewesen war. Und der ihn – Superheldencomic-Fan, der er war – kurzerhand zu »Bookman« ernannt und ihm sogar ein Cape geschneidert hatte …
Es war an diesem Tag recht ruhig in der Buchhandlung, und als Alfons ihn fragte, ob er heute früher Schluss machen könne, war Robert Mondrian sofort einverstanden. Zumal ihm auffiel, wie aufgeregt Alfons wirkte.
»Triffst du dich mit Marie?«
Die beiden hatten sich lange nicht getraut, mehr miteinander auszutauschen als ein schüchternes »Hallo« oder ein »Bis morgen«. Doch nachdem sie ihm geholfen hatten, den falschen Mordverdacht gegen Sonja Fischer auszuräumen, waren sie unzertrennlich. Und auch wenn er nicht wusste, wie eng die Beziehung der beiden mittlerweile war, so freute er sich doch sowohl für seinen tollpatschigen Mitarbeiter als auch für die unscheinbare Marie, dass sie sich endlich einen Ruck gegeben und sich ihre gegenseitige Zuneigung eingestanden hatten.
»Wieso, Chef?«
Alfons wirkte ehrlich verblüfft.
»Na, so aufgekratzt, wie du seit zwei, drei Stunden bist … Ich dachte, ihr unternehmt heute was Schönes miteinander, und du freust dich schon darauf. Sie hat doch vorhin hier im Laden angerufen, oder nicht?«
»Nein, das war Frau Heberle.«
»Na«, sagte Robert und lachte, »sie wird ja wohl nicht der Grund für deine gute Laune sein.«
Alfons blieb ernst.
»Doch, ist sie. Sie und ihre Bekannte. Ich habe Ihnen doch erzählt, Chef, dass diese Bekannte die Leiche gesehen hat. Jetzt hat mir Frau Heberle gesteckt, dass ihre Bekannte die Tote sogar kannte.«
»Ach!«
»Das wollen mir die beiden heute erzählen«, sagte er stolz und schaute auf die Uhr. »Jetzt gleich, ich muss mich beeilen.«
»Wieso, wo musst du denn so eilig hin?«
»Zu Frau Heberle. Am Telefon wollte sie mir nichts weiter verraten, und deshalb hat sie mich für fünfzehn Uhr zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Zusammen mit ihrer Bekannten.«
»Zu Kaffee und Kuchen«, echote Robert und sah ihn fragend an.
»Wissen Sie, Chef, die beiden älteren Damen haben wohl nicht so oft Besuch. Ich vermute mal, der Deal soll sein: Ich bekomme die Informationen, und dafür leiste ich den beiden eine Weile Gesellschaft.«
»Das nenne ich mal Einsatz«, lobte Robert und zwinkerte ihm zu.
»Ach, das geht schon in Ordnung. Frau Heberles Kuchen sind legendär, das sagt jeder in der Stadt. Soll ich Ihnen ein Stück mitbringen?«
»Jetzt geh schon«, sagte Robert und sah ihm lachend nach.
2
Alfons hatte kaum den Klingelknopf gedrückt, als auch schon der Türöffner summte. Vermutlich hatte ihn Frau Heberle bereits vom Fenster aus kommen sehen. Aufgeregt und erwartungsvoll, wie er war, nahm er immer zwei Stufen auf einmal, und noch bevor er oben ankam, stand seine Gastgeberin in der Wohnungstür und strahlte ihm entgegen.
»Das ist ja schön, Herr Weber, dass Sie sich Zeit für mich und meine Bekannte nehmen.«
Alfons nickte nur, obwohl ihm weniger an den beiden Damen als an den versprochenen Informationen lag. Er ließ sich von Frau Heberle ins Wohnzimmer führen, wo sich eine pummelige Weißhaarige mit einiger Mühe aus dem Sessel erhob.
»Bitte bleiben Sie doch sitzen!«, rief Alfons aus und eilte zu ihr, schob sie sanft zurück auf das Polstermöbel und drückte ihr die Hand. Er wusste, dass sie – wenn auch ein Stück entfernt – in derselben Straße wohnte wie er, und er erinnerte sich vage, dass er sie ein paarmal bei sich vorbei zum Supermarkt hatte gehen sehen. »Sie müssen Frau Pfuderer sein. Danke, dass Sie gekommen sind – es ist nämlich genau andersherum: Nicht Sie müssen mir danken, sondern ich Ihnen.«
»Nehmen Sie doch bitte Platz, Herr Weber«, flötete Elsa Heberle, und Marianne Pfuderer deutete huldvoll auf den freien Sessel zwischen ihnen beiden, als wäre das ihre Wohnung. Die beiden kicherten und wirkten auch sonst aufgedreht wie zwei etwas in die Jahre gekommene Backfische, die ihre Nervosität vor dem ersten Rendezvous mit ihrem Verehrer überspielen wollten. Alfons lächelte sie an, überlegte aber schon jetzt fieberhaft, wie er möglichst schnell das Gespräch auf das Thema lenken konnte, das ihn wirklich interessierte.
»Ein Tässchen Kaffee?«, fragte Frau Heberle, wartete mit dem Einschenken aber nicht auf Alfons Webers Antwort. »Den können Sie ruhig trinken, er ist koffeinfrei. Und dort haben wir Süßstoff. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen auch noch Milch holen – wir beide müssen ja leider auf unsere Linie achten und trinken unseren Kaffee schwarz.«
Alfons musste sich Mühe geben, eine ernste Miene beizubehalten. Marianne Pfuderer sah nicht so aus, als würde sie sich viel verkneifen, und vor ihnen auf dem Tisch standen ein Rührkuchen und zwei so fett wirkende Torten, dass es auf ein paar Tropfen Kaffeesahne auch nicht mehr angekommen wäre.
»Erst einmal eine Schokoladentorte? Ich habe ganz kleine Stückchen geschnitten, damit wir auch alle Kuchen mal probieren können.«
Die Schnitte der hohen Torte waren so breit wie zwei Stücke, die in jedem Café als sehr groß gegolten hätten, und Elsa Heberle lud ihrer Bekannten und sich vergleichbar wuchtige Portionen auf die Teller.
»Vielen Dank, Frau Heberle«, setzte Alfons an, bevor er die Kuchengabel in das Ungetüm aus dunklem Teig, schwerer Creme und viel Schokolade versenkte. »Und vielleicht können wir auch gleich über die Tote an der Kapelle reden, die Sie, Frau Pfuderer …«
»Gleich, mein Lieber, gleich. Jetzt kosten Sie erst einmal. Es soll niemand von mir sagen können, die Heberle würde ihre Gäste verhungern lassen, nicht wahr?«
Sie lachte und stopfte sich den Mund mit Torte voll. Auch aus Marianne Pfuderers bis an den Rand gefülltem Mund würde eine ganze Weile kein verständliches Wort mehr kommen, also nahm Alfons ebenfalls den ersten Bissen. Die Torte schmeckte so ausgezeichnet, wie es die in der Stadt kursierenden Gerüchte behaupteten, und mit geschlossenen Augen ließ er sich das Wunderwerk auf der Zunge zergehen. Als er die Lider wieder hob, sah er Elsa Heberle vor sich, die ihn glücklich anlächelte.
»Es scheint Ihnen zu schmecken, das freut mich!«
Alfons konnte nur nicken, und sie ermunterte ihn, gleich die nächste Gabel zu nehmen. Ein kurzer Seitenblick zeigte ihm, wie ein stattlicher Brocken zwischen Frau Pfuderers weit aufgerissenen Lippen verschwand, und er ergab sich in sein Schicksal. Als er die letzten Krümel mit den Fingerspitzen vom Teller tupfte und die Finger ableckte, wurde er gar nicht erst gefragt, und schon landete ein dickes Stück von der zweiten Torte auf seinem Teller. Mehrere Schichten lockerer Boden, dazwischen nicht zu wenig Buttercreme, eine Schicht aus Obst und einer sahnigen Creme und obenauf ein ordentlicher Schlag Sahne.
»Das sieht sehr lecker aus, Frau Heberle, aber wenn wir jetzt vielleicht kurz auch über …?«
Marianne Pfuderers Mund hatte sich gerade hinter dem nächsten imposanten Bissen geschlossen, der ihre Wangen ausbeulte, und Alfons lächelte schmerzlich, nippte am dünnen Kaffee und machte sich über sein Stück von der zweiten Torte her. Auch sie war sehr gelungen, und der fabelhafte Geschmack ließ ihn seinen Frust fast vergessen, nun schon seit einer ganzen Weile mit den beiden Damen zusammenzusitzen und noch kein Sterbenswörtchen über die Tote an der Siechenhauskapelle erfahren zu haben. Während er kaute, ließ er seinen Blick durch das altmodisch eingerichtete Zimmer schweifen, und mehrere gerahmte Bilder auf einer Anrichte nahm er etwas genauer in Augenschein. Das war ein Fehler, wie sich sofort herausstellte.
»Mein seliger Mann«, brachte Elsa Heberle mit halb vollem Mund hervor. Sie stand auf, holte das größte der Porträts und stellte es vor Alfons auf den Tisch. »Er war schon ein schmucker Bursche, nicht wahr?«
Alfons nickte, obwohl das Gesicht vor ihm weder sympathisch noch gut aussehend war, doch Frau Heberle war’s zufrieden und erzählte ihm in epischer Breite von den gemeinsamen Jahrzehnten. Als sie eine kleine Pause ließ, um zwischendurch Luft zu holen, wandte er sich halb zu der anderen Frau um, aber Marianne Pfuderer hatte sich Nachschub von der Schokoladentorte auf den Teller gepackt und kaute schon wieder mit verzückter Miene.
So ging das eine Weile, und nach der zweiten Tasse Kaffee, nach der erschöpfenden Geschichte der heberleschen Ehe und einem dicken Stück Rührkuchen ließ sich Alfons in seinem Sessel nach hinten sinken und gab zu erkennen, dass er nun nichts mehr in sich hineinbringen würde. Fast flehentlich sah er Frau Pfuderer an, die nun auch tatsächlich ihren geleerten Teller etwas von sich schob.
»Dann will ich auch mal ein bisschen erzählen«, kündigte sie an, und nach einigen Sätzen über ihren ebenfalls vor Jahren verstorbenen Gatten musste Alfons sehr an sich halten, nicht allzu enttäuscht auszusehen, weil es wieder nicht um das Thema ging, das ihn in Wahrheit hierhergeführt hatte. Inzwischen breitete sich, pappsatt, wie er war, eine Müdigkeit in ihm aus, die ihn einfach nur in dem bequemen Polstermöbel liegen und gar nicht mehr an Widerworte denken ließ. Und so erfuhr er die Höhen und Tiefen von Marianne Pfuderers Ehe, einige unerwünschte Details über ihre Nachbarschaft und über den Tag, an dem sie Elsa Heberle kennengelernt hatte. Beinahe wäre er zwischendurch eingenickt, und als die beiden Damen sich anlächelten, ganz ergriffen von ihrer seit einigen Jahren bestehenden Freundschaft, riss sich Alfons zusammen, beugte sich ein wenig vor und ergriff das Wort.
»Das ist alles schön, der Kuchen und die Torten sind sehr lecker, und ich freue mich wirklich für Sie beide, dass Sie sich so gut verstehen – aber jetzt will ich wirklich wissen, was Sie, Frau Pfuderer, über die Tote sagen können, die neben der Siechenhauskapelle gefunden wurde.«
Einen Moment lang schaute die Pfuderer den Gast indigniert an, mit erhobenen Augenbrauen und einem Schuss Empörung im Blick. Aber ihre Freundin vermittelte in zuckersüßem Tonfall.
»Jetzt nimm ihm das bitte nicht übel, liebe Marianne. Du weißt doch: Die jungen Leute … nie haben sie Zeit, zu allem fehlt ihnen die Geduld.«
Alfons wollte schon zu einer Verteidigung ansetzen, denn er hatte geschlagene zwei Stunden mit diesen Frauen verbracht, aber er schwieg, weil er sah, dass Marianne Pfuderer seiner Bitte nun endlich nachkommen wollte.
Ende der Leseprobe