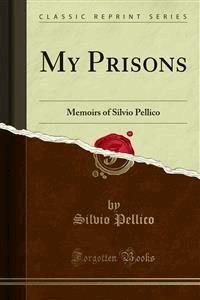Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Silvio Pellico war ein italienischer Schriftsteller. Bereits seit 1818 war er maßgeblich für die politische Zeitschrift Il Conciliatore tätig. In ihr veröffentlichte er seine politischen Artikel, in denen er immer wieder die Einheit Italiens forderte. In einem Prozess, der diesen Namen eigentlich nicht verdiente, wurde Pellico 1824 zum Tode verurteilt und bis zur Vollstreckung des Urteils in den Bleikammern, dem ehemaligen Gefängnis der Dogen von Venedig, eingesperrt. Durch einen Gnadenakt des Kaisers von Österreich Franz I. wurde die Todesstrafe in eine fünfzehnjährige Kerkerstrafe umgewandelt. Pellico verbüßte seine Haft in der Festung Spielberg bei Brünn in Mähren. Diese Autobiographie beleuchtet nicht nur diese schwere Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Gefängnisse
Silvio Pellico
Inhalt:
Silvio Pellico – Biografie und Bibliografie
Meine Gefängnisse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Meine Gefängnisse, S. Pellico
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849633172
www.jazzybee-verlag.de
Silvio Pellico – Biografie und Bibliografie
Ital. Dichter, geb. 25. Juni 1789 in Saluzzo, gest. 1. Febr. 1854 in Turin, verriet schon früh Neigung für die dramatische Dichtkunst. In seinem 16. Jahr nahm ihn ein Verwandter nach Lyon, wo er sich eifrig mit französischer Literatur beschäftigte. 1810 kehrte er zu seiner Familie nach Mailand zurück. Er wurde Lehrer des Französischen an der Militärwaisenschule und befreundete sich mit Monti und Foscolo. Hier schrieb er seine ersten Tragödien: »Laodicea« und »Francesca da Rimini« (deutsch von Max Waldau, Hamb. 1850; von Seubert, Leipz. 1872). Erstere zog er selbst als misslungen zurück; letztere errang großen Beifall. Nach dem Sturz des Napoleonischen Regiments wurde P. Erzieher. Im Hause des Grafen Porro Lambertenghi lernte er Frau v. Staël, Schlegel, Byron, Brougham und andre berühmte Ausländer kennen. Um diese Zeit entwarf er mit mehreren ausgezeichneten Patrioten den Plan zu einer Zeitschrift, welche die Wiedergeburt Italiens vorbereiten sollte. So entstand 1818 der »Conciliatore«, den die Österreicher aber schon 1820 unterdrückten. Auch Pellicos dritte Tragödie: »Eufemio di Messina« (1820), durfte nur unter der Bedingung gedruckt werden, dass sie nie ausgeführt würde. In demselben Jahre wurde P., der in den Bund der Carbonari getreten war, verhaftet. Im Februar 1821 wurde er nach Venedig abgeführt. Während seiner Gefangenschaft schrieb er die Tragödien: »Iginia d'Asti« und »Ester d'Engaddi«. Zum Tode verurteilt, aber zu 15jähriger harter Kerkerhaft begnadigt, kam er 1822 auf den Spielberg. Die oft grausame Behandlung hier hat er in »Le mie prigioni« ergreifend geschildert. Hier verfasste er die Tragödie »Leoniero da Dertona«, die er im Gedächtnis aufbewahren musste. 1830 erfolgte seine Begnadigung und Freilassung. Mit gebrochener Gesundheit und vom Mystizismus angekränkelt, kehrte er in sein Vaterland zurück und fand in Turin im Hause der Marquise Barolo als Sekretär und Bibliothekar Zuflucht. Sein Werk »Le mie prigioni« (Turin 1832 und in zahllosen neuen Drucken, sehr gut von Ravello, das. 1905) ist in fast alle gebildeten Sprachen übersetzt (deutsch, Leipz. 1833, 1872, 1893) und hat das österreichische Regiment in Italien vor ganz Europa gebrandmarkt. In seinen Tragödien, zu denen »Gismonda da Mendrisio«, »Erodiade« und »Tommaso Moro« gehören, hatte P. sich Alfieri zum Muster genommen, ohne ihn jedoch nur entfernt zu erreichen. Weichheit und Empfindsamkeit sind die hervorstechenden Züge seiner Stücke. Dasselbe Gepräge tragen seine poetischen Erzählungen aus dem Mittelalter »Cantiche« und seine lyrischen Gedichte »Poesie inedite« (Turin 1837), und auch der »Discorso dei doveri degli uomini« (1834; deutsch, Halle 1862) ermüdet trotz seiner unverwerflichen Moral durch denselben Fehler. Seine Werke sind oft herausgegeben: in 1 Bd. Mailand 1886; »Poesie e lettere inedite« Rom 1898; der »Epistolario« Florenz 1856; Briefe an Briano u.a., das. 1861; an den Bruder Luigi und Ferandi, Turin 1877–78, 2 Bde.; »Lettere alla donna gentile« Rom 1901. Übersetzungen der poetischen Werke gaben Kannegießer und Müller (2. Ausg., Stuttg. 1850) und Duttenhofer (das. 1835–37) heraus. Vgl. Giuria, Silvio P. eil suo tempo (Voghera 1854); Coppino, Commemorazione pel centenario della nascita di S. P. (Saluzzo 1889); Rinieri, Della vita e delle opere di Silvio P. (Turin 1898–1901, 3 Bde.); Pedraglio, Silvio P. (Como 1904).
Meine Gefängnisse
Habe ich diese meine Erlebnisse aus Eitelkeit, bloß um von mir zu reden, niedergeschrieben? Ich wünsche, daß dem nicht so sei; und soweit jemand als Richter über sich selbst aufzutreten vermag, so glaube ich, daß die Absichten doch etwas edlere waren, die ich dabei im Auge gehabt habe: – ich dachte, daß ich durch die Erzählung der Leiden, die ich erduldete, und mit der Darstellung der Tröstungen, welche nach meiner Erfahrung selbst im schwersten Unglücke dem Menschen noch erreichbar sind, dazu beitragen könnte, manchem Elenden Stärkung zu gewähren; – ich wollte Zeugnis davon geben, daß ich inmitten meiner langen Martern es dennoch nicht bestätigt gefunden habe, daß die Menschheit so ungerecht sei, daß sie eine so harte Beurteilung verdiene, und daß treffliche Gemüter so spärlich vorhanden sind, wie man es gewöhnlich von ihr behauptet; – auffordern wollte ich edle Herzen, den Sterblichen recht zu lieben, nicht ihn zu hassen, unversöhnlichen Haß allein zu hegen gegen gemeine Verstellung, gegen Verzagtheit, gegen jede sittliche Erniedrigung; – eine allbekannte Wahrheit wollte ich wiederholen, die so oft schon vergessen ward: daß Religion und Philosophie, die eine wie die andere, entschlossenen Willen und besonnenes Urteil heischen, und daß es ohne das gemeinsame Vorhandensein beider Bedingungen weder Gerechtigkeit, noch sittlichen Wert, noch feste Grundsätze gibt.
1.
Freitag den 13. Oktober 1820 wurde ich zu Mailand verhaftet und nach Santa Margherita gebracht. Es war drei Uhr nachmittags. Diesen Tag und ebenso an den darauf folgenden Tagen stellte man ein langes Verhör mit mir an. Aber hiervon schweige ich. Ich verhalte mich der Politik gegenüber wie ein Verliebter, der von seiner Schönen schlecht behandelt ward, und deswegen zu dem ernsten Entschluß gekommen ist, sich von ihr zurückzuziehen, ich lasse sie auf sich beruhen und rede von anderen Dingen.
Abends neun Uhr an jenem traurigen Freitage überwies mich der Gerichtsschreiber dem Gefängniswärter; dieser führte mich auf das für mich bestimmte Zimmer, ließ sich mit höflicher Entschuldigung meine Uhr, das Geld und alles andere, was ich in der Tasche hatte, aushändigen, um es mir seinerzeit wieder zuzustellen, darauf wünschte er mir ehrerbietig gute Nacht.
»Wartet ein wenig, mein Lieber,« sagte ich, »ich habe heute noch nicht zu Mittag gegessen; laßt mir etwas bringen.«
»Sogleich, mein Herr, das Wirtshaus ist ganz in der Nähe; und Sie werden finden, daß der Wein gut ist!«
»Wein trinke ich nicht.«
Bei dieser Antwort sah mich Herr Angiolino erstaunt an und schien zu erwarten, daß ich nur gescherzt hätte. Die Gefängniswärter, welche eine Schankwirtschaft halten, haben vor einem Gefangenen, der keinen Wein trinkt, einen wahren Schauder.
»Wahrhaftig, ich trinke keinen!«
»Tut mir Ihretwegen leid, der Herr werden die Einsamkeit doppelt empfinden ...«
Da er aber sah, daß ich meinen Entschluß nicht änderte, ging er hinaus, und in einer kleinen halben Stunde stand meine Mahlzeit vor mir. Ich aß nur wenige Bissen, schluckte ein Glas Wasser hinunter, darauf ward ich allein gelassen.
Das Zimmer war zu ebner Erde und lag nach dem Hofe hinaus. Gefängnisse hier, Gefängnisse dort; über mir Gefängnisse, Gefängnisse mir gegenüber. Ich lehnte mich an das Fenster und blieb eine Weile stehen, um auf das Kommen und Gehen der Kerkermeister und auf den wahnsinnigen Gesang einiger von den Eingesperrten zu hören.
Ich dachte: Ein Jahrhundert ist es her, da war dies ein Kloster; obwohl die frommen büßenden Jungfrauen, die es damals bewohnten, eine Ahnung davon hatten, daß heute in ihren Zellen nicht mehr Seufzer von Frauen und andächtige Lobgesänge, sondern Lästerungen und unkeusche Lieder ertönen würden, und daß dieselben heute Leute jeden Schlages aufnähmen, die meistens für die Arbeitshäuser oder für den Galgen bestimmt sind? Und wer wird nach Verlauf eines neuen Jahrhunderts in diesen Zellen atmen? O, über die Flüchtigkeit der Zeit! O, über den Wechsel der Dinge! Kann wer, der darüber nachdenkt, sich betrüben, wenn das Glück aufgehört hat, ihm zu lächeln, wenn er in das Gefängnis vergraben wird, wenn ihm der Galgen droht? Gestern war ich einer der glücklichsten Sterblichen auf der Erde: heute besitze ich von den Annehmlichkeiten, welche mein Leben erfreuten, keine mehr: nicht mehr Freiheit, nicht mehr den Umgang mit Freunden, keine Hoffnungen mehr! Nein, sich noch einer Täuschung hinzugeben wäre Torheit! Von hier werde ich nur herauskommen, um in noch schrecklichere Löcher geworfen oder dem Henker überantwortet zu werden! Gleichwohl, an dem Tage nach meinem Tode wird es sein, als wäre ich in einem Palaste gestorben und wäre mit den größten Ehren zu Grabe, getragen worden!
So verlieh das Nachdenken über die Flüchtigkeit der Zeit meinem Herzen neuen Mut. Aber vor meinen Geist traten mein Vater, meine Mutter, zwei Brüder, zwei Schwestern, eine andere Familie, die ich wie meine eigne liebte; da hatten die philosophischen Betrachtungen ihre Kraft verloren. Von Rührung überwältigt, weinte ich wie ein Kind.
2.
Vor drei Monaten hatte ich einen Besuch in Turin gemacht; hatte nach mehreren Jahren der Trennung meine teuren Eltern wiedergesehen, einen meiner Brüder und meine beiden Schwestern. Stets hatte in unserer Familie eine so große gegenseitige Liebe gewaltet! Keinen von den Söhnen aber hatten Vater und Mutter mit so vielen Wohltaten überhäuft als mich! Als ich die ehrwürdigen Eltern wiedersah, ach, wie sehr war ich bewegt, da sie sichtlich weit mehr gealtert hatten, als ich mir vorgestellt! Wie gern hätte ich sie damals nie wieder verlassen, wie gern ganz mich ihnen widmen mögen, um ihnen durch meine Fürsorge die Lasten des Alters zu erleichtern! Wie betrübte es mich, daß während der wenigen Tage, die ich zu Turin verweilte, etliche Geschäfte mich aus dem elterlichen Hause fortzogen, und daß ich einen nur so kleinen Teil meiner Zeit meinen geliebten Verwandten schenken konnte! Mit schmerzlicher Bitterkeit hatte die arme Mutter gesagt: »Ach, unser Silvio ist nicht unsertwegen nach Turin gekommen!« Den Morgen, als ich wieder nach Mailand abreiste, war der Abschied höchst schmerzlich gewesen. Mein Vater stieg mit in den Wagen und begleitete mich eine Meile weit; dann kehrte er ganz allein zurück. Ich wendete mich um, ihm nachzusehen, ich weinte und drückte auf einen Ring, den mir die Mutter geschenkt, einen Kuß; noch nie fühlte ich mich so beklommen, wenn ich von meinen Eltern Abschied nahm. Obwohl nicht an Ahnungen glaubend, erschrak ich doch, daß ich meinen Schmerz nicht bewältigen konnte, und war gezwungen, es ängstlich auszusprechen: Woher nur diese ungewöhnliche Unruhe? Es war mir eben, als sähe ich ein schweres Unglück voraus.
Jetzt, im Gefängnisse, fiel mir diese Beklommenheit, diese Angst wieder ein; ich gedachte aller einzelnen Worte, die ich vor drei Monaten von meinen Eltern gehört. Die Klage meiner Mutter: »Ach, unser Silvio ist nicht unsertwegen nach Turin gekommen!« fiel mir wie eine Zentnerlast auf die Seele. Ich machte mir Vorwürfe, daß ich mich nicht tausendmal zärtlicher gegen sie bewiesen hatte. – So sehr liebe ich sie, und daß ich ihnen dies nur so matt geäußert habe! Nie sollte ich sie mehr wiedersehen, und habe mich so wenig an ihrem teuren Anblicke gesättigt! so karg war ich mit den Beweisen meiner Liebe! – Diese Gedanken zerrissen mir das Herz. Ich schloß das Fenster, ging eine Stunde auf und ab, ich glaubte, die ganze Nacht keine Ruhe haben zu können. Ich legte mich auf das Bett und schlief vor Ermattung ein.
3.
Die erste Nacht in einem Gefängnisse aus dem Schlafe aufzuwachen ist etwas Furchtbares! – Ist es möglich (sagte ich, indem ich mich erinnerte, wo ich mich befände), ist's möglich! Ich hier? Ist dies wirklich nicht bloß ein Traum? Gestern also verhafteten sie mich? Gestern stellten sie das lange Verhör mit mir an, das man morgen und, wer weiß, wie lange noch, fortsetzen wird? Gestern abend vor dem Einschlafen weinte ich so heftig, da ich an meine Eltern dachte.
Die Ruhe, die vollkommne Stille, der kurze Schlaf, der meine geistigen Kräfte gestärkt hatte, schienen die Gewalt des Schmerzes in mir hundertfach gesteigert zu haben. Während hier jegliche Zerstreuung für die Gedanken fehlte, stellte sich der Kummer meiner teuren Angehörigen und vor allem die Betrübnis meines Vaters und meiner Mutter, wenn sie meine Verhaftung erfahren würden, in meiner Phantasie mit einer fast unglaublichen Heftigkeit dar.
In diesem Augenblicke, sagte ich, liegen sie noch ruhig im Schlafe oder wachen vielleicht, voll Liebe meiner gedenkend, ohne die geringste Ahnung davon, an welchem Orte ich mich befinde! Wie glücklich wären sie, wenn Gott sie aus der Welt hinwegnähme, ehe noch die Nachricht von meinem Mißgeschicke nach Turin gelangte! Wer wird ihnen Kraft geben, diesen schweren Schlag auszuhalten?
Eine innre Stimme schien mir zu antworten: Er, den alle Bekümmerten anflehen, lieben und in sich selbst empfinden! Er, der einer Mutter die Kraft gab, ihrem Sohne nach Golgatha zu folgen und unter seinem Kreuze zu stehen! Der Freund der Elenden, der Freund aller Sterblichen!
Dies war der erste Augenblick, wo die Religion in meinem Herzen triumphierte; der kindlichen Liebe verdanke ich diese Wohltat.
In der früheren Zeit hatte ich, ohne der Religion abgeneigt zu sein, mich nur wenig oder gar nicht nach ihr gerichtet. Die gewöhnlichen Einwände, mit denen man sie zu bestreiten pflegt, schienen mir zwar kein großes Gewicht zu haben, dennoch aber schwächten tausend sophistische Zweifel meinen Glauben. Schon seit lange betrafen diese Zweifel nicht mehr die Existenz Gottes; ich wiederholte mir, wenn es einen Gott gibt, dann muß eine notwendige Konsequenz seiner Gerechtigkeit sein, daß es für den Menschen, der in einer so ungerechten Welt gelitten hat, ein künftiges Leben gibt: daher ist es völlig gerechtfertigt, den Gütern dieses zweiten Lebens nachzutrachten; daher ein Kultus der Liebe gegen Gott und den Nächsten, ein beständiges Streben durch edle Aufopferung sich Verdienste zu erwerben. Schon seit lange hielt ich mir dies alles wiederholt vor und fügte hinzu: Was anderes ist das Christentum, als dies beständige Streben edler zu werden? – Da das Wesen des Christentums sich stets so rein, so philosophisch, so unangreifbar erwiesen, so wunderte ich mich, daß doch eine Zeit gekommen sei, in der die Philosophie mit dem Anspruch auftreten durfte: Von jetzt ab will ich an ihre Stelle treten! – Und in welcher Weiße willst du an ihre Stelle treten? Indem du das Laster lehrst? Gewiß nicht. Indem du die Tugend lehrst? Freilich, aber diese wird Liebe zu Gott und dem Nächsten sein; gerade dasselbe wird sie sein, was das Christentum lehrt.
Ungeachtet dessen, daß ich seit mehreren Jahren so dachte, unterließ ich es doch zu schließen: sei also konsequent! sei ein Christ! Nimm kein Ärgernis mehr an den Mißbräuchen! werde nicht böse über irgendeinen schwierigen Punkt in dem Dogma der Kirche, da ja der wichtigste und der klarste Punkt dieser ist: liebe Gott und den Nächsten.
Im Gefängnis entschied ich mich endlich, einen solchen Schluß zu ziehen, und ich zog ihn. Doch schwankte ich etwas bei dem Gedanken, wenn mancher erführe, ich sei frömmer als früher, so möchte er sich für berechtigt halten, mich für einen Heuchler oder für gedemütigt durch das Mißgeschick anzusehen. Aber in dem Bewußtsein, weder heuchlerisch noch gedemütigt zu sein, kam ich zu dem freudigen Vorsatze, mich um jeden möglichen unverdienten Tadel nicht im geringsten zu kümmern, und nahm mir fest vor, von jetzt an ein Christ zu sein und mich offen dafür zu erklären.
4.
Standhaft verharrte ich später bei diesem Entschlusse, aber daß ich ihn ernstlich erwog und ihn gewissermaßen für mich ergriff, dazu machte ich in jener ersten Nacht meiner Gefangenschaft den Anfang. Gegen Morgen hatte ich die Fassung wiedergewonnen; ich war darüber erstaunt. Ich dachte wieder an meine Eltern und die anderen Geliebten, ohne mehr an ihrer Seelenstärke zu zweifeln; die Erinnerung an ihre treffliche Gesinnung, die ich bei anderen Fällen an ihnen kennen gelernt, gewährte mir Trost.
Warum vorher diese furchtbare Aufregung in mir, da ich mit die ihrige vorstellte, und jetzt dies große Zutrauen zu der Hoheit ihres Mutes? War diese glückliche Veränderung ein Wunder? war sie eine natürliche Wirkung meines wiedererwachten Glaubens an Gott? – Was macht es aus, ob man die greifbaren erhabenen Wohltaten der Religion Wunder nennt oder nicht?
Um Mitternacht waren zwei Secondini (so heißen die Gefängniswärter, welche unter dem Kerkermeister stehen) in meine Zelle gekommen, um bei mir zu visitieren, und hatten mich in einer höchst üblen Laune gefunden. Gegen Morgen kamen sie wieder, sie fanden mich heiter und zu gemütlichem Scherze aufgelegt.
»Heute nacht, mein Herr,« sagte Tirola, »hatten Sie einen Blick wie ein Basilisk; jetzt sind Sie ganz anders, ich freue mich darüber: ein Beweis, daß Sie – entschuldigen Sie den Ausdruck – kein Spitzbube sind; denn die Spitzbuben (ich kenne das aus langer Erfahrung, und meine Beobachtungen haben einigen Wert) sind den zweiten Tag ihrer Haft erboster als den ersten. Nehmen Sie eine Prise?«
»Ich schnupfe zwar nicht, doch will ich Eure Artigkeit nicht zurückweisen. Was Eure Beobachtungen anlangt, so nehmt es nicht übel, wenn sie mir doch nicht so weise vorkommen als Ihr glaubt. Wenn ich heute früh nicht mehr so grimmig aussehe, so wäre es ja wohl möglich, daß die Veränderung ein Zeichen von törichter Gefühllosigkeit wäre, von leichtsinniger Neigung, mich zu täuschen und meine Freilassung mir nahe bevorstehend zu denken?«
»Ich würde darüber im Zweifel sein, wenn Sie, mein Herr, aus anderen Gründen im Gefängnisse wären; aber wegen dieser politischen Dinge darf man heutzutage nicht so leicht glauben, daß die so auf zwei Beinen abgemacht sind. Und Sie sind auch nicht so dumm, sich dies einzubilden. Nehmen Sie's nicht übel, Sie verstehen mich. Wollen Sie noch ein Prischen?«
»Her damit. Aber wie kann man so vergnügt aussehen, wenn man, wie Ihr, beständig unter Elenden lebt?«
»Sie werden meinen, das geschehe aus Gleichgültigkeit gegen die Leiden anderer: woher es eigentlich kommt, weiß ich wahrhaftig selber nicht so genau; aber ich kann Sie versichern, oft genug wird mir's ganz wehe ums Herz, wenn ich andere weinen sehe. Manchmal stelle ich mich bloß vergnügt, damit die armen Gefangenen doch auch fröhlich sind.«
»Da fällt mir etwas ein, mein Bester, woran ich bisher noch nicht gedacht habe: man kann das Amt eines Gefangenwärters versehen und dabei doch ein guter Kerl sein.«
»Das Geschäft tut dazu nichts, mein Herr, über das Gewölbe, das Sie da sehen, und über den Hof weg, liegt ein anderer Hof und andere Gefängnisse, alle für Weiber bestimmt. Es sind ... man kann es nicht anders sagen ... Weiber von schlechtem Lebenswandel, aber es gibt welche darunter, die, was das Herz anlangt, Engel sind. Und wenn Sie Aufseher wären ... «
»Ich?« (ich platzte vor Lachen heraus).
Tirola ward durch mein Gelächter außer Fassung gebracht und fuhr mit seiner Rede nicht fort. Wahrscheinlich meinte er, wäre ich Aufseher gewesen, würde ich dem schwerlich entgangen sein, daß ich mich in eine dieser Unglücklichen verliebte.. Er fragte nur noch, was ich zum Frühstück wünschte, entfernte sich dann und brachte mir nach wenigen Minuten den Kaffee.
Ich sah ihm fest ins Gesicht, mit einem boshaften Lächeln, welches sagen wollte: Würdest du wohl an einen anderen Unglücklichen, meinen Freund Piero, ein Billett von mir besorgen? Er dagegen antwortete mir wiederum mit einem Lächeln, das zu bedeuten schien: Nein, mein Herr, und wenn Sie sich an einen meiner Kameraden wenden, der Ihnen ja sagen sollte, so nehmen Sie sich in acht, denn er wird Sie verraten.
Ob wir uns gegenseitig richtig verstanden, dessen bin ich in der Tat nicht ganz sicher; ich weiß nur, daß ich zehnmal nahe daran war, ihn um ein Stückchen Papier und eine Bleifeder zu bitten, und doch wagte ich es nicht, weil ein gewisses Etwas in seinen Augen mir den Bescheid zu geben schien, ich solle niemandem trauen, einem anderen noch weit weniger als ihm.
5.
Wenn Tirolas Gesicht neben dem Ausdrucke von Gutmütigkeit nicht zugleich auch diesen schelmischen Blick gehabt hätte, wenn in seiner Physiognomie etwas Edleres gewesen wäre, dann würde ich der Versuchung, ihn zu meinem Botschafter zu machen, nicht widerstanden haben; und vielleicht hätte ein Billett von mir, wenn es zur rechten Zeit an meinen Freund gelangte, diesem das Mittel an die Hand gegeben, manches Versehen wieder gutzumachen – und vielleicht rettete das, wenn auch nicht ihn, den Armen, der schon zu sehr bloßgestellt war, aber einige andere und mich!
Geduld! es sollte so gehen.
Man holte mich zur Fortsetzung des Verhörs ab, und dies dauerte den ganzen Tag und einige andere, ohne daß eine andere Unterbrechung eintrat, als während der Mahlzeit.
Solange die Untersuchung noch nicht geschlossen war, vergingen mir die Tage reißend schnell, so sehr war mein Geist durch das endlose Antworten auf die verschiedensten Fragen in Anspruch genommen, ferner auch dadurch, daß ich mich während der Essenszeit und am Abend wieder sammelte, daß ich alles überdachte, was man mich gefragt und was ich geantwortet hatte, und alles überlegte, worüber man mich vermutlich noch weiter befragen würde.
Am Schluß der ersten Woche stieß mir ein großer Verdruß zu. Mein armer Piero, der ebenso sehnlich wie ich den Wunsch hegte, eine Verbindung zwischen uns herzustellen, schickte mir ein Billett zu; er bediente sich dabei nicht eines Unteraufsehers, sondern eines unglücklichen Gefangenen, der mit den Aufsehern in unsere Zimmer kam, um dort irgendwelche Dienste zu verrichten. Dies war ein Mann zwischen sechzig und siebzig Jahren, der, ich weiß nicht, zu wieviel Monaten Gefängnishaft verurteilt war.
Mit einer Stecknadel, die ich hatte, stach ich mir in den Finger, schrieb mit dem Blute ein paar Zeilen zur Antwort und steckte sie dem Überbringer zu.
Er hatte das Mißgeschick, daß man ihm aufpaßte, ihn durchsuchte, an seinem Leibe den Zettel erwischte, und wenn ich nicht irre, erhielt er dafür Schläge. Ich vernahm ein lautes Geheul und meinte, daß es von jenem alten Manne herrühre, den ich nicht wieder zu sehen bekam.
Wieder ward ich zur Untersuchung vorgeführt, ich erbebte vor Wut, als man mir den Zettel vorlegte, der mit meinem Blute beschrieben war (er enthielt Gott sei Dank nichts, was uns schaden konnte, sondern hatte nur das Aussehen einer einfachen Begrüßung). Man fragte mich, womit ich mir das Blut abgezapft hätte, nahm mir die Nadel weg und lachte die Angeführten aus. Ach, ich lachte nicht! Ich konnte den alten Boten aus meinen Augen nicht loswerden. Gern hätte ich eine Züchtigung ertragen, damit man nur ihm verziehe. Und als ich jenes Geheul vernahm, das vermutlich von ihm herrührte, da traten mir die Tränen in die Augen.
Vergebens fragte ich den Kerkermeister und die Secondini nach ihm. Sie schüttelten den Kopf und sagten: »Es ist ihm schlecht genug bekommen, er wird gewiß nichts Ähnliches versuchen, er genießt jetzt etwas mehr Ruhe.« Weiter wollten sie sich nicht auslassen.
Deuteten sie damit die verschärfte Haft an, in der man den Unglücklichen hielt, oder redeten sie so, weil er unter den Stockschlägen oder infolge derselben gestorben war?
Eines Tages glaubte ich ihn auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes unter dem Säulengange zu sehen, mit einem Bündel Holz auf dem Rücken. Mir klopfte das Herz, als wenn ich einen Bruder wiedersähe.
6.
Als ich nicht mehr durch Verhöre gequält ward und nichts mehr hatte, was meinen Geist den Tag über beschäftigte, da empfand ich die Last der Einsamkeit höchst bitter. Wohl erlaubte man mir, daß ich eine Bibel und den Dante erhielt; wohl stellte mir der Kerkermeister seine Bibliothek zur Verfügung, welche aus einigen Romanen von Scuderi, von Piazzi und noch geringerer Ware bestand; aber mein Geist war so aufgeregt, daß er zu keiner Lektüre irgendwelcher Art aufgelegt war. Jeden Tag lernte ich einen Gesang aus Dante auswendig, diese Übung geschah jedoch so mechanisch, daß ich mehr an meine Lage als an den Sinn der Verse dachte. Ebenso erging es mir bei der Lektüre anderer Gegenstände; nur einigemal darf ich ausnehmen, wenn ich in der Bibel las. Dies göttliche Buch, das ich stets so sehr geliebt hatte, selbst in der Zeit, wo ich in meinem Glauben durch Zweifel gestört war, studierte ich jetzt mit weit mehr Ehrfurcht als jemals; nur daß ich trotz des besten Willens, oftmals wenn ich darin las, in meinen Gedanken mit ganz anderen Dingen beschäftigt war, so daß ich gar nichts auffaßte. Allmählich aber gewann ich die Fähigkeit, über das Gelesene ernstlich nachzudenken und ihm immer mehr Geschmack abzugewinnen.
Eine derartige Lektüre erweckte in mir niemals die mindeste Neigung zur Frömmelei; ich meine damit jene falsch verstandene Frömmigkeit, welche zum Kleinmut oder zur Schwärmerei führt. Vielmehr lehrte sie mich, Gott und die Menschen lieben, dem Reiche der Gerechtigkeit immer mehr nachtrachten, von der Bosheit mich mit Abscheu abwenden, gegen die Boshaften selber aber Verzeihung üben. Das Christentum bestärkte das Gute, was die Philosophie in mir bewirkt haben mochte, anstatt es aufzuheben, und verlieh ihm durch tiefere und schwerer wiegende Gründe immer neue Antriebe. Eines Tages hatte ich gelesen, daß man ohne Unterlaß beten solle, das wahre Beten sei nicht ein bloßes Herplappern von Worten, wie es die Heiden tun, sondern es bestehe darin, daß man Gott mit einfältigem Sinne in Worten und Werken verehre und so handle, daß man in diesen beiden Gottes heiligen Willen erfülle; da nahm ich mir vor, mit diesem Beten ohne Unterlaß ernstlich einen Anfang zu machen: das heißt, in mir nicht einen Gedanken aufkommen zu lassen, der nicht von dem Verlangen beseelt wäre, mich ganz nach den Geboten Gottes zu richten.
Die Gebetsformeln, welche ich zur Verrichtung meiner Andacht hersagte, waren immer wenige, nicht etwa aus Mißachtung (ich glaube vielmehr, daß dieselben sehr heilsam sind, für den einen mehr, für den anderen weniger, um die Aufmerksamkeit bei der Anbetung festzuhalten), vielmehr deswegen, weil ich weiß, daß ich meiner Natur nach unfähig bin, viele Formeln auszusprechen, ohne daß meine Gedanken zerstreut umherschweifen und die Richtung auf die Anbetung verlieren.
Weit entfernt, daß der ernste Wille, die Gegenwart Gottes beständig vor Augen und im Herzen zu haben, meinem Geiste einen mühevollen Zwang verursacht hätte oder ihm ein Gegenstand der Furcht gewesen wäre, vielmehr war derselbe höchst wohltuend für mich. Indem ich nicht vergaß, daß Gott stets bei uns, daß er in uns ist, oder daß wir vielmehr in ihm sind, verlor die Einsamkeit mit jedem Tage mehr von ihrem Schrecken für mich: Bin ich nicht in der allerbesten Gesellschaft? fragte ich mich beständig. Dann ward ich heiter, fing an zu singen und zu pfeifen, mit inniger Freude und voll sanfter Rührung. Doch wie? dachte ich bei mir, wenn mich ein Fieber befallen und mich in das Grab gebracht hätte? Alle die Meinigen, hätten sie sich bei meinem Tode ihrem Schmerze auch noch so sehr hingegeben, dennoch würden sie allmählich die Kraft wiedergewonnen haben, sich mit Ergebung in meinen Verlust zu schicken. Anstatt eines Grabes hat mich das Gefängnis verschlungen; soll ich glauben, daß Gott sie nicht mit gleicher Stärke ausrüsten werde?
Die innigsten Gebete richtete mein Herz für ihr Wohl an Gott, manchmal weinte ich dabei; aber die Tränen selber waren mit Süßigkeit vermischt. Ich hatte die volle Zuversicht, daß Gott sie und mich aufrechterhalten werde. Ich habe mich nicht getäuscht.
7.
In Freiheit zu leben ist gewiß weit schöner, als sich im Kerker zu befinden; wer möchte daran zweifeln? Doch auch im Elende eines Kerkers, wenn man daran denkt, daß Gott gegenwärtig ist, daß die Freuden der Welt vergänglich sind, daß das wahre Glück in dem guten Gewissen und nicht in äußerlichen Dingen beruht, auch da kann man mit Lust das Leben empfinden. In weniger als einem Monate war ich mir, ich will nicht sagen, mit voller Sicherheit, aber doch in erträglicher Weise über mein Verhalten klar geworden. Ich sah, wenn ich nicht so niedrig handeln wollte, durch das Verderben anderer für mich Straflosigkeit zu erlangen, daß mein Schicksal höchstens der Galgen oder ein langwieriges Gefängnis sein könnte. Es war notwendig, sich darein zu fügen. – Atmen will ich, solange man mir den Odem gönnt, sagte ich, und sollte man mir ihn nehmen, so will ich das tun, Was alle Kranken tun, wenn ihr letzter Augenblick gekommen ist: ich werde sterben.
Mein Streben ging dahin, über nichts Klage zu führen und meinem Geiste alle nur möglichen Freuden zu gestatten. Die gewöhnlichste Erholung gewährte es mir, wenn ich die Güter, welche meine Tage verschönert hatten, immer von neuem aufzählte: ein trefflicher Vater, eine vorzügliche Mutter, ausgezeichnete Brüder und Schwestern, diese und jene Freunde, eine gute Erziehung, Liebe zu den Wissenschaften und vieles andere. Gab es wohl einen Menschen, der mit Glücksgütern reicher gesegnet worden als ich? Warum Gott nicht dafür danken, wenn ich jetzt gleichwohl durch Mißgeschick in ihrem Genusse gestört bin? Manchmal brachen mir bei solch einer Aufzählung Tränen der Rührung aus den Augen, ich weinte eine Weile; der Mut und die Freudigkeit aber kehrten stets wieder zurück.
Gleich in den ersten Tagen meiner Haft hatte ich mir einen Freund erworben: nicht der Kerkermeister war es, nicht einer von den Secondini, auch keiner von dem Gerichtspersonal. Dennoch spreche ich von einem menschlichen Wesen. Wer war es? – Ein taubstummes Kind, fünf oder sechs Jahre alt. Seine Eltern waren Räuber, das Gesetz hatte sie erreicht. Die arme kleine Waise ward mit einigen anderen Kindern aus gleichen Verhältnissen von der Polizei erhalten. Sie wohnten alle in einer Stube, der meinigen gegenüber, und zu bestimmten Stunden öffnete sich für sie die Tür, damit sie draußen auf dem Hofe frische Luft schöpften.
Der Taubstumme kam dann unter mein Fenster, lachte mich an und machte Bewegungen mit den Händen. Ich warf ihm ein tüchtiges Stück Brot hinunter; voll Freude sprang er darauf los, um es zu ergreifen, lief dann zu seinen Gefährten, gab allen etwas ab, kehrte dann zurück, um seinen Anteil unter meinem Fenster zu verzehren, wobei er seine Dankbarkeit durch ein Lächeln seiner schönen Augen ausdrückte.
Die anderen Kinder betrachteten mich von ferne, ohne sich heranzuwagen; der Taubstumme hatte große Zuneigung zu mir, aber nicht bloß aus Eigennutz. Manchmal wußte er nicht, was er mit dem herabgeworfenen Brote machen sollte, und gab mir durch Zeichen zu verstehen, daß er und seine Kameraden satt wären und nichts mehr essen könnten. Wenn er dann einen der Unteraufseher nach meinem Zimmer gehen sah, gab er ihm das Brot, um es mir wieder zuzustellen. Obwohl er dann von mir nichts erwartete, fuhr er doch fort, vor meinem Fenster mit äußerst liebenswürdiger Anmut zu schäkern, und freute sich, daß ich ihn sähe. Einmal gestattete ein Aufseher dem Kinde, in mein Zimmer zu kommen; kaum war es eingetreten, da lief es auf mich zu, um meine Knie zu umfassen, und stieß dabei einen Freudenschrei aus. Ich nahm es auf den Arm, und das Entzücken läßt sich nicht beschreiben, unter welchem es mich mit Liebkosungen überhäufte. Wieviel Liebe in diesem teuren Geschöpfe! Wie gern hätte ich es erziehen lassen und aus der Verworfenheit retten mögen, in der es sich befand!
Seinen Namen habe ich nie erfahren. Es selber wußte nicht, ob es einen hätte. Stets war es vergnügt, niemals sah ich es weinen, nur ein einziges Mal, als es von dem Kerkermeister, ich weiß nicht aus welcher Ursache, geschlagen wurde. Sonderbar!
An dergleichen Orten zu leben, erscheint als das höchste Maß von Elend, und doch fühlte dies Kind sich gewiß ebenso glücklich, als nur der Sohn eines Fürsten in diesem Alter es sein kann. Ich dachte eine Weile hierüber nach und lernte, daß man die Stimmung von dem Orte unabhängig machen kann. Bemühen wir uns nur, unsere Einbildungskraft in unserer Gewalt zu haben, und wir werden uns beinahe überall wohl fühlen. Ein Tag ist bald vergangen, und wenn man sich am Abend ohne Hunger und ohne heftige Schmerzen niederlegt, was liegt daran, ob das Bett sich zwischen Wänden befindet, die man ein Haus oder einen Palast nennt, oder zwischen Wänden, die ein Gefängnis heißen?
Ein vortrefflicher Schluß! Aber wie stellt man es an, daß man seine Einbildungskraft so in der Gewalt hat? Ich versuchte es, und manchmal schien es mir wohl zu gelingen; aber ein andermal triumphierte die Tyrannin, und ich erstaunte verdrießlich über meine Schwachheit.
8.
In meinem Mißgeschick, sagte ich, bin ich insofern wenigstens vom Glück begünstigt, daß sie mir ein Gefängnis im Erdgeschoß gegeben haben, nach diesem Hofe hinaus, wo auf vier Schritte dies teure Kind sich mir nähert, mit dem ich mich nach der Weise der Stummen so nett unterhalte! Bewundernswerter Scharfsinn der Menschen! Wie viele Dinge reden wir miteinander durch unzählige Ausdrücke unserer Blicke und Mienen! Welche Anmut legt es in seine Bewegungen, wenn ich ihm freundlich zulächle! wie verbessert es sie, wenn es sieht, daß sie mir nicht gefallen!
Wie gut versteht es, daß ich ihm gut bin, wenn es einen seiner Gefährten liebkost oder beschenkt! Kein Mensch kann sich eine Vorstellung davon machen, und doch bin ich imstande, während ich am Fenster stehe, für dies arme Geschöpfchen eine Art von Erzieher zu sein. Dadurch, daß wir die wechselseitige Übung der Zeichen fortsetzen, werden wir die Mitteilung unserer Gedanken vervollkommnen. Je mehr es merken wird, daß es bei mir unterrichtet und gebessert wird, desto größer wird seine Anhänglichkeit an mich werden. Ich werde für ihn der Genius der Vernunft und Güte sein; es wird lernen, mir seine Schmerzen, seine Freuden, seine Wünsche anzuvertrauen: ich, es zu trösten, es zu veredeln, es ganz in seinem Verhalten zu leiten. Während mein Los von Monat zu Monat unentschieden bleibt, wer weiß, ob man mich hier nicht alt werden läßt? Wer weiß, ob dies Kind nicht unter meinen Augen aufwächst und zu irgendeinem Dienste in diesem Hause verwendet wird? Bei einem solchen Verstande, wie es ihn zeigt, wer weiß, was aus ihm noch werden kann? Ach leider! Höchstens ein brauchbarer Secondino oder etwas Ähnliches! Und werde ich gleichwohl nicht ein gutes Werk getan haben, wenn ich dazu beitrug, das Verlangen ehrlichen Leuten und sich selber zu gefallen, in ihm erweckt, liebreiche Gefühle ihm zur Gewohnheit gemacht zu haben?
Ein derartiges Selbstgespräch war ganz natürlich. Für Kinder hatte ich stets eine große Vorliebe, und das Amt eines Erziehers dünkte mich ein sehr edles. Ein ähnliches Amt versah ich seit einigen Jahren bei Giacomo und Giulio Porro, zweien hoffnungsvollen Jünglingen, die ich wie meine Söhne liebte und beständig wie solche lieben werde! Gott weiß es, wie oft ich im Gefängnisse an sie dachte! wie sehr es mich betrübte, ihre Erziehung nicht vollenden zu können! wie heiß ich den Wunsch hegte, sie möchten einen neuen Lehrer finden, der in der Liebe zu ihnen mir gleich wäre! Manchmal rief ich mir zu: Welch eine grobe Parodie ist dies! Für Giacomo und Giulio, Kinder, welche Natur und Glück mit den herrlichsten Gaben ausgestattet haben, die sie zu verleihen vermögen, bekomme ich hier zum Schüler eine arme Waise, taub und stumm, zerlumpt, ein Kind von Räubern! ... das allerhöchstens ein Aufseher werden wird, was man sonst mit einem weniger gewählten Ausdrucke einen Schergen nennen würde.
Diese Betrachtungen machten mich irre und mutlos. Kaum aber vernahm ich das Gekreische meines Taubstummen, so geriet mein Blut in freudige Aufregung, wie bei einem Vater, der die Stimme seines Sohnes hört. Dies Gekreisch und sein Anblick zerstreuten in mir alle Gedanken in bezug auf seine Niedrigkeit. – Welche Schuld fällt auf ihn, wenn er zerlumpt und verwahrlost ist, und von Räubern herstammt? Eine menschliche Seele, im Alter der Unschuld, verdient jederzeit Achtung. So sprach ich, jeden Tag betrachtete ich ihn mit mehr Liebe, mir kam es vor, als nähme er an Verstand zu, und ich bestärkte mich in dem süßen Vorsatze, mich seiner Veredlung zu widmen; und indem meine Phantasie sich alle möglichen Fälle vorstellte, gedachte ich, eines Tages vielleicht aus dem Kerker herausgelassen zu werden, dies Kind, wenn ich die Mittel dazu hätte, in eine Erziehungsanstalt für Taubstumme zu tun und ihm so den Weg zu einem besseren Lose, als das Geschäft eines Schergen ist, zu bahnen.
Während ich mich auf so köstliche Weise mit seinem Wohle beschäftigte, erschienen eines Tages zwei Secondini, um mich abzuholen.
»Sie sollen Ihre Zelle wechseln, mein Herr.«
»Was meinen Sie damit?«
»Man hat uns befohlen, Sie auf ein anderes Zimmer zu bringen.«
»Weswegen?«
»Ein anderer wichtiger Vogel ist eingefangen worden, und da dies das beste Zimmer ist ... Sie verstehen wohl ...«
»Verstehe: es ist der erste Ruheort für die Neuangekommenen.«
So führten sie mich nach der entgegengesetzten Seite des Hofes, aber ach, ich kam nicht wieder in das Erdgeschoß, sondern in eine Zelle, von wo die Unterhaltung mit dem Taubstummen nicht mehr möglich war. Als ich über den Hof schritt, sah ich den mir liebgewordenen Knaben auf der Erde sitzen, er war bestürzt und traurig: er begriff, daß er mich verlieren sollte. Einen Moment später sprang er auf und lief mir entgegen; die Aufseher wollten ihn wegjagen, ich aber nahm ihn auf den Arm, und so schmutzig er war, ich herzte und küßte ihn, zuletzt riß ich mich von ihm los – darf ich es sagen? – die Augen von Tränen erfüllt.
9.
O mein armes Herz! Du liebst so schnell und so warm, ach, zu wie vielen Trennungen bist du schon verurteilt worden! Sicherlich war diese am wenigsten schmerzlich; um so lebhafter empfand ich sie, als meine neue Wohnung äußerst traurig war. Ein finsteres,