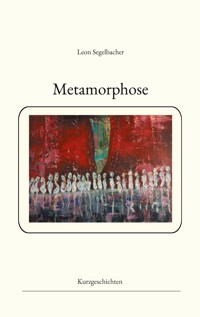
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Metamorphose - Sind wir nur eine Aufnahme, eine Collage der Erfahrungen unserer Vergangenheit und konditioniert zu den immer gleichen Mustern zurückzukehren? Warum fällt es uns so schwer uns zu verändern und warum wollen wir das überhaupt, wir sind doch gut so wie wir sind- oder? Einen Blick in unser Selbst und auf das zu werfen was um uns herum vor sich geht, kann die ein oder andere Frage auf sich werfen und einen im Nebel des Unwissens zurücklassen. Lichten können wir diesen zwar nur geringfügig aber doch zufriedenstellend, wenn wir begriffen haben wer wir für uns und andere sind. Denn verstehen wir wer wir sind, ein fluides und formbares Lebewesen unter anderen, fällt uns die Akzeptanz des Andersartigen leichter als jemals zuvor. Wer die Vergangenheit verstanden hat versteht die Zukunft noch nicht aber die Gegenwart wird nachvollziehbar. Verstehen sie ihre Vergangenheit?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Exposeé
Eine Entwicklung wird uns auf subtile Weise immer dann klar und deutlich vor Augen geführt, wenn wir dazu bereit sind, uns den Prozess, der dahinter-steckt, anzusehen. Tatsächlich wird, so werfen wir den Blick in die Vergangenheit, das Ausmaß unserer Handlungen und Gedanken erst dann vollends nachvollziehbar, sobald wir verstanden haben, wer wir einst im Innersten waren und warum wir heute derjenige sind, von dem wir glauben, er oder sie zu sein. Manchmal sind uns unsere Erinnerungen im Weg und blockieren unseren guten Willen, unsere eigene Freiheit oder verwüsten das Porträt eines Idealselbst, dass wir bereits in Stein gemeißelt hatten und nun wieder abreißen müssen.
In Metamorphose, mit seinen vierundvierzig Kurzgeschichten, wird der Prozess einer Verwandlung durch die verschiedenen Protagonisten, die als diverse Erzähler auftauchen, beschrieben. Sie alle haben mit ihren ganz eigenen Prozessen und Ängsten, verlorenen Träumen und kräftezehrenden Erinnerungen, aber auch mit Hoffnungen und Verbundenheit ihre ganz persönlichen Erfahrungen machen dürfen. Trotz den Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Akteuren und wie sie alle auf ihre Art und Weise sich ein Bild von der Realität machen, ihre Erfahrungen verarbeiten, vereint sie im Kern die Erinnerung an etwas, dass nun nicht mehr da oder in einer anderen, nicht greifbaren Form wiedergekehrt ist. Die Geschichten verkörpern den Prozess des Erinnerns, der daraus resultierenden Angst und deren Verarbeitung. Das alles ist dem festen Glauben geschuldet, dass wir, wenn wir uns nur gut genug selbst verstehen, eher dazu in der Lage sind, auch unsere Umwelt besser und toleranter nachvollziehen zu können.
Inhalt
Wo bin ich
Das Vorwort
Skizze eines Statusberichts
Sie
So wie sie ist mit mir
Asche
Am Tisch
Schlange
Zwei Mal verloren
Frühsommertage
Die Seerosen
Kann ich mich noch lieben
Die Blume
Fensterplatz
Der kleine Geist
Der Sohn
Straße
Orangefarbene Stille
Das Haus
Sonne
Ein Rauschen
Die Auszeit
Im Zug
Farbe
Gargoyle
Tauben
Briefpapier
Als der Mond die Sonne berührte
Angst
Ausbruch
Angst
Auf der Straße
Der Brunnen
Wassertropfen
Schönheit und Zerfall
Rote Klippen
Bushaltestelle
Brief der Liebe
Weiße Tulpen
Sternschnuppe
Ganz schön teuer
Dissoziative Verwandlung
Der Schaffner
Blau
Durch Gassen
Die Frau an der Bar
Stein
Farbe
Raum und Stadt
Ahornblatt
Da kommt nichts mehr
Denk nicht so viel
Das Vorwort
Wo ich bin?
Weiße Asche tropft auf den Boden des Aschenbechers zwischen gestapelten grauen Türmen nieder. In meinen müden Augen spiegelt sich mir das Bild verlorener und aufgeschriebener Gedanken, die einst in mir umherschwirrten, mich nicht in Ruhe ließen. Die Helligkeit meines Bildschirms ist auf der niedrigsten Stufe eingestellt. Trotzdem oder gerade deshalb offenbart sich mir ein Schlachtfeld aus Wörtern, die ohne Konzept und Struktur das weiße Feld der Seite durchqueren. Meine Gedanken kreisen umher. Kein Wort möchte sich mir klar und deutlich, in meinem Kopf bloßstellen, als hätten sie Angst vor etwas oder jemandem. Ich warte. Die Türme werden höher, die Tage, an denen ich an denselben Orten sitze, länger. Sie nehmen kein Ende mehr. Aus Tagen werden Wochen, die in Monaten enden, an denen ich nicht mehr daran denken möchte, nachzudenken oder mich etwas hinzugeben. Verloren gleise ich in meinem Zug erbarmungslosester Erschöpfung aus den Schienen und treibe wie auf Wolken, über Wiesen und Täler. Mir scheint an diesen Tagen die warme Morgensonne auf das bleiche Gesicht und treibt mich, von Sorgen verlassen, über unsichtbare Wege hinweg. Ich habe die tiefsten Abgründe meiner kalten Vergangenheit ausgeblendet. Ich schnipse an meiner Zigarette. Die Asche tropft ab, der Becher füllt sich, ich schalte die Musikanlage an und es läuft ein Stück, das ich nicht kenne, aber gut genug finde, es laufen zu lassen. Niemand singt in diesem Lied. Keine weiteren Worte, der Raum ist leer. Ein Stuhl, keine Wände. Eigentlich ist es gar kein Raum. Es fühlt sich an wie Unendlichkeit. Ich werfe den Stuhl in die Weiten. Einmal, zweimal, bis er zerbrochen da liegt. Ich schleudere ihn durch die Gegend und gegen die kalten Wände. Ich renne immer weiter hinter den zerstörten und zerstreuten Stuhlteilen hinterher, um sie weiter zum Brechen zu zwingen. Ich schreie, ohne einen Ton von mir zu lösen, als schluckte ich sie wieder und wieder herunter. Nichts ist zu hören, nicht meine Schreie, nicht das Knacken der Beine des Stuhls noch meine Schritte. Ich knie mich auf den Boden, die Hände in den Schoß gelegt und die Decke betrachtend. Habe ich nicht erwähnt, keinen Raum zu sehen? Ich brauche eine Pause und schließe die Augen, warmer Wind weht durch ein gekipptes Fenster, ein Sonnenstrahl berührt eines meiner geschlossenen Augenlider. Der Bildschirm ist aus. Ich atme tief und ruhig. Der Aschenbecher ist wieder voll.
Skizze eines Statusberichts
Der Nebel trübt die Stadt. In seinem weißen Schleier legt er sich über alles was davor von der Sonne berührt worden war. Gestern war das Wetter noch besser, als es heute Morgen um 8.24 Uhr ist. Draußen ist es feucht, durch die Fensterscheiben fällt ein schwaches weißes Licht, es ähnelt dem eines, in der Nacht weit geöffneten Kühlschranks. Ich stelle mir vor, wie es draußen wohl wäre, wenn ich ganz alleine wäre. Durch die Orte und Wege der Welt wandern, ohne eine Menschenseele anzutreffen. Es gäbe keine Konversation, keine offenen Geschäfte oder Veranstaltungen, zu denen man eingeladen wäre oder sie besuchen kann. Ohne die Menschen würde der Planet nicht unter den Folgen von Kriegen und Ausbeutungen leiden. Es würde keine Toten geben und auch keine Lebendigen, die sich vor dem Tod fürchten würden, keine Spezies müsste mehr Angst haben, ausgerottet zu werden, dem einzigen Zweck geschuldet, sich an ihren Hörnern oder dergleichen zu bereichern. Keine Morde, keine Korruption oder diverse andere politische Diskurse, eine drastische Verbesserung des Klimazustandes und abertausender anderer zwischenmenschlicher Konflikte, die, um sie alle hier aufzulisten, zu viel Zeit und Platz in Anspruch nehmen würden. Das Leben als Einzelgänger. Ich stelle mich mir selbst vor, in denselben Kleidern, wie ich sie bereits die vergangenen Jahre getragen hatte. Sie hatten sich nicht besonders verändert, hier und da blitzte mal eine neue Naht hervor oder ein Flicken, der sich auf einer Hose wiederfand, ansonsten sah alles noch so aus, wie als ich es gekauft hatte. Jeden Tag würden die Wolken am Himmel nur für die Welt und mich vorbeifliegen, weniger für mich. Sie würden den Regen bringen oder das Eis wieder zurück in Wasser verwandeln, das dann die Bäche und Quellen füllt und die Pflanzen aufblühen ließe.
Aus der Kanne, die auf dem Herd steht, sickert weißer Rauch. Er ist so schwer, dass er an den Rändern der Kanne und an den Türen und Schränken hinuntergleitet und über den Boden streift. Ein langgezogener weißer Schleier hatte sich über den Fußboden gelegt, die Fliesen darunter waren nicht mehr zu sehen. Es pfiff erst leise, dann immer lauter, bis der Kaffeekocher derartige Töne von sich gab und sie das Zimmer verließ. Sie zog die Türe, welche in die Küche führte, mit demselben Schwung, den sie beim Hinausgehen erreicht hatte, zu, und sorgte so für einen lauten Knall, der Minuten später im Haus noch zu vernehmen war. Es war derselbe Knall, den sie davor schon hunderte Male vernommen hatte und der ihr immer große Angst bereitete. Sie zählte die Bilder an der Wand, große Bilder mit den Abbildungen eines Mannes im Rollstuhl. Sie glaubte, es wären diese Gemälde, wahrscheinlich Ölmalerei, die man gut an den kleinen Rissen erkennen konnte, welche zwischen Farben und Formen gelegentlich auftauchten, sie blieben die etwas lebhafteren in diesem Haus. Nur diejenigen, auf denen der sonderbare Mann im Rollstuhl saß, hatten eine besondere Atmosphäre, die sie umgab wie ein transparentes Nebelkleid. Sie kannte den Mann nicht, weder sein Aussehen noch die Art und Weise, wie er an der Wand hing und aus dem Bild in die Welt starrte. Seine Augen waren hellbraun, noch heller als Bernstein, sie hatte solche Augen noch nie zuvor gesehen. Also blieb sie stehen und betrachtete den Mann in den Bildern. Warum war er wohl in einem Rollstuhl und wer hatte alle diese Werke von ihm erschaffen, war es der Wunsch des Künstlers oder doch mehr die Eitelkeit des Mannes.
Das Pfeifen im Haus wurde langsam unerträglich, sodass sie sich gezwungen sah, den Wasserkocher von der Herdplatte zu nehmen und das Fenster zu öffnen. Weißer Qualm schob sich aus den Ritzen des Fensters und verflog im Wind des Herbstes innerhalb weniger Momente. Sie sah ihm dabei zu, überlegte eine Weile, ob sie sich einen zweiten Kaffee aufgießen sollte oder schon genug getrunken hatte, und vergaß dieses Vorhaben wieder. Sie sah den Wolken am Himmel nach, wie sie immer weiter den Horizont hinaufkletterten. Es waren riesige Kumuluswolken. Ihrem Sinn nach, an diesen Himmel gebundene Vertraute, eines andren Bewusstseins zu bleiben bis sie schließlich hinter den nächsten Graden der Erdkugel verschwanden.
Regen prasselt gegen die Fensterscheiben. Draußen ist es noch finstere Nacht, der Mond liegt versteckt hinter dem Schwarz der Wolken. Nur das Zucken der Blätter im Wind und das verhaltene Streichen der Äste auf meinem durchnässten Regenmantel nehme ich noch bewusst wahr. Ringsum knackt es, Äste brechen von den Bäumen ab und fallen sanft in das nasse Laub. Der Regen ist wie die Sonne, nicht so wie die Wolken. Wenn es regnet und die ersten Wasserperlen auf den Blättern und Blüten zerplatzen, werden die Stimmen in meinem Kopf leiser. Der Regen ist laut. Er spricht mit den Menschen und mit der Natur. Doch sie verstecken sich in ihren Häusern, unter Brücken oder Bushaltestellen, sie entfliehen seinen Worten und hören ihm nicht zu. Nach kurzer Zeit werden die Bäche und Flüsse wieder sprudeln, sie werden überlaufen, die Wege mit Wasser füllen.
In der Stadt gibt es keinen Regen, dort wird es nur grau. Alles blitzt weiß und farblos unter der Decke des Himmels hervor, wie oft ich mir schon gewünscht hatte, alles sei aus Asche und würde weggespült werden wie braune Blätter, die am Straßenrand in einer Mulde liegen und darauf warten, von einem Windstoß davongetragen zu werden.
Zwei Tage sind vergangen, in denen die Hoffnung gewachsen ist. Sie hat sich wie eine Glasglocke um mein Haupt gestülpt, mein Sein hat zu seinem Körper zurückgefunden, doch ich bin es nicht. Ich bin jetzt. Ich bin nicht gestern und kann auch nicht morgen sein. Nur jetzt umgeben von tausenden Glasfragmenten, die in den verschiedensten Farben aufleuchten, wenn man in sie hineinsieht. Ich streife mir einen Wollpullover über den Kopf, er ist mir an den Armen zu weit und bestimmt auch einige Größen zu groß. Doch sein Stoff wärmt meine kalte Brust, als er sich auf ihr niedergelassen hat.
In dem Raum ist es rabenschwarz. Alles ist dumpf und wirkt so weit entfernt. Mein Atmen zieht weiße Fäden in den leeren Raum, die nach wenigen Augenblicken sich zu immer neuen Netzen zusammenfügen und wieder auflösen. Manchmal stelle ich mir vor, wie etwas, einer Spinne gleichend, über die Netze krabbelt, sie wirken so schwer. Das fragile Gerüst wackelt, aber sie halten sich fest und stolzieren über das Mosaik aus tödlichen Fallen und zielführenden Wegen, als wäre es selbstverständlich. Meine Bewunderung für sie, oder besser gesagt diese, welche ich mir vorstelle, ihnen gegenüber zu besitzen, ist bizarr. Ich habe Angst vor ihnen, Ekel. Sie sind abnorm und entsprechen keinem Maßstab. Doch sie tanzen auf den dünnsten Drahtseilen der Welt mit einer Leichtigkeit, der keiner trotzen kann. Auch leben sie alleine, in einer Symbiose mit sich selbst. Ich wünschte, sie könnten ausbrechen und sich selbst so offenbaren, wie sie sind. Ihnen fehlt die Möglichkeit dazu, anderen jedoch nicht.
Die Geräusche formen sich in meinem Kopf zu Geistern. Kleine Gestalten mit riesigen Augen und noch größeren Mäulern. Besonders gefährlich sehen sie nicht aus, zumindest nicht in meiner Vorstellung. Gegenteiliges ist der Fall, sie tanzen und lachen, schwirren durch meine Gedanken, verfangen sich in Worten und verschwinden. Zurück bleibt ein mittelgroßes Chaos, das es dann wieder zu ordnen gilt. Da nichts so ist, wie es vor ihrem Erscheinen war, findet alles einen neuen Platz. Manches liegt noch in den alten Regalen und Schubladen, doch vieles liegt zerstreut auf dem Boden und ist unsortiert. Aufräumen werde ich erst morgen, versichere ich mir, ohne mich von der Ironie dieses Gedankens überführt zu fühlen. Der letzte meiner Geister ist verschwunden und ich blicke ihm, wie er in seinem bunten Kleid davonspringt, verträumt hinterher. Es ist gewoben, dichter Stoff aus den Überresten meines unterbewussten Denkens. Diese Geister sind mir ein Rätsel.
Aus meinen Ohren entnehme ich einen weißen Kopfhörer. Um auf der rechten Seite bequem liegen zu können, hatte ich nur auf einem Ohr Musik gehört und musste, dem widerlichen Geschmack aus meinem Mund nach zu urteilen, auch dabei eingeschlafen sein. Ich wische mir über die Lippen. An den Mundwinkeln verschmiere ich die letzten angetrockneten Speichelrückstände, die mir während meines kurzzeitigen Ausflugs, fernab der realen Welt, hängengeblieben waren. Wobei das Träumen nur menschlich ist. Es ist sogar die schönere Art der Realität. Unbegrenzte Möglichkeiten im Rahmen, und darüber hinaus, der eigenen Vorstellungskraft sind hier möglich, gäbe es doch nur eine Anleitung oder ein Buch, das uns Menschen auf dem Weg in die zweite Welt des Realen begleiten könnte.
Die Menschenmengen treiben wellenartig vor meinen Augen auf und ab. Sie gehen in Geschäften einkaufen, laufen nach Hause oder sitzen verschlafen in der Straßenbahn. Nur ein wenig meiner Aufmerksamkeit schenke ich ihnen, wenn ich sie auf ihrem Weg beobachte, bis ich sie nie wieder sehen werde. Im wandelnden Moment der Zeit werden die Straßen leerer, das blühende Treiben schwillt ab und lässt den Raum für intensivere Wahrnehmungen. Gestern habe ich meinen Vater verstanden. Angenommen oder verlangt hatte ich das nie. Wie hätte ich denn auch sollen? Einzig und allein Äußerungen anderer machten meinen Vater zu dem, was ich in ihm sah und sehen wollte. Für mich blieb er eine Hülle, der ich keine Bedeutung zusprechen konnte. Er war lange Zeit nicht zu Hause, hatte mich und meine Mutter, meine Schwester nie wirklich zu Gesicht bekommen. Aber ich verstehe ihn jetzt in einer Zeit, welche mir vorgibt, nicht bei ihm zu sein, nichts von ihm zu lernen oder zu erwarten, und gerade in dieser Zeit präsentiert er mir sein Selbst, in einer Art, die ich sehr bewundere. Angemerkt haben möchte ich aber dennoch, dass es kein Wunsch ist, seinem Charakter zu gleichen. Es sind die gewissen Werte, Erfahrungen, die verborgen vor der Welt in seinem Geist sitzen und ihn zu dem machen, was er ist. Er ist mehr, als ich bin und ich, erwische mich des Öfteren in Phasen von Ekstasen der Euphorie, wenn weitere einzigartige Mosaiksteine auftauchen, die sein Gesamtbild aufleuchten lassen. Mein größter Wunsch wäre es, wenn doch nur diverse andere Menschen sich die Zeit dafür nehmen würden, sich zu verstehen, zu ergründen, was das Gegenüber zu dem macht, was es ist und nicht das, was nach außen transportiert wird. Aber möglicherweise ist dies der Normalzustand und meine eigenen Verhaltensweisen verbieten mir diesen Einblick. Die kühle Abendsonne bricht in die Stadt und in mein Gedankenkonstrukt. Die Fassaden der Altbauhäuser glühen farbefreudig und reflektieren die ersten Lichter aus den Geschäften unter ihnen. Es wirkt alles so ruhig und geordnet, eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, sich mit allem auseinanderzusetzen. Das Raunen der Menschen, Gelächter und betretenes Schweigen, alles harmoniert in einer bedeutungslosen Zusammenstellung verschiedenster Individuen, die alle für sich ein Leben in dem von vielen erleben. Die Sonne verlässt mich und ich verlasse die Bank, auf der ich noch eben saß. Es ist an der Zeit, zu gehen.
Ein neuer Tag zeichnet sich am Himmel ab. Noch bevor die Sonne zu erkennen war, unter ihrem Wolkenkleid, war ich aufgestanden, hatte mir den Schlaf aus den Augen gerieben und geduscht. Ich habe mich abgetrocknet und das Fenster zum Lüften aufgemacht. Ich war nur einer von wenigen, einer von denen, die den Wohnungen beim Verfallen zusehen, die betrachten, wie sie sich verändern. An ihnen klebten Efeuranken, die sich bedacht um und in die Fenster schlängelten und im Winter ihr grünes Kleid erneut verloren. Nur über einem Fenster hingen das ganze Jahr rote und grüne Pflanzen. Fernab einer dunklen Tristesse, die sich im Winter über der Stadt erbrach, leuchtete dieser Ort in einer ganz anderen Stimmung. Es war wie ein Fluch, ihnen zuzusehen, wie sie vor Resistenz und Freude aufloderten und sich meiner Blicke beanspruchten. Ich konnte sie den ganzen Tag sehen, ihnen zusehen, wie sie wuchsen und etwas erschufen, etwas nie zuvor Dagewesenes. So nah sie mir auch waren, bleiben sie in unerreichbarer Ferne.
Die Laternen ließen ihr Licht im Schatten des Mondes auf den Straßen liegen. Es zerbrach unter ihrem Schirm in seine Bestandteile, ich fühlte mich zum ersten Mal gedrängt, sie wieder zusammenzufügen.
Um zu schreiben, bin ich zu müde, meine Augenringe ziehen tiefe Furchen in meine Wangen, die Hände zittern und geschlafen habe ich seit Tagen nicht genug. Unüberlegt beginne ich mit der Arbeit. Jeden Tag fange ich etwas an, das nie beendet wird. Ich verfalle in einen Rausch, unvollendete Projekte zu erschaffen, sie zu stapeln und nach und nach zu vergessen. Wenn ich versuche, zu schlafen, kriechen die Geister jener Ängste durch meine Haut und Ohren. Sie nisten sich ein, werden sesshaft in dem Reich, das ich als mein persönlichstes bezeichnen würde. So werden die Tage schwerer, wie nasses Gras, das im Wind weht, trage auch ich meinen Kopf gesenkt, immer auf der Hut vor dem, was ich nicht kenne. Der Versuch, zu beobachten, erwies sich als Fehler. Angst und Unbehagen machten sich in mir breit, wie sie mich durch ihre glasigen Augen ansehen. Ich kenne sie nicht und sie mich nicht. Nicht der kleinste Teil ist mir geblieben, ich habe keinen Grund mehr, sie zu verstehen, auf sie zu hören oder mir ihre Worte zu merken, die sie ausspucken, als hätten sie jegliche Bedeutung verloren. Das letzte Glück, das mir geblieben war, bin ich. Ohne mich egoistisch erscheinen zu lassen, möchte ich vorwegnehmen, wie sehr ich mich hasste all die Zeit. Geändert hatte sich das nicht aber mittlerweile verabscheue ich vieles umso mehr. Wem die Welt einen Platz geboten hat, sollte ihn auch nutzen, hatte mein Vater damals zu mir gesagt. An diesem Tag regnete es wie aus Eimern auf die Erde herab. Der Himmel war schwarz, schwarz wie die Nacht, in der kein Mondstrahl vom Himmel fällt. Doch wie sich Dunkelheit erkennen lässt, ist das Licht nicht fern. So durchzogen grelle weiße Adern den Himmel, jedes Mal schnitten sie ihn auf und brachen ein Stück der Finsternis aus ihm heraus. Der Regen wurde stärker und hämmerte auf die Fenster und Dächer ein, es knackte und prasselte, es gab keine Ruhe, alles war aufgewirbelt. Verwelkte braune Blätter flogen in riesigen Ansammlungen durch die Luft, blieben an dünnen Ästen aufgespießt zurück oder flogen weiter in die Nacht hinaus. Ich weiß noch ganz genau, wie mein Herz, als ich am Fenster stand und den Wasserkristallen beim Zerspringen zusah, schneller schlug als sonst, nur nicht vor Aufregung. Mehr war es ein Gefühl der Verbundenheit. Es war wie eine Symbiose, die die Dunkelheit und ich eingingen. Jeder Tropfen, jedes verlorene Licht im Schwarz der Nacht sprach zu mir, leise flüsterten sie im Aufbrausen des Windes, der über das Land zog. Ich konnte sie jede Nacht hören, auch wenn kein Sturm war. Sie sprachen zu mir, zeigten mir ihre Ansichten, ihre Gefühle, eine verborgene Welt im Inneren der Nacht. Nun schlummert die Dunkelheit auch in mir, machte mich zu dem, was ich bin. Eine Ansammlung reiner Energie, die auf einer Kugel lebt, die sie selbst nie gesehen hat. Wie die Gezeiten verändert sich alles um und in einem selbst. Der Körper, er ist das Erste, was zerfällt, danach wird der Geist folgen, nur eine Energie kann lange erhalten bleiben, bis auch sie verschwinden wird. Ein Kreislauf von Neuem und es gibt keine Chance, ihm zu entfliehen. Ich muss es wissen, denn ich habe es versucht. Aus dieser Welt gibt es kein Entkommen, nicht heute und auch nicht gestern. Darum nutze ich den einzigen Zweck, den ich finden konnte, und bringe zu Papier, was ich bin. Zwischen Licht und Schatten steht jemand. Der Erste, dem es gelingt, zu verbinden, was sich trennt. Zu einem, was zusammengehört und vergessen wurde.
Sie
So wie sie ist mit mir
Eine Geschichte auf dem Ast eines sich unter dem Gewicht der darauf befindenden Person schon gefährlich nahe dem Erdreich entgegenstreckenden Baumes zu beginnen ist eine eher unkonventionelle Art, eine Idee erzählen zu wollen. An diesem fast schon lästig schönen Tag saß ich auf diesem Baum, welcher genauer gesagt ein Kirschbaum war. Die Wolken am Himmel formten sich in aller Ruhe vor den Augen der Menschen, die in dieser kleinen Stadt lebten, zu den absurdesten Gestalten. Vorausgesetzt, man wollte sie sehen. Ich wollte das nicht. Die Menschen streben immer in allem das Gute und Schöne an. Das sehen, was sie selbst, so glaubten sie, befriedigt und besänftigt. Getragen werden im Strom der Schönheit, von den Wellen der Ästhetik umspült werden. So glaubten sie, sei es einfach, ja geradezu unausweichlich, positiv zu sein und auch zu bleiben. Negativität wird dem Schlechten und Unerwünschtem zugeschrieben. Ich selbst weiß nicht, ob ich in dieser ach so in Schemata denkenden Welt nun negativ oder positiv bin. Ich bin so wie ich bin. Ich denke so, wie ich will. Ich sehe, was ich sehe, und mache meistens was ich machen will. Frei von jeglichen Werten an oder über andere Menschen. Ich sitze hier nur auf einem Ast und denke. Während ich denke, fällt mein Blick gelegentlich auf die Dinge, die mich hier in dieser Szenerie umgeben. Ich schaue … Ja, ich sehe etwas, was meinen so schön geglaubten Gemütszustand in Windeseile durcheinander bringt.
Während mir ein sanfter warmer Windstoß die Haare vor die Augen warf und mir für wenige Augenblicke die Sicht auf diese Welt nahm, musste ich an das denken, was mir soeben wie eine Fliege bei Fahrtwind ins Auge stach. Ich hob meine rechte Hand und strich mir die Haare wieder aus dem Gesicht. Da war es. Es lag einfach da. Da unter meinen in der Luft baumelnden Füßen zwischen Grashalmen und ein paar Gänseblümchen. Ich sah es an. Erst ein paar Sekunden, dann eine ganze Minute. An was ich dabei dachte, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht an den grässlichen Schmerz, welchen ich diesem Gegenstand da indirekt zu verdanken hatte. Oder aber vielleicht an die schon längst verlorenen schönen Tage, welche im Tresor der Vergangenheit lagen und dort verstaubten. Am tragischsten glaube ich aber ist, dass ich an sie dachte.
Einige Zeit später fand ich mich auf den Straßen meiner Wohnsiedlung wieder. Die Sonne brannte nun regelrecht vom Himmel auf den Straßenboden nieder und ließ den Teer an einigen Stellen gummiartig weich werden, sodass man sich bei jedem Schritt fragen musste, ob man nicht auf einem riesigen Kaugummi spazieren würde. Die Schornsteine pusteten zu dieser Zeit keinen Qualm aus. Nur das Knistern und Brutzeln der im Vorgarten grillenden Familien ließ einen noch diese sonst viel zu saubere Luft ertragen. An den Gartenhecken vorbeilaufend hörte ich die Vögel ihre Lieder immer wieder von Neuem anstimmen, so als ob sie noch niemand jemals vernommen haben könnte. Ich wollte mich ablenken und einen Blick in die Gärten werfen. Doch leider wurde mir dieser Einblick in das Leben der anderen verwehrt. Ihre riesigen akribisch zurechtgeschnittenen Ligusterhecken türmten sich vor mir auf wie eine unüberwindbare Mauer und nahmen mir meine so schön geglaubte Ablenkung vor der Vergangenheit, die mich in meinen Gedanken verfolgte. Der nun schon nicht mehr ganz so warme Sommerwind legte mir meine krausen Haare erneut in mein Gesicht. Sie kitzelten mich an der Nase und ich sah mich gezwungen, sie wieder zur Seite zu streichen. Als ich das tat, fiel mir auf, dass ein paar wenige meiner mir so vertraut vorkommenden Haare durch den langen Sommer ein wenig heller geworden waren. Sie waren nun nicht mehr dunkelbraun, sondern glichen vielmehr nassem Sand, der sich in der Sonne spiegelt. Um genau zu sein, sahen sie aus wie ihre. Sie schimmerten im Licht der am Himmelszelt bereits tiefstehenden, glühenden Sonne. Langsam setzte ich einen Fuß vor den anderen, an einigen Stellen gab der wegen der Hitze weiche Boden nach. Es war wie durch ein Moor zu waten, den Blick auf die nächsten zwei bis drei Schritte gerichtet, und trotzdem gab ich nach und schaute zurück, weiter als ich sollte. Mein Blick fiel auf die Motorhaube eines Volkswagens, rot, silberne Felgen und eine lächerlich aussehende, zehn Zentimeter große Actionfigur von Captain America. Doch was mich wirklich aufsog und vollends vereinnahmte, war das gleichmäßige Flimmern, dessen Schlieren verblassten, der Hintergrund wurde unscharf, nur noch blau.
Ich erinnerte mich an die Wellen am Strand, die wir gesehen hatten, als wir das letzte Mal zusammen im Ausland waren. Wir fuhren damals an das Mittelmeer. Sie wollte damals immer dorthin. Da ich selbst nicht besonders viele Wünsche hatte und es mir recht egal war, wo wir unsere gemeinsame Zeit verbringen würden, willigte ich ohne Wiederrede ein.
Nicht einmal einen anderen Wunsch oder besonderen Vorschlag hatten mir meine eigenen Vorstellungen oder Träume zu bieten. So fuhren wir also ans Mittelmeer. Es war der 19. Juli im Jahr 1998. Die Sonne stand hoch am Himmel und keine einzige Wolke war zu sehen. Das Tiefblau des Himmels legte sich wie eine große Kuppel über alles





























