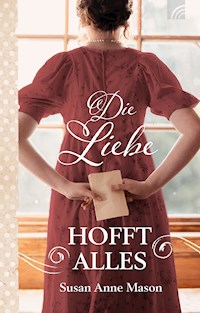Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Start einer neuen dreibändigen historischen Roman-Serie von Autorin Susan Anne Mason mit Schauplatz Toronto verspricht eine spannende Reise ins Jahr 1939. Eine zweite Chance – die bekommt Olivia Rosetti, als sie nach einer Haftstrafe in Torontos berüchtigter Frauenerziehungsanstalt von Ruth Bennington aufgenommen wird. Schon bald entdecken Olivia und die gutherzige alte Dame, dass sie eine schmerzhafte Vergangenheit teilen, und beschließen, in Ruths Stadthaus ein Mütterheim für Frauen in Not zu eröffnen. Das soll der junge Immobilienmakler Darius Reed verhindern. Sein Auftrag lautet, Ruth zum Verkauf des Anwesens zu überreden. Doch er hat nicht mit der Standhaftigkeit der beiden Frauen gerechnet – und dass Olivia bald mehr als nur eine lästige Verpflichtung für ihn ist ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Susan Anne Mason
Miss Rosetti
UND DAS HAUS DER HOFFNUNG
Aus dem Englischen vonEvelyn Schneider
Copyright 2020 by Susan A. Mason
Originally published in English under the title
A Haven for Her Heart
By Bethany House Publishers, a divison of Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.
All rights reserved.
Die Bibelzitate folgen dem Bibeltext der Schlachter.
Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten.
© der deutschen Ausgabe:
2022 Brunnen Verlag GmbH, Gießen
Lektorat: Carolin Kotthaus
Umschlagfotos: DavidPrado / Adobe Stock und
© Joanna Czogala / Trevillion Images
Umschlaggestaltung: Daniela Sprenger
Satz: DTP Brunnen
ISBN Buch: 978-3-7655-3728-8
ISBN E-Book: 978-3-7655-7636-2
www.brunnen-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Epilog
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
schon seit einiger Zeit hatte ich im Sinn, ein Buch über ein Mütterheim zu schreiben. Ich wollte eine Nebenfigur in einem meiner früheren Romane ein solches Heim im viktorianischen England ins Leben rufen lassen. Zu diesem Buch ist es aber nie gekommen und das Mütterheim war daher eine Zeit lang in Vergessenheit geraten.
Als ich allerdings angefangen habe, über eine neue Buchreihe für meinen Verlag nachzudenken, habe ich mich an diesen Gedanken zurückerinnert. Zu jener Zeit las ich in der Zeitung einen sehr erschreckenden Artikel über eine Frau namens Velma Demerson, die man 1930 in Toronto verhaftet hatte – bloß weil sie unverheiratet schwanger war.
Als mir klar wurde, dass Olivia Rosetti, die Protagonistin in Miss Rosetti und das Haus der Hoffnung einen triftigen Grund bräuchte, um solch ein Mütterheim zu gründen, fiel mir Velma Demersons Lebensgeschichte wieder ein. Zum Glück hatte ich den Artikel mit all den erschütternden Details über Velmas Leben aufbewahrt.
Ich fand noch mehr heraus, unter anderem, dass Velma selbst ein Buch über ihre Erfahrungen in der Frauenhaftanstalt Andrew Mercer Reformatory for Women (oder auch einfach Mercer genannt) verfasst hatte. Sogleich besorgte ich mir ein Exemplar ihres Buches Incorrigible. Die Lektüre war stellenweise sehr herausfordernd, denn Velma hatte unsagbare Qualen erlitten. Und doch fesselte mich ihre Geschichte so sehr, dass sie mir als Inspiration zur Ausgestaltung meiner Heldin Olivia diente.
Das wollte ich Ihnen nur vorab schon mitteilen, denn dadurch ist dieser Roman etwas düsterer geworden als meine übrigen Bücher. Dennoch sind es Dinge, die Velma sowie viele andere inhaftierte Frauen genau so durchgemacht haben. Letzten Endes wurde das Mercer Reformatory natürlich geschlossen, allerdings erst im Jahr 1969, rund dreißig Jahre nach Velmas Aufenthalt dort. Kaum vorstellbar, dass solche Gräueltaten zur jüngsten Geschichte Kanadas gehören!
In hohem Alter fand Velma den Mut, die Landesregierung von Ontario gerichtlich zur Rechenschaft zu ziehen. Bis ins Jahr 2019, als sie mit achtundneunzig Jahren verstarb, kämpfte sie für eine Entschuldigung und forderte Wiedergutmachung – für sich und all die Frauen, die mit Berufung auf dieses Gesetz gefangen genommen worden waren.
In diesem Sinne: Viel Freude mit meiner Romanheldin Olivia! Lesen Sie selbst von ihrem Wunsch nach Akzeptanz und Heilung und wie sie dadurch für viele andere Frauen zum Segen wird.
Bis zum nächsten Mal – und tausend Dank für Ihre Unterstützung!
Susan
Im Gedenken an Velma Demerson, die tatsächlich im Mercer Reformatory for Women inhaftiert war und Olivias Reise inspiriert hat.
„Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich!“Jesaja 44,22
Prolog
TORONTO, ONTARIO, KANADA NOVEMBER 1939
Olivia Rosetti schaltete das Radio ein. Dankbarerweise waren ihre Eltern heute bei einem Kirchentreffen, wodurch Olivia in den seltenen Genuss kam, ein paar Stunden für sich allein zu haben. Ihr älterer Bruder war heute Abend auch unterwegs, weshalb sie so lange Radio hören konnte, wie sie wollte.
Seit er wegen eines Herzgeräusches durch die Musterung gefallen war, verabscheute Leo die Kriegsberichte im Radio. Vor allem weil Tony, ihr ein Jahr jüngerer Bruder, alle Tests bestanden hatte und nach Übersee hatte aufbrechen dürfen. Salvatore, ihrem jüngsten Bruder, der im Priesterseminar sehr abgeschirmt lebte, war vermutlich nicht einmal bewusst, dass die Welt sich im Krieg befand.
Olivia drehte so lange am Rädchen des Radios, bis die tiefe Stimme des Rundfunksprechers durch das Zimmer hallte. Zur vollen Stunde würden gewiss Neuigkeiten von der Front bekannt gegeben werden. Nicht, dass sie dadurch etwas über Tony erfuhr. Oder über ihren Verlobten Rory. Aber die Berichte über die kanadischen Truppen und deren Verbleib mitzuverfolgen, half ihr, sich mit den beiden verbunden zu fühlen. In diesen Momenten stellte sie sich Rory in Uniform auf dem Deck eines Schiffes vor, das in Richtung Großbritannien unterwegs war, um gegen Hitlers Diktatur zu kämpfen.
O Rory, warum musstest du so früh in den Krieg ziehen? Wenn du von meiner Situation gewusst hättest, hätte dich das aufgehalten?
Mit einer Hand fuhr Olivia über ihren leicht gewölbten Bauch und ein Gefühl von Angst stieg in ihr auf. Sie hatte keine andere Wahl gehabt, als Mutter letzte Nacht in ihr Geheimnis einzuweihen. Aber die hatte es – obwohl Olivia sie angefleht hatte, es nicht zu tun – sofort ihrem Vater erzählt. Wie erwartet hatte Enrico Rosetti die Nachricht alles andere als gut aufgenommen.
Instinktiv hob Olivia eine Hand an ihre Wange, die von seiner Ohrfeige noch immer schmerzte.
„Hast du je darüber nachgedacht, welche Folgen dein sündiges Verhalten für unsere Familie hat? Dass es vielleicht die Ordinierung deines Bruders gefährdet?“, hatte er sie wütend angebrüllt. „Dich auf einen Iren einzulassen, war schlimm genug, aber nun auch noch das? Du bringst nichts als Schande über den Namen Rosetti.“
Nur das tränenreiche Bitten ihrer Mutter hatte Papàs gewaltige Tirade aus englischen und italienischen Wörtern zu einem Ende gebracht. Mit einem letzten Fluch war er aus der Wohnung oberhalb des Geschäfts gestürmt, die Treppen hinunter zu seinen Kameraden, wo er seine Sorgen im Alkohol ertränkte. Inniglich betete Olivia, dass er den Grund für sein Gelage verschwiegen hatte.
Wieder erfüllte Radiorauschen den Raum und Olivia fingerte erneut an dem Drehregler, um ein klareres Signal zu bekommen.
„In München kostete gestern Abend ein gescheitertes Attentat auf Adolf Hitler acht Menschen das Leben, zweiundsechzig wurden verletzt. Der deutsche Führer, der nur wenige Momente vor der Explosion eine Rede gehalten hatte, kam unverletzt davon.“
Schon bei der bloßen Erwähnung seines Namens ballte Olivia die Hände zu Fäusten. Hätte ein erfolgreiches Manöver womöglich schon das Kriegsende bedeutet? Leise bat Olivia Gott um Vergebung, dass sie sich so etwas wünschte. Und doch schien es, als brachte dieser Mann nur Chaos und Verwüstung über die ganze Welt.
Einerseits erfüllte es Olivia mit Stolz, dass Rory sein Land gegen diesen Tyrannen verteidigen wollte. Aber andererseits wünschte sie sich, Rory wäre nicht ganz so patriotisch gewesen. Nicht ganz so bereit, sie allein zu lassen.
Plötzlich klopfte es an der Tür. Wer mochte das sein? Jeder aus der Gegend wusste, dass das Geschäft bereits geschlossen war, und die meisten Freunde ihrer Eltern waren genau wie sie in der Kirche.
Eine böse Vorahnung überkam Olivia und sie umklammerte ängstlich die Stuhllehne. „Wer ist da?“
„Die Polizei. Bitte öffnen Sie die Tür.“
Die Polizei? Was wollten sie denn hier? Hatte es vielleicht einen Unfall gegeben?
Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie sich kurz durchs Haar fuhr und ihre Schürze über den Stuhl legte. Sie holte tief Luft und schritt zur Wohnungstür.
Ein großer Mann in Uniform stand vor ihr auf dem Treppenabsatz. „Sind Sie Miss Olivia Rosetti?”
„J-ja.“
Kurz flackerte Mitgefühl in den granitgrauen Augen des Polizisten auf. „Sie sind verhaftet.“
„Verhaftet? Wofür?“, fragte sie und ihre Hand flog vor Schreck an den Hals. War das ein Scherz? Hier musste ein Fehler vorliegen!
„Sie wurden im Sinne des Female Refuges Act wegen Unsittlichkeit angeklagt. Ich fürchte, Sie müssen mit uns kommen.“
„Was soll das heißen? Ich … ich verstehe nicht.“ Haltsuchend hielt sie sich an der Wandkonsole fest.
Mitleid schimmerte im Blick des Mannes. „Ihr Vater hat Sie angeklagt. Er behauptet, Sie seien unverheiratet, unter einundzwanzig und …“, er zögerte, während seine Augen über Olivias schlanken Körper glitten, „… in anderen Umständen.“
Obgleich sie errötete, hielt sie seinem Blick stand. „Das mag vielleicht nicht gerade erstrebenswert sein, aber das ist noch lange kein Verbrechen.“
„Ich fürchte doch. Zugegeben, auf diese Gesetzesgrundlage wird sich nicht oft berufen, aber sobald eine Strafanzeige vorliegt, müssen wir dem nachgehen.“
Olivia schwirrte der Kopf. Sie konnte kaum glauben, was der Polizist ihr soeben berichtet hatte. „Mein Verlobter ist in den Krieg gezogen. Sonst wären wir bereits verheiratet“, flunkerte sie vor Verzweiflung. „Sobald er wieder zurückkehrt, werden wir …“ Der unumstößliche Blick des Mannes ließ Olivia allmählich verstummen.
„Sie haben eine Minute, um sich fertig zu machen. Dann muss ich Sie zur Wachstation mitnehmen.“
Kapitel 1
APRIL 1941
Freiheit.
Offene Weite anstelle von schrecklichen, einengenden Gitterstäben.
Nach diesem Luxus hatte Olivia sich die letzten achtzehn Monate gesehnt, doch nun, wo sie endlich wieder auf freiem Fuße war, sah die Realität weitaus weniger schillernd aus als in ihrer Vorstellung.
Das blau karierte Arbeitskleid und die marineblaue Strickjacke hingen schlaff an ihr herunter und boten nur wenig Schutz vor der kühlen Frühlingsluft, als sie mit einer beinahe leeren Tasche in der Hand die King Street entlangtrottete. Mit jedem Block, den sie hinter sich ließ, wurde das Angstgefühl in ihr erdrückender.
Zur Freiheit gehörte, wie sich herausstellte, eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Und die sprachen nicht dafür, dass sie frei war.
Vielmehr war sie nun eine Frau ohne Zuhause, ohne Geld und ohne Freunde. Wohin also sollte sie gehen? Wagte sie es, ihre Eltern aufzusuchen? Ohne das nötige Geld für ein Busticket würde es sie mindestens eine Stunde Fußmarsch bis zur Wohnung kosten. Und falls sie sich dafür entschied und es ihr gelang, ihre Mutter allein anzutreffen, würde Mamma ihr zur Seite stehen? Oder würde sie ihr Gehorsam Papà gegenüber davon abhalten, sich für ihre einzige Tochter stark zu machen?
Olivia stolperte. Gerade als sie dachte, sie könne nicht mehr, erblickte sie einen vertrauten Straßennamen auf dem Schild über sich: Kensington Avenue.
Rosetti’s Market lag nur ein paar Straßen weiter westlich. Ihr Magen knurrte laut vor Hunger. Die letzte Mahlzeit – der Haferschleim in der Frauenhaftanstalt – lag bereits Stunden zurück. Während der Schwangerschaft hatte Olivia zwar ein wenig Gewicht dazugewonnen, doch das hatte sie durch das stundenlange Nähen in der Werkhalle schnell wieder abgearbeitet. Das sowie die mageren Essensrationen hatten schließlich dazu geführt, dass sie die Anstalt nun noch dünner verließ, als sie sie zu Beginn ihrer Haftstrafe betreten hatte.
Je näher sie dem elterlichen Geschäft kam, umso mehr widersprüchliche Gefühle wurden in Olivia wach und sorgten dafür, dass sie ihre Schritte verlangsamte. Viel zu lange schon, seit dem ersten Tag in Gefangenschaft, hatte sie von genau diesem Moment geträumt: die Rückkehr nach Hause und in ihren Laden, mit allem, was dazugehörte. All die vertrauten Geräusche und Gerüche. Der Anblick ihrer Mutter, eine Schürze umgebunden, wie sie die Kunden an der vorderen Theke bediente. Der Geruch überreifer Früchte, die im ersten Gang zum Sonderpreis angeboten wurden. Das Kassenklingeln, das bei jedem Öffnen und Schließen ertönte. Das alles machte ihr Zuhause aus.
Aber Olivias Freude über ihre Heimkehr war getrübt, Sorgen nagten an ihr. Würde Papà sie wieder zu Hause einziehen lassen? Sie hatte für ihre Schuld bezahlt – damit hatte sie es sich doch verdient, wieder in die Familie aufgenommen zu werden.
Tief in ihrem Inneren spürte Olivia allerdings, wie sich ein Teil von ihr dagegen auflehnte, bei dem Mann Hilfe einzufordern, dem sie das Leiden der letzten Monate überhaupt erst zu verdanken hatte.
Vergebung. Dem Gefängnispfarrer war das Wort leicht über die Lippen gekommen, doch Olivia tat sich schwer damit.
Wenn aber Demut ihr ein Dach über dem Kopf verschaffte, während sie auf Rorys Rückkehr wartete, würde sie ihren Stolz herunterschlucken und auf bessere Zeiten hoffen – bis dieser grausame Krieg vorüber und ihr Verlobter wieder zu Hause war. Vielleicht konnte sie dann endlich das Elend der vergangenen achtzehn Monate hinter sich lassen. Mit einer Hand auf dem flachen Bauch spürte Olivia, wie der fortwährende Schmerz in ihrem Herzen noch größer wurde. War das überhaupt noch möglich – nach allem, was sie durchgemacht und verloren hatte?
Eine Frau trat aus dem Laden auf den Gehweg und begann neben den Apfel- und Orangenkästen zu kehren.
Mamma!
Olivias Herz machte einen Satz und ungebetene Tränen brannten in ihren Augen. Wie sehr hatte sie die tröstenden Berührungen ihrer Mutter in all diesen Monaten vermisst, in denen man sie weggesperrt und schlechter behandelt hatte als eine Laborratte. Wie sehr hatte sie sich nach der Liebe ihrer Mutter gesehnt, nach aufbauenden Worten, nach dem hausgemachten Essen, das jede Krankheit heilte und jedes Übel milderte.
Auf den letzten Metern zum Geschäft beschleunigten sich Olivias Schritte und ein Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. „Mamma“, rief sie mit zitternder Stimme.
Ihre Mutter sah auf. Augenblicklich ließ sie den Besen fallen und lief Olivia entgegen, um sie in eine feste Umarmung zu schließen.
„Oh, mia preziosa ragazza.”
Die süßen Worte waren Balsam für Olivias Seele. Nachdem Mamma sie auf beide Wangen geküsst hatte, wischte sie sich mit der Schürze die Tränen aus dem Gesicht.
„Du bist viel zu dünn“, sagte sie, als sie ihre Tochter auf Armeslänge hielt und betrachtete. „Du musst essen.“
In diesem Moment knurrte Olivias Magen, als wollte er ihr zustimmen. Über die hochgezogenen Brauen ihrer Mutter lachte sie. „Ja, ich bin wirklich hungrig, Mamma. Gibt es noch Reste von heute Mittag?“
„Sì. Es ist noch Suppe da und …“ Plötzlich hielt sie inne und legte die Stirn in Falten. „Dein Vater sollte dich besser nicht sehen. Komm mit nach hinten.“
Ernüchtert straffte Olivia die Schultern. Papà hatte ihr also wie befürchtet nicht vergeben.
Schnell nahm Mamma sie beim Arm und wie zwei Diebinnen schlichen sie sich über den schmalen Gang neben dem Haus zum Hintereingang, durch das Lager und dann die Treppe hoch, die zur Wohnung führte. Eilig huschte Mamma in die Küche und öffnete den Eisschrank, um einen großen gusseisernen Topf herauszuholen. Schon bei dem Gedanken an das köstliche Essen darin lief in Olivias Mund das Wasser zusammen. Vielleicht eine Minestrone?
Auf der Arbeitsfläche lag ein großer Laib Brot. Zuerst zögerte Olivia, doch dann siegte der Hunger über ihre Zurückhaltung, und sie nahm sich ein Messer, um sich eine dicke Scheibe abzuschneiden. Nachdem sie diese großzügig mit Butter bestrichen hatte, nahm sie einen herzhaften Bissen davon. Noch nie hatte irgendetwas so gut geschmeckt! Mamma füllte ihr in der Zwischenzeit einen Teller mit Suppe. „Sie ist kalt, aber satt macht sie trotzdem.“
„Das macht nichts, Mamma.“
Hastig aß sie mehrere Löffel Suppe und genoss die geschmackliche Vielfalt, die sie beinahe vergessen hatte. Das Essen in der Anstalt war bestenfalls fade gewesen. Während sie aß, ließ sie den Blick durch ihr altes Zuhause wandern. Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, dass sie das letzte Mal hier gewesen war, und doch schien alles unverändert. In der Küche standen noch immer dasselbe ausgesessene Sofa und derselbe alte Sessel, in der Ecke dasselbe Radio auf dem klapprigen Tischchen.
Auch im Flur sah alles aus wie immer. Die Tür zu Leos Zimmer stand einen Spalt weit offen. Und ihre Tür, die erste, die man von hier aus sah, war geschlossen. Hatte Mamma dort auch alles so belassen wie vor ihrer Verbannung?
„Ich glaube nicht, dass er dich zu uns zurückkommen lässt“, sagte ihre Mutter bedrückt. Kummer lag in ihren dunklen Augen, die mittlerweile von viel mehr Sorgenfalten umgeben waren als noch vor zwei Jahren.
Bevor dieser grausame Krieg ausgebrochen war.
Bevor Olivia den schlimmsten Fehler ihres Lebens begangen hatte.
„Aber ich möchte nach Hause kommen, Mamma. Was kann ich denn nur tun?“
Traurig schüttelte Mamma den Kopf und wandte sich ab, um den Suppentopf wieder in den Eisschrank zu räumen.
Jetzt erklangen Schritte auf der Treppe. „Rosina? Sei qui?“
Der Löffel in Olivias Hand begann zu zittern und sie tropfte Suppe auf die Tischdecke.
Panisch wandte ihre Mutter sich an sie. „Geh in dein Zimmer. Ich werde mit ihm reden.“
Mit rasendem Puls stand Olivia auf, um sich zurückzuziehen. Doch dann hielt sie inne. „Nein. Ich werde mich nicht verstecken. Ich werde mit ihm reden.“
„Olivia, bitte“, flehte ihre Mutter sie mit großen Augen an, bevor ihr Blick zur Treppe huschte.
Nur eine Sekunde später erschien Olivias Vater in der Tür. Als er sie entdeckte, blieb er ruckartig stehen. Alle Farbe verschwand aus seinem Gesicht.
Zögernd trat sie einen Schritt auf ihn zu. „Papà.“
Er hob eine Hand. Seine Gesichtszüge verhärteten sich und er warf Mamma einen wütenden Blick zu. „Wie kannst du es wagen, mich so zu hintergehen und sie hier hochzulassen?“, warf er ihr auf Italienisch vor. Englisch sprach Papà nur, wenn absolut nötig.
„Enrico. Per favore …“, druckste Mamma, die sich halb hinter dem Tisch versteckte.
Wie konnte es sein, dass Olivia nie bemerkt hatte, was für ein Tyrann ihr Vater war? Wie er alle Welt zur Unterwürfigkeit zwang? Die Entrüstung darüber bestärkte ihren Mut und Olivia trat näher an ihn heran. „Mamma kann nichts dafür. Lass sie da raus.“
Seine dunklen Brauen zogen sich zu einer dichten Linie zusammen. Streitlustig verschränkte er die Arme.
Olivias Knie zitterten, ob aus Angst oder vor Wut wusste sie nicht, aber sie hielt seinem Blick stand. Vorwurfsvolle Worte schwirrten ihr durch den Kopf, doch sie bemühte sich, ihre Gefühle im Zaun zu halten. Trotz allem, was er ihr angetan hatte, trotz der Art, wie er ihre Mutter behandelte, musste Olivia bedacht handeln. Sie war weiterhin auf ein Zuhause angewiesen und wollte gerne am liebsten wieder mit ihrer Mamma vereint sein. Und irgendwo, begraben unter all dem Zorn und Schmerz, liebte sie ihren Vater auch noch immer. Deshalb wollte sie wenigstens versuchen, den Riss in ihrer Beziehung zu flicken. Tief holte Olivia Luft und bemühte sich, so demütig wie möglich zu klingen. „Papà, ich bin hier, um dich um Vergebung zu bitten. Und um zu fragen, ob ich bitte wieder nach Hause kommen darf.“
Einige Sekunden vergingen, dann knurrte ihr Vater: „Und das Kind?“
Trauer durchzuckte Olivias Körper, ein Schmerz, so vertraut wie das Atmen. Erhobenen Kopfes stand sie da und ballte die Hände zu Fäusten. „Man hat ihn mir weggenommen. Du wusstest doch, dass es so kommen würde. Er ist zur Adoption freigegeben worden.“
Entsetzt schnappte ihre Mutter nach Luft. Ihr Vater schwieg.
„Un ragazzino?“, hakte Mamma nach und ihr kummervolles Flüstern machte Olivias stoische Ruhe zunichte.
Ihr Hals schnürte sich zu, sie konnte bloß noch nicken. Ja, ein kleiner Junge. Ihr Sohn, Matteo, den sie nur wenige kostbare Minuten hatte halten dürfen, bevor er ihr aus den Armen gerissen worden war.
Ungerührt schüttelte ihr Vater den Kopf. Bei seinem kühlen Blick lief es Olivia eiskalt den Rücken hinunter. „Wir haben keine Tochter mehr. Du bist hier nicht willkommen“, erklärte er knapp, bevor er mit einem Finger auf ihre Mutter zeigte. „Und du, Rosina, wirst unten im Laden gebraucht.“ Er drehte sich wieder um und verschwand die Treppe herunter, ohne einen Blick zurückzuwerfen.
Tränen liefen über Mammas Wangen. „Es tut mir leid, cara.“
Olivias Lippen bebten. Ein Teil von ihr wünschte sich, dass Mamma sich gegen Papà behauptet hätte. Ihm eingeschärft hätte, dass Olivia natürlich noch immer ihre Tochter war und sie ihr natürlich vergeben würden. Aber sie wagte es nicht, den Zorn von Enrico Rosetti auf sich zu ziehen.
„Dann hole ich mir nur ein paar von meinen Kleidern“, sagte Olivia und musste heftig schlucken, um die Tränen zurückzuhalten, die nach Erlösung bettelten. Zielgerichtet ging sie durch den Flur zu ihrem alten Zimmer und öffnete die ächzende Tür. Was sie dann sah, traf sie zutiefst. Das Zimmer war vollkommen leer, abgesehen von ihrem Bett und einer Kommode. Es sah noch trost-loser aus als ihre Zelle in der Anstalt. Die Bilder an den Wänden fehlten und auch die Pinnwand mit ihren Auszeichnungen aus der Schule war verschwunden.
Eilig schritt Olivia auf den Einbauschrank zu und öffnete ihn. Nichts als leere Bügel. Sie drehte sich zu ihrer Mutter um und sah, wie diese an der Tür verzweifelt die Hände rang. „Mamma, wo sind alle meine Sachen?“
„Er … er hat sie weggeschmissen.“
„Wie bitte?“
Ungläubig stürmte Olivia zur Kommode und öffnete Schublade für Schublade. Leer, jede einzelne. Wieder bebten ihre Lippen. Alle Kleidung, alle Kindheitserinnerungen und vor allem alle Geschenke von Rory waren fort. Das Poesiealbum mit den liebevollen Gedichten von ihm und den getrockneten Rosen zwischen den Seiten. Die silberne Taschenuhr, die er ihr zum achtzehnten Geburtstag geschenkt hatte.
Niedergeschlagen ließ sie sich auf die weiche Matratze sinken und eine neue Welle von Trauer überrollte sie.
„Ein paar Dinge konnte ich noch retten“, sagte Mamma und fasste unter das Bett, von wo aus sie einen Kleiderbeutel hervorholte. Sie öffnete das Zugband und zeigte ihr ein paar Kleidungsstücke und eine verbeulte Zigarrenbox. Dann zog sie den Beutel wieder zu. „Später kannst du es dir in Ruhe ansehen. Aber ich muss jetzt gehen“, erklärte sie und reichte Olivia die Tasche.
„Mamma, hat Rory mir Briefe geschickt?“ Von ganzem Herzen sehnte Olivia sich nach ein paar Worten von ihm. Einem Beweis, dass er noch lebte und sie genauso sehr vermisste wie sie ihn.
Es war schlimm, dass niemand aus der Familie sie in den letzten achtzehn Monaten besucht hatte. Aber noch viel mehr hatte sie getroffen, in all der Zeit nicht einen einzigen Brief von Rory erhalten zu haben. Sie wusste nicht einmal, ob ihre Briefe ihn erreicht hatten, ob er überhaupt von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte – oder dass sie Eltern eines Sohnes geworden waren.
Bestürzt wandte ihre Mutter das Gesicht ab. „O cara.“
„Hat Papà die etwa auch vernichtet?“, fragte Olivia. Wie konnte ihr Vater nur so grausam gewesen sein? Aber letztlich hatte er noch nie etwas von Rory gehalten, hatte ihn „einen schmuddeligen Iren“ genannt und ihm vermutlich alle Schuld dafür gegeben, dass seine Tochter auf Abwege geraten war.
„Mi dispiace.“
„Warum tut es dir leid? Du warst es ja nicht“, verteidigte Olivia ihre Mutter. Ein bitterer Geschmack auf ihrer Zunge. Falls es irgendwo da draußen wirklich einen Gott gab, dann war das sicher seine Strafe. „Nun, dann muss ich eben warten, bis Rory wieder nach Hause kommt. Dass wir zusammenbleiben, kann Papà nicht verhindern.“
Tränen glänzten in den Augen ihrer Mutter, als sie den Kopf schüttelte. „Ach, Olivia … Er wird nicht nach Hause kommen.“
Olivias Herzschlag verlangsamte sich zu einem trägen Klopfen in ihrer Brust. „Was sagst du denn da? Natürlich kommt er heim. Sobald dieser lächerliche Krieg vorbei ist.“ Oder vielleicht sogar schon früher. Sie hatte sogar gebetet, dass er sich eine Verletzung zuzog – nur eine leichte, aber schlimm genug, dass man ihn zur Genesung nach Hause schickte. War das sehr selbstsüchtig von ihr?
„No, cara mia. Rory …“, zögerte Mamma. „Rory è morto.“
Schlagartig schoss Olivias Kopf nach oben, sodass sie sich auf die Zunge biss. „Tot? Nein. Das … das ist nicht möglich.“
Das Gesicht ihrer Mutter füllte sich mit Sorgenfalten. „Sì, cara. Eileen kam zu uns in den Laden und hat es uns erzählt. Vor drei Monaten haben sie ein Telegramm erhalten.“
Wenn seine Schwester hier gewesen war, musste es stimmen.
Olivias Hände zitterten. Als sie die schrecklichen Worte allmählich begriff und der Schmerz sich in ihr ausbreitete, spürte sie, wie ihr Herz sich im Brustkorb zusammenzog. Mamma hätte keinen Grund, sie anzulügen. Keinen Grund, sie zu hintergehen. Aber wie war es möglich, dass Olivia nichts geahnt hatte? Sie und Rory waren doch Seelenverwandte gewesen – hätte sie es nicht spüren müssen, als er von dieser Welt gegangen war?
Die Entfernung zwischen ihr und Rory, die sie empfand, seit er im Krieg war, vergrößerte sich nun zu einer unüberwindbaren Schlucht. Völlig verzweifelt hatte Olivia sich an ihr ungeborenes Kind geklammert, die einzige spürbare Verbindung zu ihm. Doch als die Zuständigen ihr den kleinen Matteo entrissen hatten, war ihre Hoffnung ins Schwanken geraten.
Wenn Rory endlich zurück ist, hatte sie sich selbst eingeredet, wird alles wieder werden wie früher. Gemeinsam können wir diesen Verlust überstehen.
Doch das würde nun nicht mehr geschehen.
Ein lautes Wehklagen verließ ihren Körper. „Nein. Nein! Er kann nicht tot sein. Das ist sicher ein Irrtum. Rory wird zu mir zurückkommen.“
Tröstend legte Mamma eine Hand auf Olivias Rücken. „Mi dispiace“, wiederholte sie. „Möge Gott sich über euch erbarmen.“
Ehrfürchtig stand Ruth Bennington auf der Straße vor der St Olaf’s Church und betrachtete die Schönheit dieses Kirchengebäudes. Mit einem müden Seufzen stieg sie die wenigen Treppen bis zur Eingangstür hoch, drehte den metallenen Türknauf und ließ sich selbst in die Kirchenvorhalle. Der beruhigende Geruch von Kerzenwachs und Weihrauch hieß sie willkommen.
„Also, Gott. Wird es heute Abend so laufen wie immer? Oder ist endlich der Moment gekommen, mir meinen letzten Wunsch zu erfüllen?“, murmelte sie leise vor sich hin.
Zielsicher schritt Ruth durch das Kirchenschiff, bis sie an ihrem Stammplatz ankam. Zuerst bekreuzigte sie sich, dann ließ sie sich auf der harten Bank nieder und das vertraute Gefühl des unnachgiebigen Holzes begrüßte sie. Vorne auf dem Altar brannten nur zwei kleine Flammen.
Wie lange kam sie schon hierher, um Gott anzubeten? Vierzig Jahre? Vielleicht doch eher fünfzig. Seit sie und Henry damals als frisch verheiratetes Paar nach Toronto gezogen waren.
Beinahe ungewollt wanderte Ruths Blick zu der kleinen Plakette unter dem nächstgelegenen Fenster. In Erinnerung an Henry Ward Bennington. Viel zu früh ist er von uns gegangen. Seine ihn liebende Frau, Ruth.
Eine einzelne Träne rann über ihre Wange.
Es ist an der Zeit, Herr. Natürlich will ich dir nicht vorschreiben, wie die Dinge zu laufen haben. Aber ich bin jetzt schon viele Jahre allein. Und ich bin müde. Ich möchte meinen Henry wiedersehen.
Mit dem Handschuh wischte sie sich über das feuchte Gesicht und begann ihr Gebetsritual. Falls sie Glück hatte und heute endlich der Abend wäre, an dem Gott ihre Bitte erfüllte, wollte sie bereit sein.
Zwei Stunden später hievte Ruth ihren steifen Körper von der Bank, Enttäuschung wie üblich ihr Begleiter. Gott hatte sie nicht sterben lassen, während sie zu ihm betete. Wenn sie etwas mutiger wäre, hätte sie sich vielleicht schon selbst darum gekümmert. Aber die Bilder vom Fegefeuer und der Verdammnis hatten sie bisher auf dieser Erde gehalten.
„Dein Wille geschehe“, flüsterte sie genau wie jeden Abend, wenn sie die Kirche wieder verließ.
Die niederschmetternde Aussicht, allein nach Hause zurückzukehren, ließ ihre alten Knochen schmerzen. Anfangs, als Henry gestorben war, hatte wenigstens noch ihr Enkel Thomas bei Ruth gewohnt. Doch seit der Junge vor etwa zwei Jahren nach einem Streit ausgezogen war, hatte Ruth nichts anderes mehr getan, als Gott um ihren eigenen Tod zu bitten. Ein Gebet, das bisher leider unbeantwortet geblieben war.
Langsam schleppte sie sich an den Kirchenbänken vorbei, zu erschöpft, um die Füße richtig anzuheben. Wenn sie an der letzten Reihe nicht eine kurze Pause eingelegt hätte, wäre ihr das leise Stöhnen, das durch den Raum ging, sicherlich entgangen. Aber nun hielt sie inne und spitzte die Ohren. War es wirklich da gewesen oder hatte sie sich das Geräusch nur eingebildet?
Eine Sekunde später nahm Ruth aus dem Augenwinkel heraus eine Bewegung wahr. Sie drehte sich um und sah auf einer der Kirchenbänke eine zusammengekauerte Frau liegen. Ihr langes, dunkles Haar lag über dem Gesicht und verbarg ihre Gesichtszüge. Sie zitterte und stöhnte noch einmal.
War sie krank?
Beunruhigt blickte Ruth sich in der menschenleeren Kirche um und spürte, dass sie nervös wurde. Vielleicht war die Frau nicht ganz bei Sinnen, vielleicht hatte sie eine ansteckende Krankheit.
Oder aber sie war genau wie Ruth hier, um Gott um ihren Tod zu bitten.
Ruth fasste Mut und trat auf die Frau zu. „Hallo? Brauchen Sie Hilfe?“
Die Frau rührte sich, strich sich das Haus aus dem Gesicht und versuchte, sich aufzurichten. „Sì, per favore.“ Sie war kaum älter als ein junges Mädchen, hatte glasige Augen und fieberrote Wangen.
Zaghaft trat Ruth wieder einen Schritt zurück. „Sind Sie krank? Soll ich jemanden für Sie anrufen?“
Mühsam ließ das Mädchen sich gegen die Kirchenbank fallen, der Kopf hing schlaff nach unten. „Ich habe niemanden.“
Niemanden? Wie konnte das sein? Sie war so eine hübsche junge Dame. Oder das wäre sie zumindest – gewaschen und in frischer Kleidung. „Wo wohnen Sie, Liebes?“
Sie schüttelte nur den Kopf. „Nirgends.“
Entschieden richtete Ruth sich auf und blickte sie an. Ihr selbst war zwar ein sehr behütetes Leben beschieden gewesen, aber sie erkannte sofort, wenn jemand in Not war. Und das Leben dieser jungen Frau hing offensichtlich an einem seidenen Faden. „Warten Sie hier, ich bin gleich wieder da.“
Eilig verließ Ruth die Kirche, angetrieben von einer neuen Energie. Der Pastor würde wohl oder übel sein warmes Bett gegen den Wagen tauschen und die beiden Frauen zu Ruths Haus fahren müssen.
Kapitel 2
Nur langsam wurde Olivia wach und eigentlich war sie sich sicher, dass sie träumte. Noch nie hatte sie auf einer so weichen Matratze gelegen, die auch noch nach Lilien und Lavendel duftete. Überrascht nahm sie kräftige Finger um ihre Fesseln wahr, nach einer Weile wanderten sie zu ihrer Stirn.
Mamma. Sie maß Olivias Temperatur – genau wie früher, als sie noch klein war.
Mit Mühe gelang es Olivia, die schweren Augenlider zu öffnen. Nur für Mamma würde sie den Himmel aufgeben.
Mehrmals blinzelte Olivia und versuchte, die Person vor sich zu fokussieren.
„Wie geht es ihr, Dr. Henshaw?“, fragte eine fremde Frau.
Nicht Mamma.
„Das Fieber ist gesunken. Wie es scheint, schlägt die Medizin an.“
Das Einzige, das Olivia klar erkennen konnte, war eine Weste mit silbernen Knöpfe. Wieder blinzelte sie, schließlich konnte sie das Gesicht eines Mannes ausmachen.
„Hallo, junge Dame. Wie schön, Sie wach zu sehen.“
„Wo bin ich?“ Das hier war definitiv weder ihre Zelle noch ihr Zuhause.
„Sie sind bei mir zu Hause“, erklärte nun die Frauenstimme. „Ich bin Ruth Bennington. Und das ist mein Arzt, Dr. Henshaw.“
Olivias Augen wanderten von dem überraschend jungen Mann zu einer großen, schlanken Frau mit grauen Haaren, die hinter ihm stand. Sie hatte kluge Augen und strahlte Autorität aus. Genug Autorität, dass Olivia unter der Decke zu zittern begann. Frauen wie diese hatte es in der Anstalt zur Genüge gegeben und Olivia hatte gelernt, ihnen aus dem Weg zu gehen.
„Es ist alles in Ordnung, Liebes“, beruhigte die Frau sie. „Ich habe Sie in der St Olaf’s Church gefunden, Sie hatten sehr hohes Fieber. Pastor Dixon und ich haben Sie dann hierhergebracht und ich habe einen Arzt hinzugeholt, Dr. Henshaw.“
Der Mann lächelte. „Sie liegen jetzt seit zwei Tagen hier. Aber ich glaube, das Schlimmste haben Sie nun überstanden.“ Routiniert griff er nach dem Stethoskop, das um seinen Hals hing. „Wenn Sie gestatten, würde ich gern noch einmal Ihren Herzschlag kontrollieren.“
Olivia stockte der Atem, Panik überkam sie.
„Ich lasse Sie wohl besser kurz allein“, erklärte Mrs Bennington und wollte sich zur Tür drehen.
„Nein!“, rief Olivia, festigte den Griff um die Decke und zog sie höher. Sofort schoss ihr das Bild vom Behandlungszimmer in der Anstalt ins Gedächtnis – und was passierte, wenn man mit der Ärztin alleine im Raum war …
Überrascht drehte die alte Frau sich um. „Bei Dr. Henshaw sind Sie in guten Händen, das verspreche ich Ihnen.“
„Aus dem Mund von Mrs Bennington ist das ein hohes Lob“, fügte der Arzt mit einem Zwinkern an.
„Bitte bleiben Sie“, bat Olivia so leise, dass sie daran zweifelte, ob die Frau es überhaupt hatte hören können.
Doch Mrs Bennington nickte. „Also gut. Ich setze mich hier in die Ecke.“
Beruhigt ließ Olivia die Decke los, wenngleich sie den Arzt weiterhin misstrauisch ansah. Er war noch keine dreißig, wie sie schätzte, und hatte kurzes braunes Haar und freundliche Augen. Ein gut aussehender Mann. Er lächelte kurz, dann hörte er ihr Herz ab, prüfte Augen, Ohren und den Mund und setzte sich schließlich mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck zurück. „Ich denke, die Infektion ist so gut wie überstanden. Sie sollten viel trinken und auch die Medizin weiter nehmen, die ich Mrs Bennington für Sie gegeben habe“, sagte er, nahm seinen Ärztekoffer vom Boden und stand auf. „Ich werden morgen noch einmal nach Ihnen sehen. Dann wird es Ihnen schon viel besser gehen, denke ich.“
Olivia versuchte zu lächeln. Vielleicht hatte sie den Mann falsch eingeschätzt. „Danke.“
„Nichts zu danken. Einen guten Tag noch, die Damen.“
Auch Mrs Bennington stand nun auf. „Vielen Dank noch mal, Dr. Henshaw. Ihre Gewissenhaftigkeit weiß ich zu schätzen.“
„Ich finde selbst zur Tür“, erwiderte er nach einer kurzen Verbeugung und ging.
Erleichtert seufzte Olivia. Anstatt dem neugierigen Blick der alten Frau zu begegnen, sah sie sich ihre Umgebung etwas genauer an. Das Zimmer war sehr geräumig. Rote Samttapeten schmückten die Wände und ein kunstvoll verzierter Spiegel hing über einem Waschtisch aus dunklem Holz. An der Wand brannte ein kleines Feuer in einem Kamin und an der Decke hing ein Kronleuchter, dessen kleine Kristalle im Licht funkelten.
„Hoffentlich fühlen Sie sich hier wohl“, sagte Mrs Bennington. „Mein Zimmer ist gleich am Ende des Korridors, falls Sie etwas brauchen.“
Wortlos nickte Olivia, die noch immer grübelte, wieso diese Frau eine Fremde wie sie einfach bei sich aufgenommen hatte.
„Verraten Sie mir Ihren Namen?“, fragte Mrs Bennington erwartungsvoll mit ihren klarblauen Augen.
„Olivia Rosetti.”
„Olivia. Ein schöner Name für eine schöne Frau“, erwiderte Mrs Bennington mit einem Lächeln. „Haben Sie Hunger oder Durst, Liebes?“
Zuerst wollte Olivia ablehnen, aber ihr trockener Mund und die aufgeplatzten Lippen bettelten nach Feuchtigkeit. „Ja, ich würde gern etwas trinken.“
„Ich lasse Ihnen sofort eine Kanne Tee und ein Glas Wasser bringen“, erwiderte die Frau beruhigt. „Vielleicht auch etwas Hühnerbrühe, falls meine Köchin gerade welche zur Hand hat. Sie ruhen sich einfach weiter aus. Und machen Sie sich bitte keine Sorgen, um nichts.“
An der Tür blieb die Frau noch einmal stehen und sah über die Schulter zu Olivia. „Ich weiß nicht, wer oder was Sie in die Kirche geführt hat, aber … Sie können gern so lange wie nötig hier bleiben. Auch ohne Erklärung.“
Überwältigt presste Olivia die Lippen zusammen. In ihren Augen formten sich Tränen, aber sie blinzelte sie weg. Stumm nickte sie und hoffte, dass die Frau verstand, wie dankbar sie ihr war.
Offensichtlich zufrieden verließ Mrs Bennington den Raum.
Wie versprochen, kam Dr. Henshaw am nächsten Tag wieder. Er hatte recht behalten, inzwischen ging es ihr deutlich besser. Sie konnte sich im Bett aufrichten und am Morgen hatte sie Toastbrot und Tee frühstücken können.
Dieses Mal gestattete Olivia dem Arzt, sie auch ohne Mrs Bennington im Raum zu untersuchen. Mit seiner sanften und fürsorglichen Art hatte er ihr Vertrauen gewonnen.
Sein Haar hatte die Farbe von Kastanien, wie Papà sie auch im Geschäft verkaufte, und seine Lippen umspielte ein natürliches Lächeln. Seine haselnussbraunen Augen drückten Wärme und Mitgefühl aus, ganz im Gegenteil zu dem leeren, eisigen Blick der Anstaltsärztin vom Mercer Reformatory.
Nachdem Dr. Henshaw ihre Temperatur gemessen und Herz und Lunge abgehört hatte, hängte er sein Stethoskop wieder um den Hals und rückte einen Stuhl ans Bett heran. Mit ernstem Blick setzte er sich und Olivia wurde nervös.
„Miss Rosetti, ich möchte offen mit Ihnen sein, wenn ich darf“, sagte er ganz professionell, aber nicht ohne Sorge.
Ängstlich umklammerte Olivia die Decke. Hatte er noch etwas gefunden, das nicht in Ordnung war? Was, wenn die Gerüchte stimmten und die Tests, die man im Mercer Reformatory an ihr durchgeführt hatte, überhaupt keine Tests gewesen waren? Das erklärte vielleicht auch, wie sie sich diese merkwürdige Infektion zugezogen hatte. Olivia sah ihn genau an und versuchte, seine nächsten Worte einzuschätzen, aber sein schönes Gesicht verriet nichts.
Sie wurde unruhig. „Ist es wieder schlimmer geworden?“
„Nein, im Moment scheint alles unter Kontrolle“, beruhigte er sie vorsichtig. „Aber … was ich mir nicht erklären kann, ist, wie Sie sich angesteckt haben“, begann er. „Ist jemand in Ihrer Umgebung krank gewesen? Vielleicht ein Familienmitglied? Oder jemand auf der Arbeit?“
Hitze kroch Olivias Nacken hoch. Seine Frage rief Erinnerungen wach, auf die sie nicht vorbereitet war. Der trockene, immerwährende Husten, an dem viele der Frauen gelitten hatten. Hatte sie sich mit etwas Lebensbedrohlichem angesteckt?
„Miss Rosetti?“
Beunruhigt biss sie sich auf die Lippe. Um ihr helfen zu können, musste Dr. Henshaw die Hintergründe kennen. „Ich bin kürzlich aus dem Mercer Reformatory entlassen worden. Die meisten Frauen dort waren … nicht gerade gesund.“
Seine Augen weiteten sich, aber er sprach ruhig weiter. „Ich verstehe. Darf ich fragen, für wie lange Sie dort waren?“
„Fast achtzehn Monate. Aber wegen guter Führung hat man mich etwas früher entlassen.“ Wie ironisch, wo man sie ursprünglich wegen Unsittlichkeit verhaftet hatte.
„Und war das das einzige Mal während Ihres Aufenthalts dort, dass sie krank waren?“
Olivia hätte sich am liebsten unter der Bettdecke versteckt. Ihre Antwort würde letztlich nur weitere unangenehme Fragen aufwerfen.
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, ich hatte auch eine Infektion nach …“
„Nach?“, hakte Dr. Henshaw sanft nach.
Stur schob sie das Kinn vor und sah ihn trotzig an. Wieder spürte sie den Geschmack von Bitterkeit auf der Zunge. Sollte er sie doch verurteilen, wenn er es wagte. „Nach der Geburt meines Sohnes. Sie haben ihn mir weggenommen, ohne dass ich ihn stillen durfte.“
„Haben Sie ihn in der Anstalt geboren?“
„Nein, im Krankenhaus. Dort war ich dann einige Tage, bevor es wieder zurückging. Ohne meinen Sohn.“ Bei diesen Worten begann ihr ganzer Körper zu zittern. Sie erinnerte sich an den Kummer, von dem sie sich wochenlang nicht erholt hatte, und an den Phantomschmerz in der Gebärmutter, ohne das Kind darin.
„Das ist wirklich traurig. Es tut mir ausgesprochen leid, was Ihnen widerfahren ist.“
Antworten konnte Olivia nicht, sein Mitgefühl war zu viel für sie. Bisher hatte ihr niemand außer ihrer Mutter auch nur das kleinste bisschen Mitleid entgegengebracht.
Einige Momente der Stille vergingen, dann räusperte sich Dr. Henshaw. „Aber abgesehen davon waren Sie gesund? Es gab keine anderen Komplikationen bei der Geburt?“
„Nein.“
Behutsam faltete der Arzt die Hände. „Ich weiß nicht recht, wie ich das sagen soll, aber … ich muss Sie das fragen.“
Nervös spannte Olivia den Bauch an, als erwartete sie einen Schlag. Sie wagte es kaum zu atmen, während sie die nächsten Worte abwartete.
„Hat man Sie in der Anstalt … misshandelt?
Olivia rang nach Luft. Misshandelt? Wenn er wüsste … Die Wahrheit schrie danach, ausgesprochen zu werden, aber Olivia fehlten die Worte.
„Von den anderen Gefangenen?“, fragte er. „Oder von den Wärterinnen?“
Olivia schüttelte den Kopf. Nicht, um seine Frage zu verneinen, sondern um ihm zu zeigen, dass sie nicht über die Grausamkeiten sprechen konnte, die man ihr angetan hatte.
„Ich weiß, das ist ein sehr schwieriges Thema“, fuhr er fort. „Aber es wäre nachlässig von mir, die Hinweise einfach zu übergehen.“
Hinweise? Was hatte er gesehen? Beschützend verschränkte sie die Arme vor dem Körper.
Dr. Henshaw nahm sein Stethoskop vom Hals und verstaute es in der Tasche. „Als Sie noch nicht wieder bei Bewusstsein waren, habe ich Sie untersucht.“
Hitze kroch ihren Nacken hoch. Bilder vom Behandlungszimmer der Anstalt vernebelten ihre Gedanken. Die schrecklichen Metallbetten mit den Steigbügeln. Das Tablett mit den abscheulich aussehenden Instrumenten. Die leeren Augen der Ärztin. Olivias Lippen begannen zu zittern und sie ballte die Hände zu Fäusten. Doch kein Wort kam über ihre Lippen.
„Die zahllosen Narben deuten auf willkürliche Schnittwunden in Ihrem … Intimbereich hin“, sagte er vorsichtig, „und … vielleicht sind Sie unorthodoxen chirurgischen Eingriffen zum Opfer gefallen.“ Besorgt beugte sich der Arzt ein Stück zu ihr vor. „Miss Rosetti, sind Sie missbraucht worden?“
Ein schmerzliches Schluchzen platzte aus ihr heraus und löste eine Welle heißer Tränen aus. Olivia hielt die Augen fest geschlossen und drückte sich gegen das Kissen, als all die Bilder mit einem Mal wieder da waren, die sie mit so viel Mühe unterdrückt hatte. Die Lederriemen, mit denen man sie ans Bett gefesselt hatte, die schrecklichen Spritzen, das Einschneiden des Skalpells ohne jede Schmerzbetäubung, die fürchterlich brennenden chemischen Behandlungen. Und dann später alleine in der Zelle voller Schmerzen, dass sie am liebsten auf der Stelle gestorben wäre.
Olivia wiegte sich auf dem Bett vor und zurück. Wie hatten die Anstaltsdirektoren zulassen können, dass die Ärztin solch abscheuliche Gräueltaten an ihr vorgenommen hatte? Und dann auch noch ausgerechnet eine Ärztin … Eine Frau, die Mitleid mit ihr hätte haben sollen. Wieso hatte niemand der Verantwortlichen sie aufgehalten?
„Es ist alles in Ordnung, Liebes“, drang endlich eine tröstende Frauenstimme durch Olivias Qual zu ihr hindurch. „Hier sind Sie in Sicherheit. Niemand wird Ihnen jemals wieder so etwas antun.“
Als der Tränenstrom endgültig verronnen war, öffnete Olivia langsam die Augen. Mrs Bennington saß neben ihr auf dem Bett, Dr. Henshaw hatte sich ein Stück zurückgezogen. Kummer stand ihm ins Gesicht geschrieben. Verunsichert fragte Olivia sich, ob er die schlechte Nachricht vielleicht noch gar nicht überbracht hatte?
„Werde ich sterben?“, fragte sie mit erstickter Stimme.
„Nein, Miss Rosetti“, sagte Dr. Henshaw mit noch immer ernstem Blick und kam einen Schritt näher. „Sie liegen nicht im Sterben, das versichere ich Ihnen.“
Fürsorglich reichte Mrs Bennington Olivia ein Taschentuch und sah Dr. Henshaw an. „Ich denke, unsere Patientin sollte sich jetzt besser ausruhen. Können Sie vielleicht morgen noch mal kommen, wenn sie wieder bei Kräften ist?“
„Natürlich, Mrs Bennington“, erwiderte er und nahm seine Tasche, bevor er sich noch einmal an Olivia wandte. „Man hat Ihnen schreckliche Dinge angetan, Miss Rosetti. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, gehört hinter Gitter.“ Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte – es kostete ihn offensichtlich viel Kraft, seine Emotionen im Zaun zu halten. „Falls Sie je darüber sprechen möchten oder wenn Sie Fragen haben, bin ich gern für Sie da.“
Mit einem Bilderbuch in der Hand setzte Darius Reed sich auf das Bett und sank in die weiche Matratze ein. „Warst du heute brav bei deiner Großmutter, Maus?“
Große braune Augen sahen zu ihm auf. Augen wie die ihrer Mutter. „Ja, Daddy. Ich bin doch immer brav.“
„Du hast dir also eine Gutenachtgeschichte verdient?“
„Eine? Ich verdiene zwei, nein sogar drei Geschichten“, sagte sie und zeigte die Zahl mit den Fingern. „Heute war ich extra brav.“
„Soso“, entgegnete Darius und schmunzelte über die Verhandlungstaktiken seiner Tochter. Vielleicht würde ja mal eine Geschäftsfrau aus ihr werden, wenn sie groß war. „Was bedeutet denn ‚extra brav‘?“
Auch sie grinste nun und drückte ihren zottigen Teddybären stolz an ihre Brust. „Ich habe Pappoú im Garten geholfen.“
Kurz zuckte Darius zusammen. Sein Vater bestand darauf, dass Sofia ihn auf Griechisch ansprach – und nicht mit Granddad oder Grandpa oder Pops, wie es in Kanada üblich war – und stellte sich damit stur gegen Darius’ Wunsch, sich mehr anzupassen.
„Darüber hat er sich bestimmt gefreut“, erwiderte Darius, während er sich ein Kissen hinter den Rücken schob und das Buch aufschlug. „Bist du bereit?“
Zufrieden nickte Sofia, nahm den Daumen in den Mund und kuschelte sich mit dem Kopf an Darius’ Schulter.
Eine wohlige Wärme machte sich in seiner Brust breit. Das waren die besten Momente des Tages: wenn er zu seiner Tochter nach Hause kam und ihm der süße Geruch des Schaumbads aus ihren Locken in die Nase stieg, während sie ihn so fest umarmte, dass ihm beinahe die Luft wegblieb. Und wenn sie ihn mit strahlenden Augen ansah, die nur für ihn lächelten. Diese Momente waren das viele Arbeiten und jede Mühe wert. Um Sofia ein gutes Leben zu ermöglichen, nahm Darius die langen Stunden im Büro gerne auf sich.
Nichtsdestotrotz kratzte es an seinem Stolz, dass sie beide nach dem Tod seiner Frau zurück zu seinen Eltern hatten ziehen müssen. Nach dieser Tragödie war er allerdings auf ihre Liebe und Unterstützung angewiesen, um mit seiner und Sofias Trauer umgehen zu können. Seine Eltern waren schließlich die einzige Familie, die Sofia noch geblieben war. Der Nachteil an ihrer Hilfe war jedoch, dass Sofia für seinen Geschmack zu viele griechische Worte und Angewohnheiten übernahm.
Bald schon, wenn sie in die Schule kam, würden sie ihr eigenes Zuhause haben. Und dort, so nahm er es sich fest vor, würde Darius alles Griechische ebenso sorgfältig ausrupfen wie beim Unkrautjäten im Garten.
Denn nach Geburtsrecht war seine Tochter Kanadierin, und so sollte man sie hier auch behandeln. Den Spott und die Vorurteile über ihre europäische Herkunft wollte er ihr ersparen. Es reichte, dass sie seine Kindheit befleckt hatten.
Und ihre Mutter das Leben gekostet hatten.
„Warum warst du nicht schon zum Abendessen zu Hause, Daddy?“, drehte sich Sofia mit fragendem Blick zu ihm um. „Yiayiáweint manchmal, weißt du. Ich denke, sie weint, weil sie dich vermisst.“
Mit schlechtem Gewissen presste Darius die Lippen zusammen. Wie konnte eine Vierjährige so gut darin sein, anderen ihre Schuld vor Augen zu führen? „Deine Oma weint wegen vielem, Maus. Zum Beispiel auch, wenn ihr der Eintopf anbrennt.“
Diese Antwort entlockte Sofia ein Kichern. „Das stimmt. Gestern hat sie eine Tasse fallen gelassen und hat geweint, als sie die Scherben aufgesammelt hat. Ich habe ihr gesagt, dass große Mädchen nicht weinen, aber das hat ihr nicht gefallen.“
„Nein, da hat sie dich sicher für frech gehalten. Vor den Erwachsenen muss man Respekt haben, erinnerst du dich?“
„Ja, ich weiß …“, erwiderte Sofia mit großen Augen. „Aber manchmal plumpsen mir die Worte einfach so aus dem Mund.“
Um sich das Lachen zu unterdrücken, biss Darius sich leicht von innen auf die Wange. Dieses Vorrecht hatte seine Tochter – die Dinge einfach auszusprechen … Mit einem Seufzen zog er Sofia fester in seine Arme. „Also gut, mit welcher Geschichte fangen wir an?“
„Mit der Prinzessinnengeschichte.“
Natürlich. Er schlug die abgegriffene Seite auf und begann vorzulesen. Gleichzeitig dankte er Gott in Gedanken für das wertvolle Geschenk seiner Tochter – die Quelle seiner Freude, der Grund für jeden seiner Atemzüge, jeden seiner Schritte.
Mach dir keine Sorgen, Selene. Unser Mädchen wird es sehr gut haben. Niemals wird sie das ertragen müssen, was du durchgemacht hast.
Kapitel 3
Nach vier Tagen fühlte Olivia sich endlich kräftig genug, um ihr Zimmer zu verlassen. Auf der Truhe am Fußende des Bettes lag der Beutel, den ihre Mutter hatte retten können, und Olivia holte eine Bluse sowie einen Rock heraus, schrecklich zerknittert, aber wenigstens sauber.
Die letzten Tage hatte Mrs Bennington – oder Ruth, wie Olivia sie nennen sollte – ihr immer ins Badezimmer geholfen, doch inzwischen konnte sie selbst gehen. Das Bad war mit einer großen Badewanne auf Füßen, einem Porzellanwaschbecken und einer Toilette mit automatischer Spülung ausgestattet. Annehmlichkeiten, die Ruths Enkelsohn damals veranlasst hatte, wie Olivia mittlerweile wusste.
Nachdem sie sich frisch gemacht hatte, kämmte sie sich die Haare mit der Bürste, die sie in ihrem Zimmer entdeckt hatte. Sie hatte keine Haarklammern zur Verfügung, deshalb flocht sie nun ihr Haar zu einem dicken Zopf und band ihn mit einem Faden vom Saumende ihrer Bluse zusammen. Bevor sie die Tasche wieder wegräumte, überprüfte sie noch einmal, ob die kleine Strickdecke sich weiterhin darin befand – die einzige greifbare Erinnerung an ihren Sohn. Wehmütig hielt sie sich den Stoff an die Nase und atmete den sanften Babygeruch ein. Einen Moment später atmete sie zitternd wieder aus und verstaute die Decke. Im Grunde störte es Olivia nicht, dass sie all ihre Habseligkeiten verloren hatte – solange ihr nur diese Decke blieb.
Als sie sich wieder gefasst hatte, stieg sie die breite Treppe hinab ins Erdgeschoss. Wenngleich sie sich etwas unwohl fühlte beim Erkunden dieses fremden Hauses, konnte sie nicht widerstehen, einige Momente im Eingangsbereich zu verweilen und das schöne Gebälk zu bewundern. Über den Türen, die vom Foyer abgingen, zog sich ein kunstvoll geschnitztes Gewölbe entlang. Schon allein das Treppengeländer und die verzierten Baluster waren eine Augenweide. An den Wänden hingen viele Gemälde, eine Mischung aus Landschaftsbildern und Porträts. Anscheinend hatte Ruth, oder ihr verstorbener Ehemann, eine Leidenschaft für Kunst.
„Da sind Sie ja, Olivia. Wie schön, Sie wohlauf zu sehen“, grüßte sie die alte Dame, die gerade ins Foyer trat. So groß und elegant in ihrem schlichten grauen Kleid und der Perlenkette, erinnerte sie Olivia an eine Königin.
„Ja, ich bin noch ein bisschen schwach, aber alles in allem geht es mir schon viel besser. Das habe ich allein Ihnen und Dr. Henshaw zu verdanken.“
Zielsicher kam Ruth auf Olivia zu und nahm sie beim Arm. „Kommen Sie. Heute möchte ich lieber im Wintergarten frühstücken. Da ist es viel schöner und heller als im biederen Esszimmer.“
Unsicher murmelte Olivia ihre Zustimmung, obschon sie nicht die leiseste Idee hatte, wie Wintergarten oder Esszimmer aussahen.
„Es freut mich, dass Sie mir Gesellschaft leisten. Meine Köchin macht ganz wunderbare Pancakes, mit Butter und Ahornsirup.“
Am Ende des Korridors bogen sie in ein Zimmer, das Olivia die Sprache verschlug. Ein lichtdurchfluteter Raum mit Fenstern, die vom Boden bis zur Decke reichten. In der Mitte stand ein runder Tisch mit Stühlen, während mehrere Sitzgruppen die umliegenden Fensterfronten flankierten. Überall blühten Blumen und Pflanzen, fast wie in einem Gewächshaus.
„Das ist wunderschön“, flüsterte Olivia staunend.
„Wusste ich doch, dass es Ihnen gefallen würde. Setzen wir uns. Hätten Sie gern Tee oder Kaffee? Oder lieber Orangensaft?“
„Kaffee, bitte.“ Als Olivia Platz nahm, fiel ihr Blick auf die fein angerichteten Servierteller in der Tischmitte, das goldumrandete Geschirr und die weißen Leinenservietten. Zurückhaltend faltete sie die Hände auf dem Schoß. Nichts von alledem fühlte sich richtig an. An einen so feinen Ort wie diesen gehörte sie nicht. Eher in die beengte Wohnung oberhalb des Gemüseladens, wo es nach Gewürzen und Räucherfleisch roch.
„Stimmt etwas nicht, Olivia?“ Ruth sah sie mit fragendem Blick an.
Olivia suchte nach Worten. „Sie … waren mir gegenüber sehr großzügig und ich möchte nicht, dass –“
Eine Frau in schwarz-weißer Uniform betrat das Zimmer. „Soll ich das Frühstück nun servieren, Ma’am?“
Ruth wandte sich an sie. „Ja. Bitte, Anna, seien Sie so gut.“
Sogleich hob das Hausmädchen die Speiseglocke von den Serviertellern. Ein köstlicher Duft erfüllte den Raum, als sie die fluffigen Pancakes und den Kaffee austeilte. Danach verließ sie das Zimmer wieder leise.
„Warum essen wir nicht erst einmal?“, schlug Ruth vor und breitete ihre Serviette auf dem Schoß aus. „Und dann holen wir das Gespräch nach, das schon längst fällig gewesen wäre.“
Olivia nickte, schob ihre innere Unruhe für den Moment beiseite und gab sich dem einfachen Vergnügen des Essens hin. Zum ersten Mal seit zwei Jahren konnte sie eine Mahlzeit wirklich genießen.
Nach dem Frühstück schenkte Ruth den beiden noch einen Kaffee ein und sie nahmen auf einem der Sofas mit Blick auf den herrlichen Garten Platz.
Ruhig stellte Ruth ihre Tasse auf dem kleinen Beistelltisch ab und lehnte sich gemütlich in die Kissen. „Also gut, warum erzählen Sie mir nicht einfach, was Sie auf dem Herzen haben, Olivia?“
Demütig blickte Olivia die ältere Dame an. Ruth war ausgesprochen freundlich zu ihr gewesen, doch wenn sie wüsste, wem sie da eigentlich Einlass gewährt hatte – einer Frau, die erst kürzlich aus der Haft entlassen worden war –, würde sie Olivia zweifelsohne bitten, sofort zu gehen. „Ich weiß einfach nicht, wie ich Ihnen je dafür danken soll, was Sie für mich getan haben“, begann Olivia leise.
„Keine Sorge, Geld erwarte ich nicht. Es war mir eine Freude, Ihnen zu helfen.“
„Aber Sie kennen mich doch überhaupt nicht.“
Mit erhobener Hand unterbrach Ruth sie. „Liebe Olivia, ich weiß zwar nicht, welche unglückseligen Umstände Sie an jenem Abend in die St Olaf’s Church gebracht haben. Aber eines Tages, so hoffe ich, haben Sie vielleicht genug Vertrauen in mich, um mir Ihre Geschichte zu erzählen. Und in der Zwischenzeit möchte ich Sie wissen lassen, warum ich in der Kirche war“, sagte Ruth entschieden. „Schon seit Jahren gehe ich fast jeden Abend in die Kirche und bitte Gott, mich endlich heimzurufen.“
Erschrocken zuckte Olivia zusammen, sodass etwas Kaffee über den Tassenrand in die Untertasse schwappte. „Aber wieso? Sie haben doch alles, was man sich wünschen kann.“
„So scheint es vielleicht, ja. Aber glauben Sie mir, auch alles Geld der Welt hilft nicht gegen Einsamkeit. Ich habe meinen Mann verloren. Mich von meiner Familie entfremdet. Und ich habe zwar viele Bekannte, aber kaum echte Freunde.“ Während sie sprach, blitzten die verschiedensten Emotionen in ihrem Gesicht auf. „Fast täglich gehe ich abends zum Beten in die Kirche. Stundenlang liege ich Gott mit der immer gleichen Bitte in den Ohren – und doch hält er es nicht für nötig, ihr nachzukommen. An jenem Abend, als ich gerade nach Hause gehen und mich wieder einmal in Selbstmitleid suhlen wollte, bin ich dann Ihnen, einer jungen Frau in Not, begegnet. Und habe reagiert.“ Lächelnd schüttelte Ruth den Kopf. „Das klingt vielleicht verrückt, aber ich glaube, Sie sind die Antwort auf meine Gebete. Anstatt mir das Leben zu nehmen, hat Gott mir einen neuen Grund zum Leben gegeben.“
Mit einem Mal rumorte der Kaffee in Olivias Magen. Das war zu viel. Unmöglich konnte sie Ruths Lebensgrund sein, wo ihr eigenes Leben in Trümmern lag. „Das glaube ich nicht“, erwiderte Olivia. „Und Sie besser auch nicht“, schob sie nach und stand auf. „Ich muss jetzt gehen“, sagte sie und stürmte blindlinks den Flur entlang zum Eingang.
„Olivia, warten Sie“, hielt Ruth sie auf, als sie sie an der Treppe einholte. „Sollen wir unser Gespräch nicht erst beenden? Und wenn Sie dann immer noch gehen wollen, halte ich Sie nicht auf.“
Unentschlossen umklammerte Olivia das Treppengeländer.
„Sie haben gesagt, Sie wüssten nicht, wie Sie mir danken sollen“, begann Ruth. „Vielleicht wollen Sie mir im Gegenzug einfach erzählen, was Sie in diese missliche Lage gebracht hat.“
Olivia seufzte. Vielleicht wäre es das Beste, einmal alles offenzulegen. Und sobald sie Ruth in ihre Geheimnisse eingeweiht hätte, würde Ruth sowieso darauf bestehen, dass Olivia ging. „Also gut. Aber ich warne Sie – schön ist meine Geschichte nicht.“
„Und so bin ich in der Kirche gelandet“, sagte sie. Als Olivia ihre Beichte beendet hatte, brannten unvergossene Tränen in ihren Augen. Nachdem sie die schlimmsten Momente ihres Lebens gerade noch einmal durchlebt hatte, spürte sie eine große Leere in der Brust. Sie atmete einmal tief durch und riskierte einen Blick zu Ruth.
Nachdenklich schürzte die Frau die Lippen. Ein Moment der Stille verging, bevor Ruth aufstand und ans Fenster trat. Die Morgensonne erfüllte das Zimmer mit Licht – ein herber Kontrast zu der düsteren Stimmung.
Instinktiv verkrampfte sich Olivias Magen. Wie befürchtet, hatte ihr Gnadenengel nun allen Respekt vor ihr verloren. Aber wie auch nicht? Nicht einmal ihre Eltern wollten noch etwas mit ihr zu tun haben.
Erhobenen Hauptes stand Olivia auf. Offenbar konnte sie mit niemandes Hilfe rechnen. Musste sich selbst durchschlagen.
Allein.
„Ich hole nur meine Sachen und … bin dann weg“, verkündete sie. „Danke noch mal für Ihre Gastfreundschaft, Ruth.“
Die alte Dame drehte sich wieder zu ihr um. Tränen rannen ihr über die faltigen Wangen und Schmerz hatte ihre Augen verdunkelt. „Bitte bleiben Sie noch einen Moment. Da ist noch etwas, das ich Ihnen gern erzählen würde. Etwas, das ich noch nie jemandem erzählt habe, außer meinem Ehemann – Gott sei ihm gnädig“, sagte sie mit bebenden Lippen.
Überrascht legte Olivia eine Hand an den Hals. Sie hatte mit Empörung gerechnet oder vielleicht mit Abscheu, aber gewiss nicht mit Tränen. Wortlos ließ sie sich wieder auf dem Sofa nieder und wartete, bis Ruth sich zu ihr setzte.
Mit einem Taschentuch wischte sich die alte Frau über die Wangen. „Zuerst möchte ich Ihnen sagen, wie schrecklich leid es mir tut, was Sie durchmachen mussten. Keine Frau auf der Welt sollte so gedemütigt werden. So etwas tut man keinem Menschen an.“
„Danke, dass Sie das sagen“, erwiderte Olivia gerührt und spürte, wie sich ihr Hals zuschnürte.
Ruth nickte und suchte ihren Blick. „Ich kann Ihren Schmerz sehr gut nachempfinden. Als ich noch sehr jung war, habe ich etwas Ähnliches erlebt. Wenngleich meine Erfahrung nicht ansatzweise so grausam war wie die Ihre.“ Bevor sie weitersprach, atmete Ruth tief durch. „Auch ich habe ein uneheliches Kind zur Welt gebracht. Und genau wie Ihnen ist es mir einfach weggenommen worden.“
Ungläubig starrte Olivia sie an. Diese selbstsichere, starke Frau war einst unehelich schwanger gewesen? Nur zu gut konnte Olivia sich vorstellen, wie viel schwieriger das noch vor etwa fünfzig Jahren gewesen sein musste. Und doch hatte Ruth es offensichtlich durchgestanden, ja mehr noch, sie hatte den Sprung in ein gutes Leben geschafft.
Vielleicht gab es ja doch noch Hoffnung für Olivia.
„Genau wie Sie“, fuhr Ruth fort, „hat meine Familie mich damals verleugnet. Es war schrecklich. Und erst, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich wieder angefangen, richtig zu leben. Henry hat über meine Vergangenheit hinweggesehen und mich bedingungslos geliebt. Seit seinem Tod fehlt mir der Halt in dieser Welt.“ Kummer legte sich über ihr Gesicht.
Bei diesen Worten überkam Olivia eine unerwartete Trauer über Rory. Dabei hatte sie gar nicht erst die Möglichkeit gehabt, eine so fortwährende Verbindung zu ihm aufzubauen. Wie viel schwerer musste es für Ruth gewesen sein, ihren Mann nach so vielen gemeinsamen Jahren zu verlieren? „Wie ist es nach der Geburt für Sie weitergegangen?“
„Ich hatte das Glück, dass mich eine Großtante bei sich aufgenommen hat. Sie hat damals in Montreal gelebt und sprach mehr Französisch als Englisch, aber irgendwie haben wir uns verständigt. Und ihr Mann hatte eine Druckerei, dort durfte ich mitarbeiten. Und so habe ich meinen Henry kennengelernt.“
„Und was hat Sie dann nach Toronto geführt?“
„Henry kam ursprünglich von hier und er wollte gern zu seiner Familie zurückziehen. Eines Tages hat er entschieden, den Schritt zu wagen und hier seine eigene Druckerei zu eröffnen. Eine gute Entscheidung, wie sich herausgestellt hat“, erzählte Ruth, während sie an ihrer Perlenkette spielte. „Schließlich haben wir einen Sohn bekommen und hatten im Grunde ein sehr glückliches Leben. Trotzdem gibt es da diese Leere in mir, die ich nie wirklich losgeworden bin.“
„Ihr erstes Kind“, sagte Olivia, die Hand auf dem Herzen.
Ruth nickte. „Nicht ein Tag vergeht, an dem ich mich nicht frage, was aus meinem kleinen Mädchen geworden ist. Alles, was ich für meine Tochter tun konnte, war, sie Gott anzubefehlen und zu beten, dass er ihr ein gutes Leben schenken möge.“
Die bitteren Worte, die Olivia daraufhin in den Sinn kamen, hielt sie zurück. Wie konnte Ruth noch immer auf Gott vertrauen? Wo war er gewesen, als man diese Kinder ihren liebenden Müttern entrissen hatte?
„Es bekümmert mich, dass unsere Gesellschaft nicht aus ihren Fehlern gelernt hat. Dass man jungen Frauen und deren Kindern noch immer so kaltherzig begegnet.“
„Oder schlimmer.“ Sie hatte längst nicht alle Details ihrer schrecklichen Erfahrungen in der Anstalt vor Ruth offengelegt. Manches käme besser niemals ans Licht …
Das Gesicht in die Sonne gestreckt, blinzelte Ruth und schien sich zu sammeln. „Haben Sie je daran gedacht herauszufinden, was aus Ihrem Sohn geworden ist?“, fragte sie.
„Das ist zwecklos“, erwiderte Olivia verbittert und drückte die Hände so fest zusammen, bis es schmerzte. „Die Frau von der Children’s Aid Society – also vom Kinderheim – hat sehr deutlich gemacht, dass man mir keinerlei Informationen über Matteo geben werde. Ich habe keinen Anspruch mehr auf meinen Sohn.“ Schnell schloss sie die Augen, um den Schmerz auszublenden. Ob die Pein, die diese Worte auslösten, jemals nachließ?
Tröstend strich Ruth Olivia über den Arm. „Das ist so schrecklich ungerecht“, sagte sie. „Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nicht wissen, wo Sie nun hinsollen? Oder haben Sie jemanden, bei dem Sie unterkommen könnten, so wie ich damals bei meiner Tante?“
Eine neue Welle der Hoffnungslosigkeit drohte sich über Olivia zu stülpen. „Nein, da ist niemand. Deshalb bin ich zur Kirche gegangen und habe versucht, mich zu überwinden und den Pfarrer um Hilfe zu bitten.“
Anmutig richtete Ruth sich auf. „Dann würden Sie mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie vorerst hier bei mir wohnen bleiben. Zumindest so lange, bis Sie über Ihre nächsten Schritte entschieden haben.“