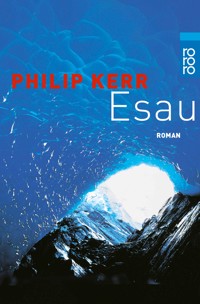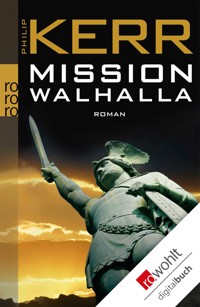
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bernie Gunther ermittelt
- Sprache: Deutsch
Privatermittler Bernie Gunther kann seinen Ruhestand auf Kuba nicht genießen, denn seine Widersacher lassen ihm keine Ruhe. Gerade will er die Insel in Richtung Haiti verlassen, da entführt die US Navy im Auftrag der CIA sein Boot und bringt ihn erst nach Guantánamo, dann ins Militärgefängnis bei New York. Von der Anschuldigung, ein Kriegsverbrecher zu sein, wird er freigesprochen, aber nur unter der Bedingung, dass er für die CIA Stasi-Funktionär Erich Mielke aufstöbert. Doch gleichzeitig will Frankreich seine Auslieferung und sein Todesurteil – wenn er nicht für die Franzosen arbeitet. Denn in seiner Zeit als Kriegsgefangener in Russland soll Gunther einen gesuchten Kriegsverbrecher gekannt haben, der Mitglied der SS in Frankreich war. Ihn soll er in der Flut der Kriegsheimkehrer im Grenzdurchgangslager Friedland identifizieren. Wieder verstrickt sich Gunther im Geflecht der nationalen Interessen, wieder muss er sich vorsehen, um nicht zwischen den Mächten zerrieben zu werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Philip Kerr
Mission Walhalla
Roman
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Allan Scott
«Ich mag Ike nicht.»
Graham Greene: Der stille Amerikaner
Kapitel 1KUBA1954
«Der Engländer da, bei Ernestina», sagte sie und deutete mit einem Kopfnicken in Richtung eines Pärchens, das in einer Ecke des luxuriös ausgestatteten Klubs beisammensaß. «Der erinnert mich an Sie, Señor Hausner.»
Doña Marina kannte mich nicht besser als jeder andere auf Kuba, oder vielleicht doch, weil uns mehr als bloß eine nette Bekanntschaft verband: Doña Marina besaß das größte und beste Bordell in ganz Havanna.
Der Engländer war groß, hatte hängende Schultern, blassblaue Augen und ein trauriges Gesicht. Er trug ein kurzärmeliges blaues Leinenhemd, eine graue Baumwollhose und blitzblanke schwarze Schuhe. Ich hatte das Gefühl, ihn schon einmal gesehen zu haben, in der Floridita Bar oder vielleicht in der Lobby des Hotel Nacional. Aber mehr als der Engländer interessierte mich in diesem Moment die neue, halbnackte chica auf seinem Schoß, die sich gelegentlich an seiner Zigarette bediente, während er vergnügt ihre kolossalen Brüste in den Händen wog, als versuchte er, den Reifegrad zweier Pampelmusen einzuschätzen.
«Inwiefern?», fragte ich und musterte mich in dem großen Wandspiegel, auf der Suche nach einer Gemeinsamkeit zwischen uns, abgesehen von der Hochachtung vor Ernestinas Brüsten, auf denen sich deutlich die großen dunklen Brustwarzen abzeichneten.
Das Gesicht, das mir aus dem Spiegel entgegenblickte, war breiter als das des Engländers, das Haar voller, aber beide waren wir um die fünfzig und vom Leben gezeichnet. Möglicherweise dachte Doña Marina, dass unsere Mienen nicht nur gelebtes Leben verrieten, sondern auch eine Spur von schlechtem Gewissen und Komplizenschaft erkennen ließen, als hätte keiner von uns beiden das getan, was er hätte tun müssen oder, schlimmer noch, als lebte jeder von uns mit einer geheimen Schuld.
«Sie beide haben die gleichen Augen», sagte Doña Marina.
«Ach, Sie meinen, sie sind blau», sagte ich, obwohl ich ahnte, dass sie das wahrscheinlich ganz und gar nicht meinte.
«Nein, das ist es nicht. Sie und Señor Greene sehen die Menschen auf eine bestimmte Art und Weise an. Als würden Sie in sie hineinblicken. Wie ein Spiritist. Oder vielleicht wie ein Polizist. Sie haben beide diesen durchdringenden Blick, als würden Sie jeden Menschen sofort durchschauen. Das kann einen richtig verunsichern.»
Es war kaum vorstellbar, dass Doña Marina sich von irgendwas oder irgendwem verunsichern ließ. Sie wirkte immer so entspannt wie eine Eidechse auf einem sonnenwarmen Felsen.
«Señor Greene, also?» Es überraschte mich nicht, dass Doña Marina keinen Hehl aus seiner Identität machte. Die Casa Marina war keines der Häuser, die man lieber unter falschem Namen betrat. Im Gegenteil, man brauchte Referenzen, um überhaupt eingelassen zu werden. «Vielleicht ist er ja Polizist. Würde mich nicht wundern, bei den großen Füßen.»
«Er ist Schriftsteller.»
«Was schreibt er denn?»
«Romane. Western, glaube ich. Er hat mir erzählt, dass er unter dem Namen Buck Dexter schreibt.»
«Nie von ihm gehört. Lebt er auf Kuba?»
«Nein, in London. Aber er kommt immer vorbei, wenn er in Havanna ist.»
«Ein Weltenbummler, was?»
«Ja. Anscheinend ist er gerade auf der Durchreise nach Haiti.» Sie lächelte. «Fällt Ihnen noch immer keine Gemeinsamkeit auf?»
«Nein, eigentlich nicht», erklärte ich mit Nachdruck und in der Hoffnung, dass sie das Thema wechseln würde.
«Wie lief es heute mit Omara?»
Ich nickte. «Gut.»
«Sie gefällt Ihnen, ja?»
«Sehr.»
«Sie ist aus Santiago», sagte Doña Marina, als würde das alles erklären. «Meine besten Mädchen kommen aus Santiago. Sie sehen von allen Mädchen auf Kuba am afrikanischsten aus. Darauf scheinen die Männer zu fliegen.»
«Da will ich nicht widersprechen.»
«Ich glaube, das hat damit zu tun, dass schwarze Frauen im Gegensatz zu weißen Frauen ein Becken haben, das fast so breit ist wie bei einem Mann. Ein anthropoides Becken. Und ehe Sie mich fragen, woher ich das weiß, ich war mal Krankenschwester.»
Das passte ins Bild. Doña Marina legte großen Wert auf Gesundheit und Hygiene, und zum Personal in ihrem Haus am Malecón gehörten zwei ausgebildete Krankenschwestern, die mit allem fertigwurden, vom Tripper bis zum Herzinfarkt. Es hieß, man hätte in der Casa Marina bessere Chancen, einen Herzstillstand zu überleben, als in der Universitätsklinik von Havanna.
«Santiago ist der reinste Schmelztiegel», fuhr sie fort. «Jamaikaner, Haitianer, Dominikaner, Bahamaer – eine karibische Stadt. Und natürlich gibt es nirgendwo auf Kuba mehr Rebellion. Jede Revolution beginnt in Santiago. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute, die dort leben, alle auf die eine oder andere Art miteinander verwandt sind.»
Sie steckte eine Zigarette in eine kleine bernsteingelbe Zigarettenspitze und zündete sie mit einem hübschen Tischfeuerzeug an.
«Wussten Sie zum Beispiel, dass Omara mit dem Mann verwandt ist, der sich in Santiago um Ihr Boot kümmert?»
Mir schwante allmählich, dass Doña Marina mit ihrer Plauderei auf etwas Bestimmtes hinauswollte, denn nicht nur Mr. Greene zog es nach Haiti, sondern auch mich. Allerdings hatte meine Reise eigentlich geheim bleiben sollen.
«Nein, wusste ich nicht.» Ich sah auf die Uhr, doch ehe ich verkünden konnte, dass es Zeit zu gehen sei, hatte Doña Marina mich schon in ihren privaten Salon bugsiert und bot mir einen Drink an. Und da sie von meinem Boot wusste, sollte ich mir wohl besser anhören, was sie zu sagen hatte. Also nahm ich dankend an.
Sie holte einen in der Flasche gereiften Rum und goss mir großzügig ein.
«Auch Mister Greene schätzt unseren Havanna-Rum», bemerkte sie.
«Ich finde, Sie sollten jetzt zur Sache kommen», sagte ich. «Sie nicht auch?»
Sie tat es.
So kam es, dass etwa eine Woche später eine junge Frau auf dem Beifahrersitz meines Chevys saß, als ich in südwestlicher Richtung auf Kubas meistbefahrenem Highway nach Santiago fuhr, ans andere Ende der Insel. Die Ironie entging mir nicht. Ich war drauf und dran, einem Geheimpolizisten zu entwischen, der mich erpressen wollte, und war dabei an eine Puffmutter geraten, die viel zu clever war, um mir offen zu drohen, mir aber einen Gefallen abverlangte, den ich ihr nur äußerst ungern tat: nämlich eine chica aus einer anderen casa in Havanna auf meinen «Angelausflug» nach Haiti mitzunehmen. Mit Sicherheit kannte Doña Marina Leutnant Quevedo und wusste auch, dass er von meinem kleinen Bootstrip keineswegs begeistert wäre. Was sie höchstwahrscheinlich nicht wusste, war, dass er gedroht hatte, mich nach Deutschland abzuschieben, wo ich wegen Mordes gesucht wurde, wenn ich mich nicht bereit erklärte, den Unterweltboss Meyer Lansky auszuspionieren, der mein Arbeitgeber war. Jedenfalls blieb mir kaum was anderes übrig, als ihrer Bitte nachzukommen, auch wenn ich auf eine derartige Beifahrerin liebend gern verzichtet hätte. Melba Marrero wurde nämlich im Zusammenhang mit dem Mord an einem Polizeihauptmann gesucht, und Doña Marina hatte Freunde, die Melba so schnell wie möglich von der Insel schaffen wollten.
Melba Marrero war Anfang zwanzig, allerdings gab sie sich gern älter. Ich vermute, sie wollte einfach ernst genommen werden, und vielleicht hatte sie ja Hauptmann Balart erschossen, weil er es nicht getan hatte. Wahrscheinlicher ist, dass sie ihn erschossen hatte, weil sie mit Castros kommunistischen Rebellen in Verbindung stand. Sie hatte kaffeebraune Haut und ein fein geschnittenes, knabenhaftes Gesicht mit einem angriffslustigen Kinn. In ihren dunklen Augen schien ständig ein Gewitter aufzuziehen. Ihr Haar war nach der italienischen Mode geschnitten – kurz und stufig mit ein paar zarten, ins Gesicht gekämmten Locken. Sie trug eine schlichte weiße Bluse, eine enge beige Hose, einen hellbraunen Ledergürtel und farblich passende Handschuhe. Sie sah aus, als würde sie gleich auf ein Pferd steigen, und ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie das Pferd vor Freude laut wieherte.
«Warum fahren Sie kein Cabrio?», fragte sie, als wir kurz vor Santa Clara waren, wo wir unseren ersten Zwischenstopp einlegen wollten. «Für Kuba braucht man ein Cabrio.»
«Ich mag keine Cabrios. Damit erregt man Aufmerksamkeit. Und ich bin nicht scharf drauf, Aufmerksamkeit zu erregen.»
«Aha, dann sind Sie wohl schüchtern, was? Oder haben Sie irgendwas ausgefressen?»
«Weder noch. Ich werde nur nicht gern beobachtet.»
«Haben Sie eine Zigarette?»
«Im Handschuhfach ist ein Päckchen.»
Sie öffnete mit einem kräftigen Fingerdruck die Klappe und ließ sie herunterfallen.
«Old Gold. Ich mag keine Old Gold.»
«Du magst mein Auto nicht. Du magst meine Zigaretten nicht. Was magst du eigentlich?»
«Wen interessiert das schon.»
Ich schielte zu ihr rüber. Ihr Mund schien sich permanent zu einem Fletschen verziehen zu wollen, und dieser Eindruck wurde durch die kräftigen weißen Zähne noch verstärkt. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwer sie anfassen konnte, ohne dabei einen Finger zu verlieren. Sie seufzte, verschränkte die Hände und schob sie zwischen die Knie.
«Erzählen Sie mir Ihre Geschichte, Señor Hausner.»
«Ich habe keine.»
Sie zuckte die Achseln. «Aber bis Santiago sind es noch über tausend Kilometer.»
«Lies doch ein Buch.» Ich wusste, dass sie eins mithatte.
«Gute Idee.» Sie öffnete ihre Handtasche, nahm eine Brille und ein Buch heraus und fing an zu lesen.
Nach einer Weile gelang es mir, einen Blick auf den Titel zu werfen. Sie las Wie der Stahl gehärtet wurde von Nikolai Ostrowski. Ich konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen.
«Was ist denn so lustig?»
Ich deutete mit einem Nicken auf das Buch auf ihrem Schoß. «Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut.»
«Das Buch handelt von jemandem, der an der Oktoberrevolution teilnimmt.»
«Dachte ich mir schon.»
«Und woran glauben Sie?»
«An nichts, eigentlich.»
«Damit ist niemandem geholfen.»
«Als ob das eine Rolle spielt.»
«Etwa nicht?»
«Meiner Meinung nach gewinnt die Partei der Ungläubigen regelmäßig die Wahl gegen die Partei der Bruderliebe. Das Volk und das Proletariat brauchen keine Hilfe. Jedenfalls nicht deine oder meine.»
«Das sehe ich anders.»
«Oh, das kann ich mir vorstellen. Aber ist doch komisch, findest du nicht? Dass wir beide nach Haiti abhauen. Du, weil du an etwas glaubst, und ich, weil ich an gar nichts glaube.»
«Sie glauben also an gar nichts. Marx und Engels hatten recht. Die Bourgeoisie produziert ihre eigenen Totengräber.»
Ich lachte.
«Eines haben wir jedenfalls geklärt», sagte sie. «Sie sind also tatsächlich auf der Flucht.»
«Ja. Ich kenne es nicht anders. Falls dich das wirklich interessiert, es ist die alte, immer gleiche Geschichte. Der Fliegende Holländer. Der Ewige Jude. Ich bin ziemlich viel rumgekommen. Ich dachte, hier auf Kuba wäre ich sicher.»
«Auf Kuba ist keiner sicher», sagte sie. «Nicht mehr.»
«Ich war aber sicher», sagte ich, ohne auf sie einzugehen. «Bis ich versucht habe, den Helden zu spielen. Dabei hatte ich eines vergessen: Ich hab nicht das Zeug zum Helden. Hatte ich noch nie. Außerdem will die Welt keine Helden mehr. Die sind aus der Mode gekommen, wie die Rocklänge von letztem Jahr. Jetzt sind Freiheitskämpfer und Informanten gefragt. Tja, für das eine bin ich zu alt, und für das andere hab ich zu viel Skrupel.»
«Was ist denn passiert?»
«Ein unausstehlicher Leutnant vom militärischen Geheimdienst wollte aus mir einen Spitzel machen, aber ich habe von der Idee nichts gehalten.»
«Dann tun Sie das Richtige», sagte Melba. «Es ist keine Schande, kein Polizeispitzel sein zu wollen.»
«Das klingt ja fast so, als würde ich etwas Ehrenhaftes tun. So ist es nicht.»
«Wie dann?»
«Ich will einfach nicht abhängig sein, von niemandem. Das kenne ich zur Genüge aus dem Krieg. Ich bin lieber mein eigener Herr. Aber das ist nicht alles. Spionage ist gefährlich. Und besonders gefährlich, wenn eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass man erwischt wird. Aber ich vermute mal, dass du das inzwischen selbst am besten weißt.»
«Was hat Marina Ihnen über mich erzählt?»
«Alles, was nötig war. Ich hab die Ohren auf Durchzug geschaltet, nachdem sie gesagt hatte, dass du einen Polizisten umgelegt hast. Mehr gibt es da nicht zu wissen. Jedenfalls nicht für mich.»
«Das klingt, als würden Sie es missbilligen.»
«Mit Polizisten ist es wie mit anderen Menschen auch», sagte ich. «Manche sind gut und manche schlecht. Ich war selbst mal so ein Polizist. Ist lange her.»
«Ich hab es für die Revolution getan», sagte sie.
«Ich hab auch nicht geglaubt, dass du es für eine Kokosnuss getan hättest.»
«Er war ein Schwein, und er hatte es verdient, und ich hab es für –»
«Ich weiß, du hast es für die Revolution getan.»
«Finden Sie nicht, dass Kuba die Revolution braucht?»
«Natürlich könnte die Lage besser sein. Aber jede Revolution verursacht erst eine Menge Rauch, und dann zerfällt sie zu Asche. Deine wird auch nicht besser sein als all die anderen davor. Das garantier ich dir.»
Melba schüttelte energisch ihren hübschen Kopf, aber ich war gerade in Fahrt gekommen: «Wenn nämlich irgendwo jemand von einer besseren Gesellschaft redet, kannst du drauf wetten, dass er vorhat, sie auf ein paar Stangen Dynamit zu erbauen.»
Danach schwieg sie und ich auch.
Rund dreihundert Kilometer östlich von Havanna legten wir eine Pause ein. Santa Clara war ein malerisches, beschauliches Städtchen. Den Park im Zentrum säumten etliche alte Wohnhäuser und Hotels. Melba machte einen Spaziergang, während ich mich auf die Terrasse des Hotel Central setzte und allein zu Mittag aß. Das war mir nur recht. Als sie zurückkam, fuhren wir weiter.
Am frühen Abend erreichten wir Camaguey. Spitzwinkelige Häuser mit großen Blumenkübeln davor prägten das Straßenbild. Parallel zum Highway rollte ein Güterzug in die entgegengesetzte Richtung. Er war mit Baumstämmen beladen, die in der waldreichen Umgebung geschlagen worden waren.
«Hier übernachten wir», erklärte ich.
«Wir sollten lieber weiterfahren.»
«Kannst du fahren?»
«Nein.»
«Ich auch nicht. Nicht mehr. Ich bin geschafft. Bis Santiago sind es noch dreihundert Kilometer, und wenn wir nicht bald anhalten, fahre ich uns beide noch direkt in die Leichenhalle.»
In der Nähe einer Brauerei – einer der wenigen auf der Insel – passierten wir einen Polizeiwagen, und erneut dachte ich darüber nach, was Melba getan hatte.
«Wenn du einen Polizisten erschossen hast, sind die bestimmt ganz scharf drauf, dich zu schnappen», sagte ich.
«Und wie. Sie haben die casa in die Luft gejagt, in der ich gearbeitet habe. Einige der Mädchen wurden schwer verletzt, manche sogar getötet.»
«Deshalb hat Doña Marina sich also bereit erklärt, dir aus Havanna rauszuhelfen.» Ich nickte. «Ja, das leuchtet mir ein. Wenn eine casa in die Luft fliegt, ist das schlecht für alle anderen. Wir sollten uns ein Zimmer teilen, das ist sicherer. Ich sage, dass du meine Frau bist. Dann musst du keinen Ausweis vorzeigen.»
«Hören Sie, Señor Hausner, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich mit nach Haiti nehmen. Aber eines sollten Sie wissen. Ich habe die Rolle der chica nur gespielt, um an Hauptmann Balart ranzukommen.»
«Gut, dass du das sagst.»
«Ich hab es für die –»
«Revolution getan. Ich weiß. Hör mal, Melba, du brauchst dir um deine Tugend, falls davon überhaupt noch was übrig ist, keine Sorgen zu machen. Ich hab dir doch gesagt, ich bin müde. Ich würde sogar in den Flammen eines brennenden Hauses einschlafen. Ein Sessel oder ein Sofa tut’s also, und du kannst das Bett haben.»
Sie nickte. «Danke, Señor.»
«Und hör endlich auf, mich Señor zu nennen. Ich heiße Carlos. Ich bin ab jetzt dein Mann, schon vergessen?»
Wir stiegen im Gran Hotel im Stadtzentrum ab und gingen auf unser Zimmer. Ich machte es mir sofort in meinem Nachtlager gemütlich, sofern das auf dem Fußboden möglich war. Der russische Boden im Sommer 1941 hatte das bequemste Bett abgegeben, in dem ich je geschlafen hatte, im Vergleich dazu war dieser hier unbequem. Andererseits war ich auch längst nicht so erschöpft, wie ich es damals war. Gegen zwei Uhr morgens wachte ich auf. Melba kniete neben mir, in ein Laken gewickelt.
«Was ist los?» Ich setzte mich auf und ächzte vor Schmerz.
«Ich hab Angst», sagte sie.
«Wovor denn?»
«Weißt du, was die mit mir anstellen, wenn sie mich schnappen?»
«Die Polizei?»
Sie nickte und begann zu frösteln.
«Und was soll ich da machen? Eine Gutenachtgeschichte erzählen? Hör zu, Melba. Morgen früh fahr ich dich nach Santiago, wir gehen auf mein Boot, und morgen Abend bist du in Haiti und in Sicherheit, okay? Aber jetzt würde ich gern weiterschlafen. Also, wenn es dir nichts ausmacht …»
«Macht mir aber was aus», sagte sie. «Im Bett ist es viel kuscheliger als hier auf dem Boden. Und es ist breit genug für zwei.»
Damit hatte sie zweifellos recht. Das Bett war etwa so groß wie ein großes Stück Weide für einen Ziegenbock allein. Apropos Bock: Wie sie meine Hand nahm und mich rüber zum Bett zog, das war schon ziemlich verlockend. Auf jeden Fall war es der Anblick, als sie das Laken auf den Boden gleiten ließ, was mich natürlich nicht störte, es war schließlich eine warme Nacht. Ich kann besonders gut denken, wenn ich so nackt bin, wie Melba es war. Ich versuchte, mich auf die Vorstellung zu konzentrieren, wie ich im Bett brav neben ihr schlief, aber es funktionierte nicht, weil sie mir vor Augen führte, was im Schaufenster angeboten wurde, und ich war kurz davor, mir die Nase an der Scheibe platt zu drücken, um genauer hinzusehen. Nicht, dass ich ernsthaft glaubte, sie sei scharf auf mich. Ich hab noch nie begriffen, warum eine Frau überhaupt einen Mann begehrt – wo Frauen doch so aussehen, wie sie aussehen. Aber Melba war jung und verängstigt und einsam, und sie wollte, dass jemand – vermutlich egal wer – sie in die Arme nahm und ihr das Gefühl gab, dass der Welt was an ihr lag. Ich kenn das. Man kommt allein auf die Welt, und man stirbt allein, und die übrige Zeit muss man sehen, wie man klarkommt.
Als wir am nächsten Tag Santiago erreichten, ruhte ihr Kopf schon seit guten hundertfünfzig Kilometern auf meiner Schulter, wie eine dunkle exotische Blume. Wir gingen miteinander um wie jedes junge Liebespaar, bei dem der Mann zufällig mehr als doppelt so alt ist wie die Frau, die zufällig noch dazu eine Mörderin ist. Vielleicht ist das ein bisschen unfair. Melba war schließlich nicht die Einzige, die jemanden erschossen hatte. Ich selbst hatte auch einige Erfahrung in dieser Hinsicht. Ziemlich viel Erfahrung sogar, aber das wollte ich lieber für mich behalten. Ich versuchte stattdessen, an das zu denken, was uns in Santiago erwartete. Manchmal macht uns die Zukunft Angst, aber die Vergangenheit ist noch schlimmer. Vor allem meine Vergangenheit. Der Gedanke an die Polizei von Santiago ließ mich jedoch vergessen, was ich erlebt hatte. Sie stand im Ruf, brutal zu sein, ein Ruf, der sicherlich nicht von ungefähr kam. Ich erinnerte mich an Doña Marinas Bemerkung, dass jede kubanische Revolution in Santiago beginnt. Dass die Leute hier davon abgesehen irgendetwas lostraten, war schwer vorstellbar. Jeglicher Beginn setzt schließlich eine gewisse Regsamkeit voraus, Bewegung, meinetwegen auch Arbeit, aber auf den verschlafenen Straßen der Stadt war von alldem nichts zu sehen. Leitern und Schubkarren standen verlassen herum, Pferde dösten vor sich hin, Boote lagen herrenlos im Hafen und Fischernetze zum Trocknen in der Sonne. Die einzigen Menschen, die aussahen, als würden sie arbeiten, waren Polizisten. Aber Arbeit konnte man das kaum nennen: Sie hockten in ihren Autos, die im Schatten der pastellfarbenen Häuser der Stadt parkten, rauchten Zigaretten und warteten darauf, dass die Dinge sich beruhigten oder in Gang kamen, je nach Sichtweise. Wahrscheinlich war es zu heiß und sonnig für irgendwelche Probleme. Der Himmel war zu blau, und das Meer war zu glatt, die Statuen zu weiß und die Schatten zu kurz. Selbst die Kokosnüsse trugen hier Sonnenbrillen.
Ich kurvte ein wenig in der Gegend herum und orientierte mich dann an der Bekohlungsanlage von Cincoreales, was mir half, meinen Weg durch das Wirrwarr aus Werften, Auslegern, Kais, Schwimmkränen, Trockendocks und Slipanlagen zu finden. Hier wurde die Bootsflotte der Bucht von Santiago gewartet. Ich steuerte den Wagen einen steilen kopfsteingepflasterten Hang hinunter und eine schmale Gasse entlang. Über unseren Köpfen thronten gewaltige Überleitungen für Straßenbahnen, die nicht mehr fuhren, wie die Takelage eines Schoners, der längst ohne sie abgesegelt war. Ich hielt auf dem Bürgersteig an und spähte durch offene Flügeltüren in eine Bootswerft hinein.
Ein bärtiger wettergegerbter Mann in kurzen Hosen und Sandalen manövrierte gerade ein Boot nach unten, das an einem rostigen Kran hing. Es flutschte wie ein Stück Seife ins Wasser, nachdem es gegen die Hafenmauer geknallt war. War ja nicht meins.
Wir stiegen aus. Ich holte Melbas Gepäck aus dem Kofferraum des Chevys und brachte es in die Werft, wobei ich mir meinen Weg zwischen Farbtöpfen, Eimern, Tauen und Schläuchen suchte, vorbei an Holzstücken, alten Reifen und Ölkannen. Das Büro in einer kleinen Holzhütte ganz hinten war nicht weniger heruntergekommen als der Rest der Werft. Mendy würde in absehbarer Zukunft wohl nicht als Hausmann des Monats ausgezeichnet werden, aber er verstand etwas von Booten, und das war gut so, weil ich so gut wie nichts davon verstand.
Vor langer, langer Zeit war Mendy einmal weiß gewesen. Nun war es nur noch sein Bart. Ein ganzes Leben auf und an der See hatte seinem Gesicht die Farbe und Textur eines abgenutzten Baseballhandschuhs verliehen. Er gehörte in eine Hängematte auf einem alten Piratenschiff mit Kurs auf Hispaniola, eine Pfeife in der einen Hand und eine Flasche Rum in der anderen. Mendy fuhr ungerührt mit seiner Arbeit fort und schien mich erst zu bemerken, als der Kran aus dem Weg war, und selbst dann sagte er bloß: «Señor Hausner.»
Ich nickte ihm zu. «Mendy.»
Er klaubte eine halbgerauchte Zigarre aus der Brusttasche seines dreckigen Hemdes, steckte sie in die schmale Öffnung zwischen Kinnbart und Schnäuzer und klopfte dann minutenlang seine Taschen nach einem Feuerzeug ab, während wir uns unterhielten.
«Mendy, das ist Señorita Otero. Sie kommt mit mir aufs Boot. Ich hab ihr erzählt, dass es bloß ein schäbiger Fischerkahn ist, aber ihr Koffer und sie scheinen zu glauben, dass wir mit der Queen Mary in See stechen.»
Mendys Augen blickten hastig von mir zu Melba und wieder zurück, als würde er einem Tischtennismatch zuschauen. Dann grinste er breit und sagte: «Aber die Señorita hat vollkommen recht, Señor Hausner. Die wichtigste Seefahrtsregel lautet, immer auf alles vorbereitet zu sein.»
«Danke», sagte Melba. «Genau mein Reden.»
Mendy sah mich an und schüttelte den Kopf. «Sie verstehen offenbar nicht viel von Frauen, Señor», sagte er.
«Ungefähr so viel wie von Booten», gab ich zu.
Mendy lachte. «Ich hoffe doch für Sie, dass es etwas mehr ist.»
Er führte uns aus der Werft hinaus zu einem L-förmigen Pier, an dem eine hölzerne Barkasse vertäut lag. Wir kletterten an Bord und setzten uns. Mendy warf den Motor an und steuerte uns in die Bucht. Fünf Minuten später machten wir längsseits an einem fünfunddreißig Fuß langen Sportfischerboot fest.
La Guajaba war schmal geschnitten, hatte aber ein breites Heck, eine Brücke und drei Kabinen. Sie verfügte über zwei Chrysler-Motoren, die jeder rund neunzig PS brachten, womit das Boot eine Höchstgeschwindigkeit von neun Knoten schaffte. Und das war auch schon so ziemlich alles, was ich über sie wusste, außer, wo ich den Brandy und die Gläser aufbewahrte. Ich hatte einen Amerikaner, dem die Bimini Bar in der Calle Obispo gehörte, bei einer Partie Backgammon geschlagen und das Boot gewonnen. Mit vollem Tank hatte La Guajaba eine Reichweite von knapp fünfhundert Seemeilen, und bis Port-au-Prince war es nur halb so weit. Ich hatte das Boot in drei Jahren nur dreimal benutzt und verfügte über ein beeindruckendes nautisches Unwissen. Immerhin wusste ich, wie man einen Kompass benutzte, und ich hatte mir vorgenommen, einfach den Bug Richtung Osten zu drehen und dann getreu dem Navigationsprinzip von Thor Heyerdahl so lange weiterzufahren, bis ich irgendwo gegenstieß. Ich war zuversichtlich, dass wir mit dieser Methode irgendwann auf Hispaniola stranden würden, schließlich war die Insel dreißigtausend Quadratmeilen groß.
Ich drückte Mendy ein Bündel Geldscheine und meine Autoschlüssel in die Hand und kletterte dann an Bord. Ich hatte überlegt, ob ich Omara erwähnen sollte und dass es besser für mich wäre, wenn er den Mund hielte, aber irgendwie kam mir das ziemlich sinnlos vor. Wahrscheinlich hätte ich so nur die brutale Offenheit heraufbeschworen, die man den Kubanern zu Recht nachsagt, und ganz sicher hätte er gesagt, ich wäre bloß noch so ein Gringo mit zu viel Geld, des Bootes nicht würdig, das mir gehörte, und ich hätte ihm schlecht widersprechen können: Wer sich für ein Stück Zucker ausgibt, den fressen die Ameisen.
Sobald wir in See gestochen waren, ging Melba nach unten und erschien in einem zweiteiligen Badeanzug mit Leopardenmuster wieder an Deck. In diesem Aufzug hätten ihr sogar die Fische hinterhergepfiffen, wenn sie sie gesehen hätten. Das ist das Schöne an Booten und warmem Wetter. Sie holen das Beste aus den Menschen heraus. Auf der Spitze einer sechzig Meter hohen Landzunge erhob sich die Festung El Morro. Eine lange, bröckelige, in den Felsen geschlagene Treppe führte vom Wasser hinauf. Die Hafeneinfahrt am Fuße der Festung war fast ebenso breit: sechzig Meter offene See, auf die ich bloß zuhalten musste, und trotzdem hätte ich uns um Haaresbreite in die Felsen manövriert. Solange ich Melba anstarrte, standen unsere Chancen schlecht, Haiti heil zu erreichen.
«Ich wünschte, du würdest dir was überziehen», sagte ich.
«Gefällt dir mein Bikini nicht?»
«Er gefällt mir sehr. Aber Kolumbus hatte gute Gründe dafür, dass er an Bord der Santa Maria keine Frauen haben wollte. Wenn sie einen Bikini tragen, stören sie den Kurs des Schiffes. Mit dir an Bord hätte er wahrscheinlich Tasmanien entdeckt.»
Sie zündete sich eine Zigarette an und beachtete mich gar nicht, und ich tat mein Bestes, sie nicht zu beachten. Ich überprüfte den Drehzahlmesser, den Ölstand, das Amperemeter und die Motortemperatur. Dann spähte ich aus dem Fenster des Ruderhauses. Vor uns lag Smith Key, eine kleine Insel, die einst in britischer Hand war. Viele der Fischer und Lotsen in Santiago stammten von dort, und mit den rotgedeckten Häusern und der kleinen Kapellenruine sah es dort sehr malerisch aus. Aber das war nichts im Vergleich zu dem Anblick von Melbas Bikinihöschen.
Die See war ruhig, bis wir die Hafenausfahrt erreichten, wo die Dünung stärker wurde. Ich schob den Gashebel nach vorn und hielt das Boot auf einem geraden Ostsüdostkurs, bis Santiago nicht mehr zu sehen war. Hinter uns pflügte das Boot eine große weiße Narbe in den Ozean, Hunderte Meter lang. Melba saß in dem Anglersessel und quietschte vor Begeisterung, als das Boot schneller wurde.
«Ist das zu fassen?», sagte Melba. «Ich lebe auf einer Insel und bin das erste Mal auf einem Boot.»
«Ich bin froh, wenn wir wieder festen Boden unter den Füßen haben», sagte ich und nahm eine Flasche Rum aus der Kartenschublade.
Drei bis vier Stunden später wurde es dunkel, und ich konnte auf unserer Backbordseite die Lichter der US-Navy-Basis Guantánamo glitzern sehen, wie die Sterne einer nahen Galaxie, Tausende von Jahren alt. Aber zugleich kam mir der Anblick vor wie eine Zukunftsvision, in der die amerikanische Demokratie die Welt regierte, in einer Hand einen Colt und in der anderen einen Streifen Kaugummi. Irgendwo in dieser tropischen Dunkelheit waren Tausende Yankees in weißen Uniformen mit den sinnlosen Routineabläufen des kolonialen Seefahrerdienstes beschäftigt. Neue Feinde und der Hunger nach neuen Siegen ließen sie in ihren schwimmenden stahlgrauen Städten des Todes hocken, wo sie Coca-Cola tranken, ihre Lucky Strikes rauchten und sich bereitmachten, den Rest der Welt von dem unsinnigen Bedürfnis zu befreien, anders sein zu wollen als sie selbst. Denn jetzt waren nicht mehr die Deutschen, sondern die Amerikaner die Herrenrasse, und statt Hitler und Stalin war nun Uncle Sam das Gesicht eines neuen Weltreiches.
Melba sah, wie sich mein Mund verzog, und schien meine Gedanken zu lesen. «Ich hasse sie», sagte sie.
«Wen? Die yanquis?»
«Wen sonst? Unsere lieben Nachbarn haben schon immer versucht, aus Kuba einen ihrer Vereinigten Staaten zu machen. Und ohne sie wäre Batista niemals an der Macht geblieben.»
Ich wollte mich nicht auf eine Diskussion einlassen. Weil wir die Nacht gemeinsam verbracht hatten und vor allem, weil ich vorhatte, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört hatten, sobald wir ein nettes Hotel gefunden hatten. Ich hatte gehört, das Le Refuge in Kenscoff, zehn Kilometer außerhalb von Port-au-Prince, wäre da genau das Richtige. Der Ferienort liegt tausendvierhundert Meter über dem Meeresspiegel und hat das ganze Jahr hindurch ein angenehmes Klima. Ungefähr so lange hatte ich auch vor dortzubleiben. Natürlich hatte auch Haiti seine Probleme, genau wie Kuba, aber das waren nicht meine Probleme. Also was kümmerten sie mich? Ich hatte andere Sorgen, zum Beispiel, dass mein argentinischer Pass bald ablief. Und jetzt stand ich vor der Herausforderung, ein kleines Boot sicher gegen den Wind zu steuern. Vielleicht hätte ich keinen Alkohol trinken sollen, jedenfalls fand ich es selbst mit den Fahrlichtern der La Guajaba nervenaufreibend, einen Kahn in der Dunkelheit über die offene See zu lenken. Mir war klar, dass wir jederzeit mit irgendwas kollidieren könnten – einem Riff oder einem Wal –, und ich wusste, ich würde mich erst wieder entspannen können, wenn es hell wurde. Bis dahin, so hoffte ich, würde die halbe Strecke bis Hispaniola schon hinter uns liegen.
Doch plötzlich sah ich etwas, das mir viel mehr Kopfzerbrechen bereitete. Ein anderes Schiff näherte sich rasch von Norden her. Für ein Fischerboot war es zu schnell, und die großen, hellen Suchscheinwerfer, die die Dunkelheit zerrissen, ließen keinen Zweifel daran, dass ein Patrouillenboot der US Navy auf uns zusteuerte.
«Was ist das für ein Schiff?», fragte Melba.
«Sieht nach der amerikanischen Marine aus.»
Selbst über die beiden Chrysler-Motoren hinweg hörte ich Melba schlucken. Sie sah noch immer schön aus, aber auch sehr ängstlich. Sie fuhr herum und starrte mich aus weit aufgerissenen braunen Augen an.
«Scheiße, was machen wir denn jetzt?»
«Nichts», sagte ich. «Das Boot da ist vermutlich sehr viel schneller als unseres, und die Leute darauf sind ganz sicher sehr viel besser bewaffnet als wir. Am besten, du gehst nach unten, legst dich ins Bett und bleibst da. Ich regele das schon.»
Sie schüttelte den Kopf. «Ich lass mich nicht verhaften», sagte sie. «Die übergeben mich der Polizei, und –»
«Niemand wird dich verhaften», sagte ich und berührte ihre Wange, um sie zu beruhigen. «Ich schätze, die wollen uns nur kontrollieren. Also, tu, was ich sage, und uns passiert nichts.»
Ich nahm Gas weg, legte den Leerlauf ein und trat aus dem Ruderhaus. Als mir der grelle Scheinwerfer direkt ins Gesicht leuchtete und das Patrouillenboot mich immer wieder mit einigem Abstand umkreiste, kam ich mir vor wie King Kong auf dem Wolkenkratzer. Ich ging zum sanft schaukelnden Heck, trank noch was und wartete so gelassen wie möglich darauf, dass sie sich die Ehre gaben.
Nach etwa einer Minute kam ein Offizier in weißer Uniform mit einem Megaphon in der Hand an die Steuerbordseite des Kanonenbootes.
«Wir suchen nach ein paar Matrosen», sagte er auf Spanisch zu mir. «Sie haben im Hafen vom Caimanera ein Boot gestohlen. Ein Boot wie dieses.»
Ich warf die Hände in die Luft und schüttelte den Kopf. «Hier sind keine amerikanischen Matrosen.»
«Dann haben Sie sicher nichts dagegen, wenn wir an Bord kommen und uns ein wenig umsehen?»
Obwohl ich sehr viel dagegen hatte, versicherte ich dem amerikanischen Offizier, dass ich überhaupt nichts dagegen hatte. Widerspruch wäre ohnehin zwecklos gewesen. Auf dem Vordeck des amerikanischen Bootes stand ein Matrose an einem Maschinengewehr Kaliber .50, ein gutes Argument, den Mund zu halten. Also warf ich ihnen ein Tau zu, hängte ein paar Fender raus und ließ sie längsseits an der La Guajaba festmachen. Der Offizier kam mit einem seiner Unteroffiziere an Bord. Über keinen von beiden ließ sich viel mehr sagen, als dass sie schwarze Schuhe trugen und aussahen, wie alle Männer aussehen, wenn man sie eines Großteils ihrer Haare und der Fähigkeit beraubt, eigenständig zu denken. Sie trugen Seitenwaffen und Taschenlampen und rochen schwach nach Pfefferminz und Tabak, als hätten sie sich gerade eben ihrer Kaugummis und Zigaretten entledigt.
«Sonst noch jemand an Bord?»
«Eine Freundin ist in der vorderen Kabine», sagte ich. «Sie schläft. Allein. Der letzte amerikanische Seemann, den wir gesehen haben, war Popeye.»
Der Offizier lächelte gequält und wippte ein wenig auf den Fußballen. «Haben Sie was dagegen, wenn wir uns selbst ein Bild machen?»
«Ganz und gar nicht. Aber lassen Sie mich erst nachschauen, ob die Dame bekleidet genug ist, um Besucher zu empfangen.»
Er nickte, und ich ging nach vorne und unter Deck. Die Kajüte roch nach Feuchtigkeit. Es gab ein Klosett, eine kleine Kabine und eine Doppelkoje, in der Melba lag, die Decke bis zum Hals hochgezogen. Darunter trug sie immer noch ihren Bikini, und ich war fest entschlossen, ihr dabei zu helfen, ihn auszuziehen, sobald die Amis weg waren und wir den Anker werfen konnten. Nichts hat eine anregendere Wirkung als Seeluft.
«Was ist los?», fragte sie ängstlich. «Was wollen die?»
«Ein paar amerikanische Matrosen haben in Caimanera ein Boot geklaut», erklärte ich. «Die suchen nach ihnen. Ich glaube nicht, dass wir uns ernsthaft Sorgen machen müssen.»
Sie verdrehte die Augen. «Caimanera. Ja, ich kann mir vorstellen, was sie da gemacht haben, die Schweine. So ziemlich jedes Hotel in Caimanera ist ein Bordell. Die casas haben sogar patriotische amerikanische Namen, wie Roosevelt Hotel. Diese Drecksäue.»
Ich hätte mich vielleicht fragen sollen, woher sie das so genau wusste, aber in diesem Moment schien es mir wichtiger, die Amerikaner schnellstmöglich wieder loszuwerden, statt mich damit zu beschäftigen, wie sie ihre sexuellen Gelüste befriedigten. «Eisenhower nennt das den Dominoeffekt. Es gibt Typen, die brauchen ein Mordstamtam, wenn sie jemand flachlegen wollen.» Ich deutete mit dem Daumen nach hinten zur Kajütentür. «Die sind da draußen. Die wollen bloß nachsehen, ob ihre Männer sich nicht unter der Koje versteckt haben oder so. Ich hab gesagt, sie können reinkommen, sobald ich mich vergewissert habe, dass du salonfähig bist.»
«Das scheint mir kaum der Fall zu sein.» Sie zuckte die Schultern. «Lass sie trotzdem reinkommen.»
Ich ging zurück an Deck und bedeutete den Männern mit einem auffordernden Nicken, hinunterzusteigen.
Sie schlurften durch die Kajütentür und liefen vor Verlegenheit rosa an, als sie Melba im Bett sahen, und wenn ich sie dabei nicht amüsiert beobachtet hätte, dann wäre mir vielleicht entgangen, dass der Unteroffizier sie kurz anstarrte und gleich darauf noch einmal fixierte, aber diesmal nicht aus dem Grund, dass er sich ein Foto von ihr neben seiner Hängematte wünschte. Die beiden waren sich schon mal begegnet. Da war ich mir sicher, und er war sich auch sicher, und als die Amis zurück ins Ruderhaus gingen, zog der Unteroffizier seinen Vorgesetzten beiseite und flüsterte ihm etwas zu.
Als ihr Gespräch hitziger wurde, überlegte ich, ob ich mich einmischen sollte, doch dann öffnete der Offizier die Knöpfe am Holster seiner Seitenwaffe, was mich veranlasste, ans Heck zu gehen und mich in den Anglersessel zu setzen. Ich glaube, ich lächelte sogar dem Mann an dem 50-Kaliber-Teil zu, aber plötzlich fand ich, dass der Anglersessel wie ein elektrischer Stuhl aussah und sich auch so anfühlte, deshalb stand ich wieder auf und setzte mich auf die Eiskiste, die zweitausend Pfund Eis fasste. Cool bleiben. Wenn Fische oder Eis in der Kiste gewesen wären, wäre ich liebend gern reingekrochen. Stattdessen nahm ich betont gelassen noch einen Schluck aus der Flasche, denn ich wollte mir nicht anmerken lassen, dass meine Nerven bis zum zerreißen gespannt waren. Aber es war nichts zu machen. Die Amis hatten mich bereits am Haken, und ich hätte am liebsten wie ein Fisch so lange wild gezappelt, bis ich ihn wieder los war.
Als der Offizier zurück zum Heck kam, glänzte in seiner Hand ein .45er Colt. Entsichert. Die Waffe war nicht auf mich gerichtet, noch nicht. Aber sie sollte verdeutlichen, dass es keinen Raum für Verhandlungen geben würde.
«Sir, ich fürchte, ich muss Sie beide leider bitten, mich zurück nach Guantánamo zu begleiten», sagte er höflich, fast so, als hätte er keine Schusswaffe in der Hand. Wie ein echter Amerikaner eben.
Ich nickte bedächtig. «Darf ich fragen, warum?»
«Das werden Sie erfahren, wenn wir in Gitmo sind», entgegnete er.
«Wie Sie meinen, Sir.»
Er winkte zwei Matrosen heran und bedeutete ihnen, an Bord zu kommen, was mir nur recht war, denn die beiden platzierten sich zwischen mich und Maschinengewehr. Da hörten wir einen lauten Knall: ein Pistolenschuss, der aus der vorderen Kabine kam. Ich sprang auf und erkannte im selben Moment, dass das keine gute Idee war.
«Lasst ihn nicht aus den Augen», brüllte der Offizier und ging unter Deck, um nachzusehen, was los war, während ich zurückblieb – mit zwei Colts, die auf meinen Bauch gerichtet waren, und einem .50er Maschinengewehr, das auf mein Ohrläppchen zielte. Ich setzte mich wieder in den Anglersessel, der kreischte wie eine Kettensäge, als ich mich darin zurücklehnte, um in die Sterne zu blicken. Man musste nicht Madame Blavatsky sein, um zu erkennen, dass sie nicht gut standen. Nicht für Melba. Und für mich wahrscheinlich auch nicht.
Wie sich herausstellte, verhießen die Sterne auch für den amerikanischen Unteroffizier nichts Gutes. Als er an Deck getaumelt kam, glich er dem Karoass oder vielleicht auch dem Herzass: Genau in der Mitte seines weißen Hemds prangte ein kleiner roter Fleck, der vor unseren Augen größer zu werden begann. Einen Moment lang schwankte er benommen, dann fiel er plump auf den Hintern. Eigentlich sah er genauso aus, wie ich mich gerade fühlte.
«Ich bin angeschossen», sagte er überflüssigerweise.
Kapitel 2KUBA1954
Etliche Stunden später. Der angeschossene Unteroffizier war ins Krankenhaus von Guantánamo gebracht worden, Melba lief sich ihre Stilettos in einer Gefängniszelle ab, und ich hatte meine Version der Geschichte erzählt, zweimal. Ich hatte Kopfschmerzen, aber das war mein geringstes Problem. Wir saßen zu viert in einem feuchten, stickigen Büro im Quartier der US-Navy-Polizei. Polizisten in Matrosenanzügen. Die drei, die sich angehört hatten, was ich zu sagen hatte, schienen meine Geschichte auch beim zweiten Mal nicht besonders glaubwürdig zu finden. Sie rutschten mit ihren fetten Hinterteilen auf überforderten Stühlen herum, zupften gelangweilt winzige Fädchen und Fusseln von den makellosen weißen Uniformen und glotzten auf die Spitzen ihrer glänzenden schwarzen Schuhe, in denen sich ihre Gesichter spiegelten. Es war wie ein Verhör durch ein Gewerkschaftsgremium der Krankenpfleger.
Es war still im Raum, bis auf das Summen der Neonleuchten an der Decke und das Klackern einer Schreibmaschine von der Größe der USS Missouri. Jedes Mal, wenn ich eine Frage beantwortete und der Navy-Bulle in die riesigen Tasten haute, hörte es sich an, als würden irgendwem die Haare mit einer sehr großen und sehr scharfen Schere geschnitten. Vermutlich mir.
Durch ein kleines vergittertes Fenster sah ich, dass draußen ein neuer Tag anbrach. Die Morgenröte legte sich wie eine Blutspur über den blauen Horizont. Das verhieß nichts Gutes. Die Amis, so viel stand mittlerweile fest, hegten den nicht unberechtigten Verdacht, ich stünde in einem sehr viel engeren Verhältnis zu Melba Marrero und ihren Verbrechen – Plural –, als ich zugab. Ihre Annahme wurde offenkundig von der Tatsache untermauert, dass ich selbst kein Amerikaner war und noch dazu eine starke Rum-Fahne hatte.
Der hellblaue Resopaltisch, auf dem Zigaretten zahllose kaffeebraune Brandflecken hinterlassen hatten, war mit Akten übersät. Dazwischen lagen zwei Schusswaffen mit kleinen Schildchen am Abzugbügel, als würden sie zum Verkauf angeboten. Eine davon war die kleine Beretta-Taschenpistole, mit der Melba auf den Unteroffizier geschossen hatte; die andere war eine Colt-Automatikpistole, die man ihm einige Monate zuvor gestohlen hatte und mit der Hauptmann Balart vor dem Hotel Ambos Mundos in Havanna erschossen worden war. Neben den Akten und Pistolen lag mein blau-goldener argentinischer Pass, und von Zeit zu Zeit nahm Captain Mackay, der Navy-Bulle, der die Vernehmung leitete, ihn zur Hand und blätterte erstaunt darin herum, als wäre es für ihn schier unfassbar, dass jemand durchs Leben gehen konnte, ohne ein Bürger der USA zu sein. Schwer zu sagen, was an Captain Mackay unerträglicher war: seine Fragen oder sein Mundgeruch. Jedes Mal, wenn sich sein rundes, bebrilltes Gesicht dem meinen näherte, nahmen mir die säuerlichen Ausdünstungen seiner Zahnfäule den Atem, und nach einer Weile fühlte ich mich, als steckte ich zerkaut, aber nur halb verdaut tief in seinen Yankee-Därmen.
Mackay sagte mit unverhohlener Verachtung: «Was Sie uns da erzählen, dass Sie sie erst vor zwei Tagen kennengelernt haben, das ergibt doch keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Sie sagen, sie wäre eine chica, mit der Sie sich eingelassen haben. Dass Sie sie gebeten haben, Sie auf einem mehrwöchigen Bootsausflug zu begleiten. Dass das auch den hohen Geldbetrag erklärt, den Sie bei sich hatten.»
«Das ist richtig.»
«Und dennoch behaupten Sie, praktisch nichts über die Frau zu wissen.»
«In meinem Alter ist es besser, nicht zu viele Fragen zu stellen, wenn eine hübsche junge Frau bereit ist, mit einem wegzufahren.»
Mackay lächelte dünn. Er war um die dreißig, zu jung, um das Interesse eines älteren Mannes an jungen Frauen nachvollziehen zu können. An seinem Wurstfinger trug er einen Ehering, und ich stellte mir irgendein patentes Mädchen mit Dauerwelle und einer Rührschüssel unter dem molligen Arm vor, die zu Hause, in einem Stabilbaukastenhäuschen auf einer trübseligen Navy-Basis, auf ihn wartete.
«Soll ich Ihnen sagen, wie ich die Sache sehe? Ich glaube, Sie waren auf dem Weg in die Dominikanische Republik, um Waffen für die Rebellen zu kaufen. Das Boot, das Geld, das Mädchen, das passt alles.»
«Da reimen Sie sich was zusammen, Captain. Ich bin ein geachteter Geschäftsmann. Ich bin recht wohlhabend und habe eine schöne Wohnung in Havanna. Ich arbeite in einem Hotelkasino. Ich bin wohl kaum der Typ, der die Kommunisten unterstützt. Und die Frau? Sie ist bloß eine chica.»
«Mag sein. Aber sie hat einen kubanischen Polizisten ermordet. Und um ein Haar einen meiner Männer.»
«Und wennschon. Haben Sie vielleicht gesehen, dass ich auf irgendwen geschossen habe? Ich bin nicht mal laut geworden. In meiner Branche sind Mädchen, Mädchen wie Melba, bloß ein netter Zeitvertreib, so etwas wie eine Zusatzprämie. Was die so in ihrer Freizeit treiben, ist –», ich überlegte einen Moment, suchte nach der besten Formulierung, «wohl kaum meine Angelegenheit.»
«Oh doch, wenn sie auf Ihrem Boot auf einen Amerikaner schießt.»
«Aber ich wusste ja nicht mal, dass sie eine Waffe dabeihatte. Hätte ich es gewusst, hätte ich die Pistole sofort über Bord geworfen. Und das Mädchen gleich mit. Und wenn ich auch nur geahnt hätte, dass sie unter dem Verdacht steht, einen Polizisten ermordet zu haben, hätte ich Señorita Marrero nie und nimmer eingeladen, mich zu begleiten.»
«Ich will Ihnen mal was über Ihre kleine Freundin verraten, Mister Hausner.» Mackay musste aufstoßen, was er längst nicht so erfolgreich unterdrückte, wie mir lieb gewesen wäre. Er nahm seine Brille ab und hauchte die Gläser an, die erstaunlicherweise nicht zersprangen. «Ihr richtiger Name ist Maria Antonia Tapanes, und sie war eine Prostituierte in einer casa in Caimanera, wo sich ihr die Gelegenheit bot, eine Pistole zu entwenden, die Officer Marcus gehörte. Daher erkannte er sie wieder, als er sie auf Ihrem Boot sah. Wir haben Grund zu der Annahme, dass sie von den Rebellen darauf angesetzt wurde, Hauptmann Balart zu ermorden. Das heißt, eigentlich sind wir uns dessen sicher.»
«Es fällt mir sehr schwer, das zu glauben. Mir gegenüber hat sie Politik nie erwähnt. Sie schien eher daran interessiert, sich zu amüsieren, als eine Revolution anzuzetteln.»
Der Captain schlug eine der Akten vor ihm auf und schob sie mir hin.
«Es ist so gut wie erwiesen, dass Ihre Gespielin schon seit geraumer Zeit als Kommunistin und Rebellin aktiv ist. Wie Sie in den Unterlagen sehen, hat Maria Antonia Tapanes wegen ihrer Beteiligung am Ostersonntagkomplott vom April 1953 drei Monate im Frauengefängnis von Guanajay gesessen. Im Juli letzten Jahres wurde ihr Bruder Juan Tapanes bei dem von Fidel Castro geführten Angriff auf die Moncada-Kaserne getötet. Getötet oder exekutiert, das wissen wir nicht genau. Als Maria aus dem Gefängnis kam und vom Tod ihres Bruders erfuhr, ging sie nach Caimanera und arbeitete dort als chica, um sich eine Waffe zu beschaffen. Das kommt häufig vor. Um ehrlich zu sein, viele unserer Männer tauschen ihre Waffen gegen Sex ein und melden sie anschließend einfach als gestohlen. Wie dem auch sei, besagte Waffe wurde benutzt, um Hauptmann Balart zu töten. Es gab auch Zeugen, die aussagten, eine Frau, auf die die Beschreibung von Maria Tapanes passt, habe ihm ins Gesicht geschossen. Und dann in den Hinterkopf, als er schon auf dem Boden lag. Vielleicht hatte er es verdient. Wer weiß? Wen interessiert’s? Eines weiß ich allerdings genau: Officer Marcus hat verdammtes Glück, dass er noch lebt. Wenn sie den Colt statt der kleinen Beretta benutzt hätte, wäre er jetzt genauso mausetot wie Hauptmann Balart.»
«Wird er wieder gesund?»
«Er kommt durch.»
«Was geschieht mit ihr?»
«Wir werden sie der Polizei in Havanna übergeben müssen.»
«Wahrscheinlich hatte sie genau davor höllische Angst und hat deshalb auf den Officer geschossen. Sie muss in Panik geraten sein. Ihnen ist doch wohl klar, was die mit ihr machen werden, oder?»
«Das soll nicht meine Sorge sein.»
«Vielleicht ja doch. Vielleicht ist genau das euer Problem hier in Kuba. Vielleicht solltet ihr Amerikaner ein bisschen mehr darauf achten, was für Leute dieses Land regieren –»
«Vielleicht sollten Sie sich ein bisschen mehr Sorgen darüber machen, was aus Ihnen wird.»
Der andere Offizier hatte sich eingeschaltet. Keine Ahnung, wie er hieß. Ich wusste bloß, dass ihm jedes Mal, wenn er sich kratzte, Schuppen vom Hinterkopf rieselten. Er hatte jede Menge Schuppen, überall. Selbst an seinen Wimpern hingen winzige Hautflöckchen.
«Gehen Sie einfach mal davon aus, dass ich das nicht tue», sagte ich. «Nicht mehr.»
«Wie bitte?» Der Schuppen-Mann hörte auf, sich am Kopf zu kratzen, und inspizierte seine Fingernägel, ehe er mich mit einem finsteren Blick taxierte.
«Wir kauen das jetzt schon die ganze Nacht durch», sagte ich. «Sie stellen mir die immer gleichen Fragen, und ich gebe Ihnen die immer gleichen Antworten. Ich hab Ihnen meine Geschichte erzählt. Aber Sie glauben mir nicht. In Ordnung. Ich verstehe Sie ja. Sie finden sie langweilig. Ich finde sie auch langweilig. Wir finden sie alle langweilig, aber ich werde Ihnen trotzdem keine andere Geschichte erzählen. Wozu auch? Wenn ich eine hätte, die plausibler klingt als die erste, hätte ich sie ja wohl gleich von Anfang an erzählt. Und da ich meine Meinung nicht ändern werde, können Sie davon ausgehen, dass es mir mittlerweile egal ist, ob Sie mir glauben oder nicht, weil ich ja ohnehin nichts tun kann, um Sie zu überzeugen. Sie haben sich Ihre Meinung doch längst gebildet. So ist das mit Bullen. Ich weiß das, weil ich selbst mal einer war. Ehrlich, es kümmert mich einen Dreck, was aus mir wird, Gentlemen.»
Der Bulle mit den Schuppen fing wieder an zu kratzen, wodurch es im Raum aussah wie in einer Schneekugel. Er sagte: «Für jemand, der nicht viel sagt, reden Sie ziemlich viel, Mister.»
«Stimmt, aber auf die Tour krieg ich wenigstens keinen Schlagring ins Gesicht.»
«Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht sicher», sagte Captain Mackay. «Gar nicht sicher.»
«Ich weiß, das wäre ohnehin egal; so hübsch bin ich nicht mehr. Aber das sollte es Ihnen umso leichter machen, mir zu glauben. Sie haben das Mädchen gesehen. Sie war der feuchte Traum jedes Seemanns. Ich war dankbar. Wie sagt man noch gleich? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und wo wir schon dabei sind, Sie sollten das auch nicht tun, Captain. Sie haben nichts gegen mich in der Hand, aber jede Menge gegen sie. Sie wissen, dass sie Ihren Unteroffizier angeschossen hat. Das ist eine Tatsache. Kompliziert wird die Sache nur, wenn Sie versuchen, mir eine Beteiligung an irgendeiner Rebellenverschwörung anzuhängen. Ich? Ich hab mich auf einen netten Urlaub mit reichlich Sex gefreut. Ich hatte viel Geld dabei, weil ich mir ein größeres Boot zulegen wollte, und das ist ja wohl nicht verboten. Wie ich bereits sagte, hab ich einen guten Job. Im Hotel Nacional. Ich hab eine nette Wohnung am Malecón in Havanna. Ich fahre einen ziemlich neuen Chevy. Warum sollte ich das alles für Karl Marx und Fidel Castro aufgeben? Sie sagen, Melba oder Maria, oder wie immer sie heißt, ist Kommunistin. Das wusste ich nicht. Vielleicht hätte ich sie fragen sollen, aber im Bett red ich nun mal lieber über versaute Sachen als über Politik. Wenn sie gern rumläuft und auf Polizisten und Navy-Soldaten schießt, dann gehört sie ins Gefängnis, finde ich.»
«Nicht sehr ritterlich von Ihnen», sagte Captain Mackay.
«Was meinen Sie mit ritterlich?»
«Galant.» Der Captain machte eine ausladende Geste. «Gentlemanlike.»
«Ach ja, cortés. Caballeroso. Ja, ich verstehe. Was erwarten Sie denn von mir? Dass ich sage, dass sie nur versucht hat, mich zu schützen? Seien Sie nett zu ihr, Captain, sie ist doch noch so jung? Das Mädchen hatte eine schwere Kindheit? Na schön. Falls es irgendwas nützt, ich glaube tatsächlich, dass die Kleine Angst hatte. Wie ich schon sagte, Sie können sich ja vorstellen, was mit ihr passiert, wenn Sie sie der hiesigen Polizei übergeben. Mit ein bisschen Glück darf sie ihre Klamotten anbehalten, wenn die sie durch die Zellen schleifen. Und vielleicht schlagen sie sie auch nur jeden zweiten Tag mit einem Ochsenziemer. Aber ich bezweifle das.»
«Das scheint Sie nicht sonderlich betroffen zu machen», sagte der Bulle mit den Schuppen.
«Ich werde sie ganz bestimmt in mein Abendgebet einschließen. Vielleicht bezahl ich ihr sogar einen Anwalt. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass Geld mehr nützt als Gebete. Der Herrgott und ich haben nicht mehr einen so guten Draht zueinander wie früher.»
Der Captain grinste.
«Ich mag Sie nicht, Hausner. Gut möglich, dass ich dem Herrgott sage, dass ich seine Abneigung gegen Sie teile, wenn ich das nächste Mal mit ihm spreche. Sie arbeiten im Hotel Nacional? Den verdammten Laden konnte ich noch nie leiden. Sie haben eine schöne Wohnung am Malecón? Ich hoffe, der nächste Hurrikan macht Kleinholz daraus, Sie argentinischer Schwanzlutscher. Es ist Ihnen egal, was aus Ihnen wird? Mir erst recht, Arschloch. Für mich sind Sie bloß irgendein pomadiger Südamerikaner, der das Maul aufreißt. Ihnen fällt keine bessere Geschichte ein? Dann sind Sie noch blöder, als Sie aussehen. Sie waren selbst mal Polizist? Interessiert mich nicht, Sie Drecksack. Ich will bloß eins von Ihnen wissen, nämlich wieso Sie einer Mörderin geholfen haben, von dieser miesen beschissenen Insel wegzukommen, die Sie Ihr Zuhause nennen. Hat irgendwer Sie um einen Gefallen gebeten? Falls ja, will ich den Namen wissen. Hat irgendwer den Kontakt hergestellt? Ich will den Scheißnamen wissen. Haben Sie sie irgendwo vom Bürgersteig aufgelesen? Dann will ich den Namen der verdammten Straße hören, Sie Arschgeige. Entweder Sie reden, oder Sie landen im Knast, Freundchen. Reden oder Knast. Wir haben heute Abend einen Angelausflug gemacht, und Sie sind uns ins Netz gegangen, Hausner. Und ich kann Sie in meine Kühlkammer stecken und den Schlüssel wegwerfen, bis ich sicher bin, dass in Ihrem verlogenen Leib kein Fitzelchen Information mehr steckt, das Sie nicht auf den Boden gekotzt haben. Die Wahrheit? Interessiert mich einen Scheißdreck. Sie wollen hier raus? Dann liefern Sie mir ein paar klare Fakten.»
Ich nickte. «Da hätte ich was. Pinguine leben fast ausschließlich auf der Südhalbkugel. Ist das klar genug?»
Ich kippelte mit dem Stuhl nach hinten, was mein erster Fehler war, und lächelte, was mein zweiter Fehler war. Der Captain war erstaunlich flink auf den Beinen. Eben hatte er mich noch angestarrt, als wäre ich eine Schlange in der Kinderwiege, und im nächsten Moment brüllte er herum, als hätte er sich einen Hammer auf den Daumen geknallt. Ehe ich mir das Lächeln vom Gesicht wischen konnte, erledigte er das für mich, trat den Stuhl unter mir weg und packte mich dann am Revers, um meinen Kopf hochzuziehen, nur um ihn gleich darauf wieder auf den Boden zu knallen.
Die anderen beiden packten je einen seiner Arme und versuchten so, ihn von mir wegzuzerren, aber seine Beine hatten immer noch genug Bewegungsfreiheit, um in mein Gesicht zu treten, als wollte er ein Feuer löschen. Es tat nicht besonders weh. Seine Rechte hatte die Größe eines Medizinballs, aber nachdem sie einmal auf meinem Kinn gelandet war, spürte ich kaum noch etwas. Mein Körper vibrierte wie ein Zitteraal, als ich dalag und darauf wartete, dass er aufhörte, damit ich ihm zeigen konnte, wer bei diesem Verhör in Wahrheit das Sagen hatte. Als sie ihn endlich wegschleiften, lag mir schon fast der nächste Witz auf der Zunge. Ich hätte ihn vielleicht auch vom Stapel gelassen, wäre da nicht das Blut gewesen, das mir aus der Nase strömte.
Als ich absolut sicher war, dass keiner mehr vorhatte, mich zu vermöbeln, stand ich vom Boden auf und sagte mir, dass ich alles daransetzen wollte, den nächsten Schlag auch wirklich verdient zu haben. Das wäre mir der Spaß wert.
«Polizist zu sein ist so ähnlich, wie wenn man die Zeitung durchblättert auf der Suche nach einem interessanten Artikel», sagte ich. «Wenn man ihn endlich gefunden hat, hat man sich schon die Finger schmutzig gemacht. Vor dem Krieg, dem letzten Krieg, war ich Polizist in Deutschland. Sogar ein ehrlicher Polizist, was euch Affen vermutlich nicht viel sagt. Zivilbulle. Kripo. Als wir in Polen und dann Russland einmarschierten, steckten sie uns in graue Uniformen. Nicht grün, nicht schwarz, nicht braun, grau. Feldgrau nannten sie das. Wenn man Grau trägt, kann man sich den ganzen Tag im Dreck wälzen und trotzdem noch adrett genug aussehen, um einem General zu salutieren. Darum das Grau. Ein anderer Grund, warum wir Grau trugen, war vielleicht der, dass wir darin tun konnten, was wir taten, und immer noch glauben, wir hätten moralische Richtlinien – sodass wir uns morgens noch im Spiegel ansehen konnten. Das war die Theorie. Ich weiß, schön blöd, nicht? Aber kein Nazi war je so blöd, dass er uns eine weiße Uniform verpasst hätte. Wissen Sie, warum? Weil man eine weiße Uniform schlecht sauber halten kann, hab ich nicht recht? Ich meine, ich bewundere Ihren Mut, Weiß zu tragen. Denn seien wir ehrlich, Gentlemen, auf Weiß sieht man alles. Besonders Blut. Und so, wie Sie sich hier aufführen, ist das ein großer Nachteil.»
Instinktiv schaute jeder an seiner makellos weißen Uniform herab, als wollte er nachsehen, ob sein Hosenschlitz zu war. Und im selben Moment fing ich eine Handvoll Blut aus der Nase auf und ließ es auf sie hinabregnen, wie Jackson Pollock auf eine weiße Leinwand. Man könnte sagen, dass ich meine Gefühle illustrieren, ihnen Ausdruck verleihen wollte und dass die primitive Technik, mein eigenes Blut durch die Luft zu schleudern, meine Methode war, ein Statement abzugeben. Jedenfalls schienen sie ganz genau zu verstehen, was ich sagen wollte. Und nachdem sie mich ordentlich zusammengeschlagen und mich in eine Zelle geworfen hatten, empfand ich eine gewisse Genugtuung darüber, wie modern ich doch war. Ich wusste nicht, ob ihre blutbespritzten weißen Uniformen Kunst waren oder nicht. Aber ich wusste, dass sie mir gefielen.
Kapitel 3KUBA UND NEW YORK1954
Die große Holzhütte, die in Guantánamo als Ausnüchterungszelle diente, stand am Strand, aber jedem, der sich nicht alle Sinne weggesoffen hatte, kam es vor, als befände sie sich irgendwo zwischen dem zweiten und dritten Höllenkreis. Heiß genug war sie auf jeden Fall.
Ich war nicht zum ersten Mal in Haft. Ich war in sowjetischer Kriegsgefangenschaft gewesen, kein schönes Erlebnis. Aber Guantánamo konnte da gut mithalten. Drei Dinge machten den Aufenthalt in der Ausnüchterungszelle schier unerträglich: die Moskitos, die Betrunkenen und die Tatsache, dass ich inzwischen zehn Jahre älter war. Zehn Jahre älter zu sein ist schon hart genug, die Moskitos waren äußerst unangenehm – die Navy-Basis war im Grunde ein einziger Sumpf –, am schlimmsten aber waren die Betrunkenen. Solange es einem gelingt, nach einer gewissen Routine zu leben, ist beinahe jede Haft erträglich. Aber die einzige Routine in Guantánamo ist das ständige Kommen und Gehen von lauten und besoffenen amerikanischen Matrosen. Die meisten von ihnen kamen nur mit ihrer Unterwäsche bekleidet in die Zelle. Manche waren gewalttätig, manche wollten Freundschaft mit mir schließen, manche wollten mich durch die Zelle prügeln, manche wollten singen, manche weinen, manche die Wände mit dem Schädel einrennen, und fast alle waren inkontinent oder kotzten, und manchmal kotzten sie mich voll.
Anfangs dachte ich noch, dass sie mich nur vorübergehend in diese Zelle eingesperrt hatten, weil gerade kein anderer geeigneter Raum frei war, aber nach zwei Wochen wurde mir allmählich klar, dass es einen anderen Grund dafür geben musste. Ich fragte die Wachen mehrmals, aufgrund welcher Rechtslage ich festgehalten wurde, aber es war nichts zu machen. Sie behandelten mich wie jeden anderen Gefangenen auch, auch wenn ich im Gegensatz zu den anderen nicht mit Bier und Blut und Kotze besudelt war. Meistens wurden diese anderen Gefangenen am späten Nachmittag wieder freigelassen, sobald sie ihren Rausch ausgeschlafen hatten. Dann gelang es mir wenigstens für ein paar Stunden, die schwülen vierzig Grad und den Gestank menschlicher Fäkalien zu vergessen und ein bisschen zu schlafen, nur um kurz darauf geweckt zu werden, weil es «Fressen» gab oder irgendwer die Zelle mit einem Feuerwehrschlauch ausspritzte oder, und das war am schlimmsten, durch eine Baumratte, oder was auch immer das für Viecher waren: Diese Nager waren sechzig Zentimeter lang und bestimmt ebenso viele Pfund schwer und sahen aus, als kämen sie geradewegs aus einem Propagandafilm der Nazis oder einem Gedicht von Robert Browning.
Zu Beginn der dritten Woche holte mich ein Unteroffizier der Navy-Polizei aus der Ausnüchterungszelle, führte mich zu einem Waschraum, wo ich duschen und mich rasieren konnte, und gab mir meine eigene Kleidung zurück.
«Sie werden heute verlegt», erklärte er. «Nach Castle Williams.»
«Wo ist das?»
«New York.»
«New York? Wieso das denn?»
Er zuckte die Achseln. «Was weiß ich.»
«Was ist dieses Castle Williams denn genau?»
«Ein Militärgefängnis. Sieht so aus, als würden Sie jetzt der Army zum Fraß vorgeworfen werden.»
Er gab mir eine Zigarette, vermutlich nur, damit ich keine weiteren Fragen stellte, und es funktionierte. Die Zigarette hatte einen Filter, der wohl meine Kehle schonen sollte, und ich schätze, er erfüllte seinen Zweck, denn ich verbrachte mehr Zeit damit, die Zigarette skeptisch zu mustern, als sie zu rauchen. Ich hatte mein halbes Leben lang geraucht. Eine Weile war ich richtig süchtig nach Tabak gewesen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie man jemals von etwas dermaßen Geschmacklosem wie einer Filterzigarette abhängig werden konnte. Sie schmeckte wie ein Hot Dog nach fünfzig Jahren Bratwurst.
Der Unteroffizier brachte mich zu einer anderen Hütte mit einem Bett, einem Stuhl und einem Tisch darin und schloss mich ein. Es gab sogar ein offenes Fenster. Es war vergittert, aber das war mir egal. Eine Weile lang stand ich auf dem Stuhl, hielt meine Nase ans Fenster und genoss eine so frische Luft, wie ich sie seit Wochen nicht mehr eingeatmet hatte. Ich schaute aufs Meer, das in einem trüben Dunkelblau schimmerte. Aber meine Stimmung war noch trüber. Ein US-Militärgefängnis in New York war ein ganz anderes Kaliber als eine kleine Ausnüchterungszelle in Guantánamo. Offenbar hatte die Navy mit der Polizei in Havanna über mich gesprochen, die Polizei hatte Kontakt zu Leutnant Quevedo vom militärischen Geheimdienst auf Kuba aufgenommen, und dieser hatte den Amerikanern meinen richtigen Namen mitgeteilt und ihnen die nötigen Hintergrundinformationen geliefert. Mit ein bisschen Glück würde ich jemandem vom FBI alles erzählen können, was ich über Meyer Lansky und die Mafia in Havanna wusste, was mich hoffentlich vor einer Auslieferung nach Deutschland und somit vor einer Anklage wegen Mordes bewahren würde. Die Bundesrepublik Deutschland hatte die Todesstrafe 1949 abgeschafft, aber bei den Amerikanern konnte man nie wissen. Immerhin hatten sie noch 1951