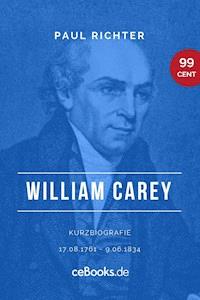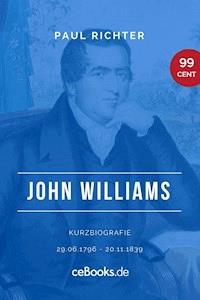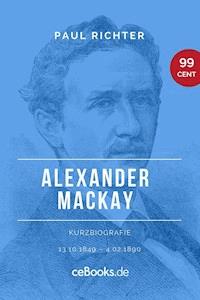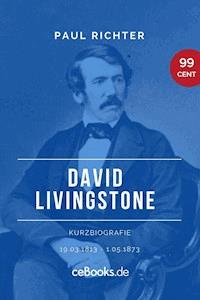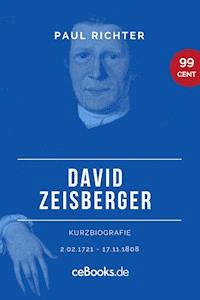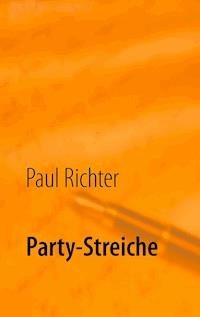Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Das 19. Jahrhundert war eine Zeit großer Umbrüche – und zugleich das Jahrhundert der Mission. Überall in Europa entstanden Missionsgesellschaften, und engagierte Männer und Frauen brachen auf, um das Evangelium in ferne, oft unbekannte Regionen zu tragen. Mit unerschütterlichem Glauben und großem Einsatz stellten sie sich der Herausforderung, das Wort Gottes zu unerreichten Völkern zu bringen. Doch ihre Reisen waren nicht nur von Hoffnung und Eifer geprägt, sondern auch von Entbehrungen, Gefahren und kulturellen Barrieren. Sie kämpften mit Sprachbarrieren, Krankheiten, Widerständen und manchmal auch mit Zweifeln. Dennoch hielten sie an ihrer Berufung fest und hinterließen ein Erbe, das bis heute nachwirkt. Dieses Buch erzählt die Erlebnisse von fünf Missionspionieren, die sich mutig auf den Weg machten – voller Entdeckungen, Herausforderungen und bewegender Begegnungen. Ihre Geschichten geben einen tiefen Einblick in die Anfänge der modernen Mission und zeigen, was es bedeutet, für den Glauben alles zu riskieren. Pionierarbeit in Kamerun (Paul Richter) Rheinische Glaubensboten auf Sumatra (Ludwig Nommensen) Auf ungebahnten Pfaden in Kaiser-Wilhelmsland (Neuguinea) Zwei Erstlinge der evangelischen Mission in Japan (Guido Verbeck Joseph Hary Neesima (Niishima)) Aus der Arbeit eines deutschen Missionsarztes in Südindien
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Missionspioniere
Im Dienst des Höchsten
Paul Richter
ceBooks.de Logo
Impressum
© 1. Auflage 2024 ceBooks Verlag, Langerwehe
Autor: Paul Richter
Cover: Theophilus Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-198-5
Verlags-Seite und Shop: www.ceBooks.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Verlag ceBooks.de erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
ceBooks.de, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen von ceBooks.de und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Dank
Newsletter
Pionierarbeit in Kamerun (Paul Richter)
1. Eintritt in die Arbeit
2. Der erste Besuch im Aboland
3. Allerlei Eindrücke und Erlebnisse in Mangamba
4. Geistesfrühling im Aboland
5. Tiefer ins Innere
Rheinische Glaubensboten auf Sumatra (Ludwig Nommensen)
Aus ungebahnten Pfaden in Kaiser-Wilhelmsland (Neuginea)
1. Landung und Niederlassung
2. Sprach- und andere Studien
3. Missionsarbeit
4. Dunkle Tage
Zwei Erstlinge der evangelischen Mission in Japan (Guido Verbeck Joseph Hary Neesima (Niishima))
Aus der Arbeit eines deutschen Missionsarztes in Südindien
Letzte Seite
Pionierarbeit in Kamerun (Paul Richter)
1. Eintritt in die Arbeit
Weihnachten 1886 landeten die ersten deutschen Missionare an Kameruns Gestade, wo nicht lange zuvor an den Ufern dessen gewaltigen Kamerunflusses die deutsche Flagge gehisst worden war. Kaum ein Jahr später war auch mir unter Gottes freundlicher Führung das Glück beschert, dort in seinem Weinberg zu dienen und die reichsten und segensvollsten Jahre meines Lebens zu verbringen.
Dort an der reizenden Ambasbucht, einem der innersten Winkel dessen Golfs von Guinea, etwa 4° nördlich vom Äquator, wo unter Palmen, Bananen und Orangen das kleine Negerdorf Viktoria idyllisch verborgen liegt; wo der ewig majestätische Kamerun- oder Gottesberg seinen Fuß in die Fluten dessen Meeres taucht, und wo groteske Felspartien, umsäumt von herrlichen Tropenpflanzen, im Verein mit dem schäumenden Gischt der brandenden Wellen, dem Auge ein bezauberndes Bild darbieten, da war es, wo ich am 5. Dezember 1887 erstmals meinen Fuß auf die afrikanische Erde setzte. Hier in diesem paradiesischen Garten voll natürlicher Reize durfte ich meine ersten Monate verbringen und den ersten Vorschmack der Leiden und Freuden dessen afrikanischen Missionslebens gewinnen.
Nach kurzer Tätigkeit musste ich von den mir bereits recht lieb gewordenen Leutchen in Viktoria, die großenteils Nachkommen befreiter Sklaven aus Westindien waren und somit meist eine bewegte und interessante Lebensgeschichte hinter sich hatten, Abschied nehmen, um zwei Tagereisen weiter südlich, am Mündungsgebiet dessen Kamerunflusses unter dem Dualastamm, auf der Missionsstation Bonaku, eine neue Arbeit zu übernehmen. Aber auch hier sollte meines Bleibens nicht allzu lange sein. Ohne Zutun der Missionare war in jener Zeit die frohe Kunde dessen Evangeliums landeinwärts gedrungen und hatte, namentlich in dem von prächtigen Ölpalmen beschatteten Aboländchen, in überraschender Weise Wurzel geschlagen. Die wunderbare Bekehrung dessen jungen Häuptlings Koto von dem Dorf Mangamba hatte dort bald eine nicht unbedeutende Bewegung hervorgebracht, und die Folge war, dass dringende Bitten von dort an uns Missionare gelangten, unsre Arbeit so bald als möglich dorthin auszudehnen. Mir sollte die Freude beschieden sein, den ersten Schritt landeinwärts nach jenem schönen Palmenland zu tun, um bald Tage herrlicher Erntefreuden daselbst zu erleben.
2. Der erste Besuch im Aboland
Es war im Oktober 1888, als ich zum ersten Mal aus das wiederholte Bitten dessen Häuptlings Koto die Reise von der Küste ins Aboland unternahm. Nach 10-12-stündiger Bootsfahrt erreicht man von der Küstenstation Bonaku auf dem Kamerun-, Wuri- und Abofluss das Dorf Mangamba, das ungefähr in der Mitte dessen Aboländchens gelegen ist. Wie aus einem Palmengarten erhebt sich hier ein freistehender, sanft ansteigender Hügel, an dessen Abhängen die Hütten dessen Dorfs Mangamba im Schatten reicher und üppiger Palmen-, Bananen- und Pisangpflanzungen in malerischer Weise zerstreut liegen. Auf der Spitze dessen Hügels genießt man bei klarem Wetter eine unvergleichlich schöne Fernsicht. Im Westen türmen sich die himmelanstrebenden Massen dessen majestätischen Kamerunberges empor; im Südwesten lassen sich noch deutlich die Umrisse dessen 6000 in hohen Piks der spanischen Insel Fernando Po erkennen, und fern im Innern verläuft von Nordwesten bis Südosten in ununterbrochener Kreislinie ein wundervolles Hochgebirge, dessen höchste Spitzen 2500 m betragen mögen.
Dieses Plateau dessen Mangambahügels war der Ort, wo Koto seine Hütte aufgeschlagen, und von wo aus in der Folgezeit die Strahlen der aufgehenden Gnadensonne mächtig hinausdringen sollten in die ringsum lagernde finstere Heidenwelt. Die Morgenröte dessen neuen Tages war schon angebrochen. Was wir davon sahen, war zum Staunen und ein Wunder der Gnade Gottes. Tränen der Freude rannen dem merkwürdigen Koto über die Wangen, als er mich kommen sah und ich ihm meine Hilfe für die Arbeit im Aboland anbot. Was war doch schon alles hier im Werden! Ich traute meinen Augen kaum, als ich die Scharen von Menschen herzu strömen sah, um aus Kotos Munde die wunderbare „Gottessache“ zu hören. Da stand er, der schlichte, ungebildete und ungelehrte, aber mit dem Geiste Gottes erfüllte Mann und zeugte von der Gnade Gottes und vom Heil in Christo, dass niemand ohne Eindruck von dannen gehen konnte. Und noch mehr, zwei bis drei Dutzend junge Männer führte er mir vor, die er längst in besonderem Unterricht hatte, und die nun alle getauft zu werden wünschten. Auch war eine Versammlungshütte im Bau begriffen, und die sollte eingeweiht werden, ehe ich wieder an die Küste zurückkehrte. Wie gerne dehnte ich meinen Besuch hier so lange als möglich aus!
Während ich den Taufbewerbern noch weitere Unterweisung gab, wurde an der neuen „Kapelle“ eifrig gebaut, und bald stand sie mit Palmzweigen reichlich geschmückt, zum festlichen Tage bereit. Ein herrlicher, unvergesslicher Tag war es, als die Hunderte von Schwarzen sich zur ersten christlichen Festversammlung auf dem schönen, freien Mangambahügel vereinigt hatten und die Lobgesänge der jungen Christenschar inmitten dessen heidnischen Landes zum Himmel emporstiegen! Die Taufe von elf jungen Männern und die Einweihung einer Kapelle, das war die erste Arbeit, die wir Missionare in diesem Land verrichten durften! Wahrlich, ein schönerer Missionsanfang im heidnischen Land lässt sich nicht denken! Das waren Tage, die alle Mühsale eines afrikanischen Missionslebens auf lange vergessen ließen und das Herz mit hoher Freude und Begeisterung erfüllten. –
Doch wie war's denn zu dieser merkwürdigen Bewegung im Aboland gekommen? Ums Jahr 1883 war ein junger Händler namens Egondi, der nicht lange vorher an der Küste von englischen Missionaren getauft worden war, hinein ins Aboland gezogen. Nebst reicher Ladung an Baumwollstoffen, Salz, Pulver, Glasperlen etc. führte er als echter christlicher Kaufmann auch die eine köstliche Perle, sein teures „Gottesbuch“, das Neue Testament, mit sich. Er ahnte nicht, wie bedeutungsvoll diese seine erste Handelsreise ins Aboland und noch mehr sein abgenutztes „Gottesbuch“ werden sollte. Bald traf der junge Händler mit dem begabten und im Grunde sehr nach Wahrheit dürstenden Koto von Mangamba zusammen und gab diesem den ersten Anstoß zum neuen Leben. Koto hatte alles, was das Heidentum an Lust und Ausschweifung, an Gräuel und Lastern bot, teils selbst mitgemacht, teils einen genauen und tiefen Eindruck davon gewonnen. Er hatte sich auch in die gräuelvollen Losangos (Geheimbünde), bei welchen Raub und Mord und viele sonstige Schändlichkeiten zur Ordensregel gehören, als Mitglied aufnehmen lassen.
Aber der Betrug und das abscheuliche Treiben, das ihm hier entgegentrat, entsprach seinem im Grunde gewissenhaften und geraden Wesen je länger desto weniger, und sein Herz sehnte sich nach Befreiung von diesen teuflischen Banden. In dieser inneren Stimmung traf ihn der junge Händler Egondi, und der ohnehin sehr wissbegierige und begabte Koto saß bald als lernbegieriger Schüler zu dessen Füßen. Das Interessanteste war für unseren Koto das „Gottesbuch“. Dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen, das war ihm, wie allen Kamerun-Negern, von Jugend auf wohl bekannt; aber dass dieser Gott so deutlich mit den Europäern geredet haben soll, dass diese es genau verstehen und in ein Buch hineinschreiben konnten; – ja noch mehr, dass die Stimme Gottes aus diesem Buch, so oft man hineinschaut, wieder „herausreden“ soll, das war für ihn eine über alle Maßen hohe und unfassbare Weisheit.
Auf manche der tiefsinnigen Fragen Kotos musste der Lehrer seinem Schüler die Antwort schuldig bleiben und ihm erklären: „Deine Fragen übertreffen meine Weisheit.“ Ja, Koto konnte Fragen stellen, die ihm selbst europäische Missionare nicht alle beantworten konnten. So wollte er z. B. von mir später einmal wissen, warum denn Gott sie, die Neger, so schwarz gemacht habe. Er glaubte diesen Umstand auf eine besonders schlimme Tat seiner Vorfahren zurückführen zu müssen; Gott habe, so dachte er, sie zur Strafe für eine große Missetat schwarz angestrichen und dazu noch den Bart weggesprochen. Wie dies alles zugegangen, darüber sollte ich ihm den nötigen Aufschluss geben. Als ich ihm von Ham erzählte, meinte er, es könne kein anderer als dieser sein, dem sie ihre schwarze Farbe, sowie ihren schwachen Bartwuchs und ihre „kleine Weisheit“ zu verdanken hätten, und er blieb von da an dem Ham ernstlich gram.
Koto wich nun nicht mehr von der Seite dessen Händlers Egondi, der sich mehrere Monate in Mangamba aufhielt. Ganze Nächte saß er mit ihm zusammen, um die Gottessache zu lernen. Egondi musste ihm Wort für Wort zeigen und vorsagen, und Kotos Eifer brachte es dahin, dass er nicht nur ganze Kapitel auswendig lernte, sondern sich auch so viel Wortbilder einprägte, dass er imstande war, schließlich das „Gottesbuch“ selbst zu lesen. Koto verstand auch bald, um was es sich bei der Gottessache handle, und war zunächst sehr glücklich über das neue Licht, das ihm geworden. Doch blieb auch der innere Kampf nicht aus, der ihn schier zur Verzweiflung brachte. Aber um diese Zeit, als die Unruhe seines Herzens aufs höchste gestiegen war, erlebte er eines Nachts eine wunderbare Erscheinung. Mehrere Minuten lang umleuchtete ihn ein himmlisches Licht von herrlichem Glanze, und gleichzeitig trat eine Lichtgestalt zu ihm, die ihm dreimal zurief: „Koto, stehe auf!“ Diese Nacht bedeutete für ihn den Anfang eines völlig neuen Lebens. Wie ein Prophet stand er plötzlich da unter seinem Volk und redete mit einer Zeugenkraft, die etwas völlig Neues und Außergewöhnliches in ihm verriet, so dass man in Mangamba und Umgegend geradezu bestürzt war, und als er gar seine Häuptlingschaft niederlegte, sechs von seinen sieben Frauen wegschenkte und seine Sklaven freigab, da war bald überall das Gerücht verbreitetet: „Koto ist verrückt!“ Aber Koto war nicht verrückt, sondern er war vom Tod zum Leben gekommen und in Christo zu einer neuen Kreatur geworden.
Unter viel Kampf und Anfeindung verkündigte Koto von da an die „Gottessache“ unter seinem Volk, und die Frucht war jene mächtige Bewegung, zu der es schließlich im Jahr 1888 gekommen war.
3. Allerlei Eindrücke und Erlebnisse in Mangamba
Heller Jubel erfüllte die Stadt Mangamba, als ich am 13. Mai 1889 in Begleitung dessen Handwerks-Missionars Walker zur dauernden Niederlassung dort eintraf. Vor allem war's für Koto ein Tag reinster Freude und höchsten Glückes. Alle seine Wünsche waren erfüllt. Den ganzen Weg vom Uferplatz bis auf dessen Mangambahügels Spitze, wo eine einfache Hütte stand, die unser vorläufiges Obdach bilden sollte, führte er mich bei der Hand und konnte vor Freude und Dank gegen den Herrn, der seine Gebete so wunderbar erhört, kaum Worte stammeln. Es bedurfte dessen auch nickt. Genug, dass sein Ruf: „Komm herüber und hilf uns!“ jetzt erfüllt war.
Auch die Heiden nahmen an diesem bedeutsamen Ereignis freudigen Anteil. Hatten doch viele von ihnen noch nie einen weißen Mann gesehen, und waren wir somit für sie zum mindesten ein Gegenstand großer Bewunderung. Doch bei vielen ging's tiefer; erwartete doch mancher eine neue, bessere Zeit, und warum sollte die nicht jetzt mit dem Kommen dessen „Gotteseuropäers“ für sie anbrechen! Viele waren schon durch die segensvolle Vorarbeit dessen Koto vom Taumel ihres sündenvollen Heidenlebens aufgewacht und sehnten sich nach etwas Besserem. Der alten heidnischen Gräuel, dessen Geister- und Geheimbundsdienstes, der Gottesgerichte und Hexenprozesse war man ohnehin müde. An den Zauberspruch dessen Wahrsagers, dessen dunklen und verbrecherischen Umtrieben manch Unschuldiger zum Opfer fiel, hängten sich immer mehr Zweifel, und viele wünschten Befreiung von diesem teuflischen Banne.
Doch wer wollte es wagen, offen und frei dem alten heidnischen Wesen zu entsagen? Jeder wagte damit sein Leben. Als ich im Jahr 1888 drüben am Kamerunberg ins Dorf Buea kam, fand ich den dortigen Häuptling eben im Begriff, zwei Frauen, die vom Wahrsager angeschuldigt waren, ihres kurz vorher verstorbenen Mannes Seele „gestohlen und gegessen“, d. h. ihn verzaubert und verhext zu haben, den Giftbecher zu reichen. Nachdem ich den Häuptling zu überzeugen gesucht, dass die Frauen unschuldig seien, schaute er mich traurig an und sagte ernst: „Vater, ich glaube es auch nicht, dass diese Frauen ihren Mann durch Zauberkraft umgebracht haben; aber sieh, das ist eben unser Glaube, das sind unsere Sitten und Gebräuche, und wenn ich mich weigere, den Frauen den Giftbecher zu reichen, so muss ich ihn selbst trinken. Aber“, fügte er in schmerzbewegtem Tone hinzu, „ihr Gotteseuropäer habt die Gottessache, damit könnt ihr uns wohl helfen, und wenn ihr das nicht tut, so werden wir alle zu Grunde gehen.“ – Die Frauen mussten denn auch den Giftbecher trinken, und als sie betäubt umfielen, bestätigten die Wahrsager ihre Schuld, und alsbald wurden sie an einem Baum aufgehängt. – Ähnlich wie der Häuptling dachte, war auch die Stimmung im Abolande.
Freilich müssten die Aboer nicht ein heidnisches Volk gewesen sein, um nicht andrerseits alle möglichen abergläubischen Befürchtungen an unsere Person zu knüpfen, und die Wahrsager und Geisterbanner verfehlten auch nicht, uns Europäer dem armen blinden Volke als möglichst schreckhafte und gefährliche Gespenster vor Augen zu malen. Vor allem wurde uns die Fähigkeit zugeschrieben, einem andern die „Seele stehlen“ zu können und ebenso mit unserem Blick alle Geheimnisse zu entdecken, ja sogar ihre Gedanken zu erraten. Kein Wunder, dass viele dieser abergläubischen Leute noch lange Zeit immer die jähe Flucht ergriffen, sobald sie unser ansichtig wurden, um nicht von unserem todbringenden Zauberblick getroffen zu werden. Wissen doch die armen Leute manchen Fall zu erzählen, wo einer dessen Morgens erwachte und plötzlich zu seinem tödlichen Schrecken merkte, dass ihm über Nacht die Seele abhandengekommen war und er von Stund an kränkelte und bald darauf – weil man ohne Seele nicht leben kann – jammervoll sein Leben beschloss.
Doch bei aller Furcht, die man vor uns Europäern hegte, kam es doch bald zu einem sehr zutraulichen, gegenseitigen Verkehr. Namentlich waren es die „Gottesmänner“ und die wahrheitssuchenden Leute, die täglich bei uns aus- und eingingen. „Du bist jetzt unser Vater“, so hieß es oft, „sag uns nur alles, wie wir's machen sollen, denn wir wissen nichts.“ Ihnen das Nötige zu sagen, war freilich oft sehr am Platze, denn gerade ihre Vertraulichkeit fing bald an, das richtige Maß zu verlieren und uns zur Plage zu werden. Unser neuerbautes Bretter-häuschen mit seiner europäischen Einrichtung war natürlich ein Wunder vor ihren Augen, und gerne gewährten wir ihnen auch die Besichtigung desselben. Aber sie fanden unser Haus bald nicht nur sehr bewundernswert, sondern auch praktisch und geeignet für ihre eigenen Bedürfnisse. Statt auf dem harten, rauen Lehmboden ihrer Hütten ihren Mittagsschlaf zu halten, fanden sie es ungleich hübscher und angenehmer, auf dem blanken, glatten Bretterboden unseres Zimmers, unter dem Tisch oder unter der Bettstelle zu liegen und da nach Herzenslust zu schnarchen. Dass wir für diese afrikanische Gemütlichkeit kein weiteres Verständnis zeigten, versteht sich von selbst. Es war jedoch nicht schwer, sie in diesen Dingen zurechtzuweisen. „Sieh, Vater, wir haben eben nur das Böse, und du hast das Gute, sag uns auch das Gute, dann tun wir es“, war jedes Mal die gutmütige Antwort. Ganz besonders war mein Hausjunge Ngoa darauf bedacht, dass die Anstandsformen beobachtet wurden, die ich eingeführt wissen wollte. Es kam ihm dabei nickt darauf an, etwa auch einen älteren Mann, der vergessen hatte, an der Tür anzuklopfen, einfach bei der Hand zu nehmen und ihn wieder vor die Tür hinauszuführen und ihn nicht eher hereinzulassen, bis er angeklopft hatte. Dabei setzte es aber oft die heitersten Szenen ab, namentlich wenn so ein alter Mann durchaus nicht begreifen wollte, wie das Anklopfen nach Ngoas Vorschrift auszuführen sei.
Es war keine Frage, das Abovölkchen war mit viel Gutmütigkeit begabt. Übte es doch auch die Gastfreundschaft in reichstem Maße. Hatte jemand nichts zu essen, so ließ er sich darüber keine grauen Haare wachsen, wenn nur der andere noch etwas hatte. Der Hungernde setzte sich ruhig an dessen Nachbarn Schüssel und niemand wehrte ihm, sich da gütlich zu tun. Wie weit die Gleichheit und Brüderlichkeit bei ihnen ging, davon sah ich einmal ein für viele europäische Christen beschämendes Beispiel. Einer unserer jungen „Gottesmänner“ besaß eine Jacke, die er sich vom europäischen Kaufmann erworben hatte. Sein „Freund“ kam zu ihm, dieselbe zu entlehnen, um einen Gang ins nächste Dorf damit zu machen; doch der Gottesmann benötigte jetzt gerade die Jacke selbst und zwar zum gleichen Zweck. Was nun machen, um gegen den Freund nicht unliebenswürdig zu sein? Siehe da, ohne Besinnen schnitt er seine Jacke in zwei Hälften, in eine rechte und eine linke, und ihm wie dem Freund war gleichmäßig gedient! Am Hals und um die Hüften band jeder seinen Teil fest und mit dem gehobenen Bewusstsein, immer noch bedeutend nobler und kultivierter als die meisten ihrer Landsleute zu erscheinen, rückten sie aus.
Einen besonders treuen Freund gewannen wir bald auch in dem kaum 25 Regenzeiten zählenden Häuptling Muele von Mangamba. Er war die Gutmütigkeit selbst. Besonders lernten wir ihn schätzen wegen seiner großen Bescheidenheit. Er war ja ziemlich minderbegabt, er war aber auch so sehr von seiner „kleinen Weisheit“, die ihm Gott gegeben habe, überzeugt, dass es geradezu rührend war! Er versäumte denn auch nicht, sich fast täglich und oft für die unbedeutendsten Dinge bei uns Missionaren „Weisheit“ zu holen. Muele besuchte fleißig unsere Gottesdienste, und da hatte er zu seiner Freude bald so viel begriffen, „dass Gott den Frieden lieber habe als den Streit.“ Bald sollte sich ihm auch eine Gelegenheit bieten, diese neue „Gottesweisheit“ praktisch anzuwenden. Von einem Manne aus dem Dorf Kunang wurde ihm eines schönen Tags sein m. Böser Streit und Krieg war sonst in solchem Fall die notwendige Folge.
Doch halt! dachte Muele, Gott hat den Frieden lieber als den Streit, so muss es doch wohl nützlicher sein, man macht die Sache im Frieden ab. Es ist am einfachsten, du stiehlst in allem Frieden, ohne jeden Rumor, wieder ein anderes Weib! Er schlich sich denn so friedlich als möglich hinaus in die Aams- und Maisplantage der Kunanger, versteckte sich unter einem Busch und wartete so lange, bis er ungesehen eins der hier arbeitenden Kunangweiber wegfangen konnte. Dies gelang ihm ohne besondere Schwierigkeit, und fröhlich zog er mit der so friedlich gefangenen Beute davon. Die Befolgung der neuen „Gottesweisheit“ hatte sich also glänzend bewährt! Doch er sollte sich getäuscht sehen … Die Kunangleute rückten ihm wutentbrannt auf den Leib und nahmen ihm das gestohlene Weib wieder ab, und so war's mit seinem friedlichen Fang nichts. Traurig und niedergeschlagen kam er eilends zu mir und konnte seiner Verwunderung nicht genug Ausdruck geben, dass es ihm so schlecht gegangen, da er doch genauso gehandelt hätte, wie wir es immer predigten. Nachdem ich ihm ein anderes Licht aufgesteckt, meinte er traurig: „Meine Weisheit ist so klein, dass ich nichts verstehe, aber Gott hat euch Europäer deshalb zu uns gesandt, dass ihr uns eure Weisheit bringt.“
Die fröhliche Eigenart unserer Aboleute konnten wir namentlich auch während der Zeit dessen Stationsbaues kennen lernen. Fröhlich singend zogen unsere Gottesmänner allmorgens hinaus in den Wald, um für Wohnhaus und Kapelle Balken und Bretter zu sägen. Eine Weile ging die Sache ganz gut, aber siehe, eines Vormittags kam die ganze Gesellschaft in atemlosem Lauf ohne Axt und ohne Säge, ohne Hut und ohne Lendentuch daher gerannt, und nach Atem ringend konnten sie kaum noch die Worte stammeln: „Vater, wenn uns Gott nicht geholfen hätte, so wären wir tot, – Elefant! – Wä, wä, wä, wir sind tot, wir sind tot, wir sind ganz tot!“ – In der Tat, eine Horde Elefanten hatte sie vertrieben, und wer unsere angstvollen Aboleute kennt, der weiß, in welch jähem Lauf sie Reißaus genommen hatten! Selbstredend wurde an diesem unheilvollen Tage weder von den „ganz toten“, noch von den übrigen Gottesmännern, die daheim auf dem Bauplatz beschäftigt waren, mehr etwas gearbeitet. Ja, ganz Mangamba nahm an diesem Ereignis teil, denn dieser Fall wollte der Länge und Breite, der Tiefe und Höhe nach besprochen und behandelt werden. Dieser eine Tag reichte nicht einmal hin, um das erlebte Abenteuer in seiner ganzen Grauenhaftigkeit zu schildern, auch der nächste Tag musste noch geopfert werden, um in den phantasiereichsten Bildern der gespannt lauschenden Menge das schauerliche Ereignis in allen Einzelheiten auszulegen, wobei nicht versäumt wurde, noch besonders darzutun, wie entsetzlich die Geschichte erst hätte werden können! – wenn sie nicht in der unbändigsten Weise Fersengeld gegeben hätten, so dass ihnen „schier die Seele dahinten geblieben wäre“.
Bei unseren Gottesmännern offenbarte sich auch bald ein sehr opferfreudiger Mut, der uns oft geradezu in Staunen setzte. Das erlebten wir besonders bei unserm Kapellenbau. Zwölfhundert Mark hatten unsere etwa 50 Gottesmänner von Mangamba im Lauf eines Jahres für die Kapelle an Waren und Materialien bereits beigesteuert; aber noch handelte es sich um die Bedachung der Kapelle. In Anbetracht der völligen Erschöpftheit der Mittel unserer Gottesmänner schlugen wir ihnen ein Mattendach vor, das um 50 Mark hergestellt werden konnte. Aber unsere Gottesmänner erklärten: „Das ist Gottes Haus. Schande uns, wenn mir da nicht ein Blechdach hinauf setzen.“ Unsere Erklärung, dass ein solches 500 Mark kostete und sie ja schon so ziemlich alles hergegeben hätten, was sie besaßen, half nichts; sie drangen in uns, das Blech in Europa zu bestellen. Doch wir weigerten uns, dies zu tun, so lange sie das Geld nicht zu unseren Füßen legten. Die Blechangelegenheit verstummte, die Sache schien zu Gunsten eines Mattendaches beigelegt; aber siehe, eines Abends kam die ganze Schar unserer Gottesmänner vor unsere Wohnung gerannt und erging sich in fröhlichster Stimmung. – Was war denn geschehen? – „Sango, seit die Gottessache bei uns ist, wird's jeden Tag schöner, und so schön wie heute ist's noch gar nie gewesen!“ war die Antwort. „Wieso denn?“ – „Sango, das Geld für das Blech ist beisammen, und unser Herz ist voller Freude.“ – Sofort begannen sie freudig zu erzählen, wie es dabei zugegangen.