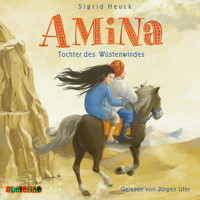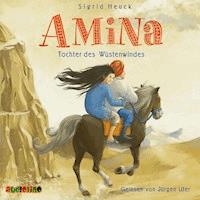Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es war einmal eine Frau, die reiste nach Cap Verden, um Drachenechsen zu sehen. Sie ritt mit den Tuareg auf Kamelen durch die Sahara, bestaunte in der unendlichen Weite der afrikanischen Steppe wilde Tiere und wanderte auf schmalen Pfaden zu den Heiligtümern im Jemen. Die bekannte Kinderbuchautorin Sigrid Heuck hat in zahlreichen Kurzgeschichten ihre Erlebnisse und Eindrücke ferner Länder eingefangen. Ihre Begegnungen mit Menschen, Tieren, Kulturen und Städten zeugen davon, welche Faszinationen die weite Welt bereithält. Sie wecken Fernweh und zeigen, wie Reisen das Leben bereichert, inspiriert und beflügelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sigrid Heuck
Mit Wind und Wolken unterwegs
Was bleibt, ist die Erinnerung
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unterwww.allitera.de
September 2015 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH © 2015 Buch&media GmbH, München Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler, München Lektorat: Martina Kuscheck Umschlaggestaltung unter Verwendung des Bilds Sigrid Heuck am Allalinhorn, ca. 1956 Printed in Germany ISBN 978-3-86906-778-0
Inhalt
Es war einmal in Italien (1955)
Es war einmal auf der Insel Korsika (1957)
Es war einmal in den Bergen Montenegros (1957)
Es war einmal in Apulien (1958)
Es war einmal in den Bergen Südtirols (1960)
Es war einmal im Zillertal (1961)
Es war einmal in Frankreich / Bretagne (1962)
Es war einmal in Irland (1965)
Es war einmal in Schottland (1967)
Es war einmal in Tunesien (1973)
Es war einmal in Peru (1978)
Es war einmal eine Reise im Ballon (1980)
Es war einmal in Mexiko. Der Prozess (1980)
Es war einmal in Ecuador (1981)
Es war einmal auf den Galapagosinseln (1981)
Es war einmal in der Sahara (1982)
Es war einmal in Sanaa (1982)
Es war einmal im Jemen (1983)
Es war einmal in Ägypten (1984)
Es war einmal in einer Schule in Harrania / Ägypten (1984)
Es war einmal im Land der Pharaonen (1984)
Es waren einmal zwei Klöster in der ägyptischen Wüste (1984)
Es war einmal im Land der Dogon (1985)
Es war einmal in Mali (1985)
Es war einmal in Marokko (1985)
Es war einmal in Indien (1986)
Es war einmal in Rajasthan (1986)
Es war einmal in Nepal (1987)
Es war einmal in China. Die Schluchten (1988)
Es war einmal auf der Seidenstraße (1989)
Es war einmal in Gambia (1990)
Es war einmal in der Südsee (1990)
Es war einmal in Papua-Neuguinea (1990)
Es war einmal in Ostafrika (1991)
Es war einmal in Tibet (1991)
Es war einmal auf der Insel Bali (1992)
Es war einmal am Huang Shan (1992)
Es war einmal in Vietnam (1993)
Es war einmal auf einer Fahrt an die Elfenbeinküste (1994)
Es war einmal auf den Seychellen (1995)
Es war einmal auf Borneo (1995)
Es war einmal auf dem Flug von Malaysia nach München (1995)
Es war einmal in China - Tian'anmen-Platz (1996)
Es war einmal auf einer Fahrt durch die Nusa Tenggara (1998)
Es war einmal auf Java (1998)
Es war einmal in Jordanien (1999)
Es war einmal auf den Kapverdischen Inseln (2000)
Es war einmal auf der Donau (2003)
Es war einmal in Norwegen (2005)
Es war einmal eine Schriftstellerin ...
Bibliografische Angaben
Es war einmal in Italien (1955)
Es war einmal vor vielen Jahren, dass der Onkel seine junge Nichte einlud, die Ferien mit ihm und seiner Frau auf der Insel Ischia zu verbringen. Diese Insel befand sich in der Bucht von Neapel nicht weit entfernt von Capri, das auf der ganzen Welt bekannt war. Sie war damals noch nicht berühmt, und der Ort, in dem sich der Onkel eingemietet hatte, war nur zu Fuß zu erreichen. Er bestand aus einigen Häusern, einer Kirche, vielen Männern, Frauen, Kindern, Hunden und Hühnern und dem alten Wachturm, der »Torre« genannt wurde. Einfach nur »Torre«.
Die Häuser befanden sich dicht ineinander verschachtelt an einem Berghang, umgeben von lauter Weinbergen. Lebte man eine Weile dort und verstand auch ein bisschen die Sprache, dann war es, als käme man in eine große Familie. Man fügte sich ein, und wenn man das gelernt hatte, dann kam es einem vor, als verstünde man vieles von so einem abgelegenen italienischen Nest. Von der Endhaltestelle des Busses aus führte ein schmaler Fußweg, jeder Bucht und jedem Vorsprung folgend, an der Küste entlang zu diesem Dorf. Vor der Piazza bog der Weg links ab, kletterte in vielen Windungen steil an der Kirche vorbei den Berg hinauf und teilte sich dann. Der Hauptweg brachte den Spaziergänger dann zu zwei Nachbardörfern oben am Berg. Man stieg Treppen hinauf, die an den Seiten der Häuser klebten, lief auf den Dächern entlang vorbei an aufgehängter Wäsche, stinkenden Fischresten, schreienden Kindern, stieg die nächste Treppe hoch, befand sich abermals auf dem Dach eines Hauses und erreichte auf diese Weise sein Ziel, wenn man nicht unterwegs mit einer Frau über ein neues Pizzarezept oder mit einem kleinen Mädchen über seine Flechtarbeit schwätzte.
Die gute Stube des Ortes war die Piazza. Sie war zugleich Hafenplatz, Spielplatz, Kino und Tanzboden. Alles Wichtige spielte sich hier ab, angefangen vom täglichen Anlegen des Motorbootes über den Streit zweier Fischer bis zum Fotografieren eines Mannequins mit Modellen für eine Boutique.
Das Haus, in dem Onkel, Tante und Nichte wohnten, lag weiter oben am Berg. Es stand als mächtiger Quader auf einer der vielen Hangterrassen. Zu erreichen war es nur durch einen schmalen Pfad, auf dem zwei Leute nicht nebeneinander gehen konnten und der durch eine Schlucht mit erstarrter Lava führte.
Das Haus gehörte der Großmutter. Außer ihr lebten noch zwei Söhne mit ihren Frauen und sieben Enkelkindern dort. Drei Zimmer auf der oberen Terrasse wurden im Sommer an fremde Gäste vermietet. Elektrisches Licht gab es nicht. Kleine Petroleumlampen und Kerzen waren die einzige Beleuchtung am Abend.
Das Regenwasser wurde in einer Zisterne gesammelt und war sehr knapp. Auf ganz Ischia soll es damals nur eine Quelle gegeben haben, außer den Thermalquellen natürlich. Jeden Morgen wurde die Nichte durch das Quietschen der Winde geweckt, mit der ihre Wirtin, Signora Giuseppina, Wasser aus dem Zisternenschacht holte. Etwas breitbeinig, den Kopf vorsichtig durch die schmale Öffnung steckend, stand sie da. Mit beiden Händen drehte sie die Kreuzbalken, langsam wand sich das Seil, an dem der Eimer hing, über die Querstange, bis er schließlich am Rand des Brunnens erschien.
Das Leben der Familie und der Gäste spielte sich in einem großen Raum ab, der auf einer Seite fast offen war. Nur die Außentreppe, die auf das Dach führte, schützte ihn ein wenig vor der Unbill des Wetters. Alte Krippen und Raufen ließen darauf schließen, dass früher auch die Haustiere hier untergebracht waren. Der Onkel und die Tante lagen oft auf der oberen Terrasse. Dort war es fast still, nur ab und zu gurrte eine Taube, eine Ziege meckerte und aus dem Nachbarhof drang leises Gekicher herauf. Dann war die Sonne im Sinken begriffen und die ersten Grillen begannen zu zirpen. Der Himmel färbte sich rot und das Leben auf der Piazza begann. Draußen auf dem Meer blitzte das Licht eines Fischerbootes auf. Eines und noch eines. Die Lichter verteilten sich und verloren sich in der Weite. Die Fischer gingen auf Tintenfischfang.
Von der Piazza aus drang die Melodie eines neapolitanischen Schlagers über die Wasserfläche. Lautes Lachen und Gläserklirren kam aus der Bar.
»Einen Espresso, meine Dame?«, fragte der Kellner. »Einen Campari- Cassata oder Cinzano fresco? Gut, und der Herr wünschen?«
Draußen schlich ein Bettler vorbei, grau, Kittel und Gesicht. War es Staub oder das Alter? Drinnen tanzte ein Paar zu den Takten eines sentimentalen Tangos. Der alte Bettler blieb stehen. Neben ihm ein Junge, beide beobachteten sie das tanzende Paar, der Junge mit einem sehnsüchtigen Ausdruck.
Eine Mutter rief ihr Kind: »Elisa! E-li-sa!«
Das kleine Mädchen in seinem verwaschenen blauen Kittel unterhielt sich gerade mit der jungen Frau. Lange schwarze, strähnige Haare fielen ihr ständig über die Augen.
»Elisa!« Noch einmal gellte der Ruf der Mutter über die Piazza, streng und nachdrücklich.
»Buona sera!«, sagte Elisa, drehte sich um und rannte weg.
Auf drei Seiten umgaben Häuser die Piazza, nur nach Süden, auf der dem Meer zugewandten Seite war sie offen. Dort verband ein schmaler Sandstreifen den Torre mit dem Dorf. Der kleine Hafen diente vielen Ruderbooten, einigen Segelbooten sowie zwei Motorbooten als Zufluchtsort. Zwei oder drei ausgediente größere Boote lagerten in der Nähe der Mole am Strand. Ihre Farben waren verwaschen und ausgebleicht. »Ilario« stand in großen Buchstaben am Bug des einen von ihnen. Was mochte es erlebt haben? Warum lagen sie hier? Es schien, als hätten sie schon lange kein Wasser mehr unter dem Kiel gehabt.
Manchmal spielten die Kinder auf den Booten so etwas Ähnliches wie Verstecken oder Seeräuber. Dann schauten kleine, freche, schmutzige Kindergesichter aus den schmalen Kajütfenstern.
»Gino, guarda!« Ein Mädchen, das Dach der Koje erkletternd, rutschte aus und fiel hin. Weinend lag es da und ließ sich vom Bruder trösten. Die übrigen verloren inzwischen den Spaß an dem Spiel. Sie dachten sich etwas anderes aus und laut miteinander diskutierend verschwand die ganze Horde hinter einer Hausecke. So oder ähnlich ging es alle Tage.
Einmal, es war zur Mittagsstunde und die Sonne brütete auf der Piazza, jagten die Kinder einen Hund. Pfeifend und johlend wurde er von einem Dutzend halbwüchsiger Jungen auf die Mole gehetzt. Die Lage schien aussichtlos für ihn, vom Steg blieb ihm nur der Weg ins Wasser. Breit, lässig, mit einen satten Grinsen saßen einige Gäste vor der Bar und beobachteten den Vorgang. Der Hund, der nicht zum Dorf zu gehören schien, war jetzt auf der höchsten Stufe seiner Verzweiflung angelangt. Er sprang ins Wasser. Schwimmend versuchte er das Land zu erreichen, wurde aber dort, kaum einen Meter vom Ufer entfernt, von der johlenden Horde der Jungen wieder daran gehindert und zurückgetrieben. Ohne zu zögern wendete er und kam, nachdem er abermals die Hälfte des Anlegestegs zurückgeschwommen war, an eine kleine Treppe. Er hastete sie empor, stand einen Augenblick zitternd still und flog dann in langen Sätzen auf die Kinder zu. Diese, erschrocken über die veränderte Lage, wichen zur Seite. Schon war der Hund an ihnen vorbei und überquerte die Piazza. Gleich darauf befand er sich auf der Höhe der Bar und in der nächsten Sekunde war er hinter einem Haus verschwunden.
Wütendes Gebrüll war die Folge des Durchbruchs. Die Horde wendete, jagte hinter ihrem Opfer her und verlor sich in einer engen Gasse. Manchmal hörte man nur von fern ihr Geschrei, langsam verebbend, doch auch das erstarb bald.
Ruhig lag die Piazza wieder in der Sonne. Die Fremden besprachen das Ereignis. Aus einer Küche ertönte das Klappern von Geschirr. Irgendwo schimpfte jemand ein Kind. Es weinte.
Die Sonne brannte auf die Pflastersteine.
Am schönsten war die Piazza am frühen Morgen. Kurz nach Sonnenaufgang wurde es lebendig. Die Männer kamen aus ihren Häusern und gingen langsam über den Sand zu ihren Booten. Zwei Kinder halfen ihrem Vater, ein großes Netz auf dem Sand auszubreiten. Es musste ausgebessert werden. Rasch hockte sich der Fischer hin, zog ein kleines Weberschiffchen aus der Hosentasche und begann das Loch zu flicken. Flink, kaum mit dem Auge verfolgbar, fuhr die Hand mit dem Schiffchen hin und her, knüpfte Knoten für Knoten. Zeigte der helle Faden nicht die Stelle an, an der das Loch gewesen war, es wäre vom übrigen Netz nicht zu unterscheiden gewesen. Ab und zu sprang der Mann auf, rasch griffen dann seine Finger in die Schnüre, liefen darüber, zogen sie an sich, spannten sie zwischen den Händen und schon hatte er ein Loch oder einen Riss gefunden, der ausgebessert werden musste. Wieder tanzte das Schiffchen durch die Maschen, den Faden hinter sich herziehend.
Wunderbare Nächte schenkte der Himmel den Menschen von Ischia. Irgendwo ertönte das Zirpen einer Grille, dazu schlug das Wasser an die Felsen der Bucht und der Wind fing sich an einer Hausecke. Die Sterne leuchteten am Firmament.
Ein paar Tage lang heulte ein Sturm. Als er sich wieder gelegt hatte, nahmen Pasquale und Federico, die Söhne des Wirts, der dem Onkel und der Tante die Zimmer vermietet hatte, ihre Nichte zum Fischen mit.
Leise schwabbelten, gluckerten die Wellen an die Bootswand, als müssten sie ihr etwas erzählen. Die Ruder schlugen im Takt und trieben das schwere Gefährt langsam vorwärts, das Wasser hinter sich in gleißende Bewegung setzend. In einer der Buchten waren Körbe ausgelegt worden, um Langusten zu fangen. Ihre Lage wurde durch einen Korken gekennzeichnet, der an einem Seil befestigt, an der Meeresoberfläche tanzte. Pasquale und Federico standen im Boot. Ihr Ruder mit beiden Händen umklammernd, bewegten sie sich stetig vor und zurück. Etwas Musikalisches hatte diese Arbeit an sich, rhythmisch Ausgewogenes und Tänzerisches. Ihre Gesichter glänzten vor Schweiß.
Federico war der Ältere von beiden. Er war einer von denen, die den Fremden aus dem Weg gehen. Vielleicht hatte er schon aufgehört, sie als Eindringlinge zu betrachten, aber noch nicht angefangen, eine Erwerbsquelle in ihnen zu sehen. Von fast gedrungenem Körperbau, war er typisch für einen Fischer dieser Insel, schmallippig, ein klein wenig verkniffen der Mund, lebhafte, intelligente Augen. Die Haut spannte sich, ausgedörrt von der Sonne über breite Backenknochen. Auf einmal entdeckte Pasquale den Kork.
»Ecco!« Einsam trieb er auf dem Wasser.
Erst beim Näherkommen bemerkte das Mädchen das schräg in die Tiefe führende Seil. Langsam begann Federico es einzuholen. Ein merkwürdiger Gegenstand näherte sich der Bordwand. Ein Bimsstein und nach ihm eine Glaskugel, dann wieder ein Bimsstein und eine Glaskugel, dann lange nichts. Immer schwerer zogen die Männer, ein Stein kam, er diente zum Verankern der Körbe an einer bestimmten Stelle und dann kam der erste Korb.
Er war leer. Nach einigen Metern der nächste, auch leer. Etwa sechs bis acht Körbe waren an einem Seil befestigt. Erst im vierten klapperten zwei Langusten mit ihren Scheren, im sechsten eine. In den Körben wurden wieder frische Köder befestigt. Fischteile in Schlingen aus Bindfaden, die sich von einer Korbwand zur anderen spannten, Köpfe mit herausquellenden starren Augen und aufgerissenen Mäulern, Schwänze und Mittelteile. Langsam, einem bestimmten Gesetz folgend, wurden die Körbe wieder ausgeworfen. Bimsstein, Glaskugel, Bimsstein, Glaskugel und zuletzt der Kork. In einem Halbkreis lagen sie nun wieder am Grund des Meeres und warteten auf neue Opfer.
Nachts fischen. Ein Treiben im Nichts. Weit entfernt schwebten die Lichter des Dorfs über dem Wasser. Rundherum schwarze Leere, aufgerissen durch die grell leuchtende Karbidlampe, die am Bug befestigt worden war und ihr Licht in die Tiefe schickte. Ihr Schein verlor sich mit einem diffusen Schimmer in der Tiefe.
Auf der Punta Imperatore blitzte es auf. Wieder und wieder. Laut rufend winkten die Männer zurück. Der Leuchtturmwärter schickte mit seinem Licht Grüße hinunter.
Pasquale sang, während er die Angelschnur auswarf, mehr laut als schön. Seine Stimme gellte über das Wasser, ohne irgendwo einen Halt zu finden. Auf und ab zogen seine Finger die Angelschnur. Manchmal holte er sie ganz heraus, schwang dann das kleine Bleigewicht mit den Haken ein paarmal durch die Luft und warf sie mit einer großen Gebärde wieder hinaus.
»Rema!«, befahl er dem Mädchen. »Rema! Rema!« Das war das Zeichen, dass sie rudern sollte. Ein dunkler Schatten huschte am Boot vorbei: ein Tintenfisch.
Tintenfisch ist eines der köstlichsten Gerichte auf der Speisekarte Süditaliens.
Signora Giuseppina war eine meisterhafte Köchin.
Nur zwei Fische erbeuteten Pasquale und das Mädchen in dieser Nacht. Jeder wog etwa ein Pfund. Widerlich wanden sich ihre Fangarme am Boden des Bootes. Rasch wechselten sie die Farbe: rot, weiß, rot, weiß. Pasquale ließ sie langsam sterben.
Am nächsten Morgen bat Giuseppina das Mädchen, das von ihr schon vorbereitete Essen auf den Weinberg zu bringen, wo die Lese begonnen hatte.
Sie wurde bereits sehnsüchtig erwartet.
Rofano, der Garten, bestand aus mehreren Terrassen. Im unteren Teil hatte man Obstbäume angepflanzt: Orangen-, Feigen-, Zitronen- und Granatapfelbäume. Der obere Teil bestand aus mehreren Terrassen voller Reben. Dazwischen stand ein altes verfallenes Haus, das fast die Bezeichnung Haus nicht mehr verdiente. Es bestand aus vier Wänden mit einer Decke, die auf einer Seite schon eingestürzt war. Doch es war tief in den Berg gebaut. Mächtige Keller beherbergten den langsam entstehenden Wein.
Gesang erklang aus der Tiefe. Federico und Pasquale kelterten. Mit nackten Füßen stampften sie die Trauben in einer wannenähnlichen Vertiefung. Im Takt marschierten sie auf der Stelle, eins, zwei, eins, zwei. Und dazu sangen sie. Das Lied schien ihnen die Arbeit außerordentlich zu erleichtern, denn sie strahlten. Vor der Vertiefung stand eine kleine Schüssel Wasser. Bevor die Männer in die Traubenwanne traten, tauchten sie ihre Füße kurz ins Wasser. Es war kaum mehr als die Idee einer Reinigung. Ihr Vater schöpfte indessen den so gewonnenen Traubensaft in einen kleinen Holzbottich, welchen er auf dem Kopf balancierend die Treppe hinauf- und gleich daneben wieder in den Raum mit den Fässern hinuntertrug. Aber ihr Onkel versicherte seiner Nichte stets, dass der Wein auf Ischia ganz ausgezeichnet war, süß, aromatisch und einer der köstlichsten, den er je getrunken hatte.
Tief unter dem Garten Rofano lag das Dorf, zum Teil verdeckt durch die vorspringende Terrasse eines Weinbergs. Nur der Torre und der schmale, ihn mit dem Dorf verbindende Sandstreifen waren zu sehen. Die Boote schienen klein, kaum länger als ein Finger.
Das Meer war ruhig, seine Fläche nur unterbrochen von Windflecken, der Horizont nicht erkennbar, dünne Schleierwolken verhüllten den Himmel. Die Hitze legte sich wie eine Decke über die Insel.
Irgendwann einmal waren die Ferien zu Ende. Während das Motorboot die Bucht verließ, nahm sich das junge Mädchen vor, nie die Farbe zu vergessen, die die Wellen annahmen, bevor sie an die Felsen des Torre schlugen. Blau, blaugrün bis zu einem hellen Türkis – Ischia.
Es war einmal auf der Insel Korsika (1957)
Die Insel Korsika war zuerst nur als dunkler Streifen am Horizont zu erahnen. Die Frau bildete sich ein, sie schon entdeckt zu haben, bevor sie wirklich als dünner Strich vor ihr aus dem Meer tauchte. Schon lange vorher hatte ihr der Wind als Willkommensgruß einen köstlichen Duft in die Nase geweht. Ihn schickte die Macchia, der Buschwald, der fast das ganze Land bedeckte. Er bestand aus Disteln, Wacholder, Ginster, Riesenfarn, Myrte, hochwachsender Erika, Mastix, Steinlorbeer, Buchs und Goldregen, aber auch aus Kamille, Pfefferminze, Eukalyptus, Rosmarin und Lavendel bedeckten fast überall das Land wie ein dichter, schwer zu durchdringender Pelz. Hie und da brachte ein schwerer Felsblock oder eine Gruppe von Korkeichen Abwechslung in die Eintönigkeit der Sträucherwildnis. Schon Napoleon hatte im Exil auf der Insel Helena festgestellt:
Mit geschlossenen Augen würde die Frau Korsika an seinem Duft erkennen.
Die Frau war mit einer Freundin und ihrem Motorroller unterwegs. Sie hatten Zelt, Schlafsäcke und das Kochgeschirr auf den Gepäckträger gepackt und waren einfach losgefahren. Das Schiff hatte sie zum Hafen von Île Rousse gebracht. Die Sonne war bereits untergegangen. Blaue, ins Violett gehende Schatten lagen zwischen den Hügeln. Hier, an der westlichen Küste hatte das Meer dem Land viele kleine Buchten abgerungen. Die Landzungen zwischen ihnen waren in der hereinbrechenden Nacht nur noch schwach auszumachen. Sie sahen aus wie dunkle Tiere, die gegen die Brandung kämpften. Ab und zu trugen sie verfallene Wachtürme auf ihren Rücken. In großen Kurven wand sich die Straße durch die Macchia. Ein Feuerschein unterbrach die Dunkelheit. Ein paar alte Korkeichen standen in hellen Flammen und das Licht war so grell, dass es die Frau blendete und sie langsamer fahren ließ. Warum brannten sie? Wer hatte sie angezündet? Wald brände gehörten zu den Besonderheiten von Korsika, die man sich nur von Fall zu Fall, jedoch nicht als ständige Erscheinung, zu erklären versuchte. Die einen meinten, es wäre Brandstiftung, die anderen, es wäre eine Glasscherbe und wieder andere waren der Ansicht, zündelnde Kinder wären schuld.
Calvi. Durch den Pinienwald, in dem sie ihr Zelt aufgestellt hatten, schimmerte die Zitadelle. Eine hohe Festungsmauer verdeckte einige Häuser, die über die Mauer zu quellen schienen, im Kampf um ein bisschen Platz. Calvi stand bis 1768 unter genuesischer Herrschaft. Aus dieser Zeit stammen die meisten Festungen und Wachtürme.
Ein kleiner Engländer ritt auf einem Holzbrett über die Wellen am Strand.
»Look, daddy«, rief er seinem Vater zu. »That's our treasure island!«
Schatzinsel, schoss es der Frau durch den Kopf. Eigentlich ganz zutreffend für Korsika. Nur, welchen Schatz meinte er?
Nach Ajaccio führte die Straße über unendlich viele Kurven.
Der Himmel bedeckte sich mit Schleierwolken. Am Nachmittag begann es zu regnen. Felsig, wild zerklüftet war die Küste. Sie war die ungeschützte Wetterseite Korsikas. Sogar die Macchia getraute sich nicht bis zum Ufer zu wachsen. Kleine verlassene Steinmäuerchen, verlassene Häuser und Hausruinen schienen von einer früheren, fruchtbareren Periode zu berichten, zugleich aber auch von großer Armut, die die Menschen gezwungen hatte, ihre Heimat zu verlassen.
Es hatte aufgehört zu regnen und wurde heiß. Stundenlang begegnete ihnen keine Menschenseele, kein Auto, kein Radfahrer, kein Fußgänger. Nur ein paar Schafe ruhten im Schatten eines Kastanienbaums oder drängelten sich um eine Quelle. Kein Hirte, kein Hund, nichts. Einmal trug der Wind Flötentöne über die Macchia. Gedanken Vergils.
Die Geschichte Korsikas war eine einzige Chronik der Unterjochung: Römer, West- und Ostgoten, Langobarden, Byzantiner, Franken, Sarazenen aus Nordafrika, Mauren aus Spanien und Genuesen haben die Korsen beherrscht. Es war ein Durcheinander an Überfällen, Herrschaftsansprüchen, friedlichen Abtretungen und verzweifeltem Bemühen um eine Lösung von der Abhängigkeit sowie Selbstständigkeit mit eigener Regierungshoheit.
Ajaccio, die Hauptstadt. Die Frau und ihre Freundin betrachteten das Geburtshaus des großen Korsen, Napoleon Bonaparte. Es war ein kleines, schmutzig-gelbes Häuschen in einer engen Gasse, das sich durch nichts von seinen Nachbarhäusern unterschied. Am Hafen flickten Fischer ihre Netze. Doch die Frau und ihre Freundin blieben nicht lange in dieser Stadt. Sie waren zum Schluss gekommen, dass die Sehenswürdigkeiten, die mit der menschlichen Kultur zusammenhängen, nicht ausschlaggebend waren für die Eigenart dieser Insel. Die Macchia, der Duft, die Korkeichenbäume und die Felsen, das war es.
Bonifacio. Sie schlugen am Golf de la Manza das Zelt auf. Es war eine große Bucht, sieben Kilometer entfernt von Bonifacio, drei Kilometer von der nächsten Quelle. Wasser war kostbar. In der Nacht weckte sie ein unheimlich tapsendes Geräusch. Schmatzend näherte es sich und entfernte sich wieder. Am Morgen jedoch entdeckten sie nur eine gemütlich grasende Eselfamilie: Hengst, Stute und ein kleines Fohlen. Wildgänse flogen in keilförmiger Formation über die Bucht.
Bonifacio am südlichsten Ende Korsikas war auf einem Felsen erbaut worden, der durch immerwährende Bewegung des Meeres von unten her langsam ausgehöhlt wird. Ein Teil der Zitadelle schwebte bereits über dem Abgrund. Ein altes Fischerboot ruhte sich mit zusammengerafften Segeln auf dem Wasser aus. Die Fischer hatten verwitterte, von Wind und Sonne gegerbte Gesichter. Die Frau stellte sich vor, dass ihre Urahnen früher einmal verwegene Piraten gewesen sein könnten. Sardinien lockte am Horizont. Sie fuhren weiter.
Kastanien- oder Olivenbaumalleen wechselten sich mit kleinen Salzfeldern oder moorigem Gelände ab. Der nackte Stamm der Korkeichen leuchtete in einem hellen, wunderbaren Rot. Auf der Suche nach einem Zeltplatz führte sie die Straße auf die Halbinsel von Picovaggia. Dort fanden sie einen Strand von einmaliger Schönheit: blütenweißer Sand und uralte Pinien. Das Meer hellgrün bis türkis, dazwischen feuerrote Steine. Bucht reihte sich an Bucht, davor im Meer weitverstreut die Gruppe der Iles Cerbicale. Die Frau lenkte ihren Roller landeinwärts in die Berge. Zweimal musste sie hart bremsen. Einmal brach eine Herde pechschwarzer Schweine, angeführt von einem mächtigen Eber aus den Büschen und überquerte die Straße. Das andere Mal hatte sich eine Gruppe Rinder die Straße als Ruheplatz ausgesucht. Gemächlich erhoben sie sich und ließen den Roller durch. Hier, im Inneren der Insel erlahmte der motorisierte Verkehr fast völlig. Kinder hüteten die langhaarigen, schwarzen Bergziegen. Die Böcke trugen große Hörner auf dem Kopf. Ab und zu sahen sie eine Frau auf einem Esel reitend.
Wovon lebten diese Korsen eigentlich? Ein kleines Reisebuch meinte, vom Korkhandel, von Obst- und Weinbau und von der Bienenzucht. Außer den Gärten rund um die Häuser gab es keine größeren bebauten Flächen. Natürlich lebten sie auch vom Fischfang und in den Bergen von der Jagd. Das musste ihnen genügen.
Corte, ehemalige Hauptstadt. In einem weiten Tal erhob sich ein schmaler hoher Hügel. Die Häuser klebten ähnlich Schwalbennestern an den Hängen ringsum. Die Zitadelle hoch oben beherrschte das Tal und sperrte das Inselinnere von der Öffnung zum Meer hin ab.
Die Frau lenkte ihr Gefährt nach Nordosten an die Küste und von dort nach Bastia. Sie musste sich beeilen, um das Schiff in Calvi um elf Uhr am Abend noch zu erreichen und wollte nur noch das Cap Corse umfahren, das sich wie ein mahnender Finger nach Norden ins Meer hin erstreckt. Und dort kamen sie wieder an brennender Macchia vorbei. Manchmal erstreckte sich die verbrannte Fläche etliche Kilometer an der Straße entlang. Es roch nach kokelndem Holz gemischt mit dem alten Macchiageruch.
Auf fast jedem Hügel stand ein alter genuesischer Wachturm. Sie standen in regelmäßigen Abständen, sodass Signale von einem Turm zum anderen gegeben werden konnten. Jahrhundertelang wurde so die Bevölkerung vor drohenden Gefahren gewarnt.
Wieder war es heiß. Kleine verfallene Kapellen und blühende Eukalyptusbüsche, das prägte sich ein, wenn man an Cap Corse dachte. Sie fuhren über St. Florent und die Balagne, den Garten Korsikas zurück, um pünktlich zum Verladen des Rollers wieder am Schiff zu sein. Sie aßen noch einmal zu Abend in einem kleinen Restaurant am Hafen. Wein, Weißbrot, Trauben und viel Käse. In der Nacht Abschied mit lautem Geschrei von Seiten der Zurückbleibenden und nicht minder lautem von denen der Abfahrenden. Nur der Monte Cinto winkte still herüber.
Blubb blubb, schlugen die Wellen an die Schiffswand. Das war nun also Korsika, die Insel, die von vielen Menschen die Insel der Schönheit genannt wurde; einer herben Schönheit, die man nur versteht, wenn man sie durchstreift, ohne Anspruch auf den Luxus, den uns die Zivilisation bietet. Dann öffnet sie sich und erzählt aus einem Schatz schöpfend ihre Geschichte.
War das das »treasure island« des kleinen englischen Jungen, der auf seinem Brett über die Wellen geritten war?
Es war einmal in den Bergen Montenegros (1957)
Es war einmal, dass die Frau, zusammen mit einer Studienkollegin, einem Zelt und einem alten Volkswagen nach Jugoslawien reiste. Damals hieß Jugoslawien noch Jugoslawien. Heute heißt es Slowenien, Bosnien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Herzegowina und Montenegro. Sie fuhren auf meist steinigen Straßen und durch mehrere Flüsse an der Küste entlang, und je weiter sie nach Süden kamen, umso weniger Ferienreisende begegneten ihnen. Manchmal bauten sie ihr Zelt auf einem Zeltplatz auf und schlossen Freundschaften mit anderen Zeltlern, mit den Zeltplatzwächtern, mit Hunden, Katzen und vielen Kindern. Sie besuchten Split und Dubrovnik, das früher Ragusa hieß, und Kotor mit seinem Golf. Sie kamen auch nach Sveti Stefan, der künstlichen Stadt auf einer Halbinsel bei Budva. Dort drehten sie um, weil die albanische Grenze ihnen die Weiterfahrt versperrte.
Von der kleinen Ortschaft Risan aus fuhren sie auf einem steilen Bergpass, vermutlich einem ehemaligen Eselssteig, in die schwarzen Berge, Crna Gora. Es schien, als wände sich die Straße in einer Felswand nach oben. Dort hielt die Frau ihr Auto kurz an. Tief unter ihr lag der Golf. Eingerahmt von einem schmalen fruchtbaren Küstenstreifen zwängte er sich zwischen die hohen verkarsteten Berge. Nach Nordosten zu kam es ihr vor, wie wenn sie sich in einer steinernen Wüste befänden. Kaum ein paar kümmerliche Sträucher brachten etwas Abwechslung in die Landschaft. Mondlandschaft. Nur selten stand neben der Straße ein Haus. Einen strengen, verschlossenen Eindruck machten die Leute hier. Nur die Kinder waren herzlich und freundlich wie immer. Sie waren pausbäckig, kräftig, immer fröhlich und zu Scherzen aufgelegt. Im Gegensatz zu den oft blassen Italienern waren diese hier kleine Lausbuben und Mädchen mit struppigem Haarschopf und fliegenden Zöpfen.
Einsam war es in den Hochebenen Montenegros und der Herzegowina, kalt, windig und einsam. Wenn sie nicht von vielen kleinen Schafherden ein wenig belebt worden wäre, wirkte die Landschaft, als ob sie im Totenschlaf läge. Doch die Schafe waren oft weit von der Straße entfernt und wenn sie sich niederlegten, passten sie sich mit ihrem schmutzig-weißen Fell fast vollständig der Landschaft an und schienen, wenn sie sich zur Ruhe legten, zu unbeweglichen kleinen Felsblöcken zu erstarren. Ab und zu standen armselige schindelgedeckte Steinhütten am Straßenrand. In solchen Momenten waren die von einem starken Wind gehetzten Wolken das einzig Bewegliche. Es schien den beiden Frauen ein vergessener Landstrich zu sein, vergessen von den Bewohnern großer Städte. Natürlich hatten sie schon von den Hochebenen Montenegros gehört. Doch sie hatten keine Vorstellung davon, wie es dort aussah. Niemand konnte begreifen, wie es dort aussah, wenn er sie nicht einmal durchquerte.
Da schlichen die Ferienreisenden an der Küste entlang, schimpften vielleicht über die vielen Steine, das Benzin und über alles, was ihnen sonst noch einfiel, anstatt sich einmal nur wenige Kilometer in das Innere des Landes zu wagen.
Es konnte sein, dass man mehr als eine Stunde durch die Berge fuhr, ohne auch nur dem Giebel einer einsamen Hütte, ein paar Schafen oder einem anderen lebendigen Wesen zu begegnen, und entdeckte plötzlich einen auf einer mageren Ponystute reitenden alten Bauern, hinter dem sein Packesel trottete und in einigem Abstand sein Hund. Und dann fuhr man nochmals eine Stunde, ohne einen weiteren Menschen oder eine Wohnstätte zu sehen.
Auf einem Hügel standen zwei Frauen und hüteten Schafe. Bis zu den Knöcheln reichende Fellcapes schützten sie vor dem scharfen Wind. Die Gesichter waren fast nicht zu erkennen, so sehr hatten sie sich in ihre Kopftücher gehüllt. Die eine strickte. Die andere spann Wolle. Sie glichen lebenden Denkmälern.
Für Motorfahrzeuge waren die Straßen nicht geeignet. Zweimal mussten die Frauen mit ihrem Auto Flüsse durchqueren. Oft waren sie lange in blökende, verschreckte Schafherden eingekeilt, manchmal waren es auch Ziegen oder eine Gruppe Eselstuten mit ihren Fohlen. Auf einfachen, mit je vier Ochsen bespannten Karren wurde das Heu eingefahren. Die Räder waren nur aus einer Baumscheibe gesägt. Plump erschienen sie und roh gezimmert und dennoch konnte man sich auf den steinigen Wegen dort oben kein anderes Fahrzeug vorstellen. Schwer mussten sie sein, schon des Windes wegen. Heugabeln waren abgeschälte Astgabeln. Landmaschinen gab es keine. Die Frauen trugen Pump- oder Pluderhosen, die an den Beinen ein Stück eingenäht waren. An den Schlupflöchern für die Füße war der Stoff zusammengerafft und fest um die Knöchel gebunden. Große Schritte konnten die Trägerinnen damit nicht machen. Sie ähnelten denen von gefesseltem Vieh. Diese Hosenröcke oder Rockhosen waren fast immer aus einem Stoff gemacht worden, der schon lange aus der Mode gekommen war, um schließlich von einer montenegrinischen Bäuerin zu einer Arbeitshose verarbeitet zu werden. Dazu trugen sie meistens ein großes, bis in die Kniekehlen fallendes Kopftuch, mit dem sie rasch ihr Gesicht verschleiern konnten, wenn sich ihnen ein Fremder näherte, denn je weiter man ins Innere des Landes kam, umso häufiger traf man auf Leute muslimischen Glaubens. Da hockte doch eine einsame Schafhirtin auf einem Felsen am Straßenrand und strickte. Das Mädchen, eifrig bemüht auf ihre Schafe zu achten und keine Masche fallen zu lassen, versäumte es den Fahrweg zu beobachten, auf dem sich ihr ein Auto näherte. Vielleicht hatte sie das Motorengeräusch auch überhört, weil ihr dieser harte, unerbittliche Wind so in den Ohren sauste, dass sie nichts bemerkte. Plötzlich erblickte sie dann das Auto und mit einer Hast, hinter der Angst zu stecken schien, schlang sie blitzschnell das Tuch um ihren Kopf, bis nur mehr ein schmaler Schlitz für die Augen offen blieb. Es bedeutete für sie die Einhaltung eines strengen muslimischen Gebotes und zugleich die Errettung ihrer Seele vor Sünde und Strafe.
In den kleinen Ortschaften standen Moscheen neben christlichen Kirchen und verfallende muslimische Friedhöfe neben denen von Christen. Gegen Sarajewo zu mehrte sich jedoch die Anzahl der Moscheen und christliche Kirchen sah man nur noch selten. Gegen Abend wurde die Landschaft wieder grün. Die Frau seufzte erleichtert auf. Vereinzelt tauchten grüne Felder zwischen den Steinen auf. Das empfand sie wie ein Geschenk. Die Bauernhäuser hatten am Giebel abgeschrägte Schindeldächer und kleine Balkone zogen sich rund um sie. Hier stand ein Baum und dort stand einer. Die grünen Felder grenzten aneinander, wurden zu Weiden, auf denen ab und zu auch Kühe oder Pferde grasten. Für eine Strecke von dreihundert Kilometern hatten die beiden Frauen ohne zu rasten ungefähr den ganzen Tag benötigt. Sie fanden es gut, dass es solche Straßen noch gab. Sie zwangen dem Besucher eine genauere Betrachtung der Gegend auf. Später schrieb die Frau das alles in ihr Tagebuch und bekämpfte damit die Angst, all diese Eindrücke wieder zu verlieren.
Was zurückblieb, war die Erinnerung.
Es war einmal in Apulien (1958)
Zu jener Zeit war es üblich, seine Ferien in Italien zu verbringen. Venedig, Florenz, Rom, Neapel und die Insel Capri waren begehrte Urlaubsziele. Doch über die Ostküste, den Sporn des Stiefels und den Absatz wussten nur wenige Leute Bescheid. Zwei Frauen war es wichtig, mehr darüber zu erfahren. Sie liehen sich ein winzig kleines Auto, packten ihr Zelt, das Kochgeschirr und was man sonst noch alles so zum Zelten braucht hinein, und fuhren los. Beiden erschien es wie ein Wunder, dass es in einem so viel besuchten Land Europas noch Landstriche geben sollte, die kaum bekannt waren, obwohl es dort einige der schönsten Kirchen Italiens gab. Sie fuhren über Ancona und Pescara, doch so richtig begann ihre Reise erst in der Stadt Termoli. Enge Gassen über grauweißen Häusern, der Gestank nach Fisch, heißem Olivenöl, Tang und Schweiß, menschlichem und tierischem Kot, dazu Kindergeschrei und von irgendwoher die Klänge eines jammernden und scheppernden Grammofons und außerdem die Menschen und ihre Lebensart, die für die Frauen das Besondere des Süditalienischen verkörperte. Die Italiener liebten die Straße und die Piazza. Schon der Norditaliener zeigte diese Neigung offen, viel mehr jedoch der Süditaliener. Kinder spielten, schrien, aßen, schliefen, erledigten ihre körperlichen Bedürfnisse auf den Straßen, während ihre Väter vor Bars und Cafés politischen Gesprächen nachgingen, die Mütter ihre Wäsche am öffentlichen Waschtrog wuschen und die Großmütter still mit dem Strickzeug im Schatten ihrer Häuser hockten. Oft wurde dort auch gekocht oder ein Kind gewickelt. Den beiden Frauen drängte sich manchmal der Eindruck auf, wozu denn überhaupt Häuser dastanden, wenn sich das ganze öffentliche Leben doch hauptsächlich auf der Straße abspielte.
Eine der Frauen hatte den Einfall, mit dem kleinen Auto zum Strand zu fahren, um zu baden, wobei das Auto bei der Rückfahrt im Sand stecken blieb. Seine Räder wühlten sich rasch bis zur Achse in den Sand. Die verzweifelte Lage hatten spielende Kinder beobachtet. Sie rannten fort und holten Hilfe. Schon bald umringten mehrere Männer das kleine Auto. Sie sparten nicht mit guten Ratschlägen. Doch erst als zufällig ein Maultierkarren vorbeikam, änderte sich die Lage. Das Muli wurde kurzerhand vor das kleine Auto gespannt und in weniger als fünf Minuten befand es sich wieder auf festem Boden. Keiner der Helfer wollte Geld. Sie waren fast beleidigt, als sie es angeboten bekamen.
»Siamo amici« – schreibt uns eine Postkarte, wenn ihr wieder daheim seid! Das war alles.
Links und rechts der Straße nach Süden erstreckten sich endlose Olivengärten. Selten, eigentlich nie waren sie eingefriedet, jeder Garten hatte jedoch als Einlass ein großes gemauertes Tor. Diese Tore waren häufig barock verschnörkelt und von wahrhaft höfischem Prunk. Am Anfang erwarteten die Frauen oft ein kleines Schlösschen oder einen vornehmen Landsitz dahinter zu entdecken, eines von jenen Landgütern, in denen adlige Familien lebten und die Boccaccio in seinem »Decamerone« so meisterhaft beschrieb. Meistens gab es aber nur einen schmaler Pfad und dahinter eine Hütte.
Ölbäume, was wäre der Süden ohne sie? Uralte, oft zopfartig ineinander verflochtene Stämme, fächerten sich in viele gedrehte Äste auf, die auf Umwegen dem Licht entgegenstrebten. Die schmalen lanzettförmigen Blätter hatten helle, fast weiße Unterseiten, die, durch den leisesten Lufthauch bewegt, jenes silbrige Blitzen verursachten, das viele Maler schon abzubilden versucht hatten. Es brauchte nur eine kleine Bewegung und die Spur des Windes war auf den Kronen der Bäume abzulesen.
Die erste der berühmten normannischen Kathedralen stand in Termoli, die nächste in Troia, dann kam Barletta, Molfetta, Canosa di Puglia, Trani, Bitonto, und auf der Strecke zwischen Foggia und Manfredonia das ehemalige Hospital der romanischen Kirche: San Leonardo.
Später, wenn die Frau sich an die apulischen Kirchen zu erinnern versuchte, so gelang ihr das nie, ohne die apulischen Kinderscharen mit ihnen in Verbindung zu bringen. Immer wenn sie mit ihrer Freundin eine Kirche besichtigen wollte, errieten Scharen von Kindern ihr Vorhaben schon bei der Einfahrt in die Ortschaft. Mit lautem Gejohle und Geschrei liefen sie hinter dem kleinen Auto her, was leicht war, da man wegen der engen Gassen und dem Verkehr nur langsam fahren konnte. Mussten sie anhalten, um sich nach dem Weg zu erkundigen, standen sofort mindestens drei Jungen auf jedem Trittbrett und versuchten sich selbst zu überschreien. Und waren sie schließlich vor dem Portal der Kirche angelangt, hatten einen schattigen Parkplatz gefunden in der Absicht auszusteigen, dann ging es erst richtig los. Einer bot sich an, auf das Auto aufzupassen, ein anderer die nächstliegenden Sehenswürdigkeiten zu zeigen, der Dritte wollte Postkarten verkaufen und alle anderen, die nichts anzubieten hatten, vereinigten sich in Sprechchören: »Dieci Lire! Dieci Lire! Sigarette! Sigarette!«
Als das beste Mittel erwies sich, einen der stärkeren Jungen zu beauftragen und ihm ein Trinkgeld zu versprechen, wenn es ihm gelänge, die beiden Frauen vor seinen Freunden zu beschützen. Es war auch die beste, wenn nicht einzige Methode zu verhindern, dass ihnen die ganze Meute durch die Kirche nachlief. Dabei war es ihnen gleich, ob dort gerade eine Hochzeit gefeiert, ein Trauergottesdienst abgehalten oder eine Messe gelesen wurde. Trotz alledem waren es sehr nette Kinder und die beiden Frauen führten viele ergötzliche Gespräche mit ihnen. Viele von ihnen waren blond und hatten blaue Augen.
Manchmal, wenn die Frau ihr Malbuch zur Hand nahm und zeichnete oder aquarellierte, schauten sie ihr zu und beobachteten genau, was auf dem Papier geschah.
»Jetzt malt sie unser Haus und jetzt das Schiff von Roberto.«
Einmal sagte ein kleines, etwa zehnjähriges Mädchen traurig: »Jetzt hat sie das Haus gemalt, in dem Elisa gestern gestorben ist.«
Danach waren sie eine Weile still.
Auf der Suche nach einem ruhigen Badeplatz erreichten die Frauen eine unweit der Straße gelegene Bucht. Einsam und allein stand da ein Fischerhaus, eines jener Häuser, die wie rechteckige Kästen aussehen und direkt auf einen Felsen gebaut worden waren. Ausgenommen eines kümmerlichen Feigenbaumes, der sich schattensuchend an die Hausmauer drängte, war weit und breit keine Vegetation zu sehen. Nur Steine. Die absolute Stille während der glühenden Mittagshitze und die ausgewaschenen porösen Felsen, in denen Tausende von versteinerten Muscheln wie einzementiert waren, verstärkte den unheimlichen, drohenden Eindruck. Hinter dem Haus hockte eine alte Frau und schälte Nüsse. Während ihre Hände mechanisch die Arbeit verrichteten, ging ihr Blick ins Leere, durch die beiden Frauen hindurch. Sie hätten sich gleich denken können, dass sie von ihr keine Antwort erwarten konnten.
Nach einiger Zeit tauchte die Frau des Fischers auf und zeigte ihnen nicht nur den besten Badeplatz in der Bucht, sondern lud sie auch zum Mittagessen ein. Etwas entschuldigend meinte sie, es gäbe aber nur Fisch. Zögernd erzählte sie von sich und ihrer Familie. Ihr Mann war Fischer und ihr ältester Sohn war auf dem Meer verunglückt. In das zwanzig oder fünfundzwanzig Kilometer entfernt liegende Bari kam sie nur selten. Zum Laufen war der Weg zu weit und der Bus zu teuer. Was sollte sie auch dort? Ihr Mann verdiente nur das Notwendigste, das sie zum Leben brauchten, gerade so viel, dass sie nicht hungern mussten. Außer dem Feigenbaum besaß sie keinen Garten. Trotzdem hatte sie nichts Eiligeres zu tun, als den beiden Frauen zum Abschied ein Körbchen Feigen zu schenken. Eine Bezahlung lehnte sie entschieden ab.
Arbeitslosigkeit, Armut und Elend waren die anderen, die schlimmen Seiten Apuliens.
Das berühmteste und meistbesuchte Denkmal des Landes war das ehemalige Jagdschloss des Staufers Friedrich des Zweiten, Castel del Monte. Die Straße dorthin führte zunächst ein Stück am Meer entlang, später nach Westen abbiegend durch die weite apulische Ebene, die von einer roten Hügelkette begrenzt wurde. Dann, auf einer kleinen Erhebung: Castel del Monte. Die steinerne Krone Apuliens, wie sie lange Zeit genannt wurde. Ein achteckiger Bau mit seinen achteckigen Wehrtürmen. Achteckig waren auch der Felsendom Jerusalems, die Pfalzkapelle in Aachen und nicht zuletzt die Krone Friedrichs, von dem niemand weiß, ob und wie lange er sich jemals in diesem Schloss aufgehalten hatte.
Den Frauen ging es wie vielen Besuchern, sie kannten es von vielen Fotos und waren trotzdem überwältigt, als sie davorstanden. Kein Schnickschnack, keine Verzierungen, nur beeindruckende kahle Kalksteinmauern. Klein und verloren stiefelten die beiden Frauen durch die Säle, erbettelten sich vom Custoden den Schlüssel für die Tür, durch die sie aufs Dach kamen und standen schließlich vor dem weiten Ausblick auf die apulische Ebene. Wenn Friedrich der Zweite jemals dort gewohnt haben sollte, dann hatte im wahrsten Sinne des Wortes die Welt zu seinen Füßen gelegen. Es war ein Ausblick, wie ihn seine Falken liebten, wenn er mit ihnen jagen ging. Andria und Canosa di Puglia im Nordosten, im Osten hinter dem Dunst verborgen das Meer, im Südosten Bitonto und Bari und im Westen, weit sich ausbreitend, das Band der Abruzzen. Das waren die kleinen Punkte, die die Frauen kannten und die in ihrer Sichtweite lagen. Friedrichs Reich war viel größer.
Als sie das Schloss verließen, hatte auf den großen Steinblöcken, die um den Bau herumlagen, eine Winzerfamilie ihr Mittagsmahl ausgebreitet. Hammelfleisch gab es und dazu den köstlichen Wein, der auf den Hügeln des Castel del Monto wächst.
Es war einmal in den Bergen Südtirols (1960)
Es waren einmal ein Mann und eine Frau. Sie waren weit gefahren, hatten ihr Auto im Tal abgestellt und waren zu einer Hütte aufgestiegen, wo sie mehrere Tage bleiben wollten. Einmal wollten sie auch eine Skitour machen.
Sie standen früh auf, doch die Berge lagen noch im Dunkeln, als sie die Hütte verließen.
»Es ist warm«, sagte der Wirt, der mit ihnen vor die Tür getreten war. »Das Wetter wird umschlagen.«
Die Hütte stand auf einem flachen Felsen. Von der Terrasse aus hatte man einen guten Blick auf die Gletscher jenseits des Tals.
»Findest du auch, dass es heute besonders warm ist?«, fragte die Frau ihren Begleiter.
»Bis Mittag hält das Wetter auf jeden Fall«, entgegnete der Mann.
Mit klammen Fingern schnallten sie die Felle unter die Skier.
»Glaubst du, dass wir über den Steilhang gehen können?«
»Das kommt auf den Schnee an.« Der Mann zog eine Lederschlaufe über die Skispitze, stemmte das Fell gegen die Hüttenwand und zurrte es fest. »Bist du so weit?«
»Ja.«
»Dann geh vor, aber langsam!«
»Geh lieber du vor!«
»Nein. Ich bleib hinter dir. Fang bloß nicht zu rennen an!«
Der Himmel am östlichen Horizont wurde hell. Die Frau suchte sich aus dem Gewirr der Spuren diejenige aus, die ihr als die Beste erschien und lief los. Am Anfang waren ihre Beine noch steif. Sie fror.
»Geh langsam!«, rief der Mann hinter ihr. »Sonst wirst du zu schnell müde.«
Sie bemühte sich langsamer zu gehen. In der hartgefrorenen Spur fanden die Felle wenig Halt. Immer wieder rutschte ein Ski zurück.
»Verdammt!«
»Das wird gleich besser, wenn die Sonne herauskommt«, tröstete sie der Mann.
Die Frau betrachtete die vor ihr liegende Spur. Sie folgte ihr mit den Augen, bis sie hinter der nächsten Bodenerhebung verschwand und überlegte dabei, wie viele Stunden sie wohl unterwegs sein würden. Hinter ihr ging die Sonne auf und tauchte die obere Kante der Felswand in Licht. Langsam verfärbte sich der Himmel und die violetten Schatten der Dämmerung verblassten allmählich.
Sie hatten jetzt beide den richtigen Rhythmus gefunden: links – rechts – links – rechts. Außer dem Raspeln und Schleifen der Skier auf dem verharschten Schnee war nichts zu hören.
Hoffentlich halte ich durch, dachte die Frau. Vor ihr ragte der Steilhang auf. Es kam ihr vor, als würden sie gegen eine Wand anrennen.
Ich habe Angst. Sie versuchte an etwas anderes zu denken. Gestern waren wieder, wie an jedem schönen Tag, viele Touristen zu ihrer Hütte aufgestiegen. Sie hatten sich, erschöpft vom langen Anstieg und stöhnend vor Hitze, auf der Terrasse breitgemacht. Einige hatten sich mit dem Wirt unterhalten, andere bevorzugten ein Sonnenbad. Der Mann und die Frau konnten nicht wissen, dass man sie während der Abfahrt über den Gletschern mit dem langen Fernglas beobachtet hatte, das auf der Terrasse stand. Sie hatten Aufsehen erregt, als sie verschwitzt und müde die Hütte erreichten.
»Ein Bier und einen Liter Teewasser, bitte!«