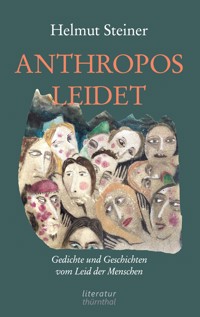Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es sind Geschichten wie das Leben und der Tod sie schreiben. Traurige, tragische, heitere und manchmal auch skurrile Geschichten, die uns berühren, verzaubern oder nachdenklich stimmen. Ob an der Donau, in der Fabrik, im Büro, im Rechenzentrum oder im Gasthaus, es sind immer die Menschen, die im Mittelpunkt der Erzählungen stehen, einfache Leute, deren Taten und Eigenheiten uns bewegen und Erinnerungen in uns wecken. Kraftvoll, spannungsgeladen, ausdrucksstark und inspiriert von zeitgenössischer Kunst, durchleuchtet der Autor gute, helle und dunkle Seiten des Daseins anhand des Schicksals unterschiedlichster Charaktere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor
Helmut Steiner, 1956 in Krems an der Donau in Niederösterreich geboren, wuchs in einer Arbeitersiedlung am Stadtrand von Krems auf. Er studierte in Wien und verbrachte danach mehrere Jahre in Deutschland. Er lebt und arbeitet in Thürnthal (NÖ).
In jungen Jahren als Musiker und Komponist aktiv, hat er über das Schreiben einen neuen Zugang zu kreativem Schaffen gefunden und bedient mit Lyrik und Prosa ein breites Spektrum der Literatur. Nach den Romanen „Wahnviertel“ und „Die Monate mit ‚R‘“ ist „Moiras Fäden“ der erste Kurzgeschichtenband des Autors. Mit „Novemberwind“, „Zwischen den Zeilen“ und „Klageliedern“ liegen bereits drei Gedichtbände vor.
Inhalt
Donauliebe
Der Ort zum Sterben
Verlorenes Leben
Der Gustl
Im Korb
Schwarmintelligenz
Die Phosphormadonna vom Schaffernak
Vom Bertl
Capitan Supercoin
Nachtschicht
Einmal schlecken wir noch
Die Pamperletsch - Files
Prolog
Merket auf, der Phäaken erhabene Fürsten und Pfleger,
Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet.
Jetzo, nachdem ihr gespeist, geht heim, und legt euch zur Ruhe.
Morgen wollen wir hier noch mehr der Ältesten laden,
Und den Fremdling im Hause bewirten, mit heiligen Opfern
Uns die Götter versöhnen, und dann die geforderte Heimfahrt
Überdenken: damit er, vor Not und Kummer gesichert,
Unter unserm Geleit, in seiner Väter Gefilde
Freudig komme, und bald, er wohn' auch ferne von hinnen;
Und ihm nicht auf dem Weg' ein neues Übel begegne,
Eh' er sein Vaterland erreicht hat. Dort begegn' ihm,
Was ihm das Schicksal bestimmt, und die unerbittlichen
Schwestern
Ihm bei seiner Geburt in den werdenden Faden gesponnen.
Homer, Odyssee, siebenter Gesang 185 – 200.
Sowohl in der Ilias als auch in der Odyssee spinnt das personifizierte Schicksal Moira seine Fäden. In der Literatur nach Homer treten die Moiren meist als Dreiheit auf. Klotho spinnt den Lebensfaden, Lachesis teilt ihn als Los zu und Atropos durchtrennt ihn unabwendbar.
Donauliebe
Ruhig wälzte der Strom seine Wasser durch das von bewaldeten Hängen gesäumte Tal. Hoch über den lang gezogenen Dörfern am rechten Ufer stiegen schroffe Felswände aus der herbstlichen Farbenpracht des Mischwaldes. Von der Witterung gekrümmte Äste einzelner aus Felsspalten und steilen Gräben ragender Föhren kratzten am strahlend blauen Himmel.
Buntes Weinlaub leuchtete von den Terrassen der Hügel am linken Ufer. Auf sonnenbeschienenen Steinen kunstvoll geschichteter Trockenmauern reckten Eidechsen ihre Leiber der letzten Wärme der Jahreszeit entgegen.
Wo früher mit Mühe und Schweiß der Natur jedes Fleckchen fruchtbarer Krume abgerungen wurde, lohnte sich der Weinbau nicht mehr und die obersten, mit Traktoren nicht erreichbaren Stufen lagen brach.
Bussarde zogen weite Kreise durch die klare Herbstluft und über den Wegen durch die Obstgärten zwischen den Dörfern flatterten Falken auf der Ausschau nach Beute.
Im knietiefen Wasser entlang des flach abfallenden Ufers trieb ein alter Mann mit seiner Zille. Größere Flusskiesel pochten an die Scheuerleisten des Bootes. Der Alte lehnte das Stechruder neben seinen Gehstock an die Sitzbank, griff nach der mit Eisenspitze und Haken beschlagenen Schubstange und stieß die Zille aus dem seichten Wasser der Schotterbank in die stärkere Strömung. Er kauerte sich aufs Stur zwischen hinterer Bank und Steuerstock und lächelte zufrieden, als der sanft schaukelnde Bug des Bootes, der Granzlstock, sich langsam stromab drehte.
In der Schifffahrtsrinne kroch ein rumänisches Schubschiff mit dumpf stampfendem Motor stromauf.
Die Bordwände der schwer mit Erz beladenen Frachtkähne reichten kaum einen Fuß hoch über die Wasserkante.
„Ein alter Diesel aus Magdeburg“, murmelte der Alte, „ein Wunder, dass der noch läuft.“
Schon als Kind war dieses Geräusch Teil seines Lebens am Strom und mit dem Strom gewesen. Es schwebte über dem Wasser. Wenn es mit dem Klang der Gegend verschmolz, entlang der Hänge rollte, von Felsen zurückgeworfen wurde und sich als breiter Teppich über das Tal legte, wirkte es beruhigend.
Früher wurden die Lastkähne von Schleppern an Seilen gezogen, oft in einem Gespann mit einem Schleppkahn voran und zwei oder drei nebeneinander gespannten Kähnen dahinter. Er erinnerte sich an ein riesiges Holzschiff, eine Siebnerin, die vor dem Kremser Hafen am Ufer verrottete, als er noch ein kleiner Junge war. Aus längst vergangenen Zeiten vernahm er das Getrampel dutzender Pferde vom Treppelweg, hörte das Geschrei und die Flüche der Schiffsleut´, die einen Schiffszug stromaufwärts treidelten, über den Strom hallen.
Singende Autoreifen und das Geheul eines Motorrads rissen ihn zurück in die Gegenwart.
„Ich liebe den Klang, den du dem Tal schenkst!“, rief der alte Mann, „Wo auch immer ich auf dieser Welt gewesen bin, er war stets bei mir!“
Die Zille schaukelte bedrohlich über die kurzen Wellen des Schubverbands und er stellte sie mit dem Stechruder quer zur Strömung.
„Ich kenne nicht nur den Klang, den du der Gegend verleihst, sondern auch deine eigene Sprache. Als ich jung war und mit meinen Freunden in dir schwamm, tauchten wir unsere Köpfe unter Wasser und lauschten dem Rauschen des Geschiebes und dem Rumpeln großer Steine am Grund.“
Vom Ufer zurückgeworfene Wellen vereinigten sich mit ihren vom hinteren Schiffsrumpf gezeugten Schwestern zu tanzenden Wasserkegeln, die gegen die Planken der Zille klatschten. Rasch verflachte der Reigen und das Boot trieb wieder ruhig im Strom.
Ächzend ließ der Alte sich auf der Bodenstreu, dem Lattenrost am Zillenboden nieder und lehnte sich an die Sitzbank: „Wenn das Leben mir Streiche spielte, sich unlösbar scheinende Aufgaben vor mir türmten, Einsamkeit an mir nagte, Traurigkeit mich plagte und ich nicht wusste, wie es mit mir weitergehen würde, suchte ich deine Nähe. Allein dein Anblick flößte mir wieder Ruhe und Zuversicht ein.
Oft habe ich Steine am Ufer gesammelt und deine Kunst bewundert, ihnen über Jahrtausende hinweg Anmut und Ebenmaß zu verleihen. Wie hohl, leer, kurzlebig und unwichtig dagegen mein Treiben als Mensch sich ausnahm.
Du hast mir die Vergänglichkeit von erfolgsheischendem Gedränge und Gezänk, die Sinnlosigkeit selbstgefälligen Strebens nach Geld und Macht gezeigt und mich von engstirnigen Querelen befreit. Wie reich und glücklich du mich mit schönen, bunten, von Streifen durchzogenen, skurril geformten Kieseln gemacht hast! An deinem Ufer hat die Zeit sich verloren und ich habe den Hauch von Ewigkeit gespürt.“
„Manchmal bin ich im Winter die Hügel hoch gewandert, habe dich von oben betrachtet, wenn in der Morgensonne glitzernde Eisschollen auf dir getrieben sind und du in der Jännerkälte gedampft hast. Wenn an trüben Tagen dünne Rauchsäulen aus den Schornsteinen schlafender Dörfer in den Nebel gestiegen sind, hat die Schneedecke die Struktur der Landschaft gemalt, die Zeilen der Weingärten geschrieben, Ränder und Wege der Obstkulturen gezeichnet und reifbedecktes Geäst der Bäume und Sträucher hat das Grau kurzer Wintertage erhellt.“
„Ich konnte ohne dich nicht leben! Ich sehnte mich nach dir. Du warst meine heimliche Geliebte. Eigentlich bist du das noch immer!“
„Wie friedlich du jetzt ziehst, voll der Schönheit und Harmonie, vor der selbst die Weiden heute ihre Häupter neigen.“
„Ich kann auch wild sein!“, tönte es aus der Tiefe.
Der Alte erschrak, stutzte und klammerte sich ängstlich an die Planken: „Du sprichst zu mir?“
„Nur wenige verstehen meine Worte“, flüsterte die Donau.
„Ich weiß, wie wild, ungestüm, gewaltig und zerstörerisch du sein kannst. Ich habe es selbst erlebt, sah mit eigenen Augen, wie entwurzelte Bäume, aufgeblähte Rinder und totes Wild in den reißenden Fluten trieben, Gedärme und Abfälle aus Schlachthöfen in umspülten Ästen schaukelten, Treibholz und Hausrat sich in den Auen türmten.“
„Dann ahnst du, was ich mit wild meine?“
Der Alte zeigte auf ein Steingebäude am rechten Ufer: „An diesem Haus ist eine Hochwassermarke über dem Fenster im ersten Stock. Ich bin schon sehr alt und habe in meinem langen Leben viel gesehen, aber ich bin froh, diese Flut nicht erlebt zu haben!“
„Die Menschen wollten mich immer zähmen. Jetzt glauben sie, es sei ihnen gelungen. Aber sie bauen nichts von Dauer. Wozu ich wirklich imstande bin, liegt außerhalb ihrer Vorstellungskraft!“
Der Alte nickte zustimmend: „Als ich jung war, war ich auch wild und ungestüm. Ich wollte, dass die Welt weiß, dass es mich gibt und zeigte ihr das auch! Dann sollten die Jahre der Zähmung folgen. In den Köpfen geisterte damals noch die Vorstellung von der Narrenfreiheit der Jugend herum und dass diese Freiheit mit der Jugend enden müsse, die Hörner abgestoßen seien, um endlich erwachsen zu sein und ins grausige Korsett unsinniger Verpflichtungen zu schlüpfen. Das funktionierte bei mir nicht. Verzeih mir bitte, wenn ich das so sage, aber ich schwamm immer gegen den Strom.“
„Jetzt lässt du dich mit dem Strom treiben?“, fragte die Donau.
Er lächelte: „Vieles von dem, was ich wollte und mir vornahm, habe ich erreicht. Von manchem musste ich ablassen, weil ein Menschenleben kurz ist und ich jetzt alt bin. Das ist schade. Aber ich bin zufrieden und brauche mich nicht mehr gegen den Strom zu stemmen. Jetzt will ich in dir treiben und deine geheimnisvolle Stimme hören. Sie klingt angenehm. Vielleicht erzählst du mir etwas über dein Leben?“
„Ich bin noch jung“, begann die Donau, „Als die afrikanische Platte die Alpen aus dem Tethysmeer gefaltet und später die flache Landmasse nördlich der Alpen angehoben hat, ist ein großer Strom entstanden, der die flachen, brackigen Wassergebiete im Norden gefüllt hat und träge zum Meer im Westen geflossen ist. Der Einschlag eines Meteoriten hat die Hebung des Schwarzwaldes beschleunigt und mich von Schwester Rhone und Bruder Rhein getrennt. Ich musste mich nach Osten wenden und mündete unweit von hier ins Meer.“
„Es ist seltsam, wie du dich durch das harte Gestein hier geschnitten hast.“
„Bevor ich mein Bett hier schnitt, floss ich durchs Altmühltal, dann formte ich das Yspertal und das Weitental und fraß mich durch die Wachau. Wenn die Böhmische Masse sich weiter hebt, werde ich wohl wieder weiter nach Süden weichen.“
Der Alte schmunzelte schadenfroh, als er sich Sankt Pölten am Grund der Donau ausmalte.
„Hast du Ziele?“
„Wie jedes Gewässer strebe ich dem Meer zu. Das ist meine Bestimmung als Fluss. Aber ich bin Wasser und Wasser hat kein Ziel, es läuft in Kreisen. Es fällt aus den Wolken, es friert, ruht an den Polen, schmilzt, taut, plätschert aus Quellen, murmelt in Bächen, rauscht in Flüssen und Strömen, füllt Seen, Meere, Ozeane und verdampft; immer wieder und immerzu!“
„Menschen vergehen und Wasser bleibt“, seufzte der Alte.
„Wohin geht deine Reise?“, fragte die Donau.
„Wir treiben ins versunkene Land meiner Kindheit, meine Zille und ich.“
„Wo liegt dieses Land?“
„Es hat hier begonnen. Jetzt existiert es nur mehr in meiner Erinnerung. Es ist durch den Bau des Kraftwerks Altenwörth verschwunden.“
„Ich kannte dieses Land. Es war wunderschön!“, schwärmte die Donau.
„Ein Paradies!“, flüsterte der Alte und zeigte ans rechte Ufer: „Hier sind wir stromaufwärts gelaufen, um bei der weißen Mauer das andere Ufer zu erreichen, wenn wir dich überquert haben. Deine Strömung war stark und wir wurden weit abgetrieben. Von der weißen Mauer gab es einst einen Wassergraben zur ‚Bauernlacke‘. Die Lacke ist dem Damm der Schnellstraße zum Opfer gefallen. Wie hässlich das neue künstliche Ufer ist! Wo früher undurchdringlicher Dschungel die Pfeilerlacke und die Offizierslacke umwuchert hat, liegt jetzt der breite Damm des Stauraums. Er hat unsere Badeplätze an den Altwassern und Ausständen unter sich begraben. Im strahlend weißen, feinen Sand haben wir Tröpferlburgen gebaut, uns in der Sonne gewärmt, wenn wir im Frühsommer bibbernd aus dem kalten Wasser gekrochen sind. Auf versteckten Lichtungen spielten wir Fußball, bauten Baumhäuser und schaukelten auf Lianen.“
Er rieb sich die Augen: „Dort drüben ragten Findlinge aus dem Wasser. Hinter ihnen öffneten sich Buchten mit breiten Sandstränden. Wir schnitzten Schiffchen aus Weidenholz und ließen sie im Kehrwasser der Buchten treiben. Als ich älter wurde, lernte ich dort die Liebe kennen.“
Er lächelte wehmütig: „In der zweiten Bucht habe ich zum ersten Mal ein Mädchen geküsst.“
„Dein Fischreichtum ernährte viele hungrige Mäuler. Wochentags wurde hier am Abend mit Daubeln gefischt, das waren Hebenetze an gekreuzten Stangen. An Samstagen trafen die Fischer sich nach dem Fang am Morgen an einer Feuerstelle in der Au, schröpften die Weißfische, rieben sie mit einer Mischung aus Mehl, Salz und Paprika ein und grillten sie als Steckerlfisch. Mit Weidenbutten am Rücken radelten sie in die Stadt und verkauften die knusprigen, noch warmen Fische.“
„Heute werden bei Festen Makrelen gegrillt, ein Trauerspiel!“
Die Zille trieb langsam unter der neuen Donaubrücke durch: „Nichts mehr an dem trostlos monotonen Ufer mit dem asphaltierten Weg erinnert an die Mündung der Krems, in der ich schwimmen lernte. Im Schilf ihres verschlammten Uferbereichs tummelten sich Bisamratten und Ringelnattern. Vor der Mündung lag eine Insel, die sich stromaufwärts bis zur weißen Mauer erstreckte und in trockenen Sommern runter bis zum Hafen reichte. Niedrigwasser brachte rostige Fliegerbomben und Panzerfäuste zutage.“
Er wischte Tränen von seinen Wangen und faltete seine Hände: „Ich danke dir für das glitzernde Eis im Jänner, für die Eisschollen, auf denen wir im Februar über die Lacken stakten, für die dampfende Au im Frühling, für die unbeschwerten Sommertage und von Unkenkonzerten gefüllten Sommernächte meiner Kindheit und meiner Jugend! Ich danke dir, dass du immer in meinem Leben da warst, wenn ich dich brauchte!“
„Ich bin noch immer bei dir und ich spüre die Reinheit und Vollkommenheit deiner Liebe!“
„Mit letzter Kraft bin ich heute in meine Zille gestiegen, um bei dir zu sein. Meine Knochen sind morsch und mein Herz schlägt nur noch schwach.“
„Willst du mich zum Meer begleiten?“, fragte die Donau.
„Das wäre wunderschön“, flüsterte der Alte, „aber werden die vielen Stauräume und Schleusen an den Kraftwerken uns nicht daran hindern?“
„Kümmere dich nicht um solche Kleinigkeiten. Vertraue mir, ich bringe dich sicher ans Ziel!“
„Du kennst mein wahres Ziel?“
„Ich weiß, dass du Charons Obolus mit dir führst!“
Langsam ließ die Zille den Betonsilo am Kremser Hafen hinter sich und am glatten Wasser schimmerte das Spiegelbild des Schlosses Wolfsberg über dem kleinen Dorf Angern. Am letzten Ausläufer des Dunkelsteinerwaldes kündigte die Wetterkreuzkirche das nahe Traisental an.
„Wie wird das Ende sich anfühlen?“
„Du wirst es nicht spüren!“
Der alte Mann zog eine Goldmünze aus seiner Rocktasche, legte sie auf seine Zunge und schlief in den Armen seiner Geliebten ein.
Lisette Rosenthal BARKEN
Der Ort zum Sterben
Niemand wollte damals gern ins Krankenhaus.
„Ins Spital gehst du warm hinein und kalt, mit den Füßen voran, tragen sie dich raus!“, sagten die Alten.
Vor fünfzig Jahren ging das Sterben schneller als heute. Viele starben lieber zu Hause als im Krankenhaus, unspektakulär, still und ohne Aufsehen.
Doch jetzt lag er ermattet von monatelangem Fieber da, im kahlen Zimmer mit acht Betten, im Spital, an dem Ort, den keiner wirklich mochte. Ratlos, wie die beiden Ärzte, zu denen er zuvor gepilgert war, hatte der dritte Arzt ihn für eine Woche zur Durchuntersuchung ins Krankenhaus geschickt.
„Vielleicht finden die was. Die haben mehr Möglichkeiten“, waren die Worte des Mediziners gewesen.
Das alte Krankenhaus, ein einstöckiges, lang gestrecktes Gebäude im ländlichen Vorort der Stadt, steht heute noch. Winzig erscheint es gegenüber dem Klotz des Neubaus, der heute auch schon in die Jahre gekommen ist. Seine Krankenzimmer und Untersuchungsräume waren einfachst ausgestattet, das Zeitalter der Gerätemedizin lag noch in weiter Ferne. In Reih und Glied fädelten Betten und blecherne Schränkchen für die persönlichen Habseligkeiten sich aneinander. Weithin sichtbar verrieten mit Kreide beschriftete schwarze Tafeln am Gestänge der Aufrichthilfen Namen, Vornamen, Alter und Krankheiten oder kranke Organe der Patienten.
Am Bettende hing ein Klemmbrett mit seiner Krankenakte, einer Sammlung handschriftlich ausgefüllter Formulare. Am Deckblatt fletschte die Fieberkurve ihre Zähne. Fünf ebenmäßige, messerscharfe Zacken, 37,3 Grad am Morgen und abends 38.
Am zweiten Blatt, inmitten unleserlicher Hieroglyphen stand das Wort Milieu, gefolgt von großem Fragezeichen. Wahrscheinlich wegen seiner langen Haare, die damals immer von der Schulmedizin mit exzessivem Suff und Drogenrausch in Verbindung gebracht wurden.