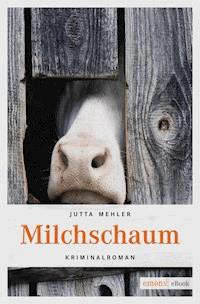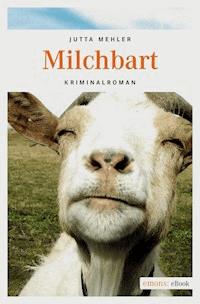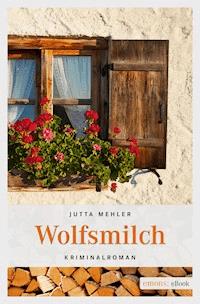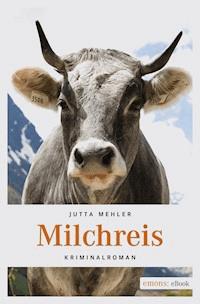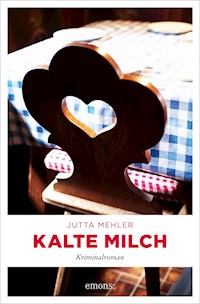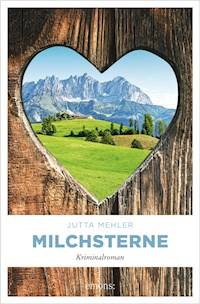Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Moldau ist für die zehnjährige Friederike Habel und ihre Geschwister nichts weiter als ein kümmerlicher Bach, an dessen Ufer sich ihr Leben abspielt. Ein Leben, das karg und entbehrungsreich ist, aber auch glücklich und sorglos. Doch dann bekommen auch sie im tiefen Böhmerwald die Auswirkungen der Machtübernahme durch die Nazis zu spüren. Nach dem Krieg werden Friederike und ihre Familie mitsamt der traumatisierten Jüdin Esther, der sie Unterschlupf gewähren, vertrieben. Auf der deutschen Seite der Grenze finden sie eine neue Heimat; hier ist das Leben nicht weniger karg und fließt doch weiter wie ein sich windender Fluss. Vor dem Hintergrund des sich erholenden Nachkriegsdeutschlands bis hin zur Wiedervereinigung beschert es den Habels Kind um Kind und lässt den Habel'schen Familienclan stetig wachsen. »Moldaukind« ist tragikomische Familiensaga und Episodenroman zugleich - rau, eindringlich und bewegend erzählt, kunstvoll und kühn konstruiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser Roman basiert auf tatsächlichen Ereignissen; die Figur der Friederike Habel und ihre Geschichte sind in weiten Teilen authentisch. Auch die Figur der Mari ist zu einem Gutteil wahr, wenn ihr vielleicht auch Worte in den Mund gelegt wurden, die sie nie gesprochen hat – durchaus aber hätte sprechen können. Andere Figuren sind ebenfalls authentisch, jedoch bis zur Unkenntlichkeit verändert; andere wiederum sind frei erfunden.
© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Ulrike Strunden eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-562-4
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
»WARUM PACK ICHS NICHT AM KRAGEN, die Mari, und hau ihr eine Watschen rein? Nein, gleich zwei hau ich ihr rein, eine links und eine rechts. Das hätts nämlich überhaupt nicht braucht, dass sie dem Fritzerl die zuckerte Milch wegsauft, die wo ihm die Mutter extra hergerichtet hat, weil er so winzig klein ist und so klapperdürr. Und dann, dann hats noch das neue Schürzerl haben müssen, die Mari, das von dem geblümelten Stoff, das wo die Mutter eigentlich mir genäht hat. Sie hats haben müssen. Alles muss sie immer haben, die Urschel.«
Friederike schnieft und wischt mit dem Ärmel den Rotz ab, der trotz heftigen Hochziehens an der Nasenspitze kleben bleibt. Im Wasser der Moldau wellt sich ihr Spiegelbild: dünne Zöpfe, ovales Gesicht, das Näschen leicht himmelwärts gebogen. Friederike ist zehn Jahre alt. Sie schnieft noch einmal, ganz leise.
»Ich darf ihr gar keine reinhauen, der Mari, und zwei schon gar nicht. Nämlich weil die Mari gestraft genug is mit ihre Krüppelfüße und … und weil mir alle Gottes Kinder sind, denen wo das verboten is, dass sie wem wehtun.« Bittere Tränen tropfen ins Moldauwasser.
Brav, Friederike, gutherzig und sanftmütig!
Das wird dem lieben Gott gefallen. Besonders weil es dir so schwerfällt.
SMETANA WAR ES, DER DIE MOLDAU so richtig berühmt gemacht hat.
»Mein Vaterland« heißt der Orchesterzyklus, das instrumentale Glaubensbekenntnis Smetanas, in dem er die Moldau ehrt und preist. Er hatte schon 1874 die erste Terz davon im Ohr, aber erst fünf Jahre später war das gesamte Werk fertig.
Smetana selbst war inzwischen taub und irre.
Der Zyklus umfasst sechs sinfonische Dichtungen. Eine davon nannte er »Die Moldau«. Flöten murmeln wellengleich, folgen plätschernd dem Fluss durch Dörfer und Wälder. Bässe donnern, wenn die Fluten über die St.-Johannis-Stromschnellen toben. Posaunen und Trompeten feiern des Stromes ruhige Majestät auf seinem Weg durch Täler und Auen.
Für Friederike Habel und ihre Geschwister und die Hand voll Arbeiterkinder aus dem Fabrikhaus ist die Moldau nur ein kümmerlicher Bach am Waldrand. Viel zu seicht zum Baden im Sommer. Gefährlich im Frühjahr, wenn das Schmelzwasser daherrauscht und droht, den Holzschuppen wegzuschwemmen. Fast verschwunden im Winter, zugeschneit, zugeweht, zugefroren.
Nütze ist es zu gar nichts, das Moldauwasser: zum Trinken nicht, ja nicht einmal zum Wäschewaschen, weil ein langes Rohr aus der Papierfabrik scharfen, gelblichen Schleim aushustet und über die Böschung ins Moldaubett spuckt und ockerfarbene Schauminseln im ruhigen Kehrwasser zurückbleiben.
Als Fischwasser taugt es auch nicht, obwohl immer noch ein paar zählebige Bachforellen darin springen. Das Fischefangen ist nämlich bei Strafe verboten und strengstens untersagt und überhaupt nicht erlaubt, und der amtsmäßige Jagdaufseher Heger passt auf wie ein Schießhund.
Friederikes jüngster Bruder, das dreijährige Fritzchen, schaut gebannt zu, wie der Heger die Angelschnur durch die tieferen Gumpen schleift, wie er in Stiefeln, die bis an den Hosenschlitz reichen, im Bachbett auf und ab stakst.
Über Nacht setzt Fritzchen das Geschaute in Geplantes um, und schon tags darauf legt er selber los: Er baut die Angel aus Zweig und Schnur, stellt sich breitbeinig in die flache gelbe Pfütze unter der Uferböschung und schwenkt sein Schnürl in die schwache Strömung.
Seine Augen fixieren starr den rostigen Nagel am Ende der Angelschnur, der als Haken dient. Reglos stiert er aufs eintönig murmelnde Gerinne, und die gleitenden Wellen ziehen Klein-Fritzens Seele mit sich fort. Unbewusst neigt er sich ihnen zu, kippt ihnen entgegen und schlägt hart auf. Wasser rauscht ihm in den Ohren, schwallt ihm in Mund und Nase. Er strampelt und rutscht und schluckt und quirlt mit den Ärmchen.
Zum Glück passt der Heger auf wie ein Schießhund.
Friederike tätschelt dem Brüderchen den Hinterkopf, dort wo die Haare noch nass sind und sandig: »Sin mir froh, dass dich der Heger noch derwischt hat. Dot wärst jetz, Jessmariaundjosef.«
Sie verdreht die Augen dorthin, wo sie die Angerufenen vermutet, und schüttelt vehement den Kopf, dass die mageren Zöpfe fliegen: Voll bitteren Vorwurfs mahnt Friederike die göttliche Instanz, in Zukunft besser aufzupassen auf die kleinen Gotteskinder.
Friederike muss sich setzen: Furchtbar wär das gewesen! Sie sieht den Kindersarg vor sich, ein weißes, steifes Fritzchen drin und die Mutter weint und der Vater humpelt hinter dem Sarg her und ist ganz grau im Gesicht und alle Geschwister sind still und traurig und können es nicht fassen, das Unglück. Und die Maria, die scheinheilige Wurzen, hängt sich tränenreich an die Else dran.
Aber das kannst glauben, versichert sich Friederike selbst, dass die Mari ganz innen drinnen schadenfroh grinsen tät.
Friederike verscheucht das makabre Bild, besinnt sich auf Demut und Dankbarkeit: Jessmariaundjosef, dankschön, dass ihr das Fritzerl am Leben lassen habts, is ja gut ausgangen alles.
Friederike rückt zum Fritzerl an den Tisch und patscht ihm, den guten Abschluss dieser Episode besiegelnd, auf das aufgeweichte Händchen.
Wieder mit sich selbst im Lot fädelt sich Friederike in den Habel’schen Alltagsrhythmus ein: Sie zieht einen der Papierstapel auf dem Tisch ganz nah an sich heran und beginnt zu falzen und zu kleben. Die fertigen Tüten lässt sie in eine Pappschachtel mit dem Aufdruck »Papierfabrik Franzenstal« flutschen.
Wie den Kulissenwechsel auf der Theaterbühne, ganz genau so würde ein Zuschauer den Wandel in der Habel’schen Küche erleben, säße er Tag um Tag vor der Küchenfensterscheibe, würde er Stund um Stund Friederike und ihre Geschwister und die Habeleltern beobachten.
Neue Requisiten leiten zum nächsten Akt und wieder neue zum übernächsten und immer weiter. Ein Schauspiel ohne Ende, ohne Anfang. Unverändert bleiben Ort und Spieler, täglich wiederholen sich die einzelnen Szenen:
Fünf der sechs Habelkinder teilen sich den Platz am Küchentisch, üben Schönschrift und Rechnen. Else, die Älteste, spielt wochentags nicht mehr vor der heimischen Kulisse. Sie näht in der Hemdenfabrik Seidensticker in Winterberg Manschetten an die Ärmel von Oberhemden, neun Stunden lang am Tag.
Wäre der Gaffer am Küchenfenster Telepath, dann könnte er Friederikes Gedanken lesen, die sich vom Einmaleins weg zu Else an die Nähmaschine (Marke Singer mit Tretantrieb) gestohlen haben: »Jessmariaundjosef, da brauchts eine Geduld dazu, viel mehr als wie beim Tüten-Zammpappen, und genau musst da sein, wie beim Schwammerlputzen, so genau.«
Vier der Habelkinder schreiben und rechnen, Fritzchen malt windschiefe O in Blau.
Vorhang: Die Hefte sind dem Nudelteig gewichen oder dem Kartoffelteig, der breitet sich auf der Holzplatte aus, wellt sich über den Scharten. Mutter Habel rollt ihn mit dem Nudelholz aus. Der Teig wird so dünn wie das braune Papier aus der Fabrik, und Hermine schneidet Rechtecke daraus.
Bloß wegen ihre Krüppelfüß, flüstern Friederikes Gedanken, während sie Apfelschnitze auf die Teigfleckchen legt, lasst ihr die Mutter das hingehn, der Mari, dass sie da in der Ecken sitzt und vom Teigrand runterzupft. Jetz dreht sies zu ein Kugerl zamm, die Teigbatzerl, und mampfts rein. Tät mich nicht wundern, wenn ihr die Hermine ein bisserl nah hinkommen tät an die frechen Finger mit dem frisch gwetzten Messer. Die Hermine, die lasst ihr nämlich nix durchgehn, der Mari. Wenns schon Geißbockfüß hat, sagt die Hermine, dann muss sie ja nicht auch noch ein Mistviech werdn, und recht hats, die Hermine.
Die Rainstritzel verlassen den Küchentisch und verschwinden im Backrohr.
Vorhang: In einer Blechschüssel auf dem Fußboden hocken Pilze für den folgenden Aufzug, schon um fünf Uhr morgens wurden sie dem dampfenden Waldboden entrissen, anderen Mäulern weggeschnappt. Rudi hat einen ganzen Korb voll hereingebracht. In der kleinen Senke zwischen den Zwillingsfelsen hat er die Pilze gefunden.
Da traut sich sonst keiner hinkraxeln als wie der Rudi, tuscheln Friederikes Gedanken, während sie das spitze Schwammerlmesser aus der Schublade angelt, drum wachsen sie da gar so übermütig her, die Braunkapperl, weil keiner hinkommt. Aber auf einmal is der Rudi da, und dann ghörn alle uns. Der Rudi, das is einer, der traut sich überall raufkraxeln. Grad jetz is er aufm Hausdach oben und putzt die Dachrinne aus, weils immer übergeht, wenn ein Gwitterregen kommt.
Sie warten auf ihr Stichwort, die Pilze, bangen vor dem spitzen kleinen Messer, das ihnen die Würmer herausbohrt, die Erde abschabt und sie zu Schnitzelchen hackt.
»Viele Hände machen schnell ein Ende«, feuert Mutter Habel ihre Mädchen an und zwingt im nächsten Akt die Krautköpfe aus dem handtuchgroßen Habel’schen Anteil vom Gemüsegarten unter den Hobel.
Im Interesse des Stapels Schürzen im Eckbank-Eck steht zu hoffen, dass die Nudeln bald im Wasser köcheln, die Pilze auf den Sieben trocknen und das Kraut in der Salzlake schwitzt, sodass der Tisch samt einem Paar Hände frei wird und es ans Plätten geht.
Vorhang: Vater Habel humpelt in die Küche. Er stützt sich auf zwei selbst gebastelte Holzkrücken. Vater Habel wäscht sich die Hände in einer Emailleschüssel voll warmer Seifenlauge, dann fährt er dem Fritzchen über den hellen Schopf und setzt sich an den Tisch zum Essen.
Vorhang: Für das Knäuel löchriger Strümpfe im Stopfkorb sieht das Publikum die Chancen für einen Auftritt schwinden, denn unnachgiebig belagert das steife braune Papier aus der Fabrik das Habel’sche Heim.
Ein Ende gibts da gar nicht, sinnt Friederike, weil wir so viel Sackerl nie nicht zammpappen können, wie die Fabrik alle Tag rauslasst aus ihrem Tor – bloß am Sonntag, da is eine Ruh.
Endlose, raschelnde Papierströme ergießen sich täglich ins Arbeiterhaus. Gefaltet, zu Säckchen in allerlei Größen zusammengeklebt, gebündelt und gezählt fließen sie zurück und mutieren am Ende des Monats zu einem winzigen Betrag, der sich als »plus siebzig Normzahlpacken Heimarbeit« in Vater Habels Lohntüte wiederfindet.
Friederike hat von Gezeiten, von Ebbe und Flut, noch nie etwas gehört, das hat der Lehrer, der Klöpp, noch nicht durchgenommen, und einen Ozean hat Friederike auch noch nicht gesehen, trotzdem ist ihr das Tidenphänomen in modifizierter Form durchaus vertraut: Jeden Samstagabend ebben die Wogen aus platten braunen Rechtecken, die von der Fabrik her kommen, ab, der Nachschub versiegt, bis am Montag eine neue Flut einsetzt.
Am Samstagabend glänzt die Tischplatte blank gescheuert unter frisch gewaschenen Leibchen, sauberen Strümpfen und Schürzen, denen der penetrante Geruch nach Klebstoff und Schwefeloxid herausgeschrubbt wurde.
Ein ovaler Holzzuber beherrscht am Samstag die Szene: zehn Eimer Wasser – Friederike zieht es schmerzhaft in den mageren Armen, wenn sie an die Schlepperei vom Brunnenhäusl über den Hof durch das Stiegenhaus an sieben anderen Wohnungstüren vorbei bis zur Habel’schen Küche denkt.
Ein Eimer Wasser füllt jeweils die zwei Töpfe auf dem Herd. Sobald das Wasser darin heiß ist, darf es in den Zuber schwappen. Die ersten vier Portionen müssen fast sieden, weil sie, vorschnell abgekühlt, die letzten dadurch verderben würden.
Immer sitzt die Mari als Allererste drin, geht es Friederike im Kopf herum, weil die was Besonders ist, nicht einmal das kleine Fritzerl lasst sie mit rein.
Erst wenns dann fertig is, die Madam, dann is zufrieden, und dann tuts mordsgönnerisch, wenn mir drankommen. Mir anderen baden zu zweit; das könnt keiner erwarten, bis alle sechs durch sind nacheinand, und kalt wärs auch längst, das Wasser. Ich bad am liebsten mit dem Rudi, bestätigt sich Friederike still, der wascht sich und steigt raus, und ich nehm das Fritzerl herein zu mir und kann noch ein bisserl sitzen bleiben, bis die Else und die Hermine herdrücken. Bei denen muss die Mutter sowieso immer dreinfahren, weils so kreischen und spritzen, und das Baden, das gehört doch zum Sauberwerden und nicht für die Gaudi.
Auf ihrem Strohsack im Nebenzimmerchen verschläft Friederike die weiteren Akte vor der Kulisse »böhmisches Bad«: Mutter Habel gießt noch einen Napf voll heißen Wassers in den Zuber nach, raspelt mit dem Fingernagel ein paar Seifenflocken hinterher und zaubert damit die Illusion eines frischen, dampfenden Schaumbades.
Ein allerletztes Mal schöpft sie aus ihrem Vorrat, dem Wasserschiff an der Herdseite – diesem winzigen, neben der Kochstelle eingelassenen Bassin, das gerade mal einen Liter fasst. Dann lässt sich der Habelvater ächzend in die – nüchtern besehen – von sechs Vorgängern angedunkelte Brühe sinken. Er hängt das Bein mit der offenen, periodisch eiternden Wunde an der Schnittstelle, die das Schicksal seines Fußes besiegelte, über den Zuberrand, und Mutter Habel platziert stabilisationshalber die Stuhllehne unter seine Wade.
Im Schlussbild sitzt Mutter Habel selbst im Zuber und schrubbt sich ab in der trüben, schlierigen Kernseifenlauge.
An der ostseitigen Wand der Wohnküche, diesem Mittelpunkt des Habel’schen Daseins, klebt ein kleiner Verschlag, wo die sechs Habel’schen Kinder aufgereiht in drei Betten schlafen.
Seufzend rollt sich Friederike vom mittleren, rettet ihren Strohsack vor einnehmenden Armen und bettet sich auf die Erde. Sie gibt ja doch keine Ruh, die Mari, bis sie nicht das Bett allein hat, weiß Friederike aus Erfahrung und grummelt im Halbschlaf: Die Mari schiebt und drückt und kratzt und lamentiert umeinander, bis dass ich mich lieber am Boden hinleg, und morgen möcht sie mir weismachen, dass sies im Schlaf gmacht und gar nix gmerkt hat davon.
»Dirndln«, schnauft die Mutter an einem dieser Herbsttage im Jahre des Herrn 1933 mit einem schnellen Blick über die linke Schulter. Sie meint Friederike und die drei Jahre ältere Hermine, die in der angeschlagenen, von den Pilzen befreiten Blechschüssel die Lehmbröckchen aus Fritzchens Hose spült. »Warm und trocken, wie das heut is, müssts ihr um eine frische Streu ausrücken.«
Das Stroh vom Vorjahr ist in den derben Leinensäcken, auf denen die Kinder schlafen, schon zu Bröseln zerfallen. Die Mädchen schütten es in den Ziegenstall: Ein bisschen Ziegenpisse soll die Streu noch aufsaugen, um dann zu guter Letzt den Gemüsegarten zu düngen.
Hermine und Friederike füllen die Säcke frisch auf und binden sie auf der Rückseite ganz locker zu, sodass jeder gut hineingreifen kann in seinen Strohsack, denn der muss geformt werden, zu Mulden geklopft und zu Hügeln gebauscht, umgearbeitet zum Negativ des schlafenden Körpers.
»Die Nachthaferln sind noch nicht ausgleert«, quäkt Mari von der Eckbank herunter, wo sie an einem Zuckerklümpchen lutscht.
»Jessmariaundjosef«, erheischt sich Friederike die Aufmerksamkeit der Heiligen Familie, »darf die Mari den ganzen Tag kommandieren?«
»Die Else, die hat sich heut schon wieder abgspatzt«, geifert die Mari unbeirrt weiter.
»Auf den Fritzerl schaut sie auf, dass er nicht wieder wo reinfallt, du Gscheithaferl«, fährt ihr Hermine über den Mund.
»Wo werd sie denn den Zuckerbatzen wieder herham, die Mari«, rätselt Friederike flüsternd, »so klein, wies ist, aber ausgfuchst für drei.«
Friederike angelt zwei Nachthaferl unter den Betten hervor und tappt damit vorsichtig die steile Treppe hinunter. Käsig riecht er, der Urin von den Buben, und Blasen sind drauf, und ein Schleimbatzen schwimmt drin.
Im anderen Nachttopf, die Else und die Hermine haben ihn sich geteilt, leuchtet es rot wie Himbeersaft, und obenauf schwimmen drei oder vier ersoffene Fliegen – reingelegt. Friederike kippt das Resümee einer Nacht in die runde Aussparung des von vielen Hintern abgewetzten Sitzbretts.
»Was tätn mir ohne die Nachthaferln«, murmelt Friederike, »endsweit is das von unserer Wohnung bis zum Abort, finster und eiskalt bei der Nacht. Und dann könnts noch sein, wennst endlich da bist, dass schon ein anderer draufsitzt aus dem Haus, und dann kannst herwarten.«
Eine lange Reihe von Mitbewohnern, sieben Familien, genau gesagt, samt Großmüttern und einer beständig wachsenden Anzahl von Kindern, windet sich als potenzielle Toilettenblockierer durch Friederikes Gedankengänge.
»Der Fritzerl und die Mari«, sieht Friederike ganz klar, »die könnens gar nicht allein. Der Fritzerl, der kann da überhaupt noch gar nicht drauf, der tät glatt durchfalln durch das Loch, bis runter in die Grubn.«
Friederike schaudert und hat das Entsetzliche vor Augen: Fritzerl segelt ungebremst zehn Meter weit hinunter in die Güllegrube, unrettbar verloren, erstickt und ersoffen in zähflüssiger Scheiße. Ein schauerlicher Tod, hie und da schon gestorben.
»Jessmariaundjosef, dankschön für die Haferln«, besinnt sich Friederike auf Demut und Dankbarkeit.
Was hupfts denn rum wie ein Schachterlteuferl, die Mari, auf ihre verdrehte Füß, wundert sich Friederike, und bevor sie zum Fragen kommt, sieht sie den Vater schon mit der blechernen Henkelkanne in der Ellenbeuge am Brunnenhäusl vorbeihumpeln. Mari stolpert neben ihm her.
Dann gibts eine Brittsuppen aufd Nacht. Friederike läuft das Wasser im Mund zusammen.
Herbst ham mir, lacht sie, da schlachten die Bauern in Außergefild, und da holens den Vatern. Extra mit dem Ochsengspann holens ihn ab, wo er doch nimmer so weit gehen kann mit die Krücken. Der Vater kanns halt am allerbesten, das Sauabstechen. Kein Tröpferl Blut bleibt drin in der Sau, wenn der Vater sticht.
Vor zwei Jahren, erinnert sich Friederike, hat der Vater die Mari das erste Mal mitgenommen, obwohl sie da erst sechs war, aber schon genauso durchtrieben. An diesem Abend haben dann die Habel’schen eine Brittsuppe gegessen, die war dick wie ein Gulasch, und obendrauf sind noch drei Blutwürste geschwommen. Seitdem geht die Mari zu jedem Schlachten mit. Keiner achtet auf sie den ganzen Tag bei der vielen Arbeit, und sie hockt blankäugig neben dem Kessel, in dem die Blut- und Leberwürste gesotten werden.
Dem Bauern und der Bäuerin süßelt Mari ins Gesicht: »Eine fette Sau habts ihr, mei, so eine feiste.«
Wenn keiner herschaut, sticht sie eine Wurst nach der andern auf.
Der Bauer blafft: »Legts nicht so viel Holzscheiter unter, die Würscht platzen.«
Wie schwach das Feuer auch brennt, die Würste platzen weiter, und die Suppe wird immer dicker.
Als Lohn für das Saustechen macht die Bäuerin dem Habel die Henkelkanne voll Suppe aus dem Kessel.
Wie die Mari dann noch ganze Würste hineinpraktiziert in das Habel’sche Abendessen, das gibt sie nicht preis, aber feiern lässt sie sich für ihre einzigartige Geschicklichkeit:
»Da bin ich wieder recht«, streicht sie es den Geschwistern hin, »gewieft muss man da sein, vom Dummschaun hupft keine Wurst in die Kann.«
»Jessmariaundjosef«, haucht Friederike einsichtig, »dann dank ich halt schön, dass mir die Mari ham, die wo uns zu einer dicken Brittsuppen verhilft.« Und ganz ehrlich gesteht sie sich selbst: Nicht einmal den äußersten Zipfel von einem Sauschwanzerl könnt ich abliefern daheim, wenn er mich mitnehmen tät, der Vater, weil mir tätens das schlechte Gewissen bis beim Schürzenbandl anmerken, wenn ich bloß hinlangen tät auf eine Blunzen. So kommts halt, grübelt Friederike, dass ich noch nie beim Schlachten dabei gwesen bin. Aber ich kenn mich trotzdem besser aus wie die Mari, die gafft in Sudkessel rein wie die Natter ins Mausloch und ist auf die Lumperei aus. Aber mir, mir hats der Vater ganz genau erklärt, wies hergeht beim Schlachten. Das ist nämlich eine Kunst, das Sauabstechen und das Blutrührn. Da is schnell was verdorben, wenn einer pfuscht.
Fein, Friederike, gut aufgepasst und völlig richtig im Köpfchen behalten! Das Sauschlachten ist eine Wissenschaft: Die Sau, das verlangt die fach- und artgerechte Tötung, muss gründlich betäubt werden, als Allererstes, und zwar mit einem gezielten Schlag auf die Schläfe. Fatal kommt es, falls der Hieb das Ohr trifft, denn das bringt die Sau dermaßen zum Quieken, dass man bis Pilsen hören kann, wer hier gepfuscht hat. Der sofort zu setzende präzise, quasi der goldene Stich in die schweinerne Halsschlagader lässt auf der Stelle bis zu drei Liter Blut in einem Schwall hervorbrechen. Mit Fettstückchen und Bindemittel angereichert und natürlich scharf gewürzt, ergibt das gut zwei Dutzend pralle Blunzen. Bei einem Stümperstich würgt die Sau knapp einen matten Liter Blut heraus, den Rest kann der betretene Schlächter, zu Kügelchen geronnen, von den zukünftigen Bratenstücken pflücken.
Selbst nach einem gelungenen Stich bleibt er jedoch flüchtig, der Mühe Lohn. Alles ist verdorben, wenn das aufgefangene Aderlassprodukt nicht schleunigst und kräftig verquirlt wird, ohne Rast und Pause, bis das rote Lebenselixier kalt ist und nicht mehr stocken mag. Wie ein Wilder muss man mit dem Kochlöffel kreisen und Achter schlagen in der blutgefüllten Wanne, sich zu Spitzengeschwindigkeiten steigern: Nur allerheftigstes Rühren bringt hyperaktive Thrombozyten zum Erlahmen.
Trickreich werfen manche Blutrührer ein paar Handvoll Schnee – soweit schon vorhanden mitten im Herbst – in das tückisch instabile Plasma, damit es schneller erkaltet, was den verklumpungsgeilen Thrombozyten das Mütchen kühlt.
Nur ein Könner bringt die schweißtreibende, kitzlige Angelegenheit zu einem glücklichen Ende, legt den Grundstock für exzellente Würste.
Wie jeder chirurgische Eingriff, sei es eine Resektion oder eine Transplantation, verlangt auch das Schlachten höchste Verantwortlichkeit und akkurates, hygienisches Arbeiten bis zum Ende: Die Würste brauchen nämlich noch eine Haut, und zwar eine saubere. Gerade dafür hat die Sau gut zwanzig Meter Darm im Bauch.
Vertrauenswürdig, reinlich und integer muss derjenige sein, der die Gedärme putzt, der sie wäscht und umstülpt, ihnen den Schleim und das Verdaute aus dem Saumagen wegrubbelt, bevor das inzwischen köstlich Sämige hineingefüllt werden darf.
Vater Habel ist der geschickteste aller Hausschlächter. Fast fünfzig Säue sticht der Vater von Oktober bis Weihnachten, dank Maris Spaß an Lug, Betrug und Dieberei eine fette Zeit für die Habel’schen.
»Dirndln«, hechelt die Mutter über dem Herd, wo sie Vater Habels eiterverklebte Verbände auskocht, »waschts euch die Füß noch ab, unten im Bach, dass die nicht so grindig herschauen morgen, wenns nach Krumau gehts.«
Friederike scheuert mit Moldausand um die schwarz unterlegten Zehennägel herum: Wenn mir doch eh barfuß gehn, sind mir eh gleich wieder staubig bis zu die Knie rauf. Mei, weit is das schon, und dann noch eine gute Stund mit dem Zug, bloß dass mir dann in Krumau sin.
Hermine springt auf zwei Moldausteinen hin und her. Ihr Haar, dicht, glänzend schwarz und steif wie ein Rossschwanz, wippt in der Sonne, ein scharfer Kontrast zu den dünnen, gräulich gelben Federn auf Friederikes Kopf.
»Lang wollt ich schon nach Krumau rein, was da alles zum Sehen gibt, der Lehrer hats doch erzählt. Die Else, grad neidig is, hats selber gsagt, weils schon aus der Schul is und nicht mitfahrn kann.«
»Neidig is schon wer anders«, rückt Friederike das Bild zurecht, »wie drei Teufeln schauts heut schon den ganzen Tag, die Mari.«
»Die braucht sich gar nicht so anstelln, ab zehn Jahr alt wird mitgangen, hat der Lehrer gsagt, und kein Tag jünger«, wettert Hermine.
»Die Mari giftet sich halt«, sagt Friederike, »weil sie genau weiß, dass sie so alt gar nicht wern kann, dass sie Stund um Stund bis auf Winterberg zu der Bahnstation gehen könnt mit ihre verkrüppelte Haxen.«
»Ja können da mir was dafür«, regt sich Hermine auf, »die kann doch froh sein, die Kranzeljungfrau, die ausgefranste, dass mirs ham operieren lassen in Prag, sonst täts jetzt noch auf die Knie rumrutschen wie noch vor zwei Jahr. Jeden Groschen hat er zammkratzt, der Vater, sein Radl hat er verkauft, damits ihr ihre Füß grad richten, die Doktorn. Da wars eh vier Wochen in Prag, die Mari, brauchts nicht auf Krumau!«
Es war schon immer notig hergegangen bei den Habels. Die Eheleute stammen beide aus Seehaid, einem So-um-die-zwanzig-baufällige-Häuser-Kaff im Böhmerwald. Seehaid liegt dicht an den Goldenen Steig drangeduckt, auf dem Gesindel und ehrbare Händler, wie auch immer sie sich unterscheiden mögen, den Grenzkamm der Bayerwaldberge zwischen Lusen und Dreisessel überschreiten.
Hart am Lusengipfel vorbei, ein paar Steinwürfe von der Moldauquelle entfernt, schwappen die Grenzgänger vom Bayerischen ins Böhmische und zurück.
Frisch verheiratet haben sich die Habels gleich ein Häuschen gebaut in Seehaid und sich dafür Geld geliehen bei der Bank. Sie haben unterschrieben, dass sie das Geld zurückzahlen werden, samt Zinsen und Gebühren und Provisionen. Aber später hat ihnen keiner sagen können, von was. Deswegen haben sie das Haus verkaufen müssen, nach drei Jahren Beten und Knickern.
»Wie haben mir ihn anbenzt, den Herrgott, dass er uns helfen soll, nicht hat er mögen«, jammert die Habelin noch heute.
Bevor es dann ganz arg geworden wäre, so ohne Bleibe, hat der Habel Arbeit in der Papierfabrik in Franzenstal gekriegt. Arbeiterhaus und Fabrik, sonst gibt es da nichts in Franzenstal, der Einöde auf halbem Weg zwischen Seehaid und Außergefild, wo die Moldau den ersten scharfen Knick zwischen die Hügel furcht und nach Südosten abbiegt, auf Krenberg zu.
Im Laufe der Jahre hat die Habelin gelernt, dankbar zu sein für das, was sie eingetauscht hat gegen das Haus, denn die Mutter Fabrik sorgt anständig für ihre Kinder: Das Dach ist dicht auf dem Arbeiterwohnhaus, das Wasser aus dem Brunnenhäusl ist sauber und staatlich geprüft – und es gibt einen Stromanschluss, in jeder Wohnküche, gratis, das haben sie nicht in Seehaid, gratis schon gar nicht.
Für die Arbeiterkinder wird etliche Jahre später sogar eigens ein Lehrer angestellt, von dem Eigentümer der Fabrik. Die Lehrersfamilie, Vater Ludwig Klöpp mit Frau und sieben Töchtern, zieht dann auch ins Arbeiterhaus.
Trotz aller liebevollen Fürsorge der Fabrik war es am Anfang hart für die Habels.
Fünf Jahre lang starben ihnen die Kinder weg.
Jetzt haben sie sechs, zwei Buben und vier Mädel, aber wie hat die Habelin den Herrgott dafür anbetteln müssen.
Die ersten drei Kinder überlebten keine vier Wochen, und die Habelin fragte Gott: »Soll mir gar keines davonkommen?«
Da ließ ihr der Herrgott das vierte, die Else.
Das fünfte nahm er wieder, als es ein paar Tage alt war. Die Habelin zündete ihr Wachsstöckl an und schrie: »Ich will kein dotes Kind mehr.«
Der Herrgott gab ihr Hermine und Rudi und Friederike und ließ alle drei leben.
Dann gab er ihr noch Maria, auch sie ließ er leben, mit verdrehten, verkrüppelten Füßen und einwärts gekrallten Zehen.
»Außerhalb von dem Fruchtwasser sind sie gelegen, die Fußerln«, diagnostizierte die Hebamme, die zur Entbindung von Außergefild herübergerannt ist. »Nie wird es laufen können, das Bodscherl!«
Die Habelin sparte auf ein größeres Wachsstöckl, kniete hin und erklärte sich: »Dot solln sie nicht sein, nicht krank, nicht verkrüppelt und richtig im Kopf, geht das?« Schwer offensichtlich, es kam nur noch ein kleines Fritzerl, winzig, aber gesund.
Zeugung und Geburt finden, wie alles andere auch, in der Wohnküche statt: Die Zeugung nachts und heimlich, die Geburt im Kokon eines Lügengespinstes.
Die Kinder nehmen es hin, hinterfragen nicht: Legt sich die Mutter ächzend ins Bett mitten am Tag, dann rennen sie weg, zu den Nachbarn, weil gleich die wilde Frau kommen wird, sagt der Vater, und da heißt es schleunigst türmen.
Die Nachbarn wissen auch schon Bescheid und lassen die Habelkinder zusammen mit der eigenen Brut in ihrer mit der Habel’schen fast identischen Wohnküche braune Papiertüten falzen.
Wenn die Habelkinder mal früher, mal später wieder nach Hause geschickt werden, ist sonderbarerweise ein Geschwisterchen vom Himmel gefallen. Sie nehmen es hin wie zwei Seiten Schönschreiben ins Heft.
An solchen Tagen kocht die Mutter keinen Sterz aus Ziegenmilch und Eiern, keine Knöpferl aus Kartoffelteig und erst recht keine Schmalznudeln. Die Kinder tauchen das trockene Brot in den eingebrühten Malzkaffee und nehmen auch das hin, wie die Rechenaufgaben vom Lehrer Klöpp.
In letzter Zeit hat das Bett von Vater und Mutter Habel im hinteren Eck der Wohnküche, unter dem Bild der milde blickenden Heiligen Familie, nicht mehr viel zu knarren unter zuckenden Habel-Körpern, weil die Sepsis Vater Habels Libido minimiert.
»Seids ihr anpappt da drin«, sticht Marias scharfe Stimme in Friederikes Ohr, »oder warts ihr, bis euch runterschwemmt auf Krumau?«
Hermine springt von ihrem Stein mit einem Satz ans Ufer und jagt dem Arbeiterhaus zu. »Jahrgang, damischer«, kommentiert Maria das Geschehen und nimmt Friederike ins Visier. Die zieht sich an der Uferböschung hoch und lässt es gottergeben zu, dass sich Maria an ihren Arm hängt.
Seit der Operation in Prag, für die die Habels das letzte Hemd geopfert haben, kann Maria zwar laufen, aber nur schwer das Gleichgewicht halten, weil ihre Fußform auffällig den Hufen der Habel’schen Ziege ähnelt, die sich damit natürlich leichter tut, weil sie sich auf vier Beine stützen kann.
Die arg verkürzte Auftrittsfläche macht dem Kind beim Gehen schwer zu schaffen und rechtfertigt Maris Angewohnheit, ihr Gewicht bei jedem Schritt an den Arm eines anderen zu hängen.
Am Rand der Wiese, die sich hinter der Fabrik bis an den Waldrand erstreckt und verboten ist für Arbeiterkinder, bremst Mari abrupt. Sie verengt ihre stechenden Äuglein zu Schlitzen und deutet auf ein schwarzes Pünktchen im Gras, ungefähr zwanzig Schritte von ihrem Standpunkt entfernt: »Siehst das, schau, eine Zigeunerwurz, geh, schnell, schnapp sie dir.«
Friederike fängt die schwarze Blüte auf dem blattlosen Stängel mit ihrem Blick, bekommt wässrige Augen, als sie an die süße, würzige Wurzel denkt, und glotzt verschreckt. »Mir dürfen doch nicht in die Wies, Mari.«
»Komm, renn, der Heger is aufs Dorf, das weiß ich gwiss«, drängelt Mari. Sie schubst Friederike von hinten an, und die fügt sich der Kraft, die akut wirkt, läuft in die Wiese und gräbt die begehrte Wurzel aus.
Der Heger ist gar nicht im Dorf, er passt auf wie ein Schießhund, registriert die Untat.
»Brauchst nimmer zum Fischen gehen«, zieht Rudi am Abendbrottisch das Fritzerl auf. »Die Frau vom Lehrer Klöpp sagt, dass es bald keine Fisch mehr gibt bei uns, weil die Fabrik alles vergift.«
Vater und Mutter Habel starren verblüfft, nur der Mari verschlägt es die Sprache so leicht nicht.
»Das wird grad sie wissen, der Saujud.«
Habels Kopf zuckt.
»Wo hast jetzt das Wort her?«
Friederike und Hermine kreuzen erstaunte Blicke. Das Schimpfwort, und um ein solches muss es sich handeln, ist neu und undurchsichtig.
Gar nicht gehemmt oder ängstlich, eher von oben herab und eingebildet auf die eigene Schlauheit, klärt Mari die Familie auf:
»Das redens doch schon im ganzen Haus hin und her, dass der Lehrer davon ist in Nürnberg, weil sie ihn nimmer haben wollten, mit seiner Frau, wo ein Jud is, und seine Töchter, wo auch Juden sind. Und wo er sich nicht schämt, dass er die Dirndln solche Namen gibt, dass mans gleich kennt, Esther und Hannah und …«
»Mari, du bist jetzt still«, fährt ihr der Vater ins Wort, »und ich will nimmer hören, dass du so was nachredst«, beendet er das Tischgespräch.
»Wenns wahr ist«, murrt die Mari noch leise nach.
Der Kochdunst trug es von Küche zu Küche, dementiert wurde nie: Die Kollegen und Nachbarn hatten dem Klöpp wegen seiner jüdischen Frau das Leben unerträglich gemacht an der Nürnberger Schule.
Da hatte ihm sein Schwager, Eigentümer der Franzenstaler Papierfabrik, angeboten, hierher zu kommen in die Einöde, wo die Fabrik das Sagen hat, um hier unbehelligt die Arbeiterkinder zu unterrichten. Klöpp hatte zugegriffen. Lehrer Klöpp erwies sich als Segen für die kleine Gemeinde. Die fünfundzwanzig schulpflichtigen Kinder aus acht Familien hat er in Grüppchen aufgeteilt und unterrichtet sie gemeinsam im gleichen Raum, mit Genehmigung der Behörde, beengt, aber mit dem Vorzug der eingesparten Stunde Schulweg nach Außergefild und zurück. Der Fabrikdirektor stiftet Hefte, Federn und Halter, sogar Farbstifte zum Wohle und zur Bildung der Untergebenen. Hier in Franzenstal müssen sie nicht mit Griffeln auf Schiefertafeln herumkratzen wie die armen Wichte im heruntergekommenen Schulhaus in Außergefild – Kvilda heißt der Ort auf Tschechisch.
Prächtige, fette, rote O und U malen die Jüngsten am Montagmorgen an ihrem Tischchen.
Friederikes Jahrgang müht sich durch haarige Textaufgaben. Scharfe Zähne kauen auf glänzenden Bleistiften, rotierende Gedanken versuchen zu ergründen, wie viel Bogen Papier die neue Maschine in der Fabrik am Tag einfärben kann, wenn sie für ein Blatt nur zwei Minuten braucht und acht Stunden am Tag arbeitet.
Friederike versucht sich zu erinnern: Was hat der Vater gesagt, einen ganzen Packen spuckt sie aus, die neue Maschine. Ein Packen, sind das fünfzig Bögen, hundert, tausend, vielleicht eine Million … so viel nicht, über tausend haben sie noch gar nicht gerechnet.
Klöpp lässt seine Schäfchen denken und kauen und träumen. Liebevoll erhellt sich sein hageres Gesicht, als Esther den Finger hebt. Sie, die Gescheiteste von allen, seine kluge und geschickte Esther, hat die Aufgabe geknackt.
Klöpp hat es nicht anders erwartet, und Esther darf erklären, wie sich die Lösung errechnet. Friederike gibt Esther durchaus Recht, dass sich eine Stunde aus sechzig kleinen Minuten zusammensetzt. Wie aber, erstaunt sich Friederike, konnte Ester daraus schließen, dass die Maschine pro Stunde dreißig Blätter färbt?
Sie ist einfach so gscheit, da kommt unsereins nie nicht mit, beugt sich Friederike dem bestaunenswerten Intellekt. Das kennt man ja schon an die schönen Spitzen, die wo sie klöppelt, dass die Esther was ganz was Besonders is.
Friederike ist eine ernsthafte Bewunderin der feinen Handarbeiten, die die Lehrerstöchter herstellen. Esthers Mutter, eine geborene Goldwein, aus Böhmen stammend, hat die Kunst des Klöppelns von ihrer Mutter erlernt und die von der Großmutter, und Gott allein weiß, wie weit sich die Klöppeltradition dieser Familie in die Vergangenheit frisst.
Von allen Klöpptöchtern zaubert Esther die feinsten und zartesten Spitzen, ihre Tischdecken und Krageneinsätze finden den Weg bis Prag und bis ins Österreichische.
Dass Ruth Goldwein einen Herrn Klöpp heiratete – Nomen est Omen, hatten alle gelacht –, kann als harmloser Spaß des Schicksals betrachtet werden. Esther hat diese Synonymie im Arbeiterhaus den Spitznamen Klöppeline eingebracht.
Der Rechengang ist aufgeklärt, Friederike schaut in die Schülergesichter um sich herum. Rudi schreibt die letzten Zahlen in sein Heft.
Aha, der hats kapiert, zieht Friederike den logischen Schluss, vif is er, der Rudi, der Lehrer möcht eh, dass mir ihn auf Winterberg ins Gymnasium schicken. Zufrieden öffnet Friederike dann ihre Ohren für die Klöpp’sche Sprachlehre.
»Versucht doch einmal zu jedem Buchstaben des Alphabets ein Namenwort zu bilden. Zum Beispiel: A wie Apfel, B wie Buntpapier, C wie China, D wie Dorf und so fort, jeder für sich, leise und schriftlich ins Heft.« So weist der Lehrer seine Schäflein an.
Friederike hat den Stift quer im Mund, beißt mit den Eckzähnen drauf: Abentandachd, Bittandachd, Christmetten, Dankandachd … Die vergangenen Religionsstunden scheinen bei ihr auf besonders fruchtbaren Boden gefallen zu sein.
Unterdessen klärt der Lehrer die »Großen« aus Gruppe vier über die Regierungsform der CSR auf: »Am 28. Oktober 1918 wurde in Prag die Tschechoslowakische Republik ausgerufen. Tomáš G. Masaryk ist unser Staatspräsident.«
Noch ist Masaryk Präsident.
Was der Lehrer im Jahre 1933 weiß von Politik und vom zeitgenössischen tschechischen Staat, ist eher historisch.
Was er nicht weiß: Konrad Henlein hat bereits die »Sudetendeutsche Heimatfront« gegründet. Aus ist es mit der Ruhephase, der seit Jahrhunderten schwelende Zwist zwischen den Deutschen und den Tschechen wird frisch geschürt. Henlein fraternisiert mit Hitler und Konsorten, die Studenten meutern in Prag, als die deutsche Universität ihre Insignien abgeben muss. Tod und Mord, Verfolgung und Vernichtung, seit tausend Jahren Alltag in Böhmen, werden wieder neu aufgelegt.
Während der Jungsteinzeit, so an die drei- oder viertausend Jahre vor unserer Zeitrechnung, mag vielleicht noch Harmonie geherrscht haben im Lande, als die Donauleute hier wohnten und den Löß beackerten; als sie die fruchtbarkeitsbringende Muttergottheit anbeteten und Abertausende kleiner Tonfigürchen modellierten ihr zu Ehren.
Der Ärger im Land zwischen Moldau und Eger begann in der Hallstattzeit.
Kaum war das Eisen erfunden, wurde es kriegerisch hinterm Erzgebirge. Die Kelten sickerten von Westen her nach Böhmen hinein, und von Osten schoben und drückten die Illyrer, bis sie an die Kelten knallten. Streit und Kampf und Zank und Mord begann, und so ging es weiter bis zu dieser Unterrichtsstunde im Jahre 1933, und danach erst recht.
Volksstämme wogten durchs Land, besetzten es, wurden wieder vertrieben, niedergemetzelt und gefangen genommen. Jeden neuen Eroberer ereilte bald das Schicksal seines Vorgängers.
Natürlich mischte die Kirche fleißig mit. Die Päpste strotzten vor guten Einfällen zum Wohle der Kirche. Die einfachen Leute auf ihrem Stückchen Scholle lernten, ihr Mäntelchen nach dem Wind zu hängen, Gott und König öfter zu wechseln als das Hemd.
Einmal gab es einen, Jan Hus war sein Name, der wollte einen tschechischen Staat, mit tschechischer Sprache, und er wollte, dass sich die Kirche da raushält. Aber der wurde fix exkommuniziert von den Kardinälen und gleich lebendig eingeäschert 1415.
Das wär ja noch schöner! So einer, so ein Quertreiber, so ein verräterischer, der ist längst gestorben für Mutter Kirche, egal wie stark er noch zuckt, wenn die Flammen züngeln.
Eine Zeitlang hatten die europäischen Herrscher genug davon, sich für Böhmen gegenseitig totzuschlagen, und Könige unterschiedlichster Nationen schoben sich für eine Hand voll Rubine das Zepter zu und den Thron unter den Hintern. Böhmen wurde verschachert, versilbert, verramscht und vererbt und bald diesem, bald jenem zugeschustert.
1890 rief wieder einmal einer laut nach einem tschechischen Staat. Karel Kramáø hieß er. Sein Rufen verhallte ungehört.
Statt Nationalismus regte sich Sepratismus: Die deutschen Volksgruppen, die eigentlich das Sudetenland bevölkerten, aber schon verzweigte Ableger in Böhmen eingewurzelt hatten, liebäugelten mit dem Deutschen Reich und hätten sich mitsamt allem Grund und Boden am liebsten angegliedert an ihren Volksstamm.
Aber daraus wurde dann doch nichts.
Tomáš Garrigue Masaryk, Gelehrter und Politiker, zeigte Flagge, und zwar tschechische. Er querte im Jahre 1918 den Atlantik, setzte, weit weg von Volk und Heimat, den »Pittsburgher Vertrag« auf, querte zurück, stoppte kurz im Französischen und ließ in Saint-Germain-en-Laye die neueste Form der CSR von der restlichen Welt bestätigen.
Die Deutschen auf dem böhmischen Boden versuchten noch schnell, sich abzuseilen mit Land und Leuten, aber da standen ihnen die tschechischen Truppen schon im Weg, und das änderte ihnen den Sinn.
Masaryk, der Gelehrte, bekam es dann ganz gut hin im Staat, mehr als fünfzehn Jahre lang war die Koexistenz recht friedlich und erfreulich, und der Lehrer in Franzenstal wähnte deshalb nichts Böses. Klöpp glaubte sich gut aufgehoben in der Obhut von Masaryk und der Papierfabrik, entschlüpft und vergessen von dem Gesindel, das immer mehr zu sagen hatte im Deutschen Reich. Klugscheißer wie Henlein, fanatisch, rassistisch, verbrecherisch und verbohrt, passten nicht in Klöpps Wunschwelt.
Nase, Osderkertze, Palmsonndag, wühlt sich Friederike durchs Alphabet und schweift dann ab, weil ihr zu Q nichts einfallen will.
Quadratratschn kommt ihr in den Sinn, aber das kann man nicht hinschreiben, und über die Buchstaben schiebt sich Maris Bild, das bei diesem Wort zwingend auftaucht und Friederike wieder an den vergangenen Freitag erinnert.
Das war der Tag, als sie in Krumau gewesen waren. Diesen Ausflug wird Friederike so schnell nicht vergessen, weil sie sich am selben Abend noch schämen musste wie noch nie in ihrem Leben, und reingeritten hatte sie die Mari, die Urschel.
Der Tag in Krumau, der Stadt in der Moldauschleife, war anstrengend gewesen. Über den Schlossgraben, durch das Latrontor an der »Münze« vorbei zum Schlossturm wanderte der Zug der Kinder, immer zwei und zwei in einer Reihe. Der Klöpp palaverte von den Rosenbergs, den Eggenbergs, den Schwarzenbergs. Friederike schwirrte der Kopf vor Fürsten und Grafen, die alle von und zu und -berg hießen, die hier wohnten, Paläste bauten, Silber schürften, ihr Geld verprassten und wieder wegstarben. Später Abend war es schon und finster, als sie nach Franzenstal zurückkamen.
Mari saß im Eckbank-Eck – Friederike sieht sie noch heute so sitzen – blinkerte engelsgleich mit blanken Äuglein und strahlte in der weißen Weste blütenreinen Gewissens.
Friederike bekam ein flaues Gefühl in der Magengrube und starrte auf Vater Habels kranken Fuß. Seine Stimme hörte sich an wie das Rascheln des braunen Fabrikpapiers.
»Der Direktor hat mich heut vor ihn kommen lassen, wegen der Zigeunerwurz! Wegen dir bestellt mich der nicht noch mal, hast du mich verstanden!«
Jessmariaundjosef, so eine Schand! Der Vater hat sich vor den Direktor hinbuckeln müssen, und abkanzeln lassen hat er sich müssen wegen mir.
Friederike fühlt sich immer noch ganz schwach, und die Saumari ist dran schuld, die Pritschen, die elendige.
»Schluss für heut«, reißt Klöpp Friederike aus ihrem Kummer um den blamierten Vater und die eigene Schmach.
Die Hefte klappen zu.
»Wir probieren noch das neue Lied«, sagt der Lehrer, »heut Abend singen wir es im Hof für eure Väter und Mütter.«
Seit Wochen übt Klöpp mit seinen Schützlingen eingängige Volksweisen aus einem alten deutschen Liederbuch. An warmen Abenden treten sie auf, neben dem Brunnenhäusl:
»Mariechen saß weinend im Garten«, erklingt es hell und harmonisch, »im Grase lag schlummernd ihr Kind, mit ihren schwarzbraunen Locken, spielt leise der Abendwind …«
Möchte vielleicht Klöpp, ganz Pädagoge, singend Lebensweisheit vermitteln? Einfach lässt sich erraten, welche Moral das vielstrophige Lied herausarbeitet.
Warum in aller Welt aber hat Friederike die Quintessenz, das Lernziel, die Textzeilen »Warum bist du so traurig, du ganz verlassener Wurm, dein Vater hat uns verlassen, in einer schweren Stund« nicht in Kopf und Bauch behalten?
Mütter, Väter und Großmütter stecken die Köpfe aus den Fenstern, stützen die Ellenbogen aufs morsche Holz und lauschen, erinnern sich und nicken und tuscheln, und hie und da zerdrückt einer eine Träne.
Der Herbst geht in den Winter über. Eintönig wechseln sich die immer gleichen Szenen ab im Franzenstal.
Wieder Sommer, der nächste Winter. Das Leben fließt monoton wie die Moldau.
Das größte Ereignis im Jahre ’34: ein Schulausflug nach Budweis. Der Lehrer schwatzt dem Kulturausschuss das Geld dafür ab, was ihn auf die schwarze Liste bringt bei der Behörde, auf der braunen steht er ohnehin schon, wegen seiner Frau.
In der mittelalterlichen Stadt Budweis, an der hier schon recht breiten Moldau gelegen, erzählt der Lehrer von König Ottokar Premysl, der dieser ehemaligen deutschen Kolonistensiedlung das Stadtrecht verliehen hat. Die kleineren Kinder fallen schon fast um vor Müdigkeit, aber sie müssen unbedingt noch erfahren, dass alle Kaufleute, die im 14. Jahrhundert an Budweis vorbeiziehen wollten, auf Befehl von Kaiser Karl IV. ihre Waren in der Stadt zum Verkauf anbieten mussten. So wurde Budweis die drittgrößte Stadt Böhmens und der größte Holz- und Getreidemarkt des Südens.
Der nun selbst schon ermattete Lehrer führt seine Schüler vom Dominikanerkloster zum Zizka-Platz und lässt sie am Samsunbrunnen rasten.
Im nächsten Jahr sammelt Klöpp neue Strafpunkte auf den Ämtern: Er luchst dem Ausschuss das Geld für eine Schülerfahrt nach Höritz zu den Passionsspielen ab.
Friederike schaut, wundert sich, wie jedes Jahr, wenn sie aus Franzenstal herauskommt, und sagt zu sich: So groß ist die Welt, so viel Leut, so viel Häuser, Jessmariaundjosef.
Das Leben in den Städten ist verwirrend, unruhig, beängstigend. Wie schön und heimelig ist es dagegen im grünen Schoß von Franzenstal. Alles geht dort seinen geregelten Gang, ruhig und vorhersehbar. Was soll ich, fragt sich Friederike, unter all diesen fremden Leuten, die an mir vorüberziehen, unbekannt, anders und doch gleich: Sie heben die Füß beim Gehn, genau wie mir in Franzenstal, sie weinen, wenns traurig sind, und sie drehn den Kopf, wenns umschauen.
Friederikes Welt ist die Papierfabrik, das Arbeiterhaus und zehn Hektar Land drum herum. Ein Ministaat mit König und Untertanen, jeder auf seinem Platz, klar, einfach und überschaubar.
Geschäftig eilt Friederike durch ihre täglichen Pflichten. Jedes Tröpfchen Wasser, das die Habel’schen verplantschen in ihrer Küche, müssen sie vom Brunnenhäusl holen, über den Hof ins Haus und die abgetretene Stiege hinaufschleppen.
Im Winter ist der Hof vereist, Schnee türmt sich vor dem Brunnenhaus. Die klobigen Schuhe vom Holzschuhmacher in Außergefild – der Vater hat sie dieses Jahr mit blauer Farbe gestrichen zum Schutz für das weiche Holz – sind viel zu breit, und Friederike dreht den großen Zeh ganz verkrampft nach oben, um nicht mitten in der Schneewehe aus dem Schuh zu schlüpfen. Schön wäre es, in den Holzschuhen den Hang hinter dem Haus hinunterzurutschen. Aber der Spaß würde die Schuhe ramponieren, und die müssen noch bis zum Mai halten, erst dann ist es warm genug zum Barfußlaufen.
Im Sommer ist das Leben sowieso viel leichter: Ins Kittelschürzchen geschlüpft, zwei Knöpfchen geknöpft, ein Schleifchen gebunden und hinausgehüpft in die warme Sonne. Wollene Strümpfe, Unterleiberl und Pudelmützen verschwinden in der braunen Truhe zwischen den Mottenkugeln. Die Sommerschürzchen sind bunt und luftig, genäht aus billigen Resten von der Stofffabrik in Winterberg.
In Vimperk, wie die Tschechen den Ort nennen, da gibt es viele Fabriken und eine Druckerei, das weiß Friederike genau, eine Druckerei, wo sie Gebetbücher drucken, so schön, dass der Bischof im Passauer Dom daraus vorbetet, und jeder Priester und jeder Ministrant hält so ein Gebetbuch mit Goldschnitt in der Hand, und sie lesen dem Bischof die richtigen Antworten auf sein Vorbeten dar-aus vor.
Die Behörden, die sind auch in Winterberg, das Standesamt, das Passamt, das Katasteramt und der Bahnhof und die Hemdenfabrik Seidensticker.
Im Spätsommer ’39 – Friederike wird jetzt bald sechzehn Jahre alt – schwärmen die Habelmädchen wie in jedem Jahr zum Beeren- und Pilzesammeln in die Wälder. Durchreisende kaufen ab und zu ein Pfund Waldhimbeeren oder die fetten, schwarzen Brombeeren, die den Mädeln zerkratzte Arme und Beine einbringen. Was übrig bleibt, wird eingeweckt für den Winter, da ist man dann froh über den süßen schwarzen Klecks auf dem trockenen Brot.
Jeder verdiente Beeren-Groschen wird gespart für Kleiderstoff und Wolle. Auch heuer ist Friederike aus ihrem Sonntagskleid herausgewachsen, sie gibt es an Mari weiter, und für Friederike näht die Mutter ein neues. Die Mari plärrt und stampft mit den Geißbockfüßen und führt sich auf wie ein herrenloser Schlauch unterm Wasserdruck, aber es hilft ihr nichts, es reicht nicht für zwei neue Kleider bei den Habels.
Jessmariaundjosef, betet Friederike in Demut und Dankbarkeit, gut, dass ich so gewachsen bin, wie tät denn das herschaun, wenn ich hinkomm zum Haŝek-Metzger in Außergefild, am Sonntag, wenn mein Pflichtjahr anfangt, jetzt wo ich fertig bin mit der Schule, wie tät denn das herschaun, wenn ich nicht einmal ein anständiges Gwand anhätt.