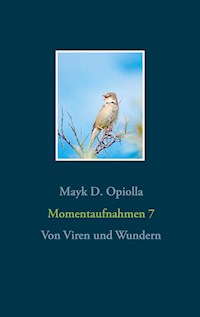Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Momentaufnahmen Berlin - Langeoog
- Sprache: Deutsch
Ein letztes Mal von Berlin nach Langeoog: In der Berliner Wohnung wohnt jetzt ein Fremder. Die Sachen? Expediert, eingelagert, verschenkt. Es gibt kein Zurück mehr. Doch auch auf der Insel stand die Zeit für den Erzähler nicht still. Wir erfahren von Heiligen und Scheinheiligen, vom Schönen und vom Scheitern, von Terror und Tagträumen, von Frust und Feiertagen, von Narben und Nacktheit, vom Sterben und den Sternen, und natürlich: Von der Liebe. Band 3 der Reihe "Momentaufnahmen Berlin - Langeoog" verzaubert mit weiteren Betrachtungen aus dem Leben eines Neu-Insulaners: Sinnlich, melancholisch und ehrlich, durchwoben von berauschend-bildgewaltigen Beschreibungen einer einzigartigen Naturlandschaft, welche den Seewind fühlbar und die Schreie der Möwen und Austernfischer beim Lesen hörbar machen. 40 neue Geschichten; mit Ausflügen ins Bergische Land, an Bord der Gorch Fock, nach Kiel, Laboe, Wilhelmshaven und Berlin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch:
Ein letztes Mal von Berlin nach Langeoog: In der Berliner Wohnung wohnt jetzt ein Fremder. Die Sachen? Expediert, eingelagert, verschenkt. Es gibt kein Zurück mehr. Doch auch auf der Insel stand die Zeit für den Erzähler nicht still. Wir erfahren von Heiligen und Scheinheiligen, vom Schönen und vom Scheitern, von Terror und Tagträumen, von Frust und Feiertagen, von Narben und Nacktheit, vom Sterben und den Sternen, und natürlich: Von der Liebe.
Band 3 der Reihe „Momentaufnahmen Berlin — Langeoog“ verzaubert mit weiteren Betrachtungen aus dem Leben eines Neu-Insulaners: Sinnlich, melancholisch und ehrlich, durchwoben von berauschend-bildgewaltigen Beschreibungen einer einzigartigen Naturlandschaft, welche den Seewind fühlbar und die Schreie der Möwen und Austernfischer beim Lesen hörbar machen.
40 neue Geschichten; mit Ausflügen ins Bergische Land, an Bord der Gorch Fock, nach Kiel, Laboe, Wilhelmshaven und Berlin.
Meinen Eltern
Inhalt
Rungholt
Wahrheit
Gorch Fock
Allein
Nebellichten
Dankbarkeit
Evolution
Weihnachtswehmut
Jahresabschied
Filmriss
Spaceboy
Tauwetter
Letzter Abend
Berlin — Langeoog
Ankommen
Valentin
Elend
Stern
Wilhelmshaven
Vierzig
Stoa
Anfang
Landgang
Pausenton
Gänsemarsch
Nichttag
Ostende
Trostlos
Tourist
Ehrenmal
Möltenort
Nackt
Bühne
Watt
Trotzdem
Toleranz
Sünder
Beerenlese
Gold
Meeresleuchten
Star
Ernte
Rungholt
Sechs Uhr früh. Zeigte sich in den letzten Wochen noch ein zögerlicher erster Lichtstreif am Himmel, so beginne ich meinen Arbeitstag nun in stockschwarzer Nacht. Schemenhaft erkenne ich Krähen auf dem Dach des Nachbarhauses. Bis auf das Rauschen der Wellen ist es absolut still. Am Strandübergang halte ich inne. Das Meer tost; Dirigent seiner eigenen Ouvertüre in Moll.
Ich denke an die Legende von Rungholt, und wie es jetzt wäre, aus der düsteren Tiefe dieses unendlichen, brüllenden Nichts vor mir das Läuten von Kirchenglocken zu vernehmen. Ein Schauer jagt durch mein Inneres und lässt mich frösteln.
Kirchenglocken sind ein seltsames Phänomen: Heimelige Idylle an einem sonnigen Sonntagmorgen, bei der man sich automatisch Kinder in weißen Kleidchen vorstellt, die Ringelpiez um Wäscheleinen tanzen, zwischen Hühnern und Gänsen, und der Pastor schlappt im Talar vorbei und grüßt, das Gesangbuch unter dem Arm. Aber dort, wo sie nicht hingehören, sind Kirchenglocken die gruseligste Sache der Welt.
Die Insel wird anders im November.
Wenn das Meer lauter wird als die Menschen, und sich der scheinbar so mühelos bezwingbare, azurblaue Ententeich des Sommers, auf dem bunte Ausflugsboote schippern, in eine zornige Urgewalt verwandelt: Eines rasenden Lebewesens gleich.
Unsere Flügel sind die Seelen der Matrosen heißt es in einem meiner Lieblingslieder, und zu sehr möchte man im Sommer daran glauben, dass sich Leid und Tod in pittoreskem Kreisen persilweißer Möwenschwingen auf blauer Himmelsleinwand auflösen.
Im November ist das anders. Dann wähnt man die Seelen der Toten noch immer gefangen auf dem Grunde des Ozeans, und nur die Glocken von Rungholt gemahnen ihrer Existenz und der Vergänglichkeit allen Seins. Ich stelle mir einen Büsumer oder Pellwormer vor, der, nach einer anstrengenden Saison, am Strand seiner Heimat Ruhe sucht, der Stille lauscht, und dann diese Glocken hört. Aber vielleicht ist die Legende von Rungholt auch einfach nur eine gute Einnahmequelle für den Tourismus: Ein nordfriesischer Loch Ness.
Oder ein zeitloses Mahnmal gegen Prunksucht, Völlerei und Gotteslästerung: Der Untergang vieler als Strafe für die Vergehen Einzelner.
Ich setze meinen Weg fort. Erste Lichter brennen im Eisenbahnschuppen, aber die Inselbahn schläft noch. Ein müder Angestellter steht in der halb geöffneten Tür und raucht. Aus den Wiesen hinter den Gleisen steigt Frühnebel.
Dann plötzlich das Scharren von Hufen in der Dunkelheit: Eine Erlkönig-eske Szene.
Ich sehe genauer hin. Auf dem Platz vor dem Lokschuppen stehen zwei mit festlichem schwarzen Kopfschmuck herausgeputzte Rappen und ein Kutscher im bodenlangen, schwarzen Capé. Im Gespann ein ebenfalls tiefschwarzer Wagen mit einem quastenverzierten
Baldachin aus Samt. Kurz denke ich: Das ist aber eine seltsame Kutsche, bis mir die Maße des Wagens auffallen. Für eine Personenkutsche ist er zu schmal. Dann dämmert es mir: Das ist der Leichenwagen von Langeoog.
Zum zweiten Mal schaudert es mich, denn mir wird klar, dass jetzt im Laderaum der 7:10 Uhr Fähre neben bunten Wasserbällen und Lenkdrachen noch etwas anderes mitfährt. Oder jemand.
Langeoog hat kein Krematorium, also müssen die Toten zur Einäscherung aufs Land. Oder vom Land zurück auf die Insel, wenn ein Insulaner beispielsweise im Kreiskrankenhaus verstirbt. Hier wird er oder sie dann beigesetzt, auf einem der beiden Friedhöfe, oder im Rahmen einer Seebestattung den Wellen übergeben.
„Eigentlich müssen die mit dem Frachtschiff rüber“, erklärt mir ein Insulaner, „aber manchmal lohnt sich das nicht, dann kommen die Särge auch auf die Personenfähre“, und ich denke, dass unsere Gäste besser doch nicht alles über die Insel wissen sollten. Und den Toten ist es wohl reichlich egal, ob sie neben Strandspielzeug und Badekleidung der Touristen oder Möbeln und Toilettenpapier für die Hotels verschifft werden.
Auch im Hotel haben wir Zimmer mit Friedhofsblick. Es sind eigentlich sehr schöne Zimmer, die zu dieser Seite hinausgehen, aber manche Gäste hadern damit. „Das Zimmer ist aber wunderbar ruhig“, trösten wir dann, „hier hören Sie frühmorgens maximal das Trappeln von Pferdehufen.“
Welche Kutsche das ist, erwähnen wir lieber nicht.
Wahrheit
Ein neues Leben hat seinen Preis. Mein Preis steht zwischen Koffern in der Empfangshalle und lacht. Er sagt etwas zu der sympathischen Frau, die ihn begleitet, und ich denke: Die ist doch genau dein Typ, wie immer, und ich freue mich, dass er gesund aussieht und offenbar glücklich ist.
Er hat sich kaum verändert, und ich erkenne die Augen und das Lachen, bevor ich den Namen höre.
Ich sage nichts. Und so begrüße und sieze ich den Mann, der mich nicht wiedererkennt, wie man eben Gäste begrüßt und zeige ihm sein Zimmer.
Später heule ich in den Abwasch.
Mensch, denke ich, wie schön, dich zu sehen. Spielst du noch Klarinette? Und was macht die Malerei, ich glaube, du hast auch gemalt damals, ich bin mir recht sicher. Farben hatte ich dir geschickt, aus China, die waren aus dem Künstlerviertel Fuzimiao. Und CDs hast du noch von mir, du Sauhund, R.E.M. und Kristin Hersh; ich bekam sie nie wieder, damals, als du fortzogst.
Ich hatte sie längst vergessen.
Und plötzlich ist alles wieder da, und ich dort, wo ich mal war, vor fünfzehn Jahren. Das alte Leben starrt mich an, und ich kann nichts tun, außer das auszuhalten, mit weichen Knien geklammert an dieses Spülbecken.
Zum Glück trage ich kein Namensschild hier, denke ich, und wünsche mir einmal mehr, einen weniger seltenen Nachnamen zu haben.
„Möchten Sie noch Kaffee“, werde ich morgen den Mann fragen, und dabei längst wissen, dass er Milch reingießt.
Die Tür ist zu.
Hinter der Tür hängt ein Spiegel, und mir fällt der Titelsong aus „Mulan“ ein: „Wann zeigt mir mein Spiegelbild, wer ich wirklich bin?“ „Jetzt“ denke ich, und bin zufrieden mit dem, was ich sehe. Vor fünfzehn Jahren dachte ich das nicht.
Aber alles hat seinen Preis: Selbst die unbezahlbare Freiheit, man selbst zu sein.
Natürlich ist der Film furchtbar verkitscht; der echten Hua Mulan haben sie den Kopf abgehauen, als sie enttarnt wurde, der chinesischen Jeanne D’Arc, meine Geschichtsdozentin in Nanjing erzählte davon; lange, bevor sich Disney des Themas annahm.
Auch das ist sehr lange her. Aber ein paar Dinge erinnere ich: Den Eisvogel, der über den Teich auf dem Campus der Nanjing shifan daxue schoss. Ich hatte vorher noch nie einen gesehen und schrieb ein grauenhaft kitschiges Gedicht darüber.
Ich erinnere die schöne Freundin, die mich auf dem Gepäckträger durch die Stadt karrte, weil ich kein eigenes Fahrrad hatte. Ich erfuhr, dass Kakerlaken stinken: Wir hatten davon im Wohnheim reichlich. Ich erinnere die abblätternde Farbe an der Wand mit dem Telefon, vor der ich zusammensackte, als ich vom Tod des Großvaters erfuhr. Mein letzter Brief an ihn war zurückgekommen, weil eine Büroklammer darin war. Gegenstände aus Metall durfte man nicht verschicken, ich wusste das nicht. Ohne die Klammer hätte ihn der Brief noch erreicht. Die verdammte Büroklammer.
Dann saß der alte japanische Lehrer neben mir, in seinem braunen Sakko. „Wo yeye qushi le“ sagte ich, Tränen in seinen Ärmel tropfend, und er tröstete mich mit japanischen Worten, die ich nicht verstand, und einer Güte, die keine Worte brauchte.
Ich lernte Papierkraniche falten und Kalligraphie. Im Frühjahr saß ein bildhübscher Russe unter meinem Fenster und las, während die Blüten des Winterpflaumenbaums auf sein glänzendes, blondes Haar fielen. Sein Name war Sascha und er hatte die schönsten Wangenknochen der Welt.
Und überhaupt, die Pflaumenbäume. Im Winter Schnee auf den Palmen und im Sommer der Duft der Gui hua Bäume. Es ist immer noch mein Lieblingsduft.
Die Stechuhr fiept, als ich meine Karte davor halte: Es ist sinnlos, ich kann so nicht arbeiten. Auf dem Rückweg von der Uhr zur Küche lausche ich auf dem Flur. Der Mann ist nicht da.
Die bunten Erinnerungsfetzen rieseln jetzt nicht mehr blütengleich herab: Es ist ein Platzregen, gepaart mit Sturmböen, die wirbelnd durch die Rinnsteine meines Innersten fegen; jede Konzentration zerstreuend.
Später.
Jetzt bin ich hier, denke ich, als ich die Wohnung aufschließe. Das ist mein Zuhause. Nanjing ist Vergangenheit, alles andere und München sowieso, sogar Berlin, ach, Berlin. Man kann nicht alles und jeden mitnehmen, und in den meisten Fällen ist das auch gut so. Aber einigen Menschen würde man gerne nochmal durchs Fenster winken.
Oder sie Klarinette spielen hören.
Gorch Fock
Die letzten Meter zur Deichbrücke laufe ich nicht, ich renne sie; schon beim Überqueren der davor liegenden Straße lebensmüde nach den berühmten drei Masten spähend, anstatt auf den Verkehr zu achten.
Und dann, endlich, sehe ich sie: Die Gorch Fock.
Majestätisch weiß liegt sie, strahlend unter zart erbläuendem Winterhimmel, und man möchte sofort barocke Zeilen dichten über güldene Masten, Abenteuer auf See und schöne Matrosen, wenn einem das nur nicht gleich den Vorwurf des Nationalismus einbrächte.
Denn tatsächlich ist dieses märchenhaft schöne Schiff, welches dort in aller Unschuld am Wilhelmshavener Bontekai vertäut liegt, das Segelschulschiff der Deutschen Marine und damit der Soldatenausbildung vorbehalten.
Gestorben wird darauf auch; gut erinnere ich den tragischen Tod einer jungen Kadettin vor drei Jahren sowie die sexistischen Kommentare als Reaktion darauf. Von wegen ‚Frauen weg von Waffen und Wanten“,‚Küche statt Koje‘ und ‚Babys statt Besantopp‘. Als hätte es da nicht auch schon Männer vom Mast geweht — deren Tod ist natürlich nicht minder tragisch.
Dennoch kann nichts meine momentane Euphorie bremsen; an das Eisengeländer der Deichbrücke geklammert, grinse ich grenzdebil vor mich hin und starre und starre und starre. Was für ein schönes Schiff!
„Entschuldigung, ist das da hinten die Gorch Fock?“ Eine ältere Dame schiebt sich ins Bild; ihr Herannahen bemerkte ich nicht.
„Das ist die aber sowas von!“ poltere ich lauter als geplant, und die Dame zuckt ein wenig zusammen und schaut irritiert. „Ist sie nicht wunderschön?“ setze ich euphorisch hinterher, aber es ist keine wirkliche Frage, also blicke ich wieder zum Schiff. Die Antwort ist irgendein Gemurmel.
Neben der Frau sind jetzt zwei Begleiter aufgetaucht. „Haben sie da gedient?“ fragt der eine, und ich sage „jaja“, ohne nachzudenken. Und wie ich diesem Schiff diene! Heute zumindest, denke ich, gäbe ich alles, um sie zu sehen, ganz egal, dass ich in Wirklichkeit die Seetauglichkeit eines größeren Rüsseltieres besitze. Aber die Leute sind schon wieder verschwunden, bevor ich das richtig stellen kann.
Ich reiße mich widerstrebend los und renne weiter zum Hotel. Nur schnell die Sachen loswerden! Auch das Zimmer hat Gorch-Fock-Blick: Große Freude! Aber ich will näher ran ans Schiff. Und rauf. Die Gangway steht schon bereit: In drei Stunden ist „open ship“.
Die Zeit bis dahin verbringe ich mit ausführlicher Außenbesichtigung des Stolzes der Deutschen Marine, um schließlich, nach einem Marsch über die nicht minder elegante Kaiser-Wilhelm-Brücke, auf der gegenüberliegenden Seite des Hafenbeckens im Café des Marinemuseums zu landen.
„Immer diese Gorch Fock!“ zetert die Angestellte nach der hundertsten Touristenfrage vor ihrem Kollegen, „was wir nicht alles darüber wissen sollen!“ Ich schmunzele. Auch hier bringen Gäste offenkundig nicht immer Freude ins Haus. Andererseits: Wir reden schließlich von der Gorch Fock!
Vor dem Café liegt die Fregatte Mölders; außer Dienst gestellt als zu besichtigendes Museumsschiff, ein mächtiger Zerstörer.
Ich erinnere, wie ich dich einst nach deinen Kindheitserinnerungen zu diesen Schiffen befragte. So ein Kriegsschiff muss doch toll sein für einen kleinen Jungen, dachte ich, und der Vater darauf noch Kapitän zur See! Ich zumindest liebte es als Kind, am Arbeitsplatz meines Vaters einzufallen, um in der Arztpraxis Unruhe zu stiften und Unmengen Verbandszeug zu klauen, mit dem ich später meine Stofftiere verarztete. Und so ähnlich sah ich auch dich als Kind vor mir: Mit der viel zu großen Kapitänsmütze deines Vaters in der Wanne Mini-Fregatten vor dir herschiebend, und singend dabei, natürlich. Und dann erst auf dem Schiff! Behende die Niedergänge rauf- und runterflitzend, bespaßt von lächelnden Kadetten. Du warst doch schon immer ein Showtalent!
In Wirklichkeit hielt sich deine Begeisterung wohl in Grenzen: Natürlich hättest du den Papa an Bord mal besucht. Aber toll gefunden? „So ein Zerstörer ist ja jetzt kein romantisches Schiff“, war alles, was du dazu brummeltest. „Wenn’s wenigstens die Gorch Fock gewesen wäre, was?“ setzte ich nach, und du schautest wieder geradeaus in dein Glas und nicktest: „Ja, war ja nicht einmal die Gorch Fock.“
Ich schaue raus zur Mölders und denke, dass ich da als Kind trotzdem Spaß drin gehabt hätte; zumindest bis zu dem Alter, an dem man den Hauptzweck eines solchen Schiffes begreift. Aber natürlich heißt ein Schiff für Seemannskinder nicht nur Abenteuer, sondern auch immer wieder Abschied. Nicht nur vom Vater, sondern auch von Schulkameraden und vertrauten Kinderzimmern, wenn man mit der Familie von einem Marinestützpunkt zum anderen ziehen musste.
Auch über dieses Thema sprachst du nicht gern.
Im Museumshop liegt ein Kinderbuch, „Wenn Papa lange wegfährt …“ heißt es. Auf dem Umschlag steht ein Vater an Bord einer Schnellbootes der Gepard-Klasse und winkt. Am Ufer seine Frau mit dem Kind an der Hand: Sie bleiben zurück.
Als Ex-Buchhändler weiß ich, dass man strikt zielgruppenaffin einkaufen muss, und also wird es hier in Wilhelmshaven wohl Bedarf dafür geben. Es bricht mir das Herz.
„War es nicht schwer für dich, dass dein Vater immer weg war?“ fragte ich dich einmal, aber du wurdest darauf recht ungehalten und warfst mir nur ein trotziges „So oft war der gar nicht weg!“ entgegen. Treffer, versenkt, denke ich rückblickend, und frage mich erneut, wie es so ist, das Aufwachsen als Soldaten- und Seemannskind. Natürlich sind auch andere Väter oft weg, auf Montage oder sonstwo, aber vielmehr als in anderen Berufen besteht bei Seeleuten doch die Gefahr des vergeblichen Hoffens auf Wiederkehr: Bei Einsätzen der Deutschen Marine in Krisengebieten erst Recht.
Meine Freundin T., Tochter eines ehemaligen Funkers der Bundesmarine, ist da auskunftsfreudiger. Wie sehr hatte sich ihr Vater über die neugeborene Tochter gefreut! Aber dann? „Fuhr er wieder zur See, und als er das nächste Mal heim kam, konnte ich laufen“. Als sie mir das erzählt, lächelt sie nicht.
Sie zeigt mir ein Bild von ihrem Vater in Uniform: Ein hübscher Mann. Und ja, es war schwer.
Auch in meiner Familie fuhren Männer zur See, wenn auch meistenteils im Kriege, also nicht freiwillig. Mein Urgroßonkel Max beispielsweise blieb 1914 im Gefecht vor den Falklandinseln mit der Scharnhost auf See, wie man so schön euphemistisch sagt, wenn einem in Wirklichkeit erst das Schiff und vielleicht noch ein Arm oder Bein weggeschossen wurde, bevor man wie eine Ratte ertrank.
Auch von Onkel Max gibt es ein Foto in Uniform, aus Flensburg. Er hat einen Kaiser-Wilhelm-Bart und die für diesen Familienzweig typischen, melancholischen Augen, die auch ich habe. Ich nehme mir vor, am 8. Dezember an ihn zu denken: Dann jährt sich der Untergang der Scharnhorst.
Im Shop kaufe ich ein paar Sachen und stecke vorsichtshalber auch ein Faltblatt der Marine ein, das die Dienstgrade und Rangabzeichen erläutert. Meine Güte, denke ich, all die dicken und dünnen Streifen und Sterne und Bezeichnungen studierend, ich bräuchte alleine Monate, bis ich die Leute an Bord auch nur vorschriftsgemäß grüßen könnte, von dem ganzen Wissen ums Segeln mit seinem ebenfalls üppigen Fachvokabular gar nicht zu reden! Zur Sicherheit kaufe ich auch zum Thema Seemannssprache ein Buch.
Vor der Gorch Fock bilden sich bereits lange Schlangen. „Isn’t she beautiful?“ schwärme ich die vor mir stehenden Australier voll, und sie pflichten mir höflich bei. „But look, did you see the damage?“ fragt der eine und weist mit ausgestrecktem Arm auf die Galionsfigur: Einen stilisierten Albatros. Und tatsächlich; der Vogel ließ beim Anlegemanöver am Bauch ein paar Federn, ein Video kursierte davon, offenkundig auch in Australien.
Natürlich machten sich die User episch darüber lustig, aber ich denke, dass ein Schulschiff nicht grundlos so heißt: Die lernen halt noch. Abgesehen davon klebt sowieso schon der 5. oder 6. Albatross am Bug der Gorch Fock; die vorherigen verlorengegangen in Stürmen oder Gottweißwo.
„Die besten Rudergänger stehen immer an Land“ kommentiert ein Seemann die Anwürfe lakonisch, und ich kann ihm nur zustimmen. Das ist wohl in allen Branchen so …
Der Matrose an der Stelling fröstelt; dennoch Haltung wahrend die Besucherströme lenkend. Endlich kann auch ich aufs Schiff. Große Freude! Ich mache Fotos von jedem Messingknauf und jedem Stück Tau.
An Bord Marine; die Männer und eine Frau beantworten bereitwillig Fragen. Dienstgrade fliegen mir um die Ohren: Kapitänleutnant, Oberbootsmann, Seekadett, Stabsgefreiter, Unteroffizier mit und ohne Portepee. Dazu Milliarden Fachbegriffe rund ums Segeln. Ich bin heilfroh, dass ich das Faltblatt eingesteckt habe, so komme ich mir nicht ganz so blöd vor.
Die Messingteile sind alle blankpoliert; genau wie die Planken und Masten. Kaum vorstellbar sind die tragischen Unglücke auf diesem Schiff; kaum vorstellbar, dass hier Menschen das Blut ihrer toten Kamerad_ innen von den Planken waschen mussten, über die nun lachend Landratten flanieren.
Ich sehe hoch zum Großmast. Er ist sehr hoch: 45 Meter. Und die Kadetten (außer jene mit ärztlich bescheinigter Höhenangst) müssen da rauf, bei Sturm und Nacht, das schöne Schiff wohl einige Male verfluchend.
Mir wird ein bisschen schwindelig, und auf einmal kann ich mir auch die unschönen Seiten vorstellen: Die Enge, die Nässe, die Müdigkeit und Angst sowie die kollektive Kotzerei im Sturm.
Bald ist der Rundgang beendet und ich schaue ein letztes Mal von Deck in die Tiefe. Dort unten, in der immer noch elend langen Warteschlange, entdecke ich Freund U., gebürtiger Spiekerooger, und beschließe: Ich gehe mit ihm gleich nochmal rauf! Die Wartezeit vertrödeln wir mit Geschichten von der Seefahrt — Auch U.s Bruder ist Seemann.
Es wird ein kurzes, aber herzliches Wiedersehen.
Zurück im Hotel platze ich in Hochzeitsfeierlichkeiten. Der Bräutigam, der soeben für ein Foto mit Blumenkindern und dem Militärpfarrer posiert, ist ein junger Oberleutnant zur See, das verraten mir zwei Streifen und ein Stern auf seinem Ärmel nach einem Blick in mein Faltblatt. Er hat ein unschuldiges Kindergesicht und ist auf diese Weise ziemlich hübsch. Seine Frau, im langen cremefarbenen Kleid, ist schwanger. Noch eine Anwärterin für das Kinderbuch, denke ich, und wieder wird mir bewusst, für wie viele Familien das hier an der Küste Alltag ist: „Wenn Papa lange wegfährt …“
Ich übermittele Glückwünsche und trolle mich auf mein Zimmer: Die Gorch Fock liegt im verblassenden Licht des Tages. Die Vorhänge lasse ich auf, damit sie morgens das Erste ist, was ich sehen werde.
Der Abschied naht. Wieder die Deichbrücke und ein letzter Blick. Ein Jahr werde ich sie nicht sehen, die Gorch Fock, erst dann liegt sie nach Werftaufenthalt und Ausbildungsreise wieder in Kiel. Womöglich sehe ich sie auch niemals wieder: Kiel ist weit. So ist das mit Abschieden: Schön war die Zeit, als man noch nicht wusste, dass zu oft ein „für immer“ darin steckt. Tschüss, schönes Schiff, denke ich traurig, und mache mich auf zum Bahnhof.
Im Zug pladdert Starkregen an die Fenster. Die Fähre nach Langeoog schwankt; es gibt eine Unwetterwarnung, mal wieder. Ich blicke hinaus auf die brodelnde, graue See und denke, dass der Mensch da eigentlich nichts verloren hat.
Aber versuchen kann man es. Denn manchmal, denke ich, ist die See ja auch freundlich: sie öffnet Handelswege, spendet Erkenntnisse, Nahrung und Leben.
Und irgendwo setzt ein glücklich heimgekehrter Funker seinem Töchterchen die Marinemütze auf.
Allein
Der Sturm hat sich gelegt. Mein Fenster empfängt mich mit warmen Lichtern: Ich mag das, wenn ich nach Hause komme. „Da hat es sich jemand aber hübsch gemacht“, denken die Leute, wenn sie vorbeiradelnd in mein Fenster schauen, und wärmen sich, genau wie ich jetzt, an dem schönen Schein.
Denn natürlich wartet dort niemand. Ich ließ das Licht absichtlich an: Weil es so mehr nach Zuhause aussieht.
Tatsächlich blicke ich beim Abstellen des Rades hinunter zum Deich, und frage die Insel, genau wie dich: Warum liebst du mich eigentlich nicht? Die Insel schweigt, genau wie du. Und immer ist es so schwer.
Natürlich kann die Insel nichts dafür. Ich wuchte die Tasche mit den nutzlosen Büchern und den Programmheften aus dem Korb. Es hat nichts mit dir zu tun, sage ich mir, die Leere im Vortragssaal erinnernd. Und ich, plötzlich so klein an dem Pult vor den Stuhlreihen; die hübsch drapierten Bücher vor mir, um die sich letzte Woche noch Interessierte scharten, heute nur mehr ein Schutzwall vor der Einsamkeit. Niemand kam.
Es ist kalt in dem Raum, und wo nach der letzten Lesung noch Weinkaraffen standen und die Luft erfüllt war von Wärme und herzlicher Bewunderung, steht nun der Künstler, den keiner will, und schiebt leise die Tische zurück an ihren Platz; die Programmhefte beim Einsammeln noch warm vom Drucker.
In Berlin wärst du heute Nacht der Künstler, und ich sähe zu dir hoch, aus der Sicherheit deines Publikums. Du warst nie allein, aber wenn, dann wäre ich da gewesen, und ich wollte immer, dass du das weißt. Doch selbst wenn Tausende kämen: Letztendlich ist jeder Künstler auf seiner Bühne allein, immer, und allein in seinem Schaffen. Auch du bist auf deiner Bühne allein, und wahrscheinlich wirst du heute Nacht ebenso allein wie ich nach Hause fahren; es sei denn, du fändest wieder jemanden, der dir das Taxi zahlt und dir zuhört, wie du mit kräftigen Zügen durch die Schatztruhe deiner Erinnerungen schwimmst. Es befriedigt nicht.
If you’re going through hell, keep going, sagte Churchill, und natürlich werde ich nicht aufhören zu schreiben, nur weil einmal niemand zu einer Lesung kommt, aber seien wir ehrlich: An der Künstler_innenhölle ist sowas schon verdammt nah dran.
Es ist still heute Nacht. Wo gestern noch Sturmböen an den Fenstern rüttelten und das Mauerwerk knarzen ließen, ist nun kein Laut zu vernehmen, bis auf das Summen von Elektrizität und das Klappern der Tastatur. Ich würde gern den Mond sehen, denke ich. Wenigstens den Mond. Und so fahre ich die Rolläden nochmal hoch, trete hinaus in eiskalte Nacht, und suche ihn, meinen stillen Freund am Firmament. Er ist da, klein wie ich, und verborgen hinter Wolken: Auch seine Supermondzeit ist vorbei.
Im Kühlschrank ist eine Flasche Champagner, man könnte sie aufmachen, denke ich, jetzt erst Recht. Aber es fühlt sich zu demütigend an.
Ich sehe wieder aus dem Fenster. Die Straße liegt vor mir im Dunkeln. Dennoch erkenne ich schemenhaft die Steine und die Sträucher, in denen Vögel schlafen. Irgendwo schlägt eine Tür. Am Rand der Straße glänzt etwas: Ich gehe nachsehen. Vielleicht ist es nur Müll, denke ich. Trotzdem: Da glänzt etwas.
Das Glänzen wärmt, als ich mich nähere. Und dann singt es, sanft und beruhigend. Ich höre genauer hin und begreife: Das Glänzen im Dunkeln ist das Meer; sein Singen das Rauschen. Das Meer, natürlich!—Fast hätte ich es vergessen.
Wo das Meer ist, ist es niemals zu still. Wo das Meer ist, ist Leben. Die Insel liebt jeden, sagt es, und jeden nicht. Die Insel wertet nicht, und das Meer zählt keine Besucher. Das Meer ist so viel größer als ich, denke ich, und trotzdem reiche ich ihm jetzt, als einziger Zuhörer.
Ich mag die Geschichten, die du erzählst, sage ich dem Meer. Vielleicht kann ich darüber schreiben. Die weißen Kämme der Wogen nicken.
Irgendwo in Berlin fährt ein Taxi durch die Nacht.
Nebellichten
Nebel liegt über der fast gespenstisch ruhigen See. Allein auf dem Deich stehend, genieße ich den Anblick des geliebten Meeres und lausche der Musik der Stille. Die Wellen berühren die Betonbefestigung des Hafenbeckens mit einem so zarten, silbrigen Klang, dass einem das Wort „Plätschern“ dafür viel zu grobschlächtig vorkommt. Die Fähre nach Bensersiel ist vor Kurzem ausgelaufen. Fast surreal mutet der Kontrast der Stille auf dem Deich zum Lärm und Gewusel im Inneren des Schiffes an, welches nun, noch in Sichtweite, mit wieder ausgeschalteten Maschinen lautlos durch das Wasser gleitet.
Die Sicht ist heute schlecht, und also muss sich der Kapitän in der engen Fahrrinne ganz vorsichtig vorantasten; oft mit nicht einmal mehr als 20 cm Wasser unter dem Kiel. Die Strecke Bensersiel — Langeoog mag kurz sein, aber sie ist gewiss nichts für Anfänger. Ich bin froh, dass ich an Land stehe.
Bald nimmt das große Motorschiff wieder Fahrt auf und entschwindet vollends im Grau.
Ich bleibe. Und noch immer badet dieser Satz mein Herz in balsamischen Essenzen. Ich bleibe: Hier. Am Meer.
Zwei Jahre, und die Liebe ist noch immer unbegreiflich. Bevor ich nach Langeoog zog, dachte ich immer, dass ich nur einen Menschen so beharrlich und ungebrochen lieben könnte, egal, wie viele Stürme und Schietweddertage dazwischen gerieten. Aber jetzt weiß ich: Es geht auch mit einer Insel.
Ich setze die Wanderung fort zum Strand. Für Dezember ist es wunderbar mild und heute überdies windstill. Meisenknödel hängen unbeachtet in den Vorgärten; die Vögel fressen sich lieber noch an den Würmern satt, die sie sich aus der regenweichen Wiese ziehen. Auch in den Dünen haben noch keine kalten Winterfarben Einzug gehalten: Der Sanddorn leuchtet in warmem Orange zwischen all den satten Grün- und Braunnuancen der Gräser; noch kann man die saftigen Beeren ernten, unserem Nationalparkführer zufolge schmecken sie um diese Zeit sogar besonders gut.
Langsam kommt die Insel zur Ruhe; der Touristenmagnet wird wieder zum Königreich der Natur, und ich bin dankbar dafür, denn auch mich hat das Jahr geschafft und ich verspüre starke Sehnsucht nach Stille.
Nach neuer Inspiration, Innehalten, Luftholen, Wachsen.
Am Strand flitzen Sanderlinge durch den Schlick, etwas weiter entfernt ruhen Möwen. Die Krähen wagen sich am Weitesten vor, das lackschwarze Gefieder vom Wind in alle Richtungen zerzaust. Die dreisten Dohlen sind ausnahmsweise mal nirgendwo zu sehen; statt dessen flattern winzige Schneeammern mit glockenhellem Piepsen wieder in Scharen über den Strand.
Ich denke an letztes Jahr und freue mich, dass sie jetzt wieder da sind. Der Winter ist schön auf Langeoog. Und kälter muss es für mich nicht werden.
Stille, denke ich, Stille. Ich giere danach. Wenn man sie nicht nur hören und fühlen könnte, sondern auch essen, atmen, schmecken, riechen: Ich flehte darum. Stille, bitte, bis mindestens Mitte Januar — Denn das neue Jahr wird aufregend.
„Dienst am Gast ist wie Dienst an der Waffe“ schrieb einst ein Freund, gelernter Hotelfachmann und jetzt Irgendwas-mit-Gender studierend. Damals, noch gänzlich von der Branche unbefleckt, dachte ich, er schriebe das nur des Wortspiels wegen, aber heute weiß ich, dass es da durchaus Parallelen gibt.
So trägt man in beiden Berufen teilweise Uniform, muss sich zu perversen Uhrzeiten von irgendwelchen Idiot_ innen anbrüllen lassen, zu noch perverseren Uhrzeiten aufstehen, merkwürdige Befehle befolgen und dabei, unter regelmäßiger Missachtung der eigenen Grenzen, körperliche Schwerstarbeit ausüben — Und all das in einem Beruf, dem überdies in der Regel (zu Unrecht) noch gesellschaftliche Ächtung widerfährt: Schade, dass mir zu „Kanonenfutter“ und „Frontschwein“ gerade kein passendes gastronomisches Pendant einfällt.
Auf jeden Fall hat all dies für mich im neuen Jahr ein Ende: Eine andere Arbeit ruft.