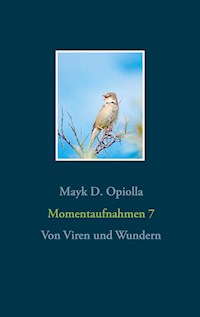Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Momentaufnahmen Berlin - Langeoog
- Sprache: Deutsch
Mit Band 4 der Reihe "Momentaufnahmen" legt Mayk D. Opiolla erneut eine Liebeserklärung an seine Wahlheimat Langeoog vor. 32 neue Geschichten bieten einen bildgewaltigen Reigen an Naturbetrachtungen und feingeistigen Reflektionen über das Leben; immer getragen von einer Melodie sinnlich-melancholischer Heiterkeit. Das Themenspektrum ist groß: Während langer Streifzüge durch die Inselnatur gibt sich der Ich-Erzähler in gewohnter Manier Tagträumen, Erinnerungen und Gedankenspielen hin. Überlegungen zu politischen und gesellschaftlichen Themen reihen sich dabei an lakonisch aufbereitete Beziehungsdesaster oder die subtile Beschreibung romantisch-zarter Bande; das Suchen und Finden von Gott ist ebenso Thema wie die Vermüllung der Meere, der Status der Bundeswehr oder die Frisur von Donald Trump. Und was hat eigentlich die ostfriesische Teezeremonie mit einem Priestergewand zu tun, was ein Brauhaus zu Jever mit Emanzipation? Mayk D. Opiolla schlägt auch dort Brücken, wo es auf den ersten Blick keinen Kontext zu geben scheint. Wir erfahren von männlicher Midlife-Crisis, von Depression, Winterstürmen, Verrat und Entfremdung, aber auch von Freundschaft, Vergebung, Geborgenheit und dem Wunder des Neuanfangs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch:
Mit Band 4 der Reihe „Momentaufnahmen“ legt Mayk D. Opiolla erneut eine Liebeserklärung an seine Wahlheimat Langeoog vor. 32 neue Geschichten bieten einen bildgewaltigen Reigen an Naturbetrachtungen und feingeistigen Reflektionen über das Leben — Immer getragen von einer Melodie sinnlichmelancholischer Heiterkeit.
Das Themenspektrum ist groß: Während langer Streifzüge durch die Inselnatur gibt sich der Ich-Erzähler in gewohnter Manier Tagträumen, Erinnerungen und Gedankenspielen hin. Überlegungen zu politischen und gesellschaftlichen Themen reihen sich dabei an lakonisch aufbereitete Beziehungsdesaster oder die subtile Beschreibung romantisch-zarter Bande; das Suchen und Finden von Gott ist ebenso Thema wie die Vermüllung der Meere, der Status der Bundeswehr oder die Frisur von Donald Trump. Und was hat eigentlich die ostfriesische Teezeremonie mit einem Priestergewand zu tun, was ein Brauhaus zu Jever mit Emanzipation? Mayk D. Opiolla schlägt auch dort Brücken, wo es auf den ersten Blick keinen Kontext zu geben scheint. Wir erfahren von männlicher Midlife-Crisis, von Depression, Winterstürmen, Verrat und Entfremdung, aber auch von Freundschaft, Vergebung, Geborgenheit und dem Wunder des Neuanfangs.
Für meine Eltern und Dich
Inhalt
Leben
Aufgeben
Natur
Lütt un groot
Ratz
Träume
Heile Welt
Hier und Jetzt
Neujahr
Decrescendo
Beseelt
Wanderer
Schatten
Plan B
Ansprüche
Freigelegt
Jever
Müll
Uhl und Nachtigall
Pleite
Sonnenschein
Sicher
Fernweh
Teetied
Norderney
Sommerwolken
Wege
Vielleicht
Krone
Währung
Atmen
Reise
Leben
Ich treffe den alten Nachbarn vor der katholischen Kirche. „Ach, min Jung, du bist das“, sagt er, er hat mich nicht gleich erkannt. „Was machst du denn hier?“, fragt er, während er meine Hand auf großväterliche Weise in seine beiden nimmt und mich gutmütig anlächelt. Ich bin froh, dass kein pseudowitziger Spruch kommt von wegen „Sünden beichten“ oder sowas, denn darauf hätte ich heute keinen Nerv.
Also erzähle ich ihm, dass ich für einen kranken Freund Kerzen angezündet und mir außerdem die Aushänge angesehen habe. Ein Orgelkonzert wird gegeben, da möchte ich gern hin. „Ich mag die Kirche“, sagt der Nachbar, und ich pflichte ihm bei; die katholische Kirche auf Langeoog ist zumindest von innen wirklich sehr schön — über das Äußere mag man streiten.
„Weißt du“, fährt er fort, und ich sehe die Erinnerung in seinen wasserblauen Augen aufziehen, „ich bin gar nicht katholisch, ich gehöre gar keiner Religion an. Aber mir hat einmal jemand in dieser Kirche gesagt: Wir heißen Sie hier nicht als Protestant oder Katholik willkommen, sondern als Mensch. Das hat mir gefallen. Und dann bin ich auch wieder hingegangen.“
„Mit mir ist das auch so“, berichte ich, „es gibt ja immer sone und solche in der Kirche. Ich hab’s dir noch nicht erzählt, sage ich, aber ich habe evangelische Theologen in der Verwandtschaft. Für die existiere ich nicht. Weil ich so bin, wie ich bin. Und dann kenne ich andere Geistliche, katholisch sogar, die mir sagen, dass Gott mich sehr wohl lieb hat, und zwar nicht obwohl, sondern weil ich bin, wie ich bin. ‚Mit manchen Menschen hat Gott eben ganz besondere Pläne‘, hat mir ein lieber Pater in diesem Kontext gesagt, und ich mag ihn nicht nur aus Eitelkeit dafür.“
Das versteht auch der Nachbar.
„Aber sag, Söhnchen“, fragt er, und ich nehme mit einem Anflug von Rührung wahr, dass er mich tatsächlich „Söhnchen“ nennt — „dein Freund: Ist er denn sehr krank? Wird er sterben?“ Ich schlucke. „Nein“, sage ich. „Es ist eher so: Er stirbt von innen. Depression, weißt du. Ich kenne das selbst.“ Ich senke den Blick und er versteht auch das. „Ja, das ist wohl die Zeit“, sagt er teilnahmsvoll, „wer hält das schon aus. Und ihr jungen Leute, ich dachte, ihr hättet es besser.“
Nachdenklich schiebt er seine blaue Seemannsmütze zurück und streicht sich eine Träne aus dem Bart, die der kühle Novemberwind aus seinen Augen getrieben hat. Die Heckenrosen um uns blühen immer noch; surreal sieht das aus, das leuchtende Pink in all dem goldgelben Laub: Die warmen Tage des Spätsommers haben die Natur durcheinandergebracht.
„Dabei haben wir es doch eigentlich gut, sagt er, deine Generation, sogar meine noch, was haben unsere Eltern und Großeltern mitgemacht, die ganze Scheiße mit den Nazis, und der Hunger und das alles.
Wir haben zu essen und es steht zumindest noch kein neuer Krieg vor der Tür, aber ich weiß nicht, wo das gerade alles hinführt mit diesem, wie heißt der, Trump, und dieser ganze Wahlkampf, das ist so würdelos, und dann hier diese Typen, die AfD, das hatten wir doch alles schonmal, also, ich brauch das nicht mehr. Und dann Putin, der will doch auch wieder die Weltherrschaft.“
Er redet sich in Rage und ich muss ein bisschen schmunzeln, denn ich kenne ihn ja schon.
Ich sehe den Nachbarn oft über seine Hecke lugen, wenn ich zur Arbeit fahre, dann winkt er und grüßt, und manchmal kommt er auch ins Büro zum Klönschnack; an seinem beeindruckend vollen weißen Haarschopf schon von Weitem zu erkennen.
„Ach, ich sabbel schon wieder zu viel“, lacht er, „meine Frau sagt das auch immer: ‚Du sabbelst zu viel‘.“
„Nein“, beruhige ich ihn, „das ist schon gut. Ich mag Menschen mit Geschichten, und du hast ja auch viel erlebt. Gerade von Menschen deiner Generation möchte ich noch viel hören, denn was bleibt uns denn, wenn die letzten Zeitzeugen tot sind? Nur noch Idioten, die ‚Geschichtsverfälschung‘ und ‚Lügenpresse‘ brüllen, weil eben keiner mehr sagen kann, wie es wirklich war!“ — Jetzt ist es an mir, mich aufzuregen.
„Und man weiß ja auch nie, wie lange man noch bleibt.“
„Ja“, sagt er, „ich denke auch oft daran. Es ist halt so, ich bin auch bald dran. Und mir braucht keiner sagen, dass er keine Angst hat vor dem Sterben. Natürlich hab ich Angst. Man weiß ja nicht, wo man hinkommt, nech. Das Wie ist mir noch egal, aber was ist denn danach? Das weiß ich doch nicht. Und die Geistlichen, ja, die erzählen viel, aber letztlich weiß es von denen ja auch keiner wirklich.“
Ich starre den Mann begeistert an und bin einmal mehr gottfroh, dass es Menschen gibt, mit denen man nicht über irgendwelchen langweiligen Scheißdreck smalltalken muss: Das Leben schreibt bessere Geschichten.
„Wobei, das rein Körperliche ängstigt mich am Sterben nicht“, fährt der Mann fort. „Ich hab so viele Tote gesehen, das zähle ich nicht mehr. Wobei den ersten, den vergisst man doch nicht. Damals, als ich zur See fuhr, hat ein plötzlich hochschnellendes Stahltau einen Kameraden enthauptet, ich hab ihn gesehen, der lief noch einen Schritt, und dann war da das ganze Blut, und ich hab erst gar nicht kapiert, was los ist. Ganz jung war ich da, 14 oder 15, wir fuhren irgendwo vor Ceylon, Sri Lanka heißt das ja jetzt.“
Terror liegt in der Stimme des Mannes. Ich kenne einige Mythomaniker, aber ich spüre, die Geschichte ist wahr, und ich wünschte, sie wäre es nicht. „Ja, so war das“, sagt er, „es kam mir damals ewig vor, wie lange der da noch stand, aber wahrscheinlich war es in Wirklichkeit nur sehr kurz. Wir mussten ihn dann einsammeln und saubermachen und alles, und dann kam er ins Wasser, Tschüss. Auf See hat man ja keine Zeit für große Sentimentalitäten, aber schlimm war das schon.“
Uns passiert eine Spaziergängerin mit ihrem Terrier.
„Wie lange fuhrst du zur See?“, frage ich, um ihn aus der Erinnerung zu hieven.
„Acht Jahre“, sagt er, „aber das hat auch gereicht“. Wir lachen. Es ist erlösend.
„Und hier“, sagt er, „du kennst das ja alles nicht mehr, hier wurden ja ständig welche angespült früher, und wir Insulaner gingen dann alle zum Strand mit einem Sarg, das war völlig klar, dass alle Männer mit anpackten. Jeder machte das, das war gar keine Frage. Und irgendwann gewöhnt man sich dran. Meine Eltern, die liegen auch hier oben auf dem Dünenfriedhof, mit dem Handkarren wurden die noch hingebracht, damals gab es das ja noch nicht mit den vielen Kutschen wie heute, und die Leute waren nicht zimperlich beim Bestatten. Ich hab das auch oft gemacht, und natürlich fiel unterwegs mal einer raus, aber dann kam der halt wieder rein, und Deckel drauf und gut.“
Ich muss lachen, auch wenn es makaber ist.
„Na, unter die Erde kriegt man sie ja letztlich immer irgendwie“, sage ich, „nur die ganzen verwahrlosten Gräber, die deprimieren mich: Man sieht es ja oft, das sich keiner mehr kümmert.“
Bei diesem Gedanken werde ich wieder ernst.
Auch hier stimmt mir der Nachbar zu. „Ja“, sagt er, „ich kenne die auch, diese Gräber, oft genug ist Familie da, und Geld haben sie auch, aber es kümmert sich trotzdem keiner. Ich hab auch schon zu meiner Frau gesagt, wir kommen ins Wasser, das ist doch am Besten so. Und dann sind wir im Wasser und lassen uns treiben mit dem Golfstrom, und ich bin nochmal überall da, wo ich mit dem Schiff gefahren bin, nur ohne die Arbeit, das ist doch schön so.“
„Ja“, sage ich, „eine Seebestattung, das möchte ich auch.“ Und überdies gehört auch das Sterben wohl zum Leben — ein Allgemeinplatz, aber so ist es. „Ich war ja auch mal kurz klinisch tot“, erzähle ich ihm, „da denkt man hinterher anders über das Leben. Vor allem ist seit dieser Erfahrung meine Geduld mit Bullshit begrenzt.“ „Mit was?“ fragt er, und ich korrigiere auf „Schietkroom“. Das versteht er. „Ich will halt keine Zeit mehr verschwenden. Und ich verlasse Menschen und Orte, die mir nicht gut tun, so ist das.“ Der Mann nickt. „Bei anderen wiederum“, fahre ich fort, „da weiß ich halt einfach, dass es sich lohnt. Und spiritueller geworden bin ich, man hat einfach feinere Antennen in alle Richtungen.“
Ich weiß nicht, ob er das nachvollziehen kann, aber mir fällt nicht ein, wie ich auf die Schnelle einem alten Insulaner erklären soll, was mieses Qi ist, also vertiefe ich es nicht weiter — die Kommunikation zwischen den Generationen ist halt doch nicht immer einfach. Aber das mit dem Nahtod erfasst er.
„Oh“, sagt er, „dann warst du auch schonmal da. Ja. Und dann siehst du jetzt erst, wie schön die Welt eigentlich ist, trotz allem. Und dass es sich lohnt.“ Ich nicke.
„Kann ja vorbei sein“, sage ich, „ganz plötzlich.
Und dann sind sie weg, all die Geschichten, die man noch erzählen wollte, all die Geheimnisse, die man niemandem anvertrauen konnte, und all die Menschen, denen man niemals mehr sagen können wird, dass man sie lieb hat.
Und dann gehen Fremde durch deine Sachen und schmeißen alles weg; die Briefe, die Fotos, die Bücher. Die schöne, weiche Strickjacke, die du so gern an Winterabenden trugst, wird achtlos in einen Müllsack gestopft, weil du längst kalt bist und nichts mehr zum Wärmen brauchst. Und Leute, die du für Freunde hieltest, regen sich auf, weil man von deinem Leben so gut wie nichts mehr verkaufen kann. Weil es für sie keinen Wert hat, all das, was du liebtest und was dein Leben ausmachte.“
„Genau so ist es“, sagt der Nachbar, „ich seh doch immer die Leute mit dem Hänger vorfahren, wenn schon wieder einer weniger ist, da kommt es dann drauf, das ganze Leben, alles muss schnell gehen heute, das Leben, das Sterben, und zack und weg. Früher“, sagt er, „haben wir uns irgendwie mehr Zeit gelassen. Mit dem Leben. Und irgendwie auch mit dem Sterben. Damals gab es noch Abschied. Heute ist es nur noch Vergessen. Und ich kann mich nur wiederholen: Wer sagt, er hat keine Angst davor, der lügt.“ Wir setzen unsere Wege fort. „Hol di munter, min Jung!“, ruft er, und tippt zum Gruß an seine Mütze. Dann radelt er davon.
Hinter uns scheinen die Kerzen durch die Fenster von Sankt Nikolaus.
Aufgeben
Es ist kalt geworden. Meine Balkonpflanzen beginnen zu leiden; einige von ihnen sind nicht winterhart und werden die Kälte nicht überstehen. Zum Sterben gezüchtet, denke ich, man zog und päppelte sie zu keinem anderen Zweck, als den Menschen einen einzigen Sommer lang Freude zu machen. Und dann war der Sommer ja doch wieder zu kurz, eigentlich ist er doch immer zu kurz. Und nun sieht man auf die sterbenden Blumen und traut sich noch nicht recht, sie auszugraben. Andererseits hätte es aber auch wenig Sinn, ihnen noch länger beim Siechen zuzusehen, wäre es nicht an der Zeit, sie durch Frosthartes zu ersetzen oder die Balkonkästen leer zu lassen bis zum nächsten Frühling?
Aber dann hofft man noch einmal auf warme Tage, auf eine weitere letzte Blüte, auf den letzten Rest wohlgenährten Grüns im Gelb des verbleichenden Jahres.
Zum Glück habe ich gerade ohnehin keine Zeit zur Gartenarbeit, also stehe ich nur etwas ratlos vor den Kästen mit den immer Zukurzgeliebten und fühle mich ihnen verwandt.
Und dann blickt man zurück auf diese kurze Ahnung von Sommer, auf diese all zu schöne Erinnerung an das Erblühende, daran, dass es jemanden gab, der wieder Licht und Farben in einem sah anstelle des Unberührbaren. Der einem einen Platz in seinen Träumen anbot. Und man näherte sich diesen Träumen mit zögerlicher Neugier und hob sie ans Herz, wie man eine Muschel ans Ohr hebt, um den Ozean darin rauschen zu hören. Man wollte es wagen.
Aber so wie der Ozean zogen sich auch die Träume zurück, und dann stand man da, ratlos wie nun vor den Balkonblumen, und wartete auf die nächste Flut.
Zuerst noch voller Hoffnung — es rauschte doch noch, das ferne Meer! Aber irgendwann begriff man, nein, die Jahre hatten es längst gelehrt, dass sich die Liebe anderen Gezeiten unterwarf als die Natur; genauer: Gar keinen Gezeiten.
Was verschwunden war, würde nicht wiederkehren. Lass los, sagte ich mir längst, er kommt nicht mehr.
Aber jeder Sonnenstrahl, jedes azurblaue Leuchten des Inselhimmels, jeder Ruf der ziehenden Gänse, ließ ihn dann ja doch wieder vernehmen, den zarten, süßen Ton der Hoffnung, den man gleichermaßen ersehnte und verfluchte.
Nun ist es Winter. Und ich frage mich einmal mehr: Wo verläuft er eigentlich, dieser Grat zwischen Naivität und Gutgläubigkeit, zwischen Realismus und Resignation? Ich finde ihn nicht, und doch balanciere ich täglich darauf.
Wie alt muss man werden, um keinerlei Hoffnungen mehr zu hegen? Und ist das überhaupt erstrebenswert?
Warum gieße ich meine sterbenden Pflanzen, wenn ich doch weiß, dass ich sie nicht retten kann? Warum vermisse ich jemanden, der mir längst entglitten ist, aus den üblichen Gründen oder anderen, ich will es nicht wissen.
Am Ende der Straße liegt der Deich. Ich kann weit ins Land schauen bis dahin, und ich denke, dass das der einzige Weg ist; nicht der Weg zum Deich als solcher, aber der Blick nach vorn: Was sonst bliebe auch übrig?
Man is not made for defeat schrieb Churchill, aber dennoch gerät man immer wieder in Situationen, in denen zumindest eine punktuelle Kapitulation kein Aufgeben, sondern ein Triumph wäre: Loslassen zu können, ohne das erstrebenswerte Ganze aus den Augen zu verlieren. Entlieben und dennoch weiter an die Liebe glauben. An die Liebe glauben können, ohne auf die Liebe zu hoffen. Die Tür für jemanden angelehnt lassen, ohne ständig aus dem Fenster zu starren, ob er denn kommt. Sich selbst wieder genug sein. Es hatte doch wunderbar funktioniert!
Irgendwann kommt das Meer zurück, wenigstens darauf ist Verlass: das Meer kommt immer zurück, und vielleicht liebe ich es auch deswegen.
Ich halte die Muschel ein letztes Mal ans Ohr. Dann lege ich sie behutsam in den Sand. Der Wind trägt die Melodie in ihrem Inneren davon, bevor sie die Wellen überspülen. Vielleicht finde ich sie irgendwann wieder, denke ich. Vielleicht höre ich dann etwas Neues.
Aber zugleich weiß ich, wie sinnlos das ist, als ich über den weiten leeren Strand blicke: Es gibt zu viele Muscheln hier. Die Strandkörbe, in denen ich mit ihm sitzen wollte, sind ohnehin längst weggeräumt. Die Bäume, in deren sonnendurchflutete Kronen ich mit ihm geschaut hätte, sind kahl.
Ich muss jetzt heim. Wenn der Wind dreht, höre ich vielleicht noch sein Rauschen in den nackten Zweigen des Waldes. Das Herbstlaub auf dem Waldboden hat jetzt die Farbe seiner Haare, denke ich, und ein letzter, bittersüßer Rest Wärme klammert sich an mein Herz wie der letzte Rest Leben an meine Pflanzen.
Ich könnte die letzte Blüte an der Hortensie einfach abreißen, denke ich, noch immer vor den Balkonkästen ausharrend, dann fiele es vielleicht leichter, sie wegzuwerfen.
Aber ich bringe es nicht fertig. Ich lasse die Blüte da, wo ich sie durchs Fenster sehen kann.
Natur
Der Supermond der vergangenen Tage hat die See nah an den Strand geholt. Weißkämmige Wellenberge donnern in stetem Rhythmus auf den Sand, während eine losgerissene Seefahrtsmarkierung im Flutsaum vom Wasser umspült wird. Der Strand ist leer. Es ist November auf Langeoog.
Abends fahre ich an dem Hotel vorbei, in dem mein Leben auf Langeoog begann. An der Rezeption ist niemand. Im Restaurant sitzt das Besitzer-Ehepaar an dem üblichen Tisch; der neue Direktor steht in unterwürfiger Haltung daneben, bereit zum Rapport. Ich empfinde nichts. Es ist ja auch schon wieder gefühlte drei Leben her.
Wieder einmal ist viel passiert in einem Jahr, und gleichzeitig auch wieder nichts: Die Ambivalenz des Dorflebens. Man radelt täglich seine beruflichen und sonstigen Pflichten ab, genießt, wenn möglich, die Natur, versucht Kontakte zu pflegen zu Familie und Freunden. Versucht zu schlafen. Versucht aufzuwachen. Versucht zu leben. In der Zeitung miese Nachrichten und ab und zu auch ein paar gute. Es wird viel gestorben dieses Jahr. Draußen rüttelt der erste Wintersturm an der Flaute im Herzen.
Meine Eltern berichten von einer Fahrt durch die Eifel. Es gab ein Unwetter, überall liegen Äste herum, berichten sie. Aber es sei schön dort, mit den vielen Bäumen, den Burgen und Weinbergen, die Mosel ein stilles, grünes Band, Frühnebel über den Tälern.
Ich weiß, sage ich. Ich war nie dort. Aber einst mochte ich jemanden aus dieser Region. Ich sah all das in seinen Augen. Vielleicht hätte ich ihn lieben können. Vielleicht hätte ich mich sogar an diesen seltsamen Dialekt gewöhnt. Inzwischen lebt auch dieser Mensch nicht mehr dort, und manchmal bekomme ich noch etwas von ihm mit, aber er streift irgendwo durch ferne Wälder, allein mit einer Form von Einsamkeit, in der ihn niemand erreicht. Das ferne Meer ist ihm kein Trost, und ich bin es auch nicht.
Die Nacht bricht allzu früh herein. Immerhin entschädigt uns der Himmel dafür mit einem prachtvollen Sonnenuntergang, Schäfchenwolken glühen in Zuckerwatterosa auf türkisblauem Grund. Hinter der Kirche, in der ich ein Licht anzünde, brandet das Meer. Sanddornbeeren leuchten aus ihren Dornenkronen; orangeroter Saft rinnt durch meine Handflächen, als ich ein paar davon pflücke, die Früchte sind überreif. Wenn niemand sie erntet, war all die Pracht umsonst.
Ich streiche etwas davon auf meine Haut; das viele Vitamin C darin ist ein Antioxidans und also gut gegen das Altern: Denn auch ich verblühe allmählich, und manchmal grämt es mich. Aber an anderen Tagen bin ich beinahe noch schön. Und das Leben, denke ich, ist es auch: Trotz allem.
Am Dünenüberweg betrachte ich gedankenverloren das Meer, auf das der goldglänzende Strandhafer nun den Blick freigibt. Die vom letzten Sturm angespülte Seefahrtsmarkierung, eine grüne Tonne, liegt immer noch dort. Der Tonnenhof auf Norderney ist informiert und wird sie wohl bald wieder auf Position schleppen lassen.
Ich überlege, ob es in meinem Inneren zuletzt eine Bojenkette gegeben hat oder irgendein anderes Seefahrtszeichen; irgendeine Richtschnur für mein Denken und Fühlen. Man soll seinen Kurs nach den Sternen richten, nicht nach den Lichtern vorbeifahrender Schiffe, heißt es in einem schönen Epigramm, und ich vermute, dass ich letztlich wohl doch allzu oft auf die oberflächliche Pracht vorbeitreibender Überwassereinheiten hereingefallen bin; blind für den Rost unter ihrem Lack und ihr defektes Ruder.
Die Nacht senkt sich auf Langeoog. Es war ein klarer Tag und der abnehmende Mond ist nur noch eine schmale Sichel. Die Sterne sieht, wer will, sehr deutlich.
Lütt un groot
Auf dem Weg zum Strand hinunter muss ich klettern: Der letzte Sturm hat steile Kanten in den Dünenfuß gefräst, die Holzbohlen der Strandüberwege sind längst weggeräumt. Dennoch zeigt sich der Tag in völliger Unschuld. Raureif hat sich über den nassen Sand gelegt und lässt das Plateau des Dünenabbruchs aussehen wie einen mit Puderzucker bestreuten, spekulatiusfarbenen Kuchen. Durch die Brandung flitzt emsig ein Sanderling.
Ein Kuchen!, denke ich konsterniert, es sieht wirklich aus wie ein Kuchen! Dabei ist jedes Nagen an den Dünen ein Nagen an unserer Existenz. Wie also kann etwas an sich so Abscheuliches so hübsch verpackt daherkommen?
Andererseits, denke ich weiter, ist das doch meistens so. Denn wie oft entpuppen sich vermeintlich grandiose Dinge im Leben als Matruschka-Puppen, deren innere Figuren nicht nur immer kleiner werden, sondern sogar immer trivialer und hässlicher, je länger man sich mit ihnen beschäftigt? Wie oft war eine nette Geste nichts als Strategie, die Freundschaft nichts als Kalkül, die Avance nichts als Eitelkeit?
Die Dämmerung hat sich über das Meer gelegt. Ich sehe das nun seit 1000 Tagen, und es wird mir nicht Leid: Das aquamarinfarbene Leuchten der sich aufbäumenden Wogen, die schneeweißen Schaumkämme. Der Sanderling hat keine Angst vor mir, er flitzt vor meinen Füßen herum, als sei ich ein Artgenosse oder irgendwas, das immer da ist: Der Sand. Die See. Die Muscheln. Und ich wünschte, ich hätte diese Gewissheit noch.
Ich habe sie nicht. Das Inselleben ist teuer, und ich weiß nicht, wie lange ich es mir noch leisten kann. Ich schiebe die Schuhspitze in einen Haufen getrockneten Tang, in dem Eiskristalle glitzern. Jedes winzige Detail ist so wunderbar auf dieser Insel. Ich geh hier nicht weg, denke ich. Nur noch in einer Kiste, mit den Füßen voran. Kurz flammt Kampfgeist auf. Aber dann ist er fort.
Wie absurd es doch ist, das Hässliche in all dem Schönen! Sieh dich doch an, sage ich der Insel. Wie kann es hier Leid geben? Wo ist hier Platz für das Schlechte? Aber nach 1000 Tagen darf man sich keiner Illusion mehr beugen: Wo Menschen sind, ist Schlechtigkeit. Denn auch Langeoog ist nur ein Mikrokosmos, in dem alles Einzug hält, was einem auch anderswo das Leben verleidet: Wie im Großen, so auch im Kleinen. Schließlich eint, wie man jährlich der Debatte ums Silvesterfeuerwerk entnehmen kann, die Menschen hier nicht einmal die Liebe zur Natur.