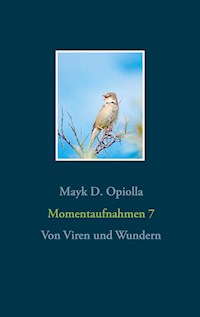
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Momentaufnahmen
- Sprache: Deutsch
Das siebte Jahr auf Langeoog. Mit dem Erwachen des Frühlings bricht die Corona-Krise auch über die Insel herein. Zum ersten Mal erfolgt der große Vogelzug fast unbeobachtet; zum ersten Mal ist es sogar an Ostern so still, dass man die Blütenblätter von den Bäumen fallen hört. Die Touristen sind fort, das Dorf rottet sich zusammen. In der Isolation entsteht neue Nähe, aber es gärt auch Gift im Langeooger Mikrokosmos. Die Zukunft erscheint zerbrechlich, Existenzsorge nagt. Und doch prägt die Prosastücke dieses Bandes keine Verzweiflung, sondern ein lebenshungriger Blick auf die Welt, die Geborgenheit im Glauben sowie das Wunder unverhoffter Liebe. Gezeichnet in eindrucksvollen Sprachbildern führt der Ich-Erzähler über eine Insel im Ausnahmezustand, aber auch an Orte tiefen Friedens. Jenseits von Langeoog bilden u.a. ein uraltes Zisterzienserstift in Niederösterreich, die tiefen Wälder der Südeifel oder die Hansestadt Bremen die Kulisse. 42 neue Geschichten, mit einem Themenspektrum von Liebe bis Weltpolitik. Die aktuelle Themenauswahl sowie ein farbenprächtiger Erzählstil, schonungslos ehrlich, mit unbestechlichem Blick und garniert mit bissigem Wortwitz, haben der "Momentaufnahmen"-Reihe von Mayk D. Opiolla mittlerweile eine feste Fangemeinde beschert: Auch weit über die Inselgrenzen hinaus. Alle Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch:
Das siebte Jahr auf Langeoog. Mit dem Erwachen des Frühlings bricht die Corona-Krise auch über die Insel herein. Zum ersten Mal erfolgt der große Vogelzug fast unbeobachtet; zum ersten Mal ist es sogar an Ostern so still, dass man die Blütenblätter von den Bäumen fallen hört. Die Touristen sind fort, das Dorf rottet sich zusammen. In der Isolation entsteht neue Nähe, aber es gärt auch eine Menge Gift im Langeooger Mikrokosmos. Die Zukunft erscheint zerbrechlich, Existenzsorge nagt. Und doch prägt die Prosastücke dieses Bandes keine Verzweiflung, sondern ein lebenshungriger Blick auf die Welt, die Geborgenheit im Glauben sowie das Wunder unverhoffter Liebe. Gezeichnet in eindrucksvollen Sprachbildern führt der Ich-Erzähler über eine Insel im Ausnahmezustand, aber auch an Orte tiefen Friedens: Darunter ein uraltes Zisterzienserstift und ein Exerzitienhaus im Wald. 42 neue Geschichten.
Meinen Eltern und A.
Inhalt
Knotenpunkt
Ende
Durchreise
Rückkehr
Festhängen
Romantik
Orkan
Versuch
44
Virus
Neue Zeiten
Unschuld
Nähe
Start
Wunder
Stillstand
Regenluft
Urlaubsträume
Wiederbelebt
Normalität
Zukunftserinnerung
Seltsam
Quarantäne
Danach
Platz
Grün
Wach
Liebe, Tod und Leben
Leib und Seele
Post
Ruhepol
Besitz
Anreise
Ankommen
Müde
Gartentor
Sprudelnd
Empfang
Herbstanfang
Bald
Bahn
Wünsche
Knotenpunkt
Nun gibt es ja Menschen, die der Ansicht sind, Katholiken wären alle nicht mehr ganz dicht, oder, um es der Jahreszeit angemessen auszudrücken: Hätten nicht alle Kerzen auf dem Adventskranz. Und angesichts dreier Gestalten, die, lediglich von dem Motto „Das Licht des Herrn leuchte uns“ beschienen, in völliger Dunkelheit am Strand entlang durch den Sand stapfen, scheint das gar nicht so abwegig. „Da verbinden sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns …“ singen sie; dann marschieren sie weiter, verschluckt von der Schwärze der Inselnacht, am Vorabend des ersten Advent.
Eine der drei Gestalten bin ich.
Ein nächtlicher „Adventsgang“ war angekündigt und ich rechnete mit einem kurzen Marsch um die Kirche, mit einigen Stationen des Innehaltens, Singens, Hinein- und Hinaushorchens; zumal wenige Minuten vor Beginn noch ein gewaltiger Wolkenbruch auf die Insel niedergegangen war.
Nun ist der Beginn einer Bußzeit aber offensichtlich nichts für Verweichlichte, und so wurde die alte Seenotbeobachtungsstelle als Ziel angegeben; eine Dreiviertelstunde Marsch von der katholischen Kirche entfernt. In völliger Dunkelheit, mit nichts ausgestattet außer mit dem Vertrauen auf den, der alle Wege kennt.
Ich bin nachtblind. Ich erkenne im Dunkeln maximal noch starke Kontraste, und generell mag ich die Dunkelheit nicht. Ich schließe niemals die Rollläden ganz und kaufe auch keine Gardinen, die jedes Licht fernhalten. Mein Vertrauen auf Gott wuchs mit den Jahren, ich bin froh darüber — doch mein Vertrauen in die Menschheit und in die Nacht bleibt wohl noch länger ausbaufähig. Nun aber muss ich vertrauen. Auf meinen Körper, meinen Gleichgewichtssinn, mein Gehör, meine Erinnerung an die im Hellen so oft beschrittenen Wege, die nun kaum mehr als fleckige Schatten links und rechts von mir sind. Und vor mir liegt nichts als Dunkelheit.
Die Ansammlungen von Teek am Strand sehen bei Nacht aus wie Krallenhiebe eines gigantischen Ungeheuers. Am Horizont blinken die roten Lichter der Windparks, dazu leuchten all die riesigen Frachter auf Reede. Im Nordosten gleitet der Schein des Leuchtfeuers von Helgoland über die schwarze See, im Westen blinkt das von Norderney. In erschreckendem Maße wird mir dabei bewusst, wie sehr die Deutsche Bucht schon zum Verkehrsknotenpunkt der internationalen Schifffahrt geworden ist; wie dicht gedrängt hier die Container von A nach B gefahren werden, obwohl sie, wie etliche Stürme bereits zeigten, in B zum Teil nicht einmal ankommen werden. Und dann liegen die Container für wer weiß wie lange auf dem Grund des Meeres, neben Tausenden toten Soldaten und anderen glücklosen Seelen, welche sich die See im Laufe der Jahrhunderte einverleibte. Und all der über Bord gespülte Müll von Kreuzfahrtriesen, Konsumgier und Berufsschifffahrt wird noch Jahrzehnte später an Strände gespült, schlimmstenfalls mit einem qualvoll verendeten Tier drumherum. „Macht euch die Erde untertan“ heißt es in der Bibel, aber in diesem Moment denke ich einmal mehr, dass es die Menschheit damit schon gewaltig übertrieben hat.
Außer der Insel-Seelsorgerin, die die Andacht leitet, ist nur der Kurpriester zum Adventsgang gekommen; beide sind mir sympathisch, was beim Bezwingen der Angst vor dem Dunkeln hilft. Niemand schwätzt; der verheißene Gang in Stille wird wirklich ein Gang in Stille. Meine beiden Weggefährten sind so ruhig, dass ich sie nicht einmal atmen höre; nur ihre leisen Schritte im Sand bieten mir Orientierung. Ungefähr alle 500 Meter bleiben wir stehen, beten und singen ein kurzes Lied.
In einiger Entfernung rühren sich Seevögel, aber es ist keine übermäßige Unruhe im Schwarm; ich hoffe, wir haben sie nicht gestört.
Die Sicht wird nicht besser: Nachtblind ist nachtblind. Aber ich stelle fest, dass mir die Beschaffenheit des Sandes unter meinen Füßen bereits Aufschluss darüber gibt, an welchem Strandabschnitt wir uns ungefähr befinden, und es ist ein herzwärmendes Gefühl, doch schon so sehr mit der Insel verwachsen zu sein. Der dunkle Dünenfuß zu meiner Rechten ist mein Ariadnefaden, meine Schritte werden mehr und mehr sicher; irgendwo hinter mir sind meine Begleiter. Ich merkte nicht einmal, dass ich sie überholte.
Wir verlassen den Strand an einem mir sehr vertrauten Überweg. Durch schwarze Dünentäler geht es auf kurvenreichen Pfaden hinauf, hinab und wieder hinauf zur Aussichtsplattform. Dann sind wir oben, und es beginnt erneut zu regnen. Aber der Regen macht mir nichts, denn längst haben sich der Frieden und das Wunder dieses Nachtganges in mein Herz gegossen, das am Tage noch unruhig und angstvoll gewesen ist. Ich lernte: Es tut gut, zu vertrauen. Es lohnt sich, auch einmal die Kontrolle abzugeben. Es ist ein großartiges Gefühl, zu wissen, dass sich sogar ein beherzter Schritt in die Dunkelheit lohnen kann. Und dass es sich lohnt, sich seinen Ängsten zu stellen.
Der Priester hat einen Schirm dabei, er hält ihn väterlich über die Seelsorgerin und mich. „Es kommt ein Schiff geladen“, singen wir. Ich mag das Lied; nicht nur, weil es so gut an die Küste passt. Ich mag seine Bilder, und die getragene Melodie mag ich auch.
„Das Schiff geht still im Triebe / es trägt ein’ teure Last / das Segel ist die Liebe /der Heilig’ Geist der Mast.“
Wieder zuhause, kommen die Sorgen des Tages zurück. Aber es ist schon weniger schwarz am Horizont.
Ende
Nach einem sehr warmen Dezember hat nun der Winter Einzug gehalten auf Langeoog. Das Jahr hat nur noch wenige Tage. Die Nacht umrahmt ein so prachtvoller Sternenhimmel, wie ihn nur winterliche Inseldunkelheit hervorbringt. Ich stehe am Fahrrad und kratze Eis vom Sattel; das erste Mal in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wo die letzten Wochen, der ganze letzte Monat geblieben sind. Selbst Weihnachten passierte dergestalt nebenbei, wie es eigentlich nicht passieren sollte. Es gab unzählige Adventsfeiern und -veranstaltungen, die ich dienstlich besuchte; dazu die ein oder andere dem Tag abgerungene Werktagsmesse; an den Sonntagen konnte ich nicht. Am ersten Weihnachtstag war frei. Ich erinnere mich an einen wohligen Kokon aus Nichtsmüssen, in Ruhe gekochtem Essen und nochmaliger Lektüre unzähliger Postkarten und Briefe, die mich in den Tagen zuvor erreicht hatten; soviel Liebe zwischen den Zeilen. Und dann war auch das Fest schon wieder vorbei.
Für viele meiner Freundinnen und Freunde oder Menschen im weiteren Bekanntenkreis war es kein frohes Fest. Sehr viele Elternteile verstarben dieses Jahr oder erkrankten schwer; teils wurden auch junge Menschen aus dem Leben gerissen. Langjährig treue Haustiere mussten für immer verabschiedet werden. Es wurde sich zerstritten oder getrennt, Babys wurden verloren und Arbeitsplätze. Dann sah man diese Menschen an, um deren Schicksal man wusste, und ahnte die Tapferkeit, die sie aufbringen mussten, um reihum „fröhliche Weihnachten“ zu wünschen, weil man das eben so machte. „Gesegnete Festtage“ sagte ich, der Neutralität halber, denn damit litt es sich hoffentlich etwas weniger.
Ich wurde mir des Luxus bewusst, meine Eltern wenigstens noch am Telefon bei mir haben zu können an Weihnachten, denn etliche meiner Freundinnen und Freunde konnten das nicht mehr. Reihum sah man, wie teils Ü50jährige im Freundeskreis wieder zu Kindern wurden und über Weihnachten heimfuhren zu Eltern, sonstiger Familie, Gans und Baum. Dann schliefen sie in ihren alten Kinderzimmern, fanden Erinnerungen wieder und Fotoalben. Und dann gab es jene, in deren Elternhaus nun Planen über den Möbeln lagen und durch dessen Zimmer Fremde als potentielle Käufer schritten. Und jene, deren Elternhaus bereits abgerissen worden war. Und jene, die nie eins hatten.
Auf der anderen Seite: Die Selbstverständlichkeit, mit der allerorten „Frohe Festtage im Kreise Ihrer Familien“,
„schöne Weihnachten im Beisein Eurer Lieben“ und so fort gewünscht wird, als sei ein Alleinsein an Weihnachten oder die Abwesenheit einer Familie, sei es durch traumatische Erlebnisse oder den Tod, vollkommen ausgeschlossen. Oder eines der letzten Tabus unserer Zeit. Ich fürchte, Letzteres.
Ich versuchte, über die Weihnachtstage so viele Bekannte wie möglich zu kontaktieren, von denen ich wusste, dass sie unter irgendeiner Form von Verlust und Ausgeschlossensein litten. Nicht aus Mitleid. Sondern weil ich wusste, wie es war, in dieser Gesellschaft unsichtbar zu sein.
Nun ist die Zeit angebrochen, die etwas mysteriös als „die Zeit zwischen den Jahren“ bezeichnet wird. Eine Zeit, in der man einerseits noch hektisch Dinge zu Ende bringen will, es sich andererseits aber auch noch nicht wirklich lohnt, etwas Neues anzufangen — denn waren dafür nicht erst die Neujahrsvorsätze gut? Es ist eine Zeit, in der viele Menschen Bilanz ziehen. Auch ich tue das. Über mein Jahr kann ich nicht klagen. „Still a pretty good year“ höre ich im Geiste Tori Amos singen; eine Frau, die mich in meiner Jugend mit ihrer keltisch-ätherischen Schönheit, ihrem Talent, ihrer Verletzlichkeit, dem Stolz in ihrer Nacktheit und der Anmut in ihrer Wut geradezu hypnotisierte. Auf jeden Fall habe ich keinen Grund zum Hadern; alles, wovor ich Angst hatte, ging gut aus oder ist in stabile Bahnen gelenkt. Es gibt keinen Verlust zu beklagen, der rückblickend nicht unumgänglich oder gar begrüßenswert gewesen wäre. Und alles, was ich liebe, ist noch da. Mehr, denke ich, kann man von so einem Jahr eigentlich nicht verlangen.
Ich erahne bereits den Horizont. Mit der Morgendämmerung glitzern gefrorene Reifenspuren auf dem Backsteinpflaster meiner Straße. In meinen Träumen glitzert der Wienerwald im Winterkleid, rattert der Nachtzug bereits einer niederösterreichischen Morgendämmerung entgegen. Dem Wetterbericht nach wird es in Wirklichkeit zwar nichts mit Schnee im Wald, aber das ist mir jetzt reichlich egal, denn die nahende Reise hilft mir, das alte Jahr erwartungsfroh und ohne Sentimentalitäten hinter mir zu lassen. Der Wanderrucksack steht längst gepackt in der Zimmerecke.
Er ist, trotz mehrfachen Umpackens und Neusortierens, ziemlich schwer, aber ganz ohne Gepäck geht es halt nicht hinüber: Weder ins neue Jahr, noch in den Wienerwald. Beim Anblick des Rucksacks muss ich wieder an die Freundinnen und Freunde denken, welche in diesem Jahr mit wirklich schwerer Last neu starten müssen. Mit der Last von Krankheit, Angst, Trauer, Armut oder Hoffnungslosigkeit. Mit Streit, Mobbing oder Verachtung. Ich hoffe, dass sie Erleichterung finden. Und dass ihnen Gott tragen hilft.
Durchreise
Die Dämmerung hat sich sehr unspektakulär angeschlichen. Irgendwann, ich erwachte lange vor dem Weckerklingeln, hatte sich der Nachthimmel über Bremen zu einem trüben Graurot aufgehellt. Wenig später konnte ich den Turm von St. Johann schon deutlich erkennen. Für die Frühmesse blieb aber keine Zeit; die Weiterreise stand an. Ich verabschiedete mich von den Birgittenschwestern in ihrem schönen, mittelalterlich anmutenden Habit, leerte mein gesammeltes Kleingeld in die Hände der Obdachlosen vor der Kirche und wuchtete mein Gepäck in ein Bahnhofsschließfach. Und dann stand ich da mit sehr viel Zeit und sehr wenig Verpflichtungen: Der Zug nach Hamburg ging erst in vier Stunden. Was blieb? Die Rückkehr in ein früheres Leben.
Und in diesem sitze ich nun im Café des Überseemuseums. Es ist ruhig, aber vermutlich verachten mich die Leute hier trotzdem, weil ich seit Stunden einen Tisch blockiere und mit meinem MacBook am W-LAN schmarotze; ein Klischeebild der digitalen Bohême, die sich für etwas Besseres hält, für so frei und so unabhängig, und dabei doch nur akademisches Prekariat ist, Lückenfüllmaterial im Getriebe eines nimmersatten Marktes.
Die Erinnerung an Berliner Jahre sitzt neben mir wie ein ominöser Schatten. Ich weiß noch, wie neidisch ich in meinem verhassten Marketing-Bürojob war, wenn mir die freien Dienstleister, mit denen ich damals kooperierte, von irgendwelchen Cafés aus schrieben. Aber als ich dann selbst als freier Dienstleister meinem täglich Brot hinterherjagte, anstatt als Angestellter im Büro zu sitzen, war der vermeintliche Glamour dieses Daseins schnell Geschichte. Ständige Unsicherheit im Nacken; dazu die Diskrepanz zwischen dem, was andere Leute dachten, wieviel man verdiente, und dem, was man wirklich erwirtschaftete im Verhältnis zum Aufwand: Dem Klinkenputzen, dem Anmahnen von überfälligen Rechnungen, dem Abarbeiten von Aufträgen unterschiedlichster Couleur: Hier die Website für einen Lastwagenteilezulieferer. Dort der Flyer für den Gourmet-Caterer. Und zwischen den Terminen reichte es eben oft nur zum Abarbeiten der Dinge irgendwo im Café, weil ich am Arsch der Welt wohnte, oder, wie der Berliner sagt, „j.w.d.“ — „janz weit draußen“.
Jedenfalls bin ich froh, diesem Dasein entronnen zu sein, und spüre, dass ich mich nicht einmal mehr im Urlaub daran gewöhnen möchte.
Das Museumscafé füllt sich. Elegante Hanseatinnen im Businesslook kommen herein, es ist Mittagszeit. Auch ich bestelle Essen, ansonsten wäre das Okkupieren des großen Tisches für mich allmählich nämlich wirklich dreist. Bremen ist eine große Stadt, dennoch treffe ich nun zum zweiten Mal an diesem Tage zufällig eine Sopranistin, die auch auf Langeoog öfters sang; seit einer schmeichelhaften Rezension meinerseits hat sie sich offenbar mein Gesicht gemerkt und grüßt freundlich: Auch das zum zweiten Mal.
Und so ist wohl sogar Bremen im Zentrum nur ein Dorf, wo man nicht Vieles unbemerkt tun kann. Aber ich mag Bremen; an mehr Größe könnte und wöllte ich mich nicht mehr gewöhnen. Und an weniger Eleganz auch nicht.
Den Beweis dafür bekomme ich wenig später in Hamburg. Als ich aus dem Zug steige, ist die Sonne soeben als goldener Ball versunken. Schön sah es aus, wie sich die filigrane Eisenbahnbrücke und die Silhouette des Bahnhofs davor abzeichneten. Aber jetzt ist es dunkel, und ich bemerke die Autos: Die roten Lichter ergießen sich wie ein Strom glühender Lava in die Stadt, ich habe lange nicht mehr so viele auf einmal gesehen. In den Bürotürmen sieht man Menschen hinter den Fenstern durch sterile Gänge wieseln, in sterilen Büros sitzen; vereinzelte Topfpflanzen in den Fenstern ein trauriger Rest von Leben. Ich danke Gott, dass dies nicht mehr mein Leben ist. Die Großstadt und ich werden wohl keine Freunde mehr, wiewohl Hamburg, so muss ich zugeben, unter den Molochen dieser Welt vermutlich noch einer der schönsten ist.
Der Anblick all dieser blinkenden Lichter, des Wuselns und Wieselns, gepaart mit einer Geräuschkulisse aus absolut allem, stresst mich jedenfalls dergestalt, dass es mich umgehend zu einem Ort zieht, an dem ich Stille um mich weiß, dazu hohe Decken und Schönes zum Ansehen. Die Rede ist ausnahmsweise nicht von einer Kirche, sondern von der Hamburger Kunsthalle.
Vor dem imposanten Bau fühle ich mich furchtbar klein; angesichts des atemberaubenden Inhalts auch noch furchtbar untalentiert. Aber das ist mir egal, denn zeitgleich ergreift mich hier sogar ein seltener Anflug von Stolz darüber, der Spezies Mensch anzugehören. Denn wer so baut und so malt, kann nicht von Grund auf schlecht sein. Ich schwelge in einer fabelhaften Sonderausstellung impressionistischer Werke, durchstreife viele Räume mit Eigenartigem, Befremdlichen und Faszinierendem, erkenne, dass ich von Kunst im Grunde überhaupt keine Ahnung habe, aber sie mir immer noch einfach gerne ansehe. Ich verlasse das Museum glücklich.
Aus einem nahen Café sehe ich aufgeklappte Apple-Rechner leuchten. Ich bestelle, Provinzler der ich nunmal bin, das, was am Wenigsten exotisch klingt und reihe mich erneut in die digitalen Café-Nomaden ein, bis die Abfahrt des Nachtzuges in die Nähe rückt.
Wieder denke ich über das Unbeständige dieser Art von Arbeit nach, diese Ruhelosigkeit, die auch ich früher als ultimative Freiheit verstand, aber heute nicht mehr ertragen könnte. Wenn das Abenteuer Alltag wird, verliert es schnell seinen Reiz. Das gilt wohl für Affären ebenso wie fürs MacBook-Vagabundentum.
Und nun möchte nicht länger auf Durchreise sein. Ich bin dankbar für alles, was ich an diesem Tage erlebte, aber nun möchte ich ankommen; nun möchte ich wissen, was mich hinter der nächsten Straßenecke erwartet.
Ich möchte ein liebes Gesicht sehen, das mich am Bahnhof abholt, Jahrhunderte alte Gesänge hören und noch ältere Gebete sprechen; umgeben von uralten, sicheren Mauern, einem guten, durchbeteten Raum und der stillen, dunklen Anmut des Waldes. In 12 Stunden werde ich da sein.
Rückkehr
Mit dem Erwachen wähne ich mich noch hinter dicken, weißgetünchten Klostermauern. In der Geborgenheit einer Zelle, deren hohes Kreuzgewölbe das Bett überspannt wie ein Wiegenhimmel, während die riesigen Doppelfenster den Blick auf den echten Himmel öffnen. Dahinter rauschen Bach und Bäume. Doch heute wird mich kein früher Glockenschlag zum Gebet rufen, wird kein vertrautes Rascheln langer, weißer Chormäntel mehr durch die Stille eines beeindruckenden Kreuzganges hallen und ich werde nicht mehr den Duft uralter Steine riechen, die ein atemberaubend schöner Brunnen mit kristallklarem Wasser besprengt.
Der Rest des Traums verfliegt: Ich bin auf Langeoog.
Der Tag empfängt mich recht mitleidslos. Kalter Regen schlägt an die Scheiben und sprüht in Fontänen aus den Ablaufrinnen, das Backsteinpflaster ist nass und dunkel wie altes Blut. Meine Balkonblumen, durch die Milde des bisherigen Winters noch immer blühend, biegen sich mit den Böen in die Waagerechte. Ich sehe hinaus; noch nicht ganz da und doch zuhause.
Auch unsere Kirche ruft zum Gebet, obwohl sie kein Geläut besitzt: Die Sonntagsmesse steht an. Mechanisch suche ich mein Regenzeug zusammen, den Fahrradschlüssel, das Kollektengeld. St.Nikolaus erwartet mich mit der stoischen Ruhe eines alten Freundes, der schon so einigen Kummer mit mir gewohnt ist.
Heute haben wir sogar zwei Zelebranten, sodass der Kontrast zum klösterlichen Konventamt mit einem halben Dutzend Priestern nicht ganz so hart ist, aber natürlich bin ich spürbar zurück in der Diaspora, denn es wird keine Kommunionbank mehr herbeigetragen und niemand hält einem ein silbernes Tellerchen unters Kinn, falls man mit dem HERRN krümelt. Dass ich dafür wieder Messdiener sein, in der Sakristei herumkramen und Fürbitten vortragen darf, tröstet indes über den Abschiedsschmerz. Denn so sehr ich das festliche, strenge Zeremoniell des Ordens auch liebe — in St.Nikolaus habe ich meinen Platz und bin dankbar für jeden Dienst, den ich mit Gottes Hilfe dort verrichten darf.
Nach dem Verräumen der Altargegenstände trete ich vor die Kirchentür. Die Wolken haben sich verzogen: Nun vergoldet die Sonne die Welt. Die See hat sich zurückgezogen, in der Ferne sehe ich ihr schönes Blau glänzen. Das Meer ist Heimat, es wird nie anders sein.
Und doch mäandert mein Herz noch irgendwo zwischen Flughafen und Bahnhöfen, zwischen uralten Mauern, pittoresken Dörfchen, frostüberzuckerten Bäumen, Barockkirchen und bewaldeten Berghängen. Noch kann der Blick auf die geliebte Insel die Erinnerung nicht übermalen. Noch fühle ich die elegante Kühle der hohen Gewölbe, die beschützende und zugleich befreiende Klarheit von weißen, fast schmucklosen Wänden und die haltgebende Verlässlichkeit, mit der der wunderschöne Chorgesang der Mönche die Kapelle erfüllt. Und dann ist da noch all die Pracht hinter den imposanten Toren, die kostbare Handschriftensammlung, die Bücherregale, die gewaltig dimensionierten Gemälde, das Kerzenlicht und all das Gold. Auch der Mensch, der all die Tage bei mir war, ist nicht fort; ich sehe ihn das Auto mit beruhigender Routine durch Serpentinen steuern, gefährliche Abgründe neben uns und über uns ein strahlender Himmel, der die meiste Zeit nicht gnädiger hätte sein können.
Vom ersten Winken durchs Bahnhofsfenster bis zum Reisesegen am Flugsteig war mir dieser Mensch ein zuverlässiger Quell der Beständigkeit und Freude, mit seinem ansteckend breiten Lächeln und der unprätentiösen Herzlichkeit, dem norddeutschen Humor und den graublauen Augen in der Farbe dunkler, sturmgepeitschter See. Ich kann nicht behaupten, ihn nicht zu vermissen.
Ich hatte Angst vor dem Flug, aber die teure Reise im Schlafwagen hatte ich mir nur für den Hinweg leisten können. Seit 13 Jahren der Fliegerei entwöhnt, fühlte ich mich wie ein Fossil angesichts all der technischen Neuerungen, der schieren Größe des Flugplatzes und der industriellen Abfertigung der Reisenden. Ich wollte noch am Boden zurück ins Kloster, zum Freund, zum Wald. Aber die Triebwerke röhrten bereits. „Halt dich am Rosenkranz fest“, hatte er noch gesagt. Und das machte ich auch.
Die Alpen durchbrachen die Wolkendecke wie Inseln. Schön sah das aus; ebenso wie die kleinen Eisblumen am Fenster, die in der Sonne glitzerten. Ein Hauch von Trost schlich sich ins Herz, denn tatsächlich fehlten mir auch das Meer und die Weite. Dann riss der Himmel auf und die Schäfchenwolken unter mir trieben wie Eisschollen vorüber. Grüne Äcker kamen in Sicht und Dörfer, in denen ich sofort nach dem Kirchturm spähte. Aber ich fand keinen, und so musste ich mich wohl der Wahrheit stellen: Die Welt, in der sich der Alltag nach keinem Geläut mehr richtete, hatte mich wieder.
Festhängen
Die Temperaturen halten sich kontinuierlich um 10°C, aber Urlaubswetter sieht anders aus. Es ist grau und regnet seit Tagen, doch der Winter kommt einfach nicht. Die Zeit scheint festzuhängen; anhand des Wetters zumindest lässt sich keinerlei Jahreszeit festmachen und auch die Vegetation ist nicht zwingend ein sicheres Indiz. Durch die Wärme sprießt zartes Frühlingsgrün an den Bäumen; die Feuchtigkeit lockt dagegen herbstlich anmutende Pilze aus dem weichem Moos in den Dünentälern.
Und doch schreitet die Zeit unerbittlich voran. Der Wandkalender mit Vogelportraits, den mir eine talentierte Freundin jedes Jahr zusammenstellt, zeigt auf dem Januarbild einen Bartkauz, der durch Wintergeäst lugt. Ich schlage das Blatt um; das nächste Bild zeigt Basstölpel beim Nestbau, in den Schnäbeln Teek, kein Plastikmüll, immerhin. Es ist Februar und das Jahr hat bereits eine Menge Unschuld eingebüßt.





























