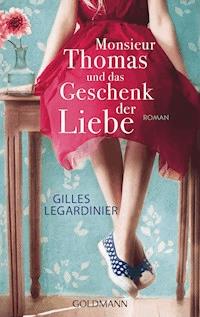
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Als der Arzt Thomas Sellac erfährt, dass er eine inzwischen 20-jährige Tochter hat, fällt er aus allen Wolken. Wie soll er Emma nach so langer Zeit ein guter Vater sein? Hals über Kopf kehrt er in seine Pariser Heimat zurück und nimmt einen Posten an, den keiner haben will, um in Emmas Nähe zu leben: Er wird Direktor eines kleinen Altenheims mit nur fünf schrulligen Bewohnern und der wunderbaren Krankenschwester Pauline. Doch die älteren Herrschaften stellen sich als Glücksfall heraus – denn schnell kommen sie hinter das Geheimnis ihres liebenswürdigen Leiters und tun daraufhin ihr Möglichstes, um Vater und Tochter zu vereinen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Ähnliche
Buch
Thomas ist Arzt und im Einsatz für die Ärmsten und Hoffnungslosesten dieser Welt. Die letzten acht Jahre hat er in einem Bergdorf in Kaschmir verbracht. Als er erfährt, dass er zu Hause in Paris eine inzwischen 20-jährige Tochter – Emma – hat, fällt er aus allen Wolken. Wie nur soll er ihr nach so langer Zeit ein guter Vater sein? Hals über Kopf kehrt er in die Heimat zurück und akzeptiert einen Posten, den keiner haben will, um in Emmas Nähe zu sein. Er wird Direktor eines kleinen Altenheims, das von fünf schrulligen Bewohnern und der Krankenschwester Pauline bewohnt wird. Doch der zuckerkranke Jean-Michel mit seiner Vorliebe für Zitronenplätzchen, der Veteran Francis und die drei distinguierten, temperamentvollen Damen Hélène, Chantal und Françoise stellen sich als Glücksfall heraus. Denn schnell kommen sie hinter das Geheimnis ihres liebenswürdigen Leiters und tun daraufhin ihr Möglichstes, um Vater und Tochter zu vereinen …
Weitere Informationen zu Gilles Legardinier
sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
Gilles Legardinier
Monsieur Thomas und
das Geschenk der Liebe
Roman
Aus dem Französischen
von Doris Heinemann
Die französische Originalausgabe erschien 2015
unter dem Titel »Quelqu’un pour qui trembler!«
bei Fleuve Noir, département d’Univers Poche, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung April 2017
Copyright © der Originalausgabe 2015 Fleuve Éditions,
département d’Univers Poche
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Elly Schuurman/Trevillion Images
FinePic®, München
Redaktion: Antje Steinhäuser
MR · Herstellung: KW
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-19668-4V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
1
Es war dunkel und ein wenig frisch. Nach der Gluthitze des Tages genoss Thomas die angenehme Kühle. Es saß vorn auf einem Felsvorsprung über einem weltverlorenen Tal in Kaschmir, im Nordwesten Indiens, und betrachtete das Dorf Ambar, das sich unter ihm ausbreitete. Er kannte hier jeden Einwohner und jedes Haus. Aus einigen der an den Hängen klebenden Hütten stieg duftender Rauch auf, immer wieder vermischt mit Funken, die zu den Sternen emporflogen und bald nicht mehr von ihnen zu unterscheiden waren. Die Gespräche der Frauen am Brunnen, das Geräusch des Wassers in den Eimern und das Klappern der Blechgerätschaften zeugten von den Vorbereitungen für das Abendessen. Allerdings würden die heute Abend servierten Gerichte nichts mit denen gemein haben, die den kulinarischen Ruf Indiens begründen. Hier gab es keine prächtigen Paläste und Shiva-Tempel, keine bunte Menge und keinen einzigen auf einem Elefanten reitenden Touristen. Nur ein paar Menschen, die an dem Ort, den ihnen das Schicksal zugewiesen hatte, zu überleben versuchten.
Beim Anblick der Kinder und Hunde, die unter freudigem Gekreisch und Gebell miteinander spielten, lächelte Thomas. Schwer zu sagen, wer da wen jagte, doch Mensch und Tier wirkten gleichermaßen glücklich. Selbst in den unwirtlichsten Gegenden können sich die Menschen amüsieren, wenn ihnen das Leben nur die nötige Zeit dazu lässt.
Seit dem ersten Tag, an dem ihn der Dorfvorstand zu diesem Aussichtspunkt hinaufgeführt hatte, um ihm die Lage des Dorfs zu zeigen, mochte Thomas diesen Ort. Nach vollbrachtem Tagewerk stieg er gern hier herauf, um sich auf die Steinbank zu setzen, die das Wetter in Tausenden von Jahren gemeißelt hatte. Tagsüber hatte man eine unendlich weite Sicht über die von Menschen geformten Landschaften und Grenzen hinweg bis hin zu den Ausläufern des Himalajas. Nachts sah man nur noch die Dorfbewohner im flackernden Licht ihrer Lampen. Die Dunkelheit zeigt einem oft das Wesentliche. In letzter Zeit zog sich Thomas noch häufiger auf diesen Ausguck zurück. Er brauchte Abstand, um nachzudenken. Besonders seit einigen Wochen.
Stimmen stiegen vom Dorf auf. Auch wenn Thomas nur einige Wörter verstehen konnte, er liebte die Melodie dieser Sprache. Sajani versuchte, ihre Kinder ins Haus zu schicken, damit sie endlich ihre Schulaufgaben machten. Der alte Kunal legte – wie jeden Tag um fast genau die gleiche Zeit – schimpfend die Steine zurück, die die Ziegen bei ihren Kapriolen von seinem Mäuerchen gestoßen hatten. Eine friedliche Dämmerung beschloss einen Tag ohne Katastrophen. Was in dieser Gegend einem Wunder gleichkam.
Im Licht des Vollmonds beobachtete Thomas sie bei ihren jeweiligen Tätigkeiten. Mit präzisen, raschen Gesten schärfte Kailash seine Werkzeuge für den nächsten Tag; Rekha reparierte das Gitter seines Hühnerstalls. Thomas hatte mit jedem von ihnen wichtige Momente erlebt. Er hatte sie behandelt und manchmal gerettet. Doch viel zu oft hatte er das Schlimmste nicht verhindern können. In Glück und Unglück hatte er an ihrer Seite extreme Gefühle erlebt, Gefühle, die an die Grenzen dessen führen, was wir wirklich sind, sobald alles Künstliche nutzlos geworden ist, wenn das Leben sich auf ein so starkes Konzentrat von Emotionen reduziert, dass es einem die Eingeweide und das Herz zerreißen kann.
Thomas hatte sich für diese tapferen Menschen oft ein leichteres Leben gewünscht, das sich im Laufe der Tage so abmildern würde, dass sie es mit weniger Leid genießen könnten. Aber wer entscheidet über das, was wir aushalten müssen? Wer hat die Macht, zwischen den Schicksalsschlägen Pausen eintreten zu lassen? Wer kann uns das Nichtwiedergutzumachende ersparen? In Indien ist der Glaube überall, doch die Götter haben wohl so viele Lasten zu tragen, dass sie nicht die ganze Zeit auf ein paar arme Teufel aufpassen können. Hier akzeptiert das jeder und hofft weiter. Wesentlich ist, dass man eine Zukunft hat, auch wenn sie nur aus dem nächsten Tag besteht.
Weil er tagtäglich mit dem Dringendsten völlig ausgelastet gewesen war, hatte sich Thomas nie wirklich die Zeit genommen, über die Tragweite dessen nachzudenken, was er in Ambar erlebt hatte, doch in den letzten Wochen stiegen all die Erinnerungen auf. Als wäre es jetzt an der Zeit, Bilanz zu ziehen.
Acht Jahre zuvor war er mit einem internationalen Ärzteteam in den Distrikt Kupwara gekommen, um der unter dem heftigen Grenzkonflikt mit Pakistan leidenden Bevölkerung beizustehen. Von genau der Stelle aus, an der er sich heute Abend befand, hatte er zum ersten Mal die in die Hänge getriebenen breiten Terrassen gesehen, auf denen die Bauern mühsam das Lebensnotwendigste anbauten. Er hatte diese unschuldigen Menschen beobachtet, die aufgerieben wurden zwischen einem Territorialkrieg, auf den sie keinen Einfluss hatten, und der Natur, die ihnen ihre Aufgabe auch keineswegs immer leicht machte. Von oben gesehen wirkten die Einheimischen wie Insekten, die sich auf dürren Ästchen abmühten. Warum gehen sie nicht weg?, hatte er sich anfangs gefragt. Warum verlassen sie diese gefährliche Region nicht, in der die Hindus in der Minderzahl sind und das Leben so hart ist? Seither hatte er sie kennengelernt und wusste, dass sie nichts mit Insekten gemein hatten und hier an ihrem Platz waren.
Das Ärzteteam hatte schließlich zusammengepackt und war gegangen. Er nicht. Eigentlich hatte er nur eine knappe Woche länger bleiben sollen, um sich um einen kleinen Jungen zu kümmern, der an starkem Fieber litt. Anders als viele andere war der Kleine durchgekommen, trotzdem war Thomas geblieben. Wieso, hatte er sich nie gefragt, bis vor Kurzem. Wahrscheinlich hatte er damals noch weniger Gründe gehabt zu gehen, als zu bleiben. Hier hatte er sich sofort nützlich gefühlt. Die Leute brauchten ihn. Mit der Zeit hatte dieser hellhäutige Mann schließlich seinen Platz gefunden. In tödlichen Wintern, brennenden Sommern und unter Monsunregenfällen, die alles mit sich rissen, hatte Thomas in Ambar den Wert des Lebens entdeckt. Und seine Zerbrechlichkeit.
Ein Rascheln in den Büschen riss Thomas aus seinen Überlegungen. Er drehte sich um und bohrte den Blick in die Dunkelheit. Sein Herz schlug schneller. Kein Zweifel, ganz in seiner Nähe hatte sich etwas bewegt. Mehr als alles andere fürchtete er, die Augen oder Reißzähne eines wilden Hundes aufblitzen zu sehen. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass er den Knüppel vergessen hatte, den Kishan immer mitnahm, wenn er hier heraufkam. Alle Leute der Gegend fürchteten sich vor den wilden Hunden. Diese Teufel waren zu jeder Tollkühnheit fähig, vor allem wenn Futter oder eine leichte Beute winkten. Thomas hatte es einige Jahre zuvor, als er Neetu gerettet hatte, am eigenen Leibe erlebt. Während er die junge Frau nach ihrem schweren Sturz in einem Nachbartal zu stützen versuchte, hatte er gegen ein Rudel Hunde – manche behaupteten sogar, es seien Wölfe gewesen – kämpfen müssen, die vom Geruch ihres Blutes angelockt worden waren. Schreiend, um sich tretend und mit dem freien Arm fuchtelnd hatte er die Tiere so lange auf Distanz halten können, bis seine Hilferufe gehört wurden. Er hasste es, sich an diese Geschichte zu erinnern, erstens weil er wirklich geglaubt hatte, die Hunde würden ihn zerreißen, und dann, weil er sich so lächerlich gefühlt hatte, als er da schreiend herumgefuchtelt hatte, kaum fähig, Neetu zu beschützen und die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Er hatte mit einem Mal erfahren, wie es ist, wenn man nichts mehr beherrscht und fürchtet, das Ende sei nahe. Er, der an die Kraft hehrer Ideen geglaubt hatte, hatte nüchtern feststellen müssen, dass die schönsten Ideale und ein reines Herz nichts gegen eine Horde streunender Hunde ausrichten können. Es hatte ihn zutiefst verängstigt. Sich daran zu erinnern, und sei es nur ganz kurz, ließ ein eisiges Frösteln über seinen Rücken gehen. Diese Erfahrung hatte zwei konkrete Konsequenzen für Thomas’ Leben gehabt: Er hatte jetzt den – seiner Ansicht nach völlig unberechtigten – Ruf, ein tapferer Mann zu sein, und außerdem eine panische Angst vor Hunden, die bei den Kindern regelmäßig große Heiterkeit auslöste.
Wieder raschelte es in der Dunkelheit, ohne dass Thomas den Urheber des Geräuschs hätte ausmachen können. Er erschauerte. Adrenalin schoss durch seine Adern. Ohne seine Umgebung aus den Augen zu lassen, tastete er nach dem nächstbesten Stein. Der war viel zu klein und würde ihm nichts nützen, dennoch beruhigte er ihn. Ein Knacken. Nicht mehr aus dem Gebüsch, sondern vom Pfad her. Wenn diese verdammten Biester sich über den Pfad näherten, schnitten sie ihm den Weg ab. Keine Möglichkeit zur Flucht. Thomas, der Panik in sich aufsteigen fühlte, überlegte, welche Überlebenschancen er hätte, wenn er vom Felsvorsprung Richtung Dorf spränge. Er stellte sich schon vor, wie er auf das Dach einer Hütte stürzte, das seinem Gewicht sicher nicht standhalten würde. Plötzlich tauchte eine Gestalt aus dem Dunkel auf.
»Wenn ich gemein wäre, hätte ich ein Hundeknurren nachgeahmt … Du solltest dich mal sehen! Du bist bleicher als der Mond!«
Kishans Gesicht wurde von einem Lächeln erhellt.
»Du hast mir vielleicht eine Angst eingejagt«, sagte Thomas atemlos.
»Dann denkst du wenigstens beim nächsten Mal an den Knüppel.«
Thomas ging seinem Freund entgegen.
»Endlich bist du zurück.«
»Ich bin gerade erst angekommen. Rajat hat mir gesagt, dass er dich hier hinaufsteigen sah.«
»Du solltest doch gestern schon zurück sein. Ich habe mir Sorgen gemacht. Dein Vater sagte mir, dass du bis nach Srinagar musstest.«
»Ja. In einer wichtigen Angelegenheit.«
Thomas fragte nicht nach, doch es wunderte ihn, dass Kishan keinen Grund für seine Reise nannte. Normalerweise hatten sie keine Geheimnisse voreinander.
»Ich habe die Gelegenheit genutzt und beim Roten Kreuz in der Ambulanz vorbeigeschaut«, sagte Kishan. »Um etwas für unseren Arzneischrank mitzubringen.«
»Es war noch nicht dringend, aber danke.«
Die beiden Männer setzten sich, zum Tal gewandt, nebeneinander. Irgendwo unten begann eine Frau leise zu singen. Thomas seufzte, er war wirklich froh, nicht mehr mit seinen Gedanken allein zu sein.
»Heute Morgen habe ich den alten Paranjay besucht«, sagte er nach kurzem Schweigen.
»Wie ist sein Zustand?«
»Nicht schlecht, aber es wäre besser, wenn er näher am Dorf leben würde. Dieses Mal hat er noch Glück gehabt. Trotzdem, wenn wir ihn nicht eines Morgens tot in seiner Hütte finden wollen, müssen wir ihn im Auge behalten.«
»Mein Vater wird mit ihm sprechen. Wir finden einen Platz für ihn.«
Sie schwiegen eine Weile.
»Du kommst immer öfter hier herauf, nicht wahr?«, fragte Kishan plötzlich.
»Es tut mir gut.«
»Denkst du an diese Frau, zu Hause in eurem Land?«
Thomas senkte den Blick.
»Ich denke weniger an sie als an das, was sie wahrscheinlich erlebt hat, nachdem ich sie verlassen habe.«
Obwohl er normalerweise auch vor den direktesten Fragen nicht zurückschreckte, zögerte Kishan, bevor er fragte: »Mein Freund, weißt du, welchen Tag wir heute haben?«
»Nein.«
»Wir feiern Raksha Bandhan, das Fest der Brüderlichkeit.«
»Aber das habt ihr doch in den letzten Jahren nicht gefeiert …«
»Heute Abend ist es anders. Für die Brüder und Schwestern, für die, die nicht unbedingt derselben Familie entstammen, aber enge Beziehungen unterhalten, ist das der Tag, an dem man sich sagt, wie wichtig man füreinander ist.«
Thomas beäugte seinen Freund misstrauisch. Selbst im Halbdunkel konnte er seinen Blick auffangen.
»Wenn du mir mal wieder einen dieser Tränke anzudrehen versuchst, die ein ausgewachsenes Yak umwerfen …«
»Nein, Thomas, ich habe drei kleine Schwestern und einen jüngeren Bruder. Aber heute Abend möchte ich dir sagen, dass ich dich als meinen großen Bruder betrachte.«
Am Klang der Stimme merkte Thomas, dass es seinem Freund ernst damit war.
»Danke, Kishan. Das bedeutet mir enorm viel. Du weißt, wie wichtig auch du mir bist.«
Beide hatten das Bedürfnis, sich in die Arme zu schließen, doch das verbot ihnen ihr Schamgefühl.
»Der Tradition gemäß tauscht man am Raksha-Bandhan-Tag geflochtene Armbänder und manchmal auch Geschenke aus … Es ist natürlich vor allem symbolisch. Aber ich habe ein Geschenk für dich, Thomas. Ich glaube, es ist ein wichtiges Geschenk, auch wenn es dir das Leben nicht leichter machen wird …«
»Wenn es ein Welpe ist, behalt dein Geschenk!«
Sie lachten.
»Und ich, was kann ich dir schenken?«, überlegte Thomas dann. »Ah! Ich weiß! Ich schenke dir mein Schweizer Messer, das hat dir doch immer so gefallen. Aber du musst mir dafür ein Geldstück geben. Das ist in meinem Land so Sitte. Es heißt, wenn man etwas mit einer Schneide verschenkt, ohne ein Geldstück dafür zu bekommen, riskiert man es, die Freundschaft zu zerschneiden.«
Ausnahmsweise ging Kishan nicht auf den scherzhaften Ton ein, den sein Freund anzuschlagen versuchte. Er wirkte sehr konzentriert.
»Dein Messer ist ein sehr schönes Geschenk, aber bitte lass mich ausreden.«
Er schwieg kurz und fuhr dann fort: »In all den Jahren, die du nun schon bei uns im Dorf lebst, hast du mir viel beigebracht. Du weißt Tausende von Dingen, von denen ich nicht die geringste Ahnung habe. Aber heute Abend weiß ich etwas, das du nicht weißt und das dein Leben verändern wird.«
»Du beunruhigst mich …«
»Ich kenne dich, Bruder, und ich schwöre dir, es ist für mich seltsam zu wissen, dass dein Leben heute Abend auf den Kopf gestellt wird. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen, auch wenn mir das, was dann folgt, Schmerz bereiten wird.«
»Wovon redest du? Du machst mir wirklich Angst.«
»Mein Stolz ist größer als meine Sorge, weil ich dem Schicksal mit meinem Geschenk helfe, dir deinen Weg zu zeigen. Und ich weiß, dass dieser Weg, der sich jetzt abzeichnet, der einzig richtige ist.«
Kishan zog einen Umschlag aus seiner Jacke und stand auf, um ihn Thomas wie eine Opfergabe mit beiden Händen zu überreichen.
»Das ist für dich.«
»Was ist das?«
»Mach ihn auf.«
Kishan richtete seine Taschenlampe auf den Umschlag. Am Schwanken des Lichtstrahls erkannte Thomas, dass die Hände seines Freundes zitterten. Er schlitzte den Umschlag auf und zog drei Blätter heraus. Im Lichtkreis erkannte Thomas das Foto eines jungen Mädchens. »Emma«. Unter dem Vornamen eine Adresse in Frankreich. Auf allen Seiten waren unterschiedlich große Fotos abgedruckt. Eine jüngere Emma auf einem Pony. Emma, fröhlich auf einer Geburtstagsparty. Emma als Pirat verkleidet. Eine ganz kleine Emma neben einer Sandburg, die größer ist als sie. Emma, auf einem Stuhl stehend und in einem Kochtopf rührend. Emma als junges Mädchen im langen Kleid mit Freunden auf einem Ball. Emma auf Skiern, strahlend und umrahmt von zwei Jungen, die sie auf die Wangen küssen …
Kishan kommentierte die Bilder: »Sie hat deine Augen, und ihr Haar hat dieselbe Farbe wie deins. Sieh mal da auf dem kleinen Pferd, sie hat genau deine Haltung. Und ihre Grübchen, erkennst du sie wieder? Sieben Monate nachdem du deine Freundin verlassen hast, ist sie zur Welt gekommen. Es gibt keinen Zweifel. Es ist so, wie es aussieht. Sie ist deine Tochter.«
Thomas antwortete nicht. Eine Sturzwelle ergoss sich in ihm und überflutete Herz und Hirn. Er hatte oft um die Kinder anderer geweint, doch jetzt weinte er zum ersten Mal um sein eigenes Kind. Mit brüchiger Stimme fragte er:
»Bist du deshalb bis nach Srinagar gegangen?«
»Ich wollte die Antwort auf die Frage finden, die dich quält, seit du diesem Kindheitsfreund begegnet bist. Ich habe gesehen, wie du reagiert hast, als er von deiner früheren Freundin und ihrem Kind sprach.«
»Wie hast du es angestellt?«
»Der Sohn eines Cousins meines Vaters ist beim Militär. Er hat Zugang zu einem Computer mit Internetanschluss. Er konnte recherchieren und mir die Ergebnisse ausdrucken.«
Thomas konnte den Blick nicht von den Fotos lösen. »Emma«. Auf wenigen eher unscharfen Bildern zeichneten sich die Jahre ab, in denen ein kleines Mädchen zur jungen Frau herangewachsen war. Auf einem der Abzüge erkannte er im Hintergrund die Mutter, Céline. Er fühlte einen Kloß im Hals. Seither hatte er für keine Frau mehr wirklich etwas empfunden. Warum hatte sie ihm nichts davon gesagt? Am schlimmsten wäre es gewesen, wenn sie es versucht hätte, aber vergeblich … Er hatte so oft den Einsatzort gewechselt. Es war Thomas unmöglich, sich auszumalen, was dieses kleine Mädchen und seine Mutter in der Zeit zwischen diesen Fotos erlebt haben mochten; schon bei dem Versuch wurde ihm schwindelig. Inzwischen war Emma etwa so alt wie Thomas, als er fortgegangen war. Das junge Mädchen wirkte fröhlich, die Mutter auch, doch was hatten sie durchmachen müssen, um ohne den Mann, der bei ihnen hätte sein müssen, im Leben voranzukommen? Thomas wischte sich die Augen. Seine Hände zitterten jetzt viel stärker als Kishans. Dieser zwang sich ein Lächeln ab.
»Und jetzt, Bruder, welchen Satz möchtest du auf keinen Fall hören?«
»Nein, Kishan, bitte nicht dieses Spiel … Nicht jetzt. Normalerweise stelle ich dir diese Frage.«
»Heute Abend bin ich an der Reihe. Und ich werde dir sagen, was du auf keinen Fall hören willst: Es bleibt dir hier nichts mehr zu tun. Du hast uns viel geschenkt. Du gehörst zu uns. Hier im Tal lobt jeder den Tag, an dem du beschlossen hast, bei uns zu bleiben. Ohne dich wäre meine kleine Schwester nicht mehr am Leben, und meine Frau wäre vor zwei Wintern gestorben. Wir alle schulden dir etwas. Du hast ohne Rücksicht auf dich selbst immer nur gegeben. Es wird sehr wehtun, wenn du fortgehst, aber jetzt musst du in dein Land zurückkehren. Seit du etwas von der Existenz deiner Tochter ahnst, bist du nicht mehr du selbst. Ich sehe es deutlich. Also geh zu ihr. Deine Zeit bei uns ist jetzt zu Ende. Wenn du länger bleibst, wird es dich nur zerstören.«
Thomas’ Tränen begannen wieder zu fließen, ohne dass er es merkte. Eingesperrte Gefühle suchen sich ihren Weg, wie sie können.
»Trockne deine Tränen, mein Freund. Sie locken nur die wilden Hunde an, die dich verschlingen werden.«
»Spotte ruhig über mich, aber du hast deinen Knüppel auch vergessen.«
»Ich hatte anderes im Kopf, als ich hier heraufkam …«
Kishan sprang plötzlich auf und streckte den Finger aus.
»Da! Hinter dir! Ich sehe einen großen Hund mit gebleckten Zähnen!«
Thomas rannte den Hang hinunter, doch als er seinen Freund schallend lachen hörte, begriff er, dass es nur ein Scherz war, einer der vielen, die sie sich gern erlaubten.
»Innerhalb weniger Minuten enthüllst du mir Emmas Existenz und willst mir weismachen, dass mich Hunde angreifen. Du willst wohl ausprobieren, wie robust mein Herz ist?«
»Ich kenne dein Herz sehr genau, und ein Herzanfall wäre jetzt wirklich keine gute Idee, denn du bist der einzige Arzt im Umkreis von vierzig Kilometern!«
Kishan streckte Thomas die Hand hin, um ihm wieder auf den Pfad zu helfen.
»Komm. Mein Vater erwartet uns im Tal.«
Unmöglich zu sagen, von wem es ausging, doch jetzt wagten sie es, sich zu umarmen.
2
Die nächsten Tage erlebte Thomas wie in einem Wachtraum. Ort und Menschen waren noch dieselben, er jedoch nicht. Von nun an wirkte alles unwirklich. Die Entdeckung, dass er eine Tochter hatte, hatte ihn derart umgeworfen, dass er sich jetzt nur noch von den aufgewühlten Fluten treiben lassen konnte. Er fühlte sich wie ein Panzerkreuzer, dessen Maschinen mitten auf dem tobenden Meer ausgefallen waren. Jahrelang hatte er sich beherrscht, seine Zweifel verborgen, um andere zu beruhigen, auch dem Schlimmsten die Stirn geboten, doch Emmas Auftauchen hatte die eiserne Rüstung, die er sich geschmiedet hatte, aufgebrochen. Im Maschinenraum stand Wasser, und niemand mehr konnte das Schiff steuern. Überfordert und ohne jede Kontrollmöglichkeit wurde Thomas von gänzlich ungefilterten Emotionen überfallen, und alles, was von den Menschen kam, deren Leben er geteilt hatte, drang in sein Herz.
Zwei Tage vor seiner Abreise kamen alle Bewohner des Tals und sogar einige Menschen aus ferneren Gegenden in den zusammengezimmerten Schuppen, der als Versammlungssaal diente. Thomas wurde mit Liedern, Applaus und sogar Schreien empfangen. Alle hatten zu seinen Ehren ihre besten Kleider angelegt. Niyati trug ihren Festtags-Sari. Kishans Vater Darsheel, Dorfvorstand, Volksschullehrer und Besitzer der einzigen Schreibmaschine im Tal, hielt eine Rede, die Thomas nur in groben Zügen verstand. Dann forderte der Patriarch seinen Sohn vor den versammelten Dorfbewohnern auf, in deren Sprache zu übersetzen, was er nun auf Französisch zu Thomas sagen werde – er war nicht wenig stolz darauf, diese Sprache zu sprechen.
Darsheel dankte dem Arzt für seine Hilfe und erinnerte an all das, was sie zusammen durchgemacht und aufgebaut hatten.
»Du hast uns viel Glück gebracht. Du schenktest mir auch das Vergnügen, wieder deine Sprache zu sprechen und sie den Meinigen zu vermitteln. Die Bücher, die du mir gabst, hüte ich wie Schätze. Unsere Schule wird von nun an deinen Namen tragen, aber wir werden nie vergessen, dass das Fenster klemmt, weil du es falsch eingesetzt hast!«
Vor der versammelten Gemeinde erzählte der Dorfvorstand eine Reihe von Anekdoten, die Thomas größtenteils schon vergessen hatte. Ein Lebensabschnitt, zusammengefasst in einigen fröhlichen Szenen, denn was Thomas an Ernsthaftem geleistet hatte, war ohnehin allen bekannt.
»Als du zu uns kamst, warst du ein großes Kind. Ich sah dich lernen und verstehen. Und heute gehst du als Mann.«
Bei diesen bewegenden Worten Darsheels lachten die Leute zu Thomas’ Verwunderung immer noch lauthals.
»Nun ja«, gestand Kishan. »Ich übersetze ihnen nicht, was mein Vater sagt. Es ist zu persönlich. Ich erinnere sie lieber an die witzigen Sachen, die du bei uns angestellt hast. Viele wussten noch gar nicht, dass du an der Grenze eine Kugel abgekriegt hast und dass dir das Haus, das du dir gebaut hast, über dem Kopf zusammengebrochen ist. Was jedoch die Hunde angeht, da wissen alle Bescheid …«
Zum Schluss seiner Rede packte Darsheel Thomas bei den Schultern und drückte ihn an sich.
»Du wirst uns fehlen. Wie immer dein Weg verlaufen mag, ich hoffe, er führt dich eines Tages wieder zu uns. Möge Ganeshas Weisheit über deinen Entscheidungen leuchten.«
Es hatte etwas Surreales, dass der Dorfvorstand und der Arzt mit Tränen in den Augen inmitten einer Menge standen, die sich vor Lachen bog. Thomas war immer beeindruckt gewesen von der Fähigkeit dieses großen Volkes, das Schicksal als Chance oder Lehre zu betrachten. Niemand verübelte ihm, dass er fortging. Es war das Beste, was er tun konnte, und alle schienen es viel selbstverständlicher hinzunehmen als er.
»Sie scheinen nicht sonderlich traurig darüber zu sein, dass ich gehe …«
»Wir haben ihnen erklärt, dass du nach Frankreich gehst, um zu deiner Familie zurückzukehren. Sie freuen sich für dich!«
Die Kinder brachten ihm selbst gebastelte Geschenke.
Am letzten Tag wunderten sich die Leute, dass Thomas immer noch im Dorf war. Viele sprachen mit ihm, wortreicher als je zuvor. Auch wenn Thomas nicht alles verstand, er würde nie ihre intensiven, wohlwollenden Blicke vergessen. Jeder schien ihm viel anzuvertrauen zu haben. Weil eine unmittelbar anstehende Trennung die Gefühle befreit. Weil die Menschen bis zum letzten Moment warten, bevor sie etwas auszusprechen wagen.
Am Morgen des Abfahrtstages gab es weder Zeremonien noch Gefühlsüberschwang. Alle waren wie gewöhnlich an ihre Arbeit gegangen. Nur Shefali hatte es so eingerichtet, dass sie noch im Dorf war, um Thomas Adieu sagen zu können. Thomas wusste, dass sie immer eine Schwäche für ihn gehabt hatte. Er hoffte, dass sie endlich heiraten würde, wenn er nicht mehr da wäre.
Darsheel, Kishan und Thomas sagten kein Wort, als sie in dem alten Geländewagen zum Flughafen fuhren. Bevor sie die Asphaltstraße erreichten, mussten sie eine lange Strecke über holprige und oft in einen Berghang hineingehauene Pisten zurücklegen. Alle möglichen Geräusche und die wegrutschenden und von unten gegen das Fahrzeug schlagenden Steine überbrückten das Schweigen. Durch die staubigen Fenster des hin und her geschüttelten Wagens sah Thomas die Landschaft vorübergleiten. Wie oft hatte er sie zu Fuß durchquert. Er hätte nie gedacht, dass er dieses Land eines Tages verlassen würde. Das Leben ist nie so, wie man es sich vorstellt.
Je näher sie der Ebene kamen, desto üppiger wurde die Vegetation und desto besser die Straße. Sie kamen schneller voran.
Als sie den Wagen schließlich vor der Flughafenhalle abgestellt hatten, griff Kishan nach Thomas’ bescheidenem Gepäck und begleitete seinen desorientiert wirkenden Freund hinein.
»Schick deine Mailadresse an das Büro des Roten Kreuzes. Sie geben sie mir dann, wenn ich das nächste Mal hingehe. Wir sollen in einigen Monaten auch eine Internetverbindung bekommen. Dann melde ich mich bei dir!«
Im Tumult der Abflughalle klangen Kishans Worte erstickt und fern. Er musste Thomas’ Gesicht zwischen die Hände nehmen, damit ihm dieser in die Augen sah.
»Ich wünsche dir viel Glück. Du erzählst uns dann alles!«
Die beiden Männer wechselten noch ein paar Worte. Beide wussten sich nicht zu verhalten. Thomas empfand die ganze Situation als unwirklich. Als sein Flug aufgerufen wurde, verabschiedete sich Darsheel herzlich von ihm, und Kishan umarmte ihn.
Und dann saß Thomas im Flugzeug, ohne recht zu wissen, wie er dorthin gekommen war. Ihm wurde bewusst, dass es bei den letzten Worten zwischen ihm und dem besten Freund, den er je gehabt hatte, um Ziegenzitzen gegangen war. Als das Flugzeug abhob, wurde ihm außerdem bewusst, dass er weder den Fluss Neelum noch den alten Paranjay noch einmal besucht hatte.
Bei der Zwischenlandung in Delhi war Thomas immer noch in diesem Schwebezustand. Der Marmorboden faszinierte ihn. Es war lange her, dass er eine so große, völlig ebene Fläche ohne Staub, Risse oder Geröll gesehen hatte. Um diesen Luxus auszukosten, schlurfte er in der Schlange für die Zollkontrolle mit den Füßen über den Boden. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten riskierte er nicht mehr bei jedem Schritt einen umgeknickten Fuß. Als er, abwesend lächelnd, am Schalter ankam, hielt er dem Beamten mechanisch seinen abgenutzten Pass und die in all den Jahren völlig zerfledderten offiziellen Papiere entgegen.
Thomas sah sich um, als würde er eine längst vergessene Welt neu entdecken. Er wusste nicht genau, in welcher Hinsicht, aber er wusste, dass sich alles geändert hatte. Noch nie hatte er so viele so flache Bildschirme so viele Bilder verbreiten sehen. Eine Frau drehte sich um sich selbst und ließ eine unecht wirkende Haarpracht wirbeln. Ein Mann mit athletischem Oberkörper und wissendem Lächeln benutzte ein tastenloses Telefon, das kaum größer war als eine Tablettenschachtel. Eine Flut von Informationen und schrecklichen Nachrichtenbildern, unterbrochen von kitschigen Szenen und gespickt mit abgehackten Werbebotschaften in schreienden Farben. Dieser wilde Reigen ermüdete Thomas derart, dass er Kopfschmerzen bekam.
Nachdem er die Boarding-Kontrollen hinter sich gebracht hatte, überraschte ihn die Vielzahl der gleißend hellen Läden, die zu astronomischen Preisen Waren feilboten, deren Nutzen sich ihm in den seltensten Fällen erschloss. Nicht minder verblüfft war er über die erschreckend vielen Imbisstheken mit ihrem Überangebot unterschiedlichster Gerichte und Snacks, die er zu einem Großteil nie zuvor gesehen hatte. Der Vorrat jedes dieser Stände hätte gereicht, um die Bevölkerung von Ambar mehrere Wochen lang zu ernähren. Selbst auf der Toilette blieb er nachdenklich vor den Lampen stehen, die die Wände beleuchteten und nahezu übergangslos zwischen allen Regenbogenfarben wechselten.
Als Thomas ins Flugzeug stieg, registrierte er alles, das Lächeln der Stewardessen, ihre perfekten Hochsteckfrisuren, die glänzenden Abzeichen der Piloten, das leise Klacken ihrer schönen Schuhe auf dem Boden, die Anzahl der Filme, die man durch Tippen auf den Bildschirm auswählen konnte, die Menüs, die Menge des dabei produzierten Abfalls und vor allem die unglaubliche Bequemlichkeit der Sitze im Vergleich zu den im Dorf gefertigten Hockern. Er fühlte sich wie ein Neuling in einer seltsamen Welt. Hatte ihn sein Aufenthalt im Dorf in eine dermaßen weit entfernte Dimension versetzt, dass sein früheres Leben so tief in sein Gedächtnis abgesunken war?
Während des Flugs konnte Thomas keinen Schlaf finden. Zum Teil, weil sein Sitznachbar ständig von einem Film zum anderen zappte und keinen zu Ende sah, aber vor allem, weil er zum ersten Mal mit dem allein war, was die Entdeckung von Emma in ihm ausgelöst hatte. Die Nachbeben breiteten sich immer weiter in seinem Denken aus und gestalteten seine innere Landschaft völlig neu. Von Kind an hatte er immer nützlich sein wollen. Bei seinen Entscheidungen hatte er sich ganz bewusst an dieser Richtschnur orientiert. Und so hatte sich Thomas zu einem Menschen geformt, der sich für die Gesundheit anderer Menschen einsetzte, und zwar unabhängig von deren politischen oder religiösen Überzeugungen. Das war es, was ihn am ehesten definierte, das war der Schlüssel zu ihm. Er war mit diesem Selbstbild im Einklang. Und dann hatte er sich mit einem Mal in der Rolle eines infamen Freundes und abwesenden Vaters wiedergefunden. Thomas hatte immer gedacht, er kenne sein Leben, und dennoch war ein wesentlicher Teil dieses Lebens ohne sein Wissen abgelaufen. Vater, von einem Tag zum anderen. Er hatte sich nie wirklich vorgestellt, Vater zu sein. Was für ein Vater konnte er sein? Was bedeutete es, ein Kind zu haben? Wo lag der Unterschied zwischen einem Erzeuger und einem Vater? Wozu war man nütze, wenn man mit zwei Jahrzehnten Verspätung kam? Hatte man Rechte über die, denen man das Leben geschenkt hatte? Oder nur Verpflichtungen ihnen gegenüber?
Er dachte auch an Céline und das, was er für sie empfunden hatte. Manche Erinnerungen tauchten wieder auf. Bestimmte Momente, Blicke, Schweigen. Er war selbst überrascht, wie lebendig sie noch in ihm waren, wo er doch gedacht hatte, er habe alles vergessen. Hatte er es glauben wollen, um nichts bereuen zu müssen?
Nur noch wenige Stunden, dann würde Thomas wieder in Frankreich sein, ohne die geringste Idee, wie er sein neues Leben angehen sollte, von dem er selbst wenige Tage zuvor noch nichts geahnt hatte. Er würde jetzt auf Sicht fliegen müssen. Seine überraschende Rückkehr hatte ihm keine Zeit gelassen, wieder mit Menschen in Kontakt zu treten, außer mit Franck, einem ehemaligen Kollegen. Aber welche Fragen sich Thomas auch stellen mochte, die Antwort hing immer von Emma ab, die von alledem nichts ahnte. Auch ihre Geschichte war ohne ihr Wissen geschrieben worden. Vielleicht geht es uns allen so. Obwohl Thomas nach Hause zurückkehrte, war es ein Sprung ins Ungewisse. Ein Sprung ins Leere, zwischen Schuld, Lust, Angst und Hoffnung. Kann man in einem solchen Fall überhaupt bereit sein?
Vor allem hoffte er, Kontakt zu Emma herstellen zu können. Seit Kishan ihm die Fotos geschenkt hatte, trug er sie ständig bei sich und sah sie immer wieder an. Er kannte sie bis in die winzigsten Details. Den psychopathischen Mörderblick des Ponys, die Anzahl der Knöpfe auf dem Piratenkostüm, die Farbe der Kerzen auf dem Geburtstagskuchen. Er hätte mit geschlossenen Augen jeden Gegenstand beschreiben können, den Emma in der Hand hielt, und jedes Kleidungsstück, das sie trug. Er brannte darauf, sie in Wirklichkeit zu sehen. Er würde wahrscheinlich nicht sofort mit ihr sprechen, aber er sehnte sich danach, sie wenigstens anzusehen. Er brauchte es. Er wollte sie auf keinen Fall stören oder sich in ihr Leben drängen, aber er war entschlossen, ihr so nahe wie möglich zu kommen.
Das Flugzeug landete bei Sonnenaufgang in Paris. Thomas betrat die Ankunftshalle inmitten der Menschen, die sich lachend und gerührt in die Arme fielen. Auf ihn wartete niemand. Wahnsinn, wie viel verwundbarer man sich fühlt, wenn man allein ist. Fast schon beschämt schlängelte er sich diskret durch die Menge, über der Schulter die verblichene Sporttasche, in die sein ganzes Leben passte. Er ging durch die unendliche Flughafenhalle. Auch hier viele Bildschirme, riesige Parfümreklamen mit hochmütig blickenden Frauen und verführerisch lächelnden Männern. Thomas bewegte sich wie ein Zombie vorwärts. Nach den Blicken derer zu schließen, denen er begegnete, bewegte er sich nicht nur wie ein lebender Toter, sondern war in seinen verschlissenen, aus der Mode gekommenen Kleidungsstücken auch entsprechend kostümiert. Er trug das T-Shirt, auf das Kishan geschrieben hatte: »Don’t follow me, I’m lost.« Kishan hatte es ihm geschenkt, weil die Kinder aus dem Tal die fatale Neigung hatten, Thomas, der sich ziemlich oft verirrte, vertrauensvoll zu folgen. In diesem Flughafen mit seinem Überfluss an Hinweisschildern verschärfte sich die Bedeutung dieser Botschaft auf seinem T-Shirt noch. Doch jetzt gab es kein Kind mehr, das Thomas nachlief. Es wurde ihm bald klar, dass er wieder lernen musste, in seiner Heimat zu leben, die nur sechs Stunden Zeitverschiebung, aber Lichtjahre von Ambar entfernt war.
Als er endlich den Fahrkartenautomaten für die RER-Tickets gefunden hatte, stand er ratlos davor. Der Mann, der hinter ihm Schlange stand, wurde ungeduldig. Thomas wagte es, ihn um Rat zu fragen, doch der Typ sah ihn nur verächtlich an und wechselte den Automaten. Da bot ihm ein junges Mädchen Hilfe an. Thomas hörte ihr nicht richtig zu, als sie ihm etwas erklärte. Er sah sie an. Sie hätte seine Tochter sein können.
Inmitten dieser eiligen, abweisenden Leute, angesichts dieser abstrusen Werbetafeln und obskuren Hinweisschilder kam ihm seine Reise plötzlich vor wie eine hoffnungslose Odyssee. Es wäre vergleichsweise weniger verrückt gewesen, das Tal von Kapoor zu Fuß über die Pässe erreichen zu wollen, und zwar mitten im Monsunregen und mit dem Risiko, jederzeit von einem Blitz erschlagen zu werden.
3
Von Indien war Thomas menschenüberfüllte und stauverstopfte Großstädte gewöhnt, aber Paris war ganz anders. So wenige Fahrräder und so viele Autos, die nur ihren Fahrer transportierten und die direkt vom Band gerollt zu sein schienen, so sauber waren sie! Keine nachlässig verschnürten Lasten, die in alle Richtungen herausragten und herunterzufallen drohten, keine Fahrerkabinen, in denen die Leute übereinandersaßen, keine Menschen auf den Dächern der Busse. Ampeln an allen Kreuzungen. In einer wohl geordneten Choreografie wartete jede Schlange, bis sie an der Reihe war. Klar abgegrenzte Bürgersteige. Wenige Kinder und kaum Alte, dafür viele Menschen in nüchternen Anzügen, die im Gehen den Blick auf ihr Smartphone richteten. Sie ignorierten ihre gesamte Umgebung, sogar die majestätischen Gebäude, die den Horizont versperrten und die Sonne verbargen.
Thomas verlief sich und kam deshalb zu spät im Restaurant an. Er fragte den Kellner, ob er erwartet werde. Der machte eine vage Handbewegung zu einem Tisch weiter hinten. Während Thomas den Raum durchquerte, bemerkte er, dass hier zwar die Küche nach nichts roch, dafür aber die Menschen nach Parfüm. Vielleicht nach dem von den Werbetafeln.
Als er ihn kommen sah, stand ein robust wirkender Mann auf und streckte ihm lächelnd die Hand entgegen.
»Monsieur Sellac! Da bist du ja endlich. Ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich je wiedersehen würde.«
Thomas war nicht mehr daran gewöhnt, seinen Nachnamen zu hören. Franck hatte sich im Aussehen verändert. Die beiden Männer hatten sich in Angola kennengelernt; sein früherer Kollege hatte sich damals um die Logistik der humanitären Einsätze gekümmert.
Während sie sich setzten, musterten sie sich eine Weile ganz offen. Beide schienen diesen prüfenden Blick nach all den Jahren für völlig natürlich zu halten. Francks Blick war wie immer, direkt und aufmerksam, doch ansonsten war er ein wenig in die Breite gegangen. Sein schönes Hemd spannte über dem Bauch. Er trug eine dicke Armbanduhr. An den Schläfen hatte er bereits erste weiße Härchen.
Der Unterschied zwischen den beiden sprang ins Auge. Ihm gegenüber wirkte Thomas noch schmaler, und seine für indische Verhältnisse so helle Haut noch verwitterter und sonnenverbrannter. Thomas war mit Sicherheit der schlechtestgekleidete Mann im ganzen Restaurant – vermutlich auch im ganzen Viertel –, und das Glas auf seiner alten Armbanduhr war zerkratzt und gesprungen.
»Wann haben wir uns zum letzten Mal gesehen?«, fragte Franck nachdenklich. »Vor zehn Jahren? Bei diesem Erdbeben in Asien?«
»Vor fast zwölf Jahren. Ich gratuliere dir zu deiner Stelle. Ein schöner Erfolg, und ein wirklich verdienter. Wie geht es deiner Frau und deinen Kindern? Sie müssen inzwischen groß sein.«
»Danke, meinen Kindern geht es gut, aber von meiner Ehe sind nur noch Unterhaltszahlungen übrig.«
»Tut mir leid.«
»So ist das Leben. Ich weiß nicht, wie du es fertiggebracht hast, so lange durchzuhalten. Also ich konnte nicht mehr, nach Afrika.«
Thomas beugte sich vor und fragte Franck in vertraulichem Ton: »Als du von deinem Einsatz zurückgekommen bist, war dir da auch so, als würdest du ein fremdes Land betreten oder sogar eine Welt von Irren?«
»Absolut. Ich fand sie hirnrissig mit ihren Schlussverkäufen, ihren Fernsehsendungen und ihren Problemchen. Gestern hast du noch um ein bisschen Wasser gekämpft, und heute siehst du sie streiken, weil die Restaurant-Gutscheine abgeschafft werden sollen … Ich kam mir vor wie ein Außerirdischer! Völlig aus einer anderen Zeit! Und wenn ich bedenke, wie schnell sich unsere hübsche Kultur seit meiner Rückkehr weiterentwickelt hat, kann ich mir den Schock vorstellen, den du wahrscheinlich gerade erleidest. Aber keine Sorge, das dauert nicht lange. Jetzt geht meine neue Lebensgefährtin im Schlussverkauf shoppen, ich schau mir im Fernsehen Fußballspiele an, und wir haben eine Menge Problemchen. Wieso bist du zurückgekommen?«
Thomas zögerte.
»Vor langer Zeit, bevor ich fortging, habe ich eine junge Frau geliebt. Sie hieß Céline. Wir verstanden uns sehr gut, aber ich musste sie wegen meines ersten Einsatzes verlassen.«
»Du möchtest sie gern wiedersehen?«
»Nicht so sehr, dass ich deshalb zurückgekehrt wäre … Aber sie hat eine Tochter von mir bekommen. Ich habe es erst kürzlich erfahren. Und wegen dieses Kindes wollte ich zurück.«
»Tolle Überraschung … Wie alt ist die Kleine?«
»Gar nicht mehr so klein: Sie ist fast zwanzig.«
»Und wie hat sie reagiert, als sie erfuhr, dass du auf der Matte stehen würdest?«
»Sie weiß noch nichts davon. Vermutlich weiß sie übrigens nicht einmal, dass es mich gibt. Bestenfalls bin ich eine Leerstelle, schlimmstenfalls ein Schuft, der sie und ihre Mutter im Stich gelassen hat.«
Der Kellner kam, um die Bestellung aufzunehmen.
»Haben Sie schon gewählt?«
Franck antwortete wie aus der Pistole geschossen:
»Ein Tatar mit viel Kapern, bitte.«
Thomas hatte die Karte noch gar nicht aufgeschlagen.
»Zweimal, bitte.«
»Und zu trinken?«
»Eine Flasche von Ihrem hervorragenden Cahors«, bat Franck.
»In Ordnung!«
Thomas lachte.
»Ich habe seit mindestens acht Jahren weder Kapern noch rohes Fleisch gegessen – und schon gar nicht einen Cahors dazu getrunken …«
Franck lächelte leicht, kam aber auf ihr eigentliches Thema zu sprechen: »Was deine Bitte angeht, habe ich leider keine besonders guten Nachrichten. Ich schwöre dir, ich hab’s versucht, ich habe mein ganzes Adressbuch abtelefoniert, aber Stellen sind rar. Es werden immer weniger Ärzte eingestellt, vor allem in den Krankenhäusern. Warum schließt du dich nicht einem NGO-Team an? Deine Erfahrungen wären bei der Vorbereitung der Einsätze sehr wertvoll. Und da gibt es wirklich Nachfrage …«
»Hast du nichts in meiner Gegend?«
»Nichts Annehmbares. Außerdem würde ich dir nicht raten, dich da zu vergraben. Selbst wenn du wegen deiner Tochter zurückgekommen bist, du musst auch an deine eigene Zukunft denken. Im Gesundheitswesen wird nicht mehr so gearbeitet wie vor deinem Weggang aus Frankreich. Auch dort haben die Betriebswirte die Idealisten verdrängt …«
»Ich verstehe. Schlussverkauf, Fußball im Fernsehen und die Problemchen …«
»Ich meine es ernst, mein Junge.«
»Was meinst du genau mit ›nichts Annehmbares‹?«
»Ehrlich, es lohnt nicht einmal, darüber zu sprechen. Lass mich einen Termin mit einem Freund im Ministerium für dich vereinbaren, der kennt jeden.«
»Die Stelle, von der du mir so abrätst, ist sie wenigstens in der Gegend, in die ich will?«
»Ich glaube, ja, aber wirklich …«
»Dann nehme ich sie.«
»Du weißt doch noch gar nicht, worum es sich handelt!«
»Für mich ist der Ort wichtiger als der Job.«
»Ich hab noch nicht mal die Stellenbeschreibung mitgebracht, weil die Stelle so uninteressant ist. Ich glaube, es ist eine Seniorenresidenz, was ganz Winziges. Da gehst du ein.«
»Wenn die Lage stimmt, ist es mir recht.«
Knurrend zückte Franck sein Smartphone und stellte eine Verbindung zu einem Spezialserver her. Nach wenigen Sekunden erschien die Stellenbeschreibung auf dem Display, und er hielt sie Thomas hin.
»Sieh selbst. Aber sei nicht blöd, ich kann etwas zehnmal Besseres für dich finden …«
»Leiter einer Seniorenresidenz, Public-Private Partnership, ständiges Personal (außer leitendem Angestellten): 1. Sechs Bewohner. Große Dienstwohnung. Einstellung ab sofort.«
»Gibt es eine Möglichkeit nachzusehen, wo genau sie ist?«
»Tipp auf den Button rechts.«
Als Thomas das Ergebnis sah, zögerte er keine Sekunde.
»Franck, das ist ideal. Vielen Dank! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das hilft.«
»Wenn du deinen Fehler einsiehst, gib mir Bescheid. All die Jahre im Einsatz, um in diesem verrückten Loch zu enden … Was willst du da bloß machen?«
»Sehen, ob das Schicksal mich noch will.«
4
Der Letzte, der Thomas die Haare geschnitten hatte, hieß Marish und war ein kurzsichtiger alter Mann, bei dem der Arzt auch noch eine Form von Parkinson festgestellt hatte. Seine Hände zitterten, aber er bestand darauf, Thomas zu »frisieren«, um ihm für seine Mühe zu danken. Dabei benutzte er die rostige Schere, die ihm auch beim Geflügelschlachten gute Dienste leistete. Kishan hatte über das Ergebnis sehr gelacht und ihm angeboten, das Ganze noch einmal abzuflämmen.
An diesem Morgen betrat Thomas den ersten Friseursalon, den er nach dem Verlassen des Bahnhofs gesehen hatte und der stolz als »Visagist und Haut Coiffeur« firmierte. Die Trommelfelle taten ihm weh, weil der Friseur so gegen diese »schreckliche Haar-Sabotage« wetterte, dessen bösartiger Urheber Thomas »massakriert« habe, bevor er nun von diesem hauptstädtischen Friseur »gerettet« wurde, und das für den Gegenwert von zehn Monatslöhnen eines indischen Arbeiters.
Einige Tage zuvor hatte das neue Schuljahr begonnen, und Thomas fühlte sich in seinen neuen Kleidern – Jeans, Schuhe, Poloshirt und Blouson – wie einer der Schüler, denen er begegnete. Jeder einzelne Teil seiner neuen Ausstattung kratzte, was ihm einen etwas seltsamen Gang verlieh. Beim Betrachten der Kinder war ihm aufgefallen, dass die jüngsten unter dem Gewicht vollgepackter Schulranzen schwankten, die weit über ihre Schultern hinausragten, während die größeren, deren Haar häufig mit einer Art Leim aufgerichtet worden war, nur kleine, manchmal mit seltsamen Inschriften bekritzelte Rucksäcke trugen. Als würden die Kinder hier, je weniger sie tragen konnten, desto mehr belastet.
Thomas war erleichtert, als er die Rue de la Liberté ohne allzu große Schwierigkeiten fand. Doch als er merkte, dass er gerade vor der Nummer 27 stand, wo doch das Heim die Hausnummer 371 hatte, beschleunigte er seinen Schritt.
Die Straße zog sich Richtung Westen, entfernte sich vom Stadtzentrum, durchquerte den Stadtrand, ließ auch bald die vereinzelten Wohnanlagen hinter sich, zog sich an einem Stadion entlang und verlief dann weiter zwischen Schuppen, Gebrauchtwarenläden und Reparaturwerkstätten hindurch. Zu seiner Verwunderung sah Thomas mehrere Fabrikgebäude, die zu Lagerhäusern für Privatkunden umgebaut worden waren. Diese Welt musste ja wirklich von materiellen Gütern überquellen, dass die Leute gezwungen waren, Container zu mieten, um ihre Besitztümer außerhalb der Wohnung aufzubewahren.
Je weiter Thomas vorankam, desto weniger Menschen sah er. Er war inzwischen ziemlich lange niemandem mehr begegnet, außer einer Katze und einem alten Karton, den der Wind vor sich hertrieb.
Na, zu Fuß können die alten Herrschaften jedenfalls nicht fliehen …, dachte er.
In der Ferne zeichneten sich über den Industriegebäuden bewaldete Höhen ab, aber sie waren mit der schroffen, dürren Berglandschaft im Distrikt Kupwara nicht zu vergleichen.
Als Thomas endlich vor der Hausnummer 371 stand, zögerte er. Er sah noch einmal die Adresse auf den Unterlagen nach. Dass das Altenheim zwischen einer Autowerkstatt nebst Schrottplatz und einer offenbar stillgelegten Fabrik stand, war nicht das Überraschendste. Was Thomas wirklich verblüffte, waren die lebhaften Farben und der fröhlich lächelnde riesige Teddybär, der an die Fassade der Seniorenresidenz gemalt war. Es schien ihm alles nicht zusammenzupassen. Er ging zum Haupteingang und klingelte. Sehr bald öffnete ihm eine Frau. Sie war ganz sicher jünger als er und wirkte charmant und eher willensstark. Ihr höfliches Lächeln konnte das Misstrauen in ihrem Blick nicht ganz verbergen.
»Guten Tag.«
»Guten Tag. Ich bin Thomas Sellac, der neue Direktor.«
»Willkommen. Ich bin Pauline Choplin, die hier zuständige Krankenschwester.«
Die junge Frau sah sich auf der Straße um und fragte: »Wo ist Ihr Wagen?«
»Ich bin zu Fuß gekommen.«
»Aus dem Stadtzentrum?«
»Ja.«
»Sie hätten anrufen sollen, dann hätte ich Sie abgeholt. Es ist weit …«
»Ich habe kein Handy.«
Mademoiselle Choplin konnte ihre Überraschung nicht verbergen. Der Mann vor ihr, dessen Blouson so neu war, dass das Etikett noch am Ärmel hing, war bestenfalls ein Sozialfall und schlimmstenfalls ein Serienmörder, der sie als Geisel nehmen würde, sie und alle Heimbewohner.
»Kommen Sie doch bitte herein«, sagte sie dennoch höflich.
»Ich weiß, ich komme zwei Stunden zu früh, aber ich dachte, mein Vorgänger würde froh sein, ein wenig Zeit zu gewinnen.«
»Das ist sehr nett von Ihnen, aber der ist schon im letzten Monat gegangen, auf die Minute genau zum Ende der Kündigungsfrist.«
»Aber dann …«
»Ja, seither sind wir allein, und wissen Sie was? Wir haben es überlebt. Ehrlich gesagt hatte ich sogar gehofft, es würde so bald gar kein Nachfolger kommen.«
Thomas erstarrte, als er sich im Eingangsbereich des Heims umsah. Noch mehr gemalte Teddybären, überall, und außerdem bunte Luftballons, lächelnde Blümchen und tanzende Kaninchen. Vom Boden bis zur Decke. Ein Kaleidoskop schreiender Farben, neben dem die Straßen von Bombay zu einem deprimierend farblosen Bild verblasst wären.
Pauline Choplin warf ihm einen besorgten Blick zu.
»Ich hoffe, Sie haben keine Allergie gegen kindgerechte Raumgestaltung …«
»Bisher hatte ich noch keinen Anfall. Haben Sie das alles hingemalt, weil alte Leute angeblich wieder zu Kindern werden?«
»Als die Fabrik nebenan geschlossen wurde, haben wir einfach nur die Räumlichkeiten der dazugehörigen Kinderkrippe übernommen. Sie werden sehen, anfangs möchte man noch eine Sonnenbrille aufsetzen, um nicht farbenblind zu werden, aber dann gewöhnt man sich daran. Und außerdem, Kinderkrippe oder Altenheim, wo ist da der Unterschied? Die Insassen halten Mittagsschlaf und tragen häufig Windeln!«
Die Krankenschwester lachte herzhaft, wurde jedoch schnell wieder ernst, als sie sah, dass ihr neuer Chef keine Miene verzog.
»Ich zeige Ihnen Ihr Büro. Ihre Dienstwohnung liegt darüber. Haben Sie an Gepäck nur diese eine Tasche?«
»Ja.«
Als er die junge Frau wieder staunen sah, fügte Thomas eilig hinzu: »Der Rest kommt später.«
Im Büro fand Thomas einen sehr sichtbar positionierten Stapel von Akten und Unterschriftenmappen vor, zwei Archivschränke und auf der Pinnwand, die die halbe Wand einnahm, eine beeindruckende Anzahl von Dienstanweisungen. Er bemerkte sofort den Computer und den Drucker. Die würde er brauchen.
»Ist der Rechner ans Internet angeschlossen?«
Die Krankenschwester wirkte ein wenig verwirrt von dieser Frage, nickte jedoch, als wäre nichts. Thomas las einige der Anweisungen. Er staunte über eine solche Papierverschwendung und so viel Formalismus.
»Ihr Vorgänger war ein Fan von ›kleinen Mitteilungen‹«, erklärte Pauline Choplin. »Er schrieb ständig welche, egal, worum es ging.«
»Ich verstehe. Für diese Krankheit gibt es sicher auch einen Namen …«
»Er war vermutlich ein guter Geschäftsführer. Aber in menschlicher Hinsicht … Selbst nach drei Jahren brachte er die Namen der Heimbewohner noch durcheinander.«
»Es sind sechs, nicht wahr?«
»Fünf. Madame Berzha hat uns verlassen, friedlich und im Schlaf. Die Belegschaft besteht heute also aus drei Frauen und zwei Männern. Von einundsiebzig bis achtundachtzig Jahren. Darf ich Sie etwas fragen?«
Es war lange her, dass eine Frau Thomas so offen in die Augen gesehen hatte. Verwirrt vertiefte er sich in eine Anweisung zum Befüllen der Flüssigseifenspender.
»Aber bitte.«
»Warum haben Sie sich für diese Stelle entschieden?«
»Ich habe Verwandte hier in der Gegend.«
Um weiteren Fragen vorzubeugen, tat Thomas so, als würde er sich für ein Memo über die Größe der Brotrationen interessieren.
»Wer kümmert sich um die Mahlzeiten?«
»Die Gemeinde lässt sie zweimal täglich liefern. Aber ich mache das Frühstück.«
»Gibt es Heimbewohner, die eine besondere Versorgung brauchen?«
»Sie sind noch relativ autonom. Drei von ihnen sind in ständiger ärztlicher Behandlung. Ich werde Ihnen ihre Akten zeigen, wenn Sie möchten. Sie sind der Erste, der sich für ihre medizinische Behandlung interessiert …«
»Wahrscheinlich gebe ich einen ziemlich dürftigen Geschäftsführer ab, aber ich bin von der Ausbildung her Arzt.«
»Welches Fachgebiet?«
»Verzweifelte Fälle am Ende der Welt.«
Sie brach in Lachen aus. Zum zweiten Mal seit Thomas’ Ankunft, und er freute sich schon jetzt über die Spontaneität und Energie, die seine Mitarbeiterin ausstrahlte.
»Nun, Doktor, soll ich mit der Führung beginnen?«
5
Nach den Maßstäben Ambars wäre die Dienstwohnung geräumig genug gewesen für Kishan, seine Frau, seine drei Kinder, seine Eltern, seine Schwiegereltern und auch noch für den einen oder anderen Onkel. Thomas sah sich in seiner neuen Bleibe kurz um und stellte die Tasche in der Diele ab.
»Die Heimbewohner kommen nie hier herauf, Sie werden Ihre Ruhe haben. Es gibt sogar einen direkten Ausgang nach draußen, wenn Sie mögen, über die Treppe am Ende des Gangs.«
»Und das da, was ist das?«
»Eine weitere, kleinere Wohnung. Sie dient als Lager. Wir stellen dort Möbel ab. Manche stammen noch aus der Kinderkrippe.«
»Das Heim wirkt komfortabel.«
»Finden Sie? Nun, umso besser. Ihr Vorgänger fand es eng und veraltet … Ursprünglich war dieses Heim für ältere Menschen ein gemeinsames Pilotprojekt der Krankenkasse und der Gemeinde. Als die Fabrik stillgelegt wurde, kaufte die Stadt das Gebäude, um es umzubauen. Die Idee war gut: weniger Bewohner in einem familiäreren Rahmen. Doch die Krankenkasse hat sich immer mehr aus der Finanzierung zurückgezogen, und schließlich wurden die Bewohner aufgefordert zuzuzahlen.«
Thomas trat an eins der Fenster an der Rückfront des Gebäudes und staunte über das große Grundstück dahinter.
»Ist das ein Garten?«
»Ein ehemaliger Obstgarten, der sich bis zum Fluss hinunterzieht, das Ufer ist da unten bei der großen Weide. Die Renonce, angeblich ist sie reich an Forellen. Wenn Sie wollen, zeige ich sie Ihnen.«
»Warum nicht? Seit wann arbeiten Sie hier?«
»Seit der Eröffnung vor etwas mehr als drei Jahren. Vorher war ich im Krankenhaus, aber die Arbeitszeiten und die Atmosphäre wurden mir zu stressig. Außerdem wollte ich mehr Zeit für meinen kleinen Sohn haben. Als sein Vater uns verließ, kündigte ich, um diese Stelle hier anzutreten.«
Noch zwei Monate früher hätte Thomas die Geschichte vom Vater, der Frau und Kind verlässt, als banale soziale Wirklichkeit abgetan. Doch heute empfand er ganz anders.
»Wie alt ist Ihr Sohn?«
»Er wird bald acht.«
Fast hätte sich Thomas gewohnheitsmäßig nach seiner Gesundheit erkundigt, aber er hielt sich rechtzeitig zurück und fragte stattdessen: »Wissen die Heimbewohner, dass ein neuer Heimleiter ernannt wurde?«
»Machen Sie Witze? Natürlich wissen sie es! Ich bin sicher, seit der Sekunde, in der Sie dieses Haus betreten haben, spionieren sie Ihnen nach! Sie werden sehen, manchmal haben sie etwas sehr Kindliches, was mir übrigens sehr gefällt.«
»Sie haben mir nachspioniert? Im Ernst?«
»Natürlich. Ehrlich gesagt haben sie Ihren Vorgänger nie gemocht. Im letzten Winter hatte Monsieur Lanzac die Grippe, und er ist nur aufgestanden, weil er versuchen wollte, dem Direktor seine Bazillen anzuhängen. Es ist ihm schließlich sogar gelungen!«
»Charmant. Und Sie, wie dachten Sie über den früheren Heimleiter?«
»Darf ich ehrlich sein?«
»Das wäre eine gute Basis für unsere Zusammenarbeit.«
Kaum merklich veränderte sich die Haltung der jungen Frau.
»Er war nicht allzu …«
Sie zögerte, und da sie sah, dass Thomas auf die Antwort wartete, sagte sie scharf: »Er war ein karrierebesessener kleiner Bürokrat, der im sozialen Bereich nichts zu suchen hatte. Dieser Typ hat nie für jemand anderen als sich selbst gearbeitet.«
Nachdem sie dieses Urteil gefällt hatte, wurde Pauline sofort wieder liebenswürdig.
»Gehen wir wieder hinunter, ich möchte Ihnen die Heimbewohner vorstellen.«
6
Pauline Choplin führte Thomas in den Gemeinschaftsraum. Die Wände waren mit bunten Schlangenlinien und kleinen kuschelig runden Tieren bemalt, die für Kinder unter fünf Jahren sicher außerordentlich faszinierend waren. Als wäre sie ein kleines Mädchen, das einen Streich ausheckt, legte Pauline den Finger an die Lippen, um Thomas zum Schweigen zu ermahnen.
»Nun, Herr Direktor, soll ich jetzt unsere Heimbewohner holen?«
Thomas sah sie verständnislos an. Sie raunte ihm zu: »Jetzt müssen Sie sagen: ›Aber gern« oder ›Ich bitte darum‹.«
Er nickte und sagte laut und mit tiefer Stimme: »Ich bitte darum!«
Pauline bedeutete ihm, er solle lauschen. Das Geräusch einer Tür, die sich öffnete, dann einer weiteren. Sehr bald kam eine erste Gestalt angetrippelt. Eine gebeugte kleine Dame mit makellos weißem Haar trat über die Schwelle des Gemeinschaftsraums wie über die Ziellinie eines Zeitlupen-Rennens. Sie kam näher und besah sich dabei den Neuankömmling. Ihre Augen waren hell und ihr Blick weit lebhafter als die Bewegungen ihres Körpers. Sie streckte ihm die Hand entgegen.
»Guten Tag, Monsieur, ich heiße Françoise Quenon. Wissen Sie, heute Nacht bin ich um 2 Uhr 22, um 4 Uhr 44 und um 5 Uhr 55 aufgewacht, und Sie sind um 9 Uhr 09 angekommen …«
Ein zweiter Bewohner stürzte so schnell herbei, wie ein älterer Herr es eben kann, ging an der alten Dame vorbei und schüttelte Thomas kräftig die Hand.
»Francis Lanzac. Meine Freunde nennen mich ›Oberst‹. Achten Sie nicht auf sie, Doktor, sie ist verrückt. Sie sieht überall Zeichen des Übernatürlichen. Mit ihren albernen Uhrzeitgeschichten wird sie Ihnen verkünden, Sie seien der Antichrist und lediglich hier, um uns unsere Seelen und die Zitronenkekse zu rauben.«
Die alte Dame protestierte: »Schweig, Francis! Ich war zuerst hier. Und er ist nicht der Antichrist!«
»Was soll er denn deinen dämlichen Uhrzeiten zufolge sonst sein? Die Reinkarnation eines Radioweckers?«
Jetzt erschien ein zweiter Mann, der sich sehr würdig auf einen Stock stützte, mit zwei weiteren Frauen. Thomas war bald von den Heimbewohnern umringt, die sich betrugen wie Kindergartenkinder beim Besuch des Weihnachtsmanns. Vielleicht war es gar nicht so abwegig gewesen, sie in einer Kinderkrippe unterzubringen.
»Er ist sehr jung, und diese Schultern …«, setzte eine Dame mit perfekt onduliertem, bläulich schimmerndem Haar an.
»Auf jeden Fall sieht er sehr viel besser aus als unser letzter Direktor«, pflichtete ihr die Dritte bei.
»Na ja, das ist ja auch nicht schwer«, witzelte Francis.
Der Herr mit dem Gehstock trat näher und verneigte sich höflich vor Thomas.
»Ich grüße Sie. Ich habe einen Sohn in Ihrem Alter. Einmal im Jahr besucht er mich mit seiner Frau, jedes Mal mit einer anderen. Oder aber ich erkenne sie nicht wieder.«
Pauline griff ein: »Lassen Sie den Herrn Direktor doch mal zu Atem kommen. Wenn alle einverstanden sind, koche ich einen Schwarztee oder Kräutertee, wir setzen uns an den Tisch, und jeder kann sich in Ruhe vorstellen.«
»Tee? Dann muss ich wieder die ganze Nacht Pipi!«, erklärte Chantal, die Dame mit dem bläulichen Haar.
»Falls es Zitronenkekse gibt, darf Jean-Michel heute keinen bekommen, er hat gestern zwei genommen«, mischte sich die Dritte ein, Hélène.
Der Angeklagte, auf seinen Stock gestützt wie ein Aristokrat, der für sein offizielles Porträt Modell steht, verneigte sich wieder vor Thomas.
»Könnten wir nicht sagen, dass Ihre Ankunft hier alle Zähler auf null zurückstellt? Eine Art Amnestie. Dann bekäme ich auch einen Keks.«
»Sind diese Kekse denn so gut?«
Die fünf Heimbewohner seufzten im Chor.
»Pauline backt sie«, erklärte Francis. »Und nur wegen der Kekse versuchen wir nicht zu fliehen!«
»Solange ich sie nicht probiert habe, weiß ich nicht, was mir entgeht, also schenke ich Ihnen heute meinen.«
»Das ist sehr nett von Ihnen, aber warum sollte Jean-Michel noch mehr bekommen?«, protestierte Chantal.
7
Thomas war schon mehrmals von Leuten betrachtet worden, und aufs Gründlichste, insbesondere von den Kindern in Ambar, als er zum ersten Mal in ihr Dorf gekommen war. Bei dieser Gelegenheit hatte er übrigens auch seinen ersten Satz in Hindi gelernt: »Dein Hosenschlitz ist offen.« Die Erwachsenen hatten sich diskreter verhalten, aber die Kleinen hatten sich nicht geniert, sich vor ihm aufzubauen und ihn von Kopf bis Fuß genau zu mustern. Und so erging es ihm auch jetzt.
Pauline begann mit der Vorstellung: »Das ist Françoise, die Jüngste unter uns …«
Francis unterbrach sie.
»Das ist doch alles nur Gesums. Verzeihung, aber vielleicht könnten wir ihm die Liste von uns Alten mitsamt unseren Krankengeschichten ersparen. Sie haben ihm doch gesagt, Sie würden ihm unsere Akten zeigen. Wir hingegen bekommen keine Unterlagen über ihn. Also, Doktor, dürfen wir Ihnen Fragen stellen?«
»Aber gern.«
Chantal stürzte sich als Erste ins Gefecht.
»Sie sind ja ganz schön braungebrannt, wo waren Sie in Urlaub?«
»Ich komme nicht aus dem Urlaub, sondern aus Indien, wo ich gearbeitet habe.«
»Worin bestand Ihre Arbeit?«
»Ich habe Leute behandelt. Ich bin Arzt.«
Francis riss die Augen auf.
»Toll! Wie lange waren Sie bei den Indern?«
»Acht Jahre.«
»Waren Sie in einem Reservat?«, fragte Chantal. »Haben Sie mit Pfeil und Bogen Bisons gejagt?«
»Ich war nicht bei den Indianern, sondern bei den Indern. Im Land der heiligen Kühe.«
»Warum, zum Teufel, haben Sie acht Jahre mit Kühen zusammengelebt?«, fragte Hélène erstaunt.
»Ich wollte Ihnen nur einen weiteren Hinweis auf das Land geben. Ich wohnte in einem abgelegenen Tal im Süden Kaschmirs, in der Nähe der Grenze zu Pakistan.«
»Kaschmirpullis sind da sicher viel billiger als hier …«
»Haben Sie da auch Katzenfleisch gegessen?«, erkundigte sich Chantal.
»Die Inder essen keine Katzen.«
»Es sind die Eskimos, die Katzen essen!«, rief Jean-Michel.
»Die Eskimos essen auch keine Katzen«, stellte Thomas richtig.
Er begegnete dem Blick Paulines, die sich sichtlich über diese Wendung des Gesprächs amüsierte.
Hélène fragte: »Werden Sie erlauben, dass uns Théo weiterhin besucht?«
»Wer ist Théo?«
»Paulines Sohn. Er ist hinreißend, wir helfen ihm bei den Hausaufgaben, und er spielt mit uns.«
Pauline mischte sich etwas verlegen ein: »Der frühere Heimleiter war damit einverstanden, dass ich ihn mitbrachte, weil ich dann länger bleiben konnte …«
»Wenn allen so daran gelegen ist, wüsste ich nicht, warum man es ändern sollte.«
Francis fragte plötzlich: »Hatten Sie schon mal Sex zu dritt?«
Die vier Frauen protestierten vehement, und Jean-Michel verdrehte die Augen.
»Bitte verzeihen Sie ihm, Doktor, er ist ein Hornochse!«
»Aber er hat nichts mit den Kühen zu tun, mit denen Sie acht Jahre zusammengelebt haben«, erläuterte Hélène.
»Doktor, antworten Sie nicht, das geht keinen was an! Machen Sie doch, was Sie wollen, mit diesen Indern in ihren Tipis.«
Während sich jeder auf seine eigenen Irrwege begab und selbst Pauline noch nach dem roten Faden zu suchen schien, fragte Françoise sehr ruhig: »Und ansonsten, Doktor, haben Sie Kinder?«
8
E





























