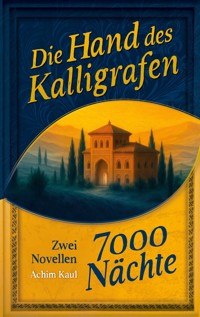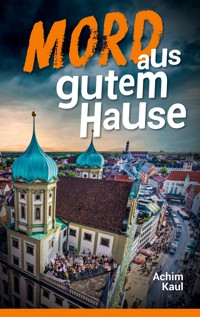Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Tausende Demonstranten strömen aufgewühlt durch Augsburgs Fußgängerzone. Aus dem Hinterhalt schießt jemand scheinbar wahllos in die Menschenmenge. Ein Mann stirbt im Kugelhagel. Erlebt Augsburg einen Terroranschlag? Tobt ein Amokschütze seine Wut aus? Handelt es sich um einen gezielten Mord? Kommissar Zweifel hat es in seinem neuen Revier mit brandgefährlichen Gegnern zu tun, auch aus den eigenen Reihen. Zudem erlebt Klaus-Peter Wolf, berühmter Autor der Ostfriesenkrimis, bei seinem Gastauftritt in diesem neuen Augsburgkrimi sein "blaues" Wunder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Achim Kaul
Mord aus gutem Hause
Der neue Augsburgkrimi
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Epilog
Nachbemerkung und Danksagung
Impressum neobooks
1. Kapitel
Mord aus gutem Hause
Zweifel wurde am Samstagmorgen von einem ungeduldigen Klopfen geweckt. Es war eher ein Hämmern, unrhythmisch und unangenehm laut. Er wälzte sich aus dem Bett und versuchte, die Augen offen zu halten. Er stand auf und tappte verschlafen den Flur entlang. Er gähnte. Das heftige Hämmern setzte wieder ein.
»Ja doch«, brummte er genervt und blieb mit den Zehen des rechten Fußes an seinem Bücherregal hängen. Der plötzliche Schmerz machte ihn hellwach. Er riss die Eingangstür auf.
»Seit wann hast du denn eine Glatze?« Zweifel war wie vom Donner gerührt. Sein Vater stand vor ihm.
»Dad …«, brachte er mühsam hervor und presste stöhnend die Augen zusammen, als er seine Zehen bewegte.
»Sag nicht Dad. Kannst du kein anständiges Deutsch?« Zweifel schüttelte heftig seinen Kopf. Einerseits um die nach Aufmerksamkeit brüllenden Zehen aus seinem Bewusstsein zu verscheuchen, andererseits, um die Fragen zu sortieren, die ihm kreuz und quer durchs Hirn schossen und schließlich, um die Fata Morgana in Gestalt seines Erzeugers als solche zu entlarven. Was nicht gelang. Sein Vater, den er mehr als nur eine Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte, stand leibhaftig vor ihm. Er starrte auf den blankpolierten, schwarzen Schuh am linken Fuß seines Vaters und auf die arg ramponierte Sandale an dessen rechtem Fuß. Die Frage, die sich daraus ergab, schob Zweifel auf seiner Prioritätenliste ganz nach hinten. Sein Vater hatte ihn etwas gefragt.
»Die hatte ich schon bei meiner Geburt«, antwortete er fast automatisch.
»Bist du sicher? Hat Ed wohl vergessen. Ich wollte, den Rest hätte Ed auch vergessen.« Zweifel hatte keine Ahnung, was genau sein Vater damit meinte. Sie standen einander in der offenen Tür gegenüber, wie ein Mann, der einen anderen Mann nach dem Weg fragt, den dieser nicht kennt.
»Kaffee wäre gut für Ed. Und eine Orange. Ja, ich denke, das wäre angemessen. Hast du so was im Haus?«, fragte Edwin Zweifel auf eine etwas irritierende Weise.
»Sicher«, sagte sein Sohn, »komm rein.« Kaum hatte er sie ausgesprochen, schwante ihm, dass er diese Worte noch bereuen würde.
Wenig später saß Ed unbequem auf einer Art Barhocker an der Küchentheke seines Sohnes. Zweifel war im Bad. Er hatte seinem Vater eine Tasse Kaffee durchlaufen lassen und ihm gezeigt, wie die Maschine zu bedienen war, falls er eine zweite wollte. Orangen hatte er zwar keine, schenkte ihm dafür aber ein Glas Saft ein. Ed hatte sich schweigend an die Theke gesetzt, ein Tütchen Zucker aus einer Keramikschale herausgefischt, sorgfältig an einer Ecke aufgerissen und langsam in das Glas Orangensaft rieseln lassen.
Zweifel stand unter der Dusche und versuchte, sich zu erinnern, wann er seinen Vater das letzte Mal gesehen hatte. Zwanzig Jahre war das her, länger noch, es musste Anfang 1994 gewesen sein, im nasskalten Berliner Winter. Zweifel stellte die Dusche ab und blieb eine Weile tropfnass stehen. Die Bilder aus der Vergangenheit stürzten auf ihn ein und blockierten vorübergehend das Bewusstsein dafür, was als Nächstes zu tun war, nämlich, sich abzutrocknen und anzuziehen. Als er damit fertig war, hörte er, wie die Kaffeemaschine ihre typischen Geräusche von sich gab. Sein Vater schien sich also schon wie zuhause zu fühlen. Ein Gedanke, der Zweifel zu beunruhigen begann. Er ging in die Küche.
»Der Saft ist Ed zu süß«, brummte sein Vater.
»Hast du immer noch diese Angewohnheit?«, erwiderte Zweifel, holte Brot aus dem Schrank und fütterte den Toaster mit zwei Scheiben. Sein Vater zog die frisch gefüllte Tasse unter der Auslaufdüse hervor und stellte sie vorsichtig auf die Theke, auf der er vorhin schon etwas Kaffee verschüttet hatte. Er nahm ein weiteres Zuckertütchen, riss eine Ecke ab und versenkte den Inhalt in das volle Glas Orangensaft.
»Was willst du damit sagen?«, fragte er im gleichen brummigen Ton. Zweifel stellte seine Tasse unter den Koffeinspender.
»Der Saft ist Ed zu süß«, ahmte er seinen Vater nach. »Du redest von dir in der dritten Person. Du tust so, als ob dieser Ed jemand anders wäre. Das meine ich damit.« Edwin Zweifel nippte an seinem Kaffee und schwieg. Dieses Schweigen kam Zweifel wie die Ankündigung großer Schwierigkeiten vor.
Er hatte seinen Vater nicht schweigend in Erinnerung. Im Gegenteil. Wenn er nicht gerade mit seinen Kunden telefonierte, selten kürzer als eine halbe Stunde, redete er mit Nachbarn, quatschte mit Bekannten, die zufällig am Haus vorbeiliefen, sprach Fremde an, die zufällig am Haus vorbeiliefen und anschließend zu den Bekannten zählten. Einmal hatte Zweifel von seinem Fenster aus beobachtet, wie sein Vater einen Müllmann in ein Gespräch verwickelt hatte. Der Fahrer des Müllwagens hatte ungeduldig gehupt, war schließlich mit einem Fluch auf den Lippen ausgestiegen und lauschte wenig später fasziniert den Worten seines Vaters. Zweifel hatte keine Ahnung, was Ed, so nannte ihn alle Welt, den Leuten erzählte. Aber es war seine Art und Weise, Geld zu verdienen. Zweifels Mutter war früh gestorben. Eines Tages kam er nach Hause und fand seinen Vater im Wohnzimmer vor, wo er aus dem Fenster starrte und ihn nicht beachtete. Seine Mutter war in der Küche. Zuerst sah er die Flecken am Kühlschrank. Ein Stuhl war umgefallen, die Tischdecke halb heruntergezogen. Es roch säuerlich nach Essig und Zwiebeln, der Salat war auf dem ganzen Küchenboden verteilt. Die Schüssel war verkehrt herum auf ihrer Hand gelandet, zwischen den verkrampften Fingern lugte ein Stück rote Paprika hervor. Sie lag auf der Seite, als hätte sie auf dem Boden ein Schläfchen machen wollen, die Knie angezogen. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Zweifel kniete neben seiner Mutter, die Hand unter ihrem Nacken, in dem fassungslosen Bemühen, sie ins Leben zurückzuwünschen, als er die Stimme seines Vaters hörte.
»Hirnschlag«, verkündete er so sachlich, als wäre nur eine Sicherung herausgeflogen.
»Warum hast du keine Hilfe …«
»Da kam jede Hilfe zu spät, Junge. Da war nichts zu machen.« Es war merkwürdig, aber im Rückblick kam es Zweifel so vor, als hätte sein Vater damals begonnen, von sich in der dritten Person zu reden.
»Ich rede, wie es mir passt«, sagte Ed und stellte seine Tasse auf die Theke. Zweifel war nicht nach einem Streit mit seinem Vater zumute. Nicht eine halbe Stunde, nachdem er seit ewigen Zeiten plötzlich wiederaufgetaucht war. Ihm lagen viele Fragen auf der Zunge, die er mit einem großen Schluck Kaffee hinunterspülte. Es war Samstagmorgen und er hatte sich für das Wochenende vorgenommen, seine umfangreiche Sammlung an Kunst- und Fotobänden in aller Ruhe durchzusehen und vielleicht einen oder zwei ausgedehnte Waldspaziergänge zu machen. Außerdem musste er seinen Umzug nach Augsburg vorbereiten. Dieser Plan war nun in Gefahr. Er musterte seinen Vater über den Rand der Kaffeetasse hinweg. Wie alt war er jetzt eigentlich? Er stellte eine schnelle Berechnung an und kam auf 74 Jahre. Im Gegensatz zu seinem Sohn hatte Ed Zweifel einen dichten, weißen Haarschopf, den er noch nie zu bändigen vermocht hatte. Die Haare standen wild in alle Richtungen ab, als wäre er in einem Doppeldecker ohne Helm hergeflogen. Die grünen, hellwachen Augen hatte er halb geschlossen. Er tat, als bemerkte er den Blick seines Sohnes nicht. Zweifel gab sich einen Ruck.
»Wie hast du mich überhaupt gefunden?«
»War nicht schwer«, war die lapidare Antwort.
»Ach was! Das will ich jetzt aber genau wissen.« Ed warf seinem Sohn einen langen Blick zu und drehte das Glas mit dem Orangensaft hin und her.
»Du warst in der Zeitung. Dein letzter Fall hat Aufsehen erregt.« Zweifel ahnte, dass er die Antwort auf seine Frage nicht in einem einfachen Satz serviert bekäme. Er musste nachhaken wie bei einem widerspenstigen Zeugen.
»Wo hast du darüber gelesen?« Ed tat, als konzentrierte er sich auf den Orangensaft, doch sein Sohn brachte an diesem Morgen keine Geduld für eine subtile Gesprächsführung auf.
»Ist ja auch egal«, sagte er mehr zu sich. Der Toaster spuckte zwei Scheiben aus. Zweifel nahm eine und biss ab. Ed ließ das Glas los.
»Trockener Toast?«, fragte er und seine Stimme klang herausfordernd. Wortlos nahm Zweifel einen Teller vom Regal über der Spüle und legte die andere Scheibe darauf. Aus dem Kühlschrank holte er Margarine und ein Glas Erdbeermarmelade und stellte beides vor seinen Vater hin. Mit dem Finger deutete er auf einen steinernen Bierkrug, in dem er sein Besteck aufbewahrte.
»Mehr hab ich nicht zur Auswahl.« Er steckte zwei neue Scheiben in den Toaster und biss das zweite Drittel seiner Scheibe ab. »Auf Besuch bin ich nicht eingestellt«, fügte er mit vollem Mund hinzu. Ed nickte und griff nach seiner Tasse.
»Du lebst allein? Ich dachte du bist verheiratet. Mit dieser Journalistin. Wie heißt sie nochmal?« Zweifel schoss das Blut in den Kopf. Eine barsche Antwort lag ihm auf der Zunge. Er schluckte sie hinunter zusammen mit dem Rest seines trockenen Toasts. Die neue Situation bereitete ihm zunehmend Kopfzerbrechen. Er trank hastig seine Tasse leer.
»Sie hieß Ella.«
»Ihr habt euch getrennt?« Zweifel schüttelte den Kopf.
»Sie wurde umgebracht. Ist schon lange her. Stand auch in der Zeitung«, antwortete er. »Aber das hast du wohl nicht gelesen.« Den Satz konnte er sich nicht verkneifen. Sein Vater schaute ihn prüfend an. Dann griff er nach einem Messer und bestrich seinen Toast mit Margarine. Zweifel sah zu, wie Ed einen großen Klacks Erdbeermarmelade aus dem Glas pulte und auf der dicken Margarineschicht verteilte. Ihm entging das Zittern der Hand nicht.
»Kannst du mir sagen, wie es kommt, dass du nach mehr als zwanzig Jahren so mir nichts, dir nichts samstagmorgens bei mir hereinschneist?« Sein Versuch, ruhig und gelassen zu klingen, misslang. Die Frage hing genauso vorwurfsvoll in der Luft, wie sie im Grunde gemeint war. Ed blieb davon unbeeindruckt, warf einen langen Blick auf seinen Toast und biss herzhaft hinein. Zweifel schüttelte den Kopf und wartete ab. Eine Weile war nichts zu hören als das Kauen seines Vaters. Schließlich trafen ihn seine grünen Augen.
»Schlimm, was mit deiner Frau passiert ist.« Zweifel rührte sich nicht. Er wollte in Anwesenheit seines Vaters nicht an Ella denken.
»Kann Ed noch ein Brot haben?« Die Frage schien an seine Kaffeetasse gerichtet. Wie auf Kommando sprangen die zwei Scheiben aus dem Toaster. »Ed weiß, wie sich das anfühlt«, sagte er und zog die Margarine zu sich heran. Zweifel dachte an seine Mutter.
»Natürlich«, murmelte er und legte seinem Vater einen Toast auf den Teller und nach kurzem Überlegen auch den zweiten.
»Also — du bist mir noch eine Antwort schuldig.« Ed war mit der Margarine fertig und nahm das Marmeladenglas in die Hand. Er tat so, als kontrollierte er die Inhaltsstoffe.
»Ed ist pleite«, sagte er nach einer langen Pause. Das traf Zweifel wie ein trockener Kinnhaken. Er starrte seinen Vater an.
»Was soll das heißen? Was ist mit dem Haus?«
»Wurde versteigert.«
»Und?«
»Und was?«
»Na, da muss doch Geld geflossen sein.« Ed nickte und biss in das Marmeladen-Margarine-Gemisch, das er auf seinem Toast angerichtet hatte.
»Aber nicht in Eds Richtung«, antwortete er mit vollem Mund. Es schien ihn nicht weiter zu belasten. Zweifel vergaß vor Verblüffung, den Kopf zu schütteln.
»Und jetzt?«, fragte er. Ed schluckte hinunter und wischte ein paar Krümel aus seinem Mundwinkel.
»Jetzt bin ich hier.«
Melzick wälzte sich auf die andere Seite und landete mit ihrer Nase an der Wand, die nach frischer Farbe roch. Es war kurz nach sieben. Das wusste sie, ohne die Augen zu öffnen. Sie hatte den Schuss gehört. Natürlich war es kein Schuss. Wie jeden Morgen um dieselbe Zeit hatte Frau Stalinke aus dem Erdgeschoss das Haus verlassen, um mit ihrem selbst gestrickten Kampfdackel das zu machen, was normale Hundebesitzer als „Gassi gehen“ bezeichnen. Frau Stalinke fasste diese Tätigkeit eher militärisch auf: Sie ging auf Patrouille, nicht ohne zuvor die Tür zum Treppenhaus einer Belastungsprobe zu unterziehen. Melzick hatte sich schon oft gefragt, woher diese Frau mit ihren dünnen Ärmchen die Wucht nahm, das ganze Haus erzittern zu lassen. Sie vermutete eine bisher unbekannte asiatische Kampfkunst. Die frische Farbe roch angenehm. Melzick nahm einen tiefen Zug durch die Nase und wusste im selben Augenblick, dass an Schlaf nicht mehr zu denken war. Wie zur Bestätigung meldete sich ihr Handy. Auf ihr verschlafenes »Ja?« meldete sich Zacharias.
»Morgen Mel. Heute geht’s rund. Bist du dabei?«
»Wobei?«, antwortete sie umrahmt von einem herzhaften Gähnen.
»Ach Schwesterchen! Ich hab dir doch den Link geschickt. Die Demo in Augsburg.« Melzick kratzte sich an der Nase, während sie in ihrem Gedächtnis kramte.
»Was für’n Link? Welche Demo? Wer spricht da überhaupt?« Zacharias wollte schon empört loslegen. Im letzten Moment ging ihm ein Licht auf.
»Keine Chance, Mel. Wenn du mich reinlegen willst, musst du früher aufstehen.«
»Will niemand reinlegen, kleiner Bruder, will einfach nur liegenbleiben«, nuschelte Melzick und drehte sich auf den Rücken.
»Hätte ich mir denken können«, sagte Zacharias mit vollem Mund und legte noch eins drauf. »Kommst eben jetzt auch schon ins Ego-Alter.« Er schmatzte genüsslich. »Fängt bei den meisten ab dreißig an, bist wohl etwas früher dran.« Melzick setzte sich abrupt in ihrem Bett auf und blinzelte den letzten Rest Schlaf weg.
»Deine Provokationen waren auch schon mal cooler, Zack.«
»Da gehen die Expertenmeinungen auseinander.« Zacharias hatte den Mund schon wieder voll.
»Was kaust du mir da eigentlich andauernd vor?«
»Etwas, worüber die Experten sich einig sind.«
»Und das wäre?«
»Meine Mango-Maccadamia-Muffins.«
»Ok ok, Zack, heb mir welche auf.«
»Sind schon eingepackt. Wir treffen uns am Bahnhof. Vergiss dein Transparent nicht.«
»Was für’n Transparent denn?«
»„Freiheit für Gluten“«, »„Nieder mit den freien Radikalen“«, was man eben so fordern darf als Polizeibeamtin.«
»Ich denk das ist ’ne Klima-Demo.«
»Na dann eben: „Inlandsflüge nur für Bienen“.«
»Das ist mir zu lang.« Zacharias ließ einen Stoßseufzer hören.
»Forget it. Hauptsache du machst mit.«
»Was ist mit deiner Freundin Jocelyn?«
»Was soll mit ihr sein?«
»Könnte riskant sein, als Illegale bei einer Demonstration erwischt zu werden.«
»Mel, es gibt keine illegalen Menschen.«
»Du weißt, wie ichs meine.«
»Weiß ich und Jocelyn weiß, was sie tut.«
»Na dann — man sieht sich.« Zacharias wollte noch etwas sagen, überlegte es sich anders und legte auf. Melzick musste dran denken, wie Zacharias ihr die junge Frau aus Äthiopien vor ein paar Wochen vorgestellt hatte. Sie beschloss, sich bei Gelegenheit um eine Rechtsberatung zu kümmern. Zacharias war ein unverbesserlicher Optimist. Seine rosarote Brille war zu oft beschlagen. Er weigerte sich einfach, Schwierigkeiten wahrzunehmen, bevor sie ihm im Genick saßen.
»Dafür hat er ja mich«, dachte Melzick, seufzte und sprang aus dem Bett.
2. Kapitel
Zweifel wollte sich auf nichts einlassen. Sein Vater hatte das Marmeladenglas in beide Hände genommen und drehte es hin und her.
»Eine Vater-Sohn-WG wär doch mal was anderes«, brummte er. »Ed hat da überhaupt kein Problem damit. Wichtig ist ’ne klare Aufgabenverteilung. Du gehst zur Arbeit, um den Rest kümmert sich Ed. Das ist er gewohnt.« Zweifel nahm ihm die Erdbeermarmelade aus der Hand und stellte das Glas demonstrativ in den Kühlschrank.
»Du fällst nicht mit der Tür ins Haus, du bretterst mit ’nem LKW in meine Küche. So funktioniert das nicht.«
»Käme auf einen Versuch an. Und was den LKW angeht — das bisschen Zeug, was Ed hat, passt in einen VW Käfer.« Ed fischte ein Zuckertütchen aus der Schale, riss eine Ecke ab und beglückte den Orangensaft mit einer weiteren Überdosis. Zweifel beobachtete irritiert, wie sein Vater das Glas mit der linken Hand drehte und suchte nach Worten.
»Es geht nicht. Ich will es nicht. Such dir bitte ein anderes Nest.«
»Machst du dir Sorgen um deinen Zuckervorrat?«
»Ich mach mir keine Sorgen. Ich ziehe um.« Eds rechte Hand verharrte mit dem inzwischen leeren Zuckertütchen zwischen Daumen und Zeigefinger über dem Orangensaft.
»Wohin?«, fragte er, ohne seinen Sohn anzusehen.
»Nach Friedberg.«
»Welches Friedberg?«
»Bei Augsburg.«
»Wann?«
»Ich bin mittendrin.«
»Sieht gar nicht so aus.« Zweifel seufzte.
»Liegt vielleicht daran, dass mein Zeug auch in einen VW Käfer passt.«
»Hast du einen?«
»Was?«
»VW Käfer.«
»Nein.«
»Sondern?« Zweifel stieß noch einen tiefen Seufzer aus.
»Cadillac Eldorado 1959.« Sein Vater warf ihm einen kurzen Blick zu und knüllte das Papiertütchen zusammen.
»Viel zu schade für die Straße«, meinte er.
»Das sehe ich anders. Ich sehe überhaupt vieles anders, als du, Dad, und deswegen würde es nicht funktionieren.« Ed warf ihm einen langen Blick zu.
»Das sehe ich anders.« Unwillkürlich mussten beide lächeln.
»Hört sich besser an, wenn du nicht in der dritten Person von dir redest«, sagte Zweifel und stellte die Margarine in den Kühlschrank. Sein Vater ließ sich von dem Frühstücks-Barhocker rutschen und hob einen Zeigefinger.
»Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst.« Er machte ein paar Schritte zur Tür hin, dann drehte er sich um. Seine grünen Augen musterten Zweifel.
»Nach Eds Erfahrung gibt es drei triftige Gründe für einen Umzug: Du brauchst einen neuen Chef, du bist einer Frau auf der Spur oder du hast was ausgefressen.« Zweifel verschränkte die Arme.
»Du hast einen Grund vergessen.«
»Und der wäre?«
»Flucht.«
»Bist du auf der Flucht?«
»Ich nicht, aber ich bin jetzt mal von dir ausgegangen.« Edwin Zweifel kam wieder zurück und stellte sich direkt vor seinen Sohn hin.
»Wenn du glaubst, dass ich damals vor irgendwas geflohen bin, dann …« Er stockte, verlor die Konzentration. Er schloss die Augen und presste Daumen und Zeigefinger an seine Nasenwurzel. Als er den Satz beendete, war seine Stimme deutlich leiser geworden.
»… dann hast du vermutlich Recht. Aber«, und wieder der Zeigefinger, »nur aus deiner Sicht. Für Ed war das keine Flucht. Wovor hätte er auch fliehen sollen?«
»Vor mir.« Die Worte waren draußen, bevor Zweifel einen Gedanken fassen konnte.
»Du weißt, dass das Blödsinn ist.«
»Damals wusste ich es nicht. Mutter war tot und du bist drei Tage nach der Beerdigung verschwunden.«
»Du warst alt genug und Ed hat jeden Monat einen Scheck …« Zweifel winkte ab.
»Ich weiß, ich weiß.« Er seufzte zum dritten Mal an diesem Morgen. »Warum das alles wieder aufwärmen?«
»Ed hat nicht davon angefangen.«
»Wenn man davon absieht, dass du dein Comeback in meiner Küche probst.«
»Das hielt Ed für am effektivsten.« Zweifel ließ seine flache Hand auf die Küchentheke fallen. Das Problemlösungs-räderwerk in seinem Kopf hatte bereits zu rattern begonnen. Er hatte jedoch keine Lust, die Probleme seines Vaters zu lösen.
»Effektiv vielleicht, was den Zuckerverbrauch angeht, aber nicht erfolgreich, Dad. Ich kann dir nicht helfen. Meine neue Wohnung ist nicht groß genug.«
»Das hat Ed schon begriffen. Du willst nicht. Trotzdem wäre es interessant, zu erfahren, warum dieser Ortswechsel …« Zweifel unterbrach ihn.
»Das überlass ich deiner Fantasie. Ein paar Gründe sind ja schon gefallen. Such dir einen aus.« Edwin Zweifel fuhr mit beiden Händen durch seinen wirren weißen Haarschopf, dann schnalzte er mit der Zunge und wandte sich erneut zum Gehen.
»Falls du Hilfe brauchst«, sagte er, schon im Flur mit der Hand auf der Klinke und ohne seinen Sohn anzusehen, »wird Ed dich schon finden.« Er öffnete die Eingangstür, trat ins Treppenhaus und zog sie hinter sich zu. Zweifel starrte in den Flur, der so leer war wie immer und ertappte sich bei dem Gedanken, dass Ed das gelingen möge. Als er eine halbe Stunde später seine Wohnung verließ, entdeckte er die Visitenkarte auf der Matte vor der Eingangstür. „Ed Z.“ stand darauf, „Überlebenskünstler“. Handschriftlich war eine Mobilfunknummer ergänzt.
Jocelyn sah Melzick als erste und winkte ihr mit einem zusammengerollten Transparent durch die offene Tür zu. In den beiden Großraum-Waggons des 9 Uhr 30-Zuges der Bayerischen Regio-Bahn von Bad Wörishofen nach Augsburg herrschte ein Gedränge wie in einem Airbus, nachdem der Pilot die Turbinen abgeschaltet und die Passagiere gebeten hat, sitzenzubleiben. Etwa zehn bis fünfzehn Senioren, allesamt im neonfarbenen Radler-Dress bewachten mit grimmigen Blicken die E-Mountainbikes, mit denen sie eine Expedition ins Altmühltal wagen wollten. Der Anführer, der als einziger seinen Fahrradhelm aufbehalten hatte, erteilte seinem Trupp lautstarke Instruktionen. Keiner hörte ihm zu, außer den Fahrgästen, die die Gefahr zu spät erkannt hatten und aus Platzmangel gezwungen waren, in seiner Hörweite für die nächste Stunde sitzenzubleiben. Zacharias hatte den Wichtigtuer rechtzeitig bemerkt und mit Jocelyn einen Platz im vorderen Waggon ergattert. Melzick schloss ihr klappriges Dreigangrad ab und hastete den Bahnsteig entlang. Ein nerviges unerbittliches Piepen zeigte an, dass es höchste Zeit war. Zacharias blockierte wie zufällig die Lichtschranke der automatischen Tür. Mit dem letzten Piepton sprang Melzick auf.
»Zurückbleiben! Zefix!«, fauchte die Stimme des Zugführers aus dem Lautsprecher über ihnen. Zacharias grinste seine Schwester an und hob die Hand. Melzick schlug klatschend ein und nickte Jocelyn zu, die sie auf ihre scheue Art anlächelte.
»Jetzt nehmen Sie doch mal das Gelump aus meinem Gesicht!«, keifte eine Frauenstimme hinter dem Rücken der jungen Afrikanerin. Jocelyn versuchte, das Transparent auf der Gepäckablage unterzubringen. Zacharias half ihr dabei und murmelte eine Entschuldigung in Richtung der etwa fünfzigjährigen, korpulenten Frau im hellblauen Kostüm, die den sorgfältig frisierten Kopf schüttelte.
»Dürfen die überhaupt mit dem Zug fahren?«, war dumpf eine zweite Stimme zu hören. Die Nägel der vorgehaltenen Hand waren korallenrot lackiert, passend zur lila überhauchten Kurzhaarfrisur der Fragestellerin.
»Ich dachte, die dürfen ihren festen Bereich, also ihr Reservat oder wie man das nennt, nicht so einfach verlassen«, schob sie hinterher.
»Die Frage ist doch, wer denen die Fahrkarte zahlt«, mischte sich ein blasser, hochgewachsener junger Mann im enggeschnittenen silbergrau glänzenden Anzug ein. Sein Adamsapfel kämpfte gegen den straffgezogenen Knoten seiner schmalen Krawatte. Melzick wechselte einen Blick mit Zacharias und berührte Jocelyn leicht am Unterarm. Am besten ignorieren, war die Devise.
»Ich geb euch bis Buchloe Zeit«, dachte Melzick jedoch für sich. »Bis dahin dürft ihr euch auskotzen, von mir aus. Wer uns danach noch mit einer derartigen Wortmeldung beglückt, wird eine Bewusstseinserweiterung erleben.« Zacharias lehnte wegen der Enge lässig mit einer Schulter an der automatischen Tür. Jocelyn neben ihm wirkte so, als wollte sie sich unsichtbar machen. Melzick fragte sich nicht zum ersten Mal, ob es eine gute Idee von Zacks Freundin war, an der Demo teilzunehmen. Sie musterte stirnrunzelnd ihren Bruder, der sich in seinen ausgebeulten Jogginghosen, dem Schlabbershirt und den viel zu großen Sneakers sichtlich wohl zu fühlen schien.
»Guck nicht so«, sagte er, »das sind meine besten Klamotten.«
»Schon klar. Wie viele Leutchen werden wir denn sein?«, fragte sie. Zacharias zog die Nase kraus.
»Also, angemeldet sind 2000, aber Phil rechnet mit fast 5000. Aus Berlin, Köln und Hamburg haben sich große Gruppen angesagt.«
»Phil ist wer nochmal?«
»Der hat die Demo initiiert und organisiert. Du hast ja keinen Schimmer, was für’n Aufwand das ist.«
»Doch, hab ich.« Zacharias verdrehte die Augen.
»Schwesterchen, du kennst doch nur die andere Seite.«
»Ich war mal in München dabei. 30000 Leute, Marienplatz, fünfunddreißig Grad in der Sonne. Ich weiß, wie so was abläuft.«
»Ach ja? Wie viele ›Begleiter‹ waren denn da?« Zacharias sprach die Anführungszeichen mit. Melzick zuckte mit den Schultern.
»Werden wohl so um die 800 Kollegen gewesen sein.«
»Und was, glaubst du, lässt sich leichter organisieren?« Bevor Melzick antworten konnte, meldete sich der blasse Anzugträger zu Wort, der direkt hinter ihr stand.
»Ich hab gelesen, dass diese Demonstrationen«, er sprach dieses Wort in Großbuchstaben, »den Steuerzahler jedes Jahr Millionen kosten. Millionen!« Die korpulente Dame in hellblau fühlte sich angesprochen.
»Es ist einfach unglaublich. Was gibt es denn überhaupt zu demonstrieren? Hier in Deutschland?«
»Nächster Halt Buchloe. Bitte in Fahrtrichtung rrrächts aussteigen«, mischte sich der Zugführer zackig ein.
»Und dann kommen welche von sonst woher und machen ihren grässlichen Zinnober hier bei uns. Zuhause, da wo sie hingehören, würden sie dafür ausgepeitscht«, meinte die Frau mit den grellroten Fingernägeln. Jocelyn wusste nicht, wo sie hinschauen sollte. Ihre Gesichtsfarbe war noch einen Hauch dunkler geworden. Zacharias holte tief Luft. Melzick stupste ihn an und schüttelte den Kopf. Der Zug hielt. Es stiegen nur wenige Fahrgäste aus. Aus dem hinteren Waggon waren empörte Stimmen zu hören. Die Mountainbike-Schwadron kam mit einer Gruppe rüstiger Wanderer, jeder mit einem Survival-Paket von der Größe eines Seesacks auf dem Rücken, ins Gehege. Die Woche über wurden die Egos gehätschelt und gepflegt, um an Samstagvormittagen in den Zügen der DB aufeinander zu prallen. Die Stimmung heizte sich auf. Melzick wartete auf die nächste Durchsage.
»Zurrrückbleiben«, blökte der Zugführer. Der Zug nahm Fahrt auf und verließ den Bahnhof Buchloe.
»Man kann überhaupt nicht mehr ungestört einkaufen«, beschwerte sich die Dame in hellblau. »Ständig diese plärrenden Jugendlichen mitten in der Innenstadt zur Hauptgeschäftszeit.« Längst nicht mehr hinter vorgehaltener Hand gab die andere Diskussionsteilnehmerin ihren scharfen Senf dazu.
»Kein Deutsch können, aber dämliche Parolen grölen.«
»Wissen Sie, was das die deutsche Wirtschaft kostet?«, maulte der Anzugträger und zerrte an seiner Krawatte. Der Zug machte einige ruckartige Seitwärtsbewegungen, bis er im richtigen Gleis nach Augsburg war. Die Frau in hellblau verlor den Halt und rempelte Jocelyn an. Zacharias runzelte die Stirn. Obwohl die Kostümträgerin sich nicht entschuldigt hatte, drehte sich Jocelyn zu ihr um und sagte in akzentfreiem Deutsch:
»Das macht doch nichts.« Es war einer der ersten Sätze, die sie gelernt hatte. Sie eignete sich die deutsche Sprache in ganzen Sätzen an. Zacharias brachte sie ihr bei. Sie hatte ein gutes Ohr und schaffte es spielend, jeglichen fremdartigen Tonfall zu vermeiden. Sie klang wie jemand, der nie etwas anderes als glasklares Hochdeutsch gesprochen hatte. Zacharias reagierte sofort.
»Hast du gewusst«, sagte er unüberhörbar für die Umstehenden, »dass fünfundachtig Prozent der Deutschen es nicht für nötig halten, sich zu entschuldigen, wenn sie jemanden anrempeln?« Melzick unterdrückte ein Grinsen und nickte.
»Hab ich auch gelesen. In Bayern sollen es sogar fünfundneunzig Prozent sein. Ist ’ne ganz neue Studie.« Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie die Frau hinter Jocelyn rot anlief.
»Ja ja«, seufzte Melzick, »ist ’ne traurige Sache mit der Unhöflichkeit der Deutschen. So was ist in anderen Ländern einfach undenkbar.«
»Man sollte die Leute eigentlich davor warnen«, pflichtete Zacharias bei.
»Oh, das steht schon in vielen Reiseführern«, sagte Melzick. »Das wird die Touristen ganz schön abschrecken.« Zacharias schnalzte mit der Zunge.
»Gar nicht auszudenken, wie sich das auf die deutsche Wirtschaft auswirkt. Was meinen Sie?« Er hatte den blassen Anzugträger direkt angesprochen. Der rümpfte angewidert die Nase und blickte demonstrativ gelangweilt an Zacharias vorbei. Sein Adamsapfel machte dabei allerdings ein paar heftige Klimmzüge. Der Zug näherte sich seiner Höchstgeschwindigkeit. Die Klimaanlage war im Urlaub. Die Vormittagssonne brannte durch die großen Panoramascheiben.
»Hat jemand ’ne Ahnung, woher das Wort Arroganz kommt?«, fragte Zacharias in die Runde. Melzick hüstelte vornehm.
»Jo. Das wurde im 18. Jahrhundert aus dem Französischen entlehnt. Arrogant« (sie sprach es genüsslich gedehnt aus) »hat damals auch hochnäsig bedeutet, wird aber heutzutage mehr im Sinne von eingebildet verwendet«. Auf der Stirn des Schlipsträgers machte sich eine Zornesfalte bemerkbar, umrahmt von winzigen Schweißtröpfchen.
»Ursprünglich geht es auf das lateinische „arrogans“ gleich anmaßend zurück«, fügte Melzick strahlend hinzu.
»Anscheinend gab es schon damals Zeitgenossen, die dieses Attribut verdienten«, sinnierte Zacharias. Melzick bemerkte, wie ruhig es plötzlich um sie herum geworden war. Sie fing ein scheues Lächeln von Jocelyn auf und ein freches Grinsen von Zacharias, der noch nicht genug hatte.
»Wie ist es mit borniert? Hört sich auch irgendwie französisch an.«
»Jep«, sagte Melzick. »Kommt von borne, der Grenzstein. Bedeutet engstirnig.« Sie sprach das Wort laut und deutlich aus mit unmittelbarer Wirkung auf einige in der Nähe befindliche Stirnen.
»Ja, dann fehlt eigentlich nur noch ignorant«, verkündete Zack fröhlich. Melzick nickte und wirbelte ihre hennaroten Dreadlocks durcheinander.
»Das ist ein besonders schönes Wort. Diesmal wieder aus dem Lateinischen.«
»Und bedeutet?«, fragte Zacharias.
»Ja, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen: von tadelnswerter Unwissenheit zeugend.« Zacharias hob eine Hand und Melzick schlug ein.
»Hätte ich nicht besser formulieren können«, meinte Zacharias und blickte freundlich in die Runde. Hinter Jocelyns Rücken war ein undefinierbares Zischen zu hören. Die Dame in hellblau flüsterte ihrer Begleiterin mit den korallenroten Fingernägeln ein paar deutsche Worte ins von goldenen Klunkern bewachte Ohr. Der junge Mann im engen Designer-Anzug war zwischen ignorieren und reagieren hin- und hergerissen. Die schmale Krawatte bewahrte seinen Kragen nur mühsam vorm Platzen. Als die allerseits erleichtert aufgenommene Durchsage:
»Nächster Halt Augsburg Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung lllinks«, ertönte, beugte er sich zu Zacharias herab.
»Für einen Hartz-IV-Schmarotzer reißt du dein Mäulchen ganz schön weit auf«, raunte er ihm zu. Zacharias schenkte ihm sein unverschämtestes Grinsen.
»Als selbständiger Unternehmer bin ich es gewohnt, Menschen sicher einzuschätzen, was ihre Fähigkeiten angeht. Ihre schmale Krawatte deutet da auf eine eher enge Bandbreite hin. Sie sollten außerdem an Ihren Vorurteilen arbeiten. Die sind irgendwie noch nicht ausgereift. Ich würde Ihnen ja gerne näher erläutern, wie das geht, aber ich fürchte, ich habe jetzt was Besseres vor. Es gibt da aber sicher einen auch für Sie erschwinglichen VHS-Kurs.« Melzick hatte ihrem Bruder staunend zugehört, während sie das Transparent aus der Gepäckablage fischte. Der Zug hielt mit einem kräftigen Ruck, so als ob der Zugführer seinen Fahrgästen einen Schlag ins Genick mit auf den Weg geben wollte. Jocelyn drückte auf den grün leuchtenden Taster und war als Erste auf dem Bahnsteig. Melzick und Zacharias folgten ihr. An der Treppe warteten sie, bis sämtliche Fahrgäste an ihnen vorbei waren. Einige nickten ihnen zu. Ein schmalbrüstiger Herr mit abgewetzter Aktentasche, Typ Oberstudienrat, zwinkerte sogar in ihre Richtung. Die beiden pastellfarbenen Damen hatten es auffallend eilig, an ihnen vorbeizukommen. Von dem jungen Anzugträger war nichts zu sehen.
»Wahrscheinlich hat er sich aufs Klo verzogen und googelt den Unterschied zwischen impertinent und inkontinent«, meinte Zacharias.
»Seit wann hast du denn diesen Geschäftsführerton drauf?«
Zacharias zwinkerte Jocelyn zu.
»Wir arbeiten viel daran«, meinte sie, ein weiterer Satz aus ihrem Repertoire. Melzick legte beiden eine Hand auf die Schulter, wobei ihr das Transparent herunterfiel.
»Ich bin schwer beeindruckt.« Zacharias bückte sich und hob es auf.
»Das lässt sich noch steigern, Mel, wait and see.« Sie gingen langsam die Treppe hinunter, um zum südöstlichen Ausgang zu gelangen.
»Sind wir nicht ein bisschen früh dran?«, fragte Melzick.
»Was hast du denn gefrühstückt?«
»’Ne halbe Grapefruit.«
»Dacht ich mir. Deswegen gehen wir jetzt zum Brunchen ins „Dreizehn“.
»Ins „Dreizehn“?«
»Genau. Bei der Kresslesmühle. Das beste vegane Restaurant Downtown. Wir sind bei der Demo locker drei Stunden auf den Beinen. Da brauchst du ordentlich Power. Da reicht dein Pampelmüschen nicht.«
»Schon gut, du hast mich überredet.« Sie drehte sich zu Jocelyn um, die versuchte, mit den beiden Schritt zu halten.
»Und du verrätst mir, wie du so schnell Deutsch gelernt hast.« Jocelyn warf Zack einen fragenden Blick zu. Der gab ihr ein Zeichen.
»Die deutsche Sprache ist ein wunderbarer Wald, aber ich kenne erst ein paar Bäume.« Melzick blieb vor Staunen der Mund offen stehen.
»Aha.« Zacharias schaute angestrengt zur Seite, aber er wusste in diesem Moment, dass seine Schwester ihn zu diesem Thema bei Gelegenheit nochmal interviewen würde.
3. Kapitel
In der Annastraße war um diese frühe Stunde noch nicht viel los. Die meisten Läden öffneten erst um zehn. Carlo war das egal. Er bezog seinen Stammplatz in der Fußgängerzone, schräg gegenüber vom „Weißen Hasen“. Sokrates begleitete ihn mit der ganzen Gelassenheit seiner elf Hundejahre. Seine Miene strahlte Zufriedenheit aus. Das machte die Routine. Sein Leben verlief in geregelten Bahnen, genauso wie das seines Herrchens. Carlo setzte sich auf den Boden, lehnte den Rücken an die Fassade des Drogeriemarktes und streckte seine kurzen Beine auf einer Decke aus. Sie war grün und blau und gelb gemustert und glich mit ihren nach oben abgewinkelten Fransen einem fliegenden Teppich in Warteposition. Carlo legte das Etui mit seiner uralten Blockflöte sorgfältig rechts neben sich. Die schwarze, mit einem Schnappschloss versehene Holzschatulle stellte er offen ganz vorne auf den Teppich. Sokrates drehte sich, behutsam wie eine Katze mit den Pfoten tapsend, ein paar Mal um sich selbst, bevor er sich auf seinem angestammten Platz neben der Schatulle niederließ. Er legte seinen Kopf vorsichtig auf seine alten Pfoten. Jedes Mal, wenn eine Münze auf Holz klapperte oder gar ein Geldschein raschelte würde er einen prüfenden Blick in die Schatulle werfen, so als wollte er im Kopf überschlagen, wieviel sie denn schon verdient hatten. Seiner Hundeerfahrung nach kam das beim Publikum besonders gut an. Die Art und Weise, wie die beiden ihren Arbeitstag in aller Ruhe vorbereiteten, strahlte eine große Souveränität und Weisheit aus. Sie beherrschten ihr Metier und wussten, was zu tun war. Vor allem wussten sie, warum sie es taten.
»Guten Morgen, Carlo, du bist aber früh dran«, sagte die junge Frau, die in dem Esprit-Laden gleich gegenüber arbeitete. Carlo nickte ihr freundlich zu.
»Alte Gewohnheit. Ich war immer schon der Erste im Büro«, sagte er. Sie beugte sich zu dem schwarz-weißen Border-Collie herab und kraulte ihn sanft hinter den Ohren.
»Und was meint Sokrates dazu?« Sokrates blinzelte mit den Augen und gähnte ausführlich.
»Er nutzt die Zeit zum Nachdenken. Eine durchaus edle Art, den Tag zu beginnen«, antwortete Carlo. Die junge Frau, deren Namen er nicht kannte und die ihn seit einem halben Jahr jeden Samstagmorgen begrüßte, schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, sagte »na dann«, und entfernte sich mit federnden Schritten in Richtung Personaleingang. Carlo kramte seine verbeulte Thermoskanne aus dem speckigen Rucksack, schraubte den Deckel ab und gönnte sich die erste Tasse des Tages. Sokrates schnüffelte flüchtig in seine Richtung, erkannte den vertrauten Kaffeeduft und nahm seine Denkerposition wieder ein. Carlo trank in kleinen Schlucken und hielt den Kopf dabei gesenkt. Aus den Augenwinkeln beobachtete er eine Person in einem blauen Handwerkeroverall, eine Baseballmütze tief ins Gesicht gezogen, die vor der Seitentür zum „Weißen Hasen“ stehengeblieben war. Ein Trio älterer Damen mit großen Einkaufstaschen trippelte auf dem Weg zum Stadtmarkt einträchtig schnatternd an ihm vorüber. Sie hatten keinen Blick für ihn, geschweige denn einen Euro. Carlo sah es ihnen nach. Er leerte seinen Kaffeebecher und wischte ihn mit einem Taschentuch sauber, bevor er ihn wieder aufschraubte. Dabei murmelte er wie stets dieselben Worte:
»Der Kaffee ist genau richtig. Wir haben unseren besten Platz bezogen. Heute wird ein guter Tag.« Sokrates nahm das vertraute Gemurmel als Beweis, dass alles wie immer war. Zufrieden blinzelnd schloss er die Augen. Doch etwas war anders. Carlo war ein geübter Beobachter. Er tat fast nichts anderes. Diese Person vor der Seitentür des „Weißen Hasen“ benahm sich absolut unauffällig. Der Handwerkeroverall, die Werkzeugtasche, die verdreckten Sicherheitsschuhe — nichts daran war ungewöhnlich. Carlo hatte den Typen aus der Richtung des Rathausplatzes kommen sehen.
»Freiwillige Überstunden am Wochenende«, dachte er, »wahrscheinlich inoffiziell, das bringt am meisten Kohle.« Allerdings konnte er sich nicht erinnern, samstags jemanden in dem maroden Gebäude arbeiten gesehen zu haben. Carlo nickte abwechselnd vor sich hin und schüttelte den Kopf, während er seine Visitenkarten sortierte. Der Typ im Overall mit der schwarzen Baseballmütze stellte seine Werkzeugtasche auf das Pflaster und machte sich am Vorhängeschloss des Bauzauns zu schaffen. Als Carlo wenig später hinübersah, waren die Tasche und der Typ verschwunden und das Schloss hing wie vorher am Bauzaun. Irgendetwas hatte Carlo trotzdem stutzig gemacht. Viel später an diesem Tag würde es ihm wieder einfallen.
Das Haus in der Annastraße, Ecke Welserplatz, mitten in der Fußgängerzone, war der ideale Ort für das Vorhaben. Seit dem Brand im Februar des vorigen Jahres stand der „Weiße Hase“ leer. Die Restaurierungsarbeiten an dem zweistöckigen, historischen Gebäude mit dem riesigen Satteldach würden noch Jahre in Anspruch nehmen. Von den Fenstern im ersten Stock konnte man die Annastraße in beide Richtungen überblicken. Die Stangen und Bretter des Baugerüstes schützten vor unliebsamer Entdeckung. Samstags hielt sich niemand in dem Gebäude auf. Wer es ohne aufzufallen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten betreten wollte, musste authentisch wirken und für alle Fälle eine plausible Story auf Lager haben. Es war fast ein Kinderspiel, in das Haus reinzukommen und es war niemand dagewesen, der sich hätte wundern können. Die Leute, die um diese Uhrzeit in der Fußgängerzone unterwegs waren, wollten entweder zum Bäcker, zum Stadtmarkt oder zum Königsplatz, wo sich Busse und Straßenbahnen drängelten. Sie alle hatten ein Ziel und keine Augen für irgendetwas anderes. Selbst der Bettler mit seinem Köter hatte keinen Blick verschwendet. Er war viel zu sehr mit seiner Thermosflasche beschäftigt, die hundertprozentig mit Hochprozentigem gefüllt war. — Falscher Gedanke! Das war möglicherweise ein Irrtum. Vielleicht hatte er scharfe Augen, eine Kamera und war ein gut getarnter Polizist. — Auch falsch! Jetzt bloß keine Gespenster sehen am helllichten Tag. Es war düster genug in diesem alten Bau. Er war vollkommen leergeräumt. Absolut nichts erinnerte daran, dass hier einmal ein traditionell bayerisches Wirtshaus residiert hatte. Es roch nach Kalk und Staub und irgendeiner chemischen Substanz. Auf die Wände waren pinkfarbene Markierungen und Zahlen gesprüht. Architekten-Graffiti. Die Treppe machte einen stabilen Eindruck. Der erste Stock bestand aus einem einzigen riesigen Raum. Durch die verdreckten und teilweise beklebten Fenster drang spärliches Morgenlicht. Die ungewohnten Arbeitshandschuhe ließen die Finger feucht werden. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Also weg damit. In der Tasche waren sie am besten aufgehoben und konnten nicht vergessen werden. Die Schritte der zwei Nummern zu großen Sicherheitsschuhe hallten unangenehm laut. Es war nicht einfach gewesen, geräuschlos bis zur Fensterfront zu kommen. Aber dann gewann folgende Überlegung die Oberhand: Entweder befand sich niemand sonst im Gebäude, was zu 99% wahrscheinlich war, dann war Leisetreterei überflüssig. Wenn aber jemand da war, dann würde das vorsichtige Herumschleichen nicht zu der Aufmachung als Handwerker passen. Und erst recht nicht zu der Story von der liegengelassenen, mit Bargeld, EC-Karte und Eintrittskarten gefüllten Brieftasche. Wer angeblich auf der Suche nach einem solchen verlorenen Schatz ist, der läuft ohne groß zu überlegen kreuz und quer durch alle Räume und poltert die Treppe hinauf und hinunter. Genau! Das war der richtige Weg. Also erstmal die Treppe hoch in den zweiten Stock. Hier war das Licht noch diffuser, da praktisch alle Fensterscheiben zugeklebt waren. Die Räume waren ebenfalls leer. Auf den mit Kalk bestäubten Bodenbrettern ein paar Spuren von Katzenpfoten, die mitten im Raum aufhörten, als hätte die Katze sich in Luft aufgelöst. Innehalten. Konzentrieren. Lauschen. Die Werkzeugtasche in die andere Hand nehmen. Weiter, die schmaler werdende Treppe hinauf zum Dachgeschoss. Die Sicherheitsschuhe polterten schwer auf den Holzstufen. Spätestens jetzt hätte sich ein zufälliger Besucher bemerkbar gemacht, sei es der Architekt oder jemand vom Bauamt oder ein Techniker oder ein Hausmeister, hätte „Hallo“ gerufen, wäre ebenfalls die Treppe hochgekommen, um zu sehen, wer an einem Samstagmorgen in diesem riesigen Gebäude herumgeisterte. Aber da war niemand, auch nicht in dem Dachgeschoss. So viel war sicher. Ein Blick auf die Uhr. Der Countdown konnte beginnen. In etwa vier Stunden würde es in der Annastraße in Höhe des Welserplatzes sehr laut werden. Tausende würden ihre Wut und ihre Empörung herausschreien. Würden den Leuten, die brav ihre Konsumaufgaben erledigen wollten, im Weg stehen, sie ärgern, aufrütteln, verstören. Sie fühlten sich alle im Recht. Und einer davon fühlte sich besonders im Recht. Er stand besonders im Weg. In der Werkzeugtasche lag die Lösung für dieses Problem bereit.
Der samstägliche Brunch im „Dreizehn“ war sehr beliebt. Das vegane Restaurant im Herzen der Altstadt boomte praktisch seit seiner Eröffnung. Die beiden jungen Betreiberinnen verwöhnten die Geschmacksnerven ihrer Gäste ebenso zuverlässig wie preiswert. Für 13 Euro konnte man sich am Buffet die Teller füllen, so oft man wollte.
»Habt ihr reserviert?«, fragte die eine der beiden Zacharias, nachdem der sich erfolgreich bis zur Kassentheke vorgedrängelt hatte. Rings um ihn standen Hungrige jeder Altersgruppe mit einem Teller in der Hand und einer Mischung aus Gier und Vorfreude in den Augen. Aus Platzmangel spielte sich der Kampf am kalten Buffet in der Nähe des Eingangs auf ein paar Quadratmetern ab. Zacharias setzte ein entwaffnendes Lächeln auf.
»Reservieren ist doch was für Spießer. Ist ja genauso, wie sein Handtuch an den Pool legen, bevor die Sonne aufgeht.« Sie schnalzte mit der Zunge und verdrehte kurz die Augen.
»Tja — dann seht mal zu, ob die Spießer für euch noch einen Platz freimachen.«
»Zack, trödele nicht rum und steh den Leuten nicht im Weg«, sagte eine tiefe Männerstimme direkt neben seinem Ohr. Zacharias fuhr herum.
»Phil! Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist am Hauptbahnhof und flüsterst den Teilnehmern deine Regeln ins Ohr.« Phil war einen Kopf größer als Zacharias, bezeichnete das schüchterne blonde Kraut auf seinen Wangen als Backenbart und trug wie immer ein bunt gemustertes Stirnband.
»Hombre! Erstens sind das nicht meine Regeln, sondern die der Polizei. Zweitens muss ich ja nicht alles selbst machen. Delegieren ist eine Kunst und die musst du beherrschen, wenn du ein großes Ding durchziehen willst. Und drittens hab ich wie jeder vernünftige Spießer rechtzeitig einen Tisch reserviert.« Phil nickte mit dem Kopf in Richtung des Nebenraumes, links von der Küche. Zacharias wurde von einem breitschultrigen, braungebrannten Jüngling unsanft zur Seite geschoben. Bevor Zacharias mosern konnte, fragte Phil:
»Du bist doch sicher nicht allein hier?« Zacharias war kurz davor, dem Jüngling seinen Ellbogen in die Seite zu rammen, besann sich aber eines Besseren und hob stattdessen seine Hand mit drei Fingern.
»Dann geht doch einfach mal ganz unauffällig zu meinem Tisch«, sagte Phil und schaffte es gleichzeitig, seinen rechten Stiefel wie zufällig auf einem Flipflop-bewehrten Fuß zu platzieren, der wie zufällig dem Jüngling gehörte.
»Ich geb dir ein Zeichen, wenn die Luft hier rein ist«, fügte Phil hinzu. Zacharias lotste Mel und Jocelyn, die draußen gewartet hatten, herein. Er hörte Phils tiefe Stimme, die sich so überschwänglich bei dem Jüngling entschuldigte, dass aus den breiten, braungebrannten Schultern die Luft entwich wie aus einem kaputten Schwimmreifen. Nach ein paar Minuten kam Phil mit zwei Tellern in jeder Hand an seinen Tisch.
»Ich denke, gegen Obst als Auftakt ist nichts einzuwenden.« Er stellte Melzick, Jocelyn und Zacharias einen Teller hin und ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Aus der Brusttasche seiner Latzhose zauberte er vier Gabeln hervor und hielt sie in seiner kräftigen Faust über den Tellern.
»Erst der Name dann die Gabel«, grinste er in die Runde.
»Mel«, grinste Melzick zurück.
»Ah ja, du bist seine Schwester«, erwiderte er und wandte sich nach rechts. »Dann bist du …?«
»Jocelyn.«
»Schön, Jocelyn, du bist seine …?«
»Wir arbeiten zusammen«, kam Zacharias ihr zuvor und schnappte sich seine Gabel aus Phils Hand. Phil schmunzelte, sagte aber nichts dazu. Jocelyn vermied es, ihn anzusehen und konzentrierte sich auf ihren Teller, der mit Grapefruit- und Orangenstücken, Kiwi-Scheiben und blauen Weintrauben beladen war. Die anderen taten es ihr gleich und für ein paar Minuten herrschte gefräßiges Schweigen. Phil hatte in den letzten Tagen so viel reden müssen, dass er froh über die Stille am Tisch war. Melzick wartete einfach nur ab und beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Zacharias hatte einen Bärenhunger und stibitzte eine Kiwi von Jocelyns Teller, die mit ihren Gedanken woanders war. Schließlich legte Melzick ihre Gabel hin.
»Glaubst du wirklich, dass da heute 5000 Leute kommen werden?«, fragte sie Phil. Der schob seinen leeren Teller zur Seite und beugte sich über den Tisch.
»Nach meinen letzten Informationen werden es noch mehr.« Er flüsterte fast. »Das wird die größte Demo in Augsburg seit dem Sommermärchen.« Jocelyn hob verwirrt den Kopf.
»Sommermärchen?«, fragte sie und Melzick registrierte, dass es sich überhaupt nicht akzentfrei anhörte.
»Die Fußball-WM«, erklärte Zacharias mit vollem Mund. Er aß wie immer sehr langsam. »Da war die halbe Stadt auf den Beinen und zwar jede halbe Stadt in Deutschland.«
»Fahnen und Transparente gab es da auch«, warf Melzick ein, »aber mir will einfach nicht einfallen, wofür die damals protestiert haben. Was war es denn bloß?« Jocelyn entging die Ironie. Sie wurde immer verwirrter.
»Lass gut sein, Mel«, sagte Zacharias. »Die Leute waren einfach nur begeistert, das ist alles.«
»Ich glaube, das verstehe ich nicht«, sagte Jocelyn, diesmal wieder in perfektem Deutsch.
»Da bist du nicht die Einzige«, brummte Melzick. »Und jetzt möchte ich wirklich wissen, woher du so gut …«, doch Zacharias kam ihr zuvor.
»Genau, ich möchte auch wissen, was es jetzt noch Leckeres gibt. Komm Jocelyn!« Er nahm ihre beiden Teller und stand auf. Jocelyn folgte ihm zum Buffet. Phil warf Melzick einen Blick zu.
»Du bist Polizistin? Zack hat mal so was erwähnt.«
»Du darfst ihn Zack nennen?«
»Wieso nicht?«
»Weil er es seiner großen Schwester verbietet.« Phil zuckte mit den Schultern und deutete kurz auf ihre hennaroten Dreadlocks. Bevor er etwas sagen konnte, hob Melzick abwehrend ihre Hand.
»Ich schlage vor, du machst keine Bemerkung über meine Haare, dann sag ich auch nichts über deinen Bart.« Phil grinste und hob ergeben beide Hände.
»Ok, ok, hast ja Recht. Deine erste Demo als Polizistin?«
»Meine erste Demo als Demonstrantin.« Phil nickte anerkennend.
»Ich geb dir einen guten Rat als alter Hase: Sei freundlich zu den Bullen.« Melzick warf ihm einen Blick zu und griff nach ihrem Teller.
»Ich kann nur freundlich sein, wenn ich satt bin.« Phil stand ebenfalls auf.
»Da haben wir ja was gemeinsam.«
Zweifel saß auf dem Boden und lehnte mit dem Rücken an seinem Bücherregal. Die Romane von Hemingway, Faulkner, Dostojewski und Tolstoi hatte er schon aussortiert. Auch die Gesamtausgabe von Georges Simenon, die ihm seine Frau vor vielen Jahren geschenkt hatte.
»Schließlich musst du wissen, wie Kommissare in anderen Ländern arbeiten. Und da du noch nie in Frankreich warst, dachte ich, du fängst am besten mit „Kommissar Maigret“ an.« Kurz danach war sie bei einem Banküberfall auf fürchterliche Art ums Leben gekommen. Er hatte keine einzige Seite von Simenon zu Ende gelesen. Ihre Stimme wisperte in seinen Ohren wie in einer Endlosschleife, sobald er nur ein paar Zeilen zu lesen versuchte. Schon lange spielte er mit dem Gedanken, die Bücher zu verkaufen und jetzt, während er die Umzugskartons zusammensteckte, war der Entschluss gefallen. In seiner neuen Wohnung war kein Platz dafür, redete er sich ein und wollte rasch sämtliche Bände in den Kartons verstauen, bevor ihm eine Ausrede einfallen würde. Nur seine Kunstbände würde er mitnehmen.
Durch so viele Entscheidungen erschöpft, blätterte er gedankenverloren in einem Buch über die russischen Realisten. Sein Blick fiel auf ein Gemälde Ilja Repins, das einen wüsten Haufen ausgelassener Kosaken darstellte, die dem türkischen Sultan einen Brief schrieben. Er starrte auf das trostlose Ambiente seines Wohnzimmers. Hatte er wirklich jahrelang hier gewohnt? Wie oft hatte er Gäste gehabt? Wie oft hatte ein Fest die Wände gewärmt? Wie oft hatte es gute Gespräche gegeben? Er konnte sich an kein einziges erinnern. Mit einem energischen Kopfschütteln verscheuchte er die trübseligen Gedanken. Er klappte die russischen Realisten zu. Dabei fiel ihm schlagartig sein Date ein. Er blickte auf die Uhr und sprang auf. Lucy durfte er nicht warten lassen.
4. Kapitel
»Das muss bestraft werden, Herr Kommissar.« Mit diesen Worten hatte sie Zweifel zu einem ausführlichen Mittagessen bei sich zu Hause eingeladen. Er ahnte, dass sie dabei erfahren wollte, welcher kühle Grund ihn dazu bewogen hatte, aus heiterem Himmel nach Friedberg umzuziehen. Die Entscheidung kam ganz plötzlich. Die Vorstellung, weitere fünfzehn Jahre in Bad Wörishofen zu verbringen, bis zu seiner Pensionierung, überfiel ihn am Schreibtisch. Er sprang auf, wischte den Ausgangskorb mit dem unvermeidlichen Papierkram impulsiv vom Tisch und riss die Tür seines Büros auf. Lucy fiel vor Schreck die Kaffeetasse aus der Hand, mit der Folge, dass das neueste Rundschreiben des Innenministeriums hellbraun überflutet wurde.
»Das ist vollkommen unmöglich«, rief Zweifel. Lucy starrte ihn verdattert an und schnappte nach Luft.
»Aber das war doch jetzt Ihre Schuld. Lieber Himmel, was für eine Schweinerei!« Sie rieb hektisch am Ärmel ihrer rosafarbenen Bluse, der mit dunklen Tropfen gesprenkelt war. Die Kaffeepfütze breitete sich rasch auf ihrem vollbeladenen Schreibtisch aus und saugte sich zwischen all den Blättern, die lose herumlagen, fest. Ein braunes Rinnsal lief an ihrer Schreibtischunterlage entlang, bis es die Kante erreichte und unerbittlich auf den hellen Teppichboden tropfte. Lucy brachte im letzten Moment Maus und Tastatur in Sicherheit. Sie blickte Zweifel mit großen Augen an und fand keine weiteren Worte. Der schüttelte den Kopf und zwinkerte mit den Augen, als sähe er nicht richtig.
»Lucy! Mir ist gerade etwas klar geworden!«, rief er.
»Mir auch«, erwiderte sie trocken, zauberte eine Rolle Küchentücher unter ihrem Schreibtisch hervor und tupfte energisch und empört den Sumpf auf ihrem Schreibtisch trocken. Ein unangenehm säuerlicher Geruch nach feuchtem Papier und kaltem Milchkaffee machte sich bemerkbar. Zweifel legte beschwörend beide Hände flach auf ihren Tresen.
»Ich muss weg.« Lucy war sehr beschäftigt und hörte nur mit halbem Ohr zu.
»Wer muss das nicht?«, brummte sie. Zweifel winkte ab.
»Das meine ich nicht.« Etwas in seiner Stimme ließ sie aufhorchen. Sie unterbrach ihre Trockenlegungsmaßnahmen und sah ihn stirnrunzelnd an. Er lächelte sie an und nickte.
»So ist es. Ich muss weg.« Eine halbe Stunde später präsentierte er das Versetzungsgesuch seinem Chef Alois Klopfer. Der wäre normalerweise aus allen Wolken gefallen, aber da er selbst kurz vor einem Karrieresprung ins Ministerium nach München stand, blieb er gelassen.
»In Augsburg dürfte mordtechnisch gesehen etwas mehr los sein als in Bad Wörishofen«, meinte er und unterschrieb das Gesuch.
»Ich bin nicht auf der Suche nach Morden, Chef. Ich brauche Veränderung.« Klopfer nickte.
»›Variatio delectat‹, wie der alte Lateiner Gerhard Polt in einem seiner Sketche im schönsten Premium-Bayerisch deklamiert. Aber warum gehen Sie dann nicht gleich nach München?« Zweifel schüttelte den Kopf.
»Ich will nach Augsburg zurück. Vor meiner Berliner Zeit hab ich dort ein paar Monate verbracht.« Er schloss kurz die Augen. »Und die habe ich in bester Erinnerung. Ich glaube einfach, dass das jetzt das Richtige für mich ist.«
»Sie werden dort nicht so leicht eine vernünftige Wohnung finden.« Zweifel winkte ab.
»Ach was, da mach ich mir keine Gedanken.« Er hatte aber sehr bald eingesehen, dass Klopfers Behauptung zutraf. Eher würden Störche auf dem Perlachturm nisten, als dass er ein passendes Nest in der Altstadt fände. Mit viel Glück bekam er den Zuschlag für eine winzige Zweizimmerwohnung unter dem Dach im alten Kern von Friedberg, direkt an der Stadtmauer. Das Wittelsbacher Schloss war nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Von seinem Fenster aus hatte er freien Blick in Richtung Westen auf die Silhouette von Augsburg: den Hotelturm, im Volksmund Maiskolben genannt, die Ulrichs-Kirche, den Perlachturm samt Rathaus, den Gaskessel. Seine engste Mitarbeiterin, Melinda Zick, die er vom ersten Tag an Melzick genannt hatte, witterte die drohende Veränderung.
»Gibts irgendwelche Neuigkeiten, die ich wissen müsste?«, hatte sie zwei Wochen später Lucy gefragt.
»Was meinst du, Mel?«
»Na, was meinen Chef betrifft, Lucy. Du hörst doch sonst immer das Gras wachsen.« Lucy zuckte mit den Schultern.
»Was das angeht: Außer Rasenmähern und Laubbläsern hör ich nix mehr in letzter Zeit. Frag ihn doch einfach, deinen Chef.« Doch Zweifel kam ihr zuvor und sorgte für Klarheit, als er die beiden noch am gleichen Tag in sein Büro bat.
»Der Fall Kronberger«, begann er und räusperte sich. Unvermutet verlor er den Faden, als er Lucy und Melzick in die Augen blickte.
»Also — der Kronberger-Mord …« Melzick verschränkte die Arme und zog die Augenbrauen hoch. Lucy ahnte schon etwas und legte eine Hand auf den Mund. Zweifel ärgerte sich über seine plötzliche Unsicherheit und klatschte einmal in die Hände, was die beiden zusammenzucken ließ.
»Um es kurz zu machen: Das war mein letzter Fall hier.« Melzick schluckte.
»Was soll das heißen?«
»Ich habe meine Versetzung beantragt. Ich gehe nach Augsburg.« Lucy schlug nun auch die zweite Hand vor den Mund.
»Sie haben das wirklich ernst gemeint«, flüsterte sie.
»Also hast du doch was gewusst«, stieß Melzick hervor. Lucy schaute sie aus großen Augen an und schüttelte den Kopf.
»Er hat nur gesagt, er muss weg, mehr nicht, Mel. Und vorher hat er mir so ’nen Schreck eingejagt, dass die Flecken nie mehr rausgehen aus meinem Schreibtisch.«
»Ich versteh kein Wort, Lucy. Und ich versteh überhaupt nur Bahnhof!«, rief Melzick und funkelte ihren Chef an. Der hob beschwichtigend beide Hände.
»Da gibt es gar nicht viel zu verstehen. Lucy, erinnern Sie sich an meine Worte? Was hab ich gesagt, nachdem Sie Ihren Schreibtisch mit Kaffee überschwemmt hatten?« Lucy starrte ihn an und dachte nach.
»Das ist vollkommen unmöglich.« Zweifel nickte.
»Genau.«
»Was ist unmöglich?«, wollte Melzick wissen. »Chef! Jetzt reden Sie doch mal Klartext!« Zweifel deutete mit beiden Händen vielsagend auf seinen Schreibtisch und auf den Rest seines Büros.
»Sehen Sie sich das an. Können Sie sich vorstellen, dass ich noch fünfzehn Jahre an diesem Tisch in diesem Büro hocke?«
»Klar!«, rief Melzick spontan. Zweifel lachte kurz auf.
»Ganz ehrlich, Melzick«, er schüttelte den Kopf, »das glaub ich Ihnen nicht.« Lucy war schon ein Stückchen weiter.
»Er hat Recht, Mel.« Melzick kratzte wild auf ihrem Kopf herum.
»Aber, Herrgott nochmal, wer denkt denn so weit in die Zukunft? Ich denk höchstens bis zum nächsten Ersten.«
»Das tu ich auch«, sagte Zweifel. »Am nächsten Ersten bin ich woanders und viel mehr weiß ich auch nicht.« Melzick schüttelte den Kopf. Sie ahnte, dass da nichts zu machen war. Außerdem fehlten ihr die Worte. Sie nahm Zweifels Entscheidung persönlich. Es war ein harter Schlag und sie wollte plötzlich nur noch weg. Ohne Lucy oder Zweifel auch nur eines Blickes zu würdigen, stürmte sie aus dem Büro. Eine wilde Wut schlug in ihrer Brust. Eine schwere Enttäuschung hatte sie im Genick gepackt. Sie brauchte frische Luft. Sie riss ihr Fahrrad aus dem Ständer, sprang auf und trat mit voller Kraft in die Pedale. Zweifel beobachtete sie aus dem Fenster seines Büros. Lucy stand neben ihm. Sie seufzte. Er drehte sich zu ihr um.
»Sie wird schon drüber wegkommen«, brummte er und seine Stimme klang heiser. Lucy zuckte mit den Schultern.
»Da wäre ich nicht so sicher.« Zweifel war immer noch unwohl beim Gedanken an diese Szene. Aber nichts konnte ihn von seinem Entschluss abbringen. Er griff nach der Flasche Wein, die er Lucy mitbringen wollte. Dabei war er so in Gedanken, dass sie ihm aus der Hand rutschte, auf den Boden knallte und in tausend Scherben zersprang. Lucys Worte kamen ihm in den Sinn:
»Das muss bestraft werden.« Er fluchte laut, fischte die Scherben aus der Weinpfütze und warf sie in den Müll. Den Rest beseitigte er in aller Eile mit Papiertüchern. Er riss das Küchenfenster auf, schnappte seinen Schlüsselbund und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen.
»Sie sind zu spät, Herr Kommissar«, begrüßte ihn Lucy, »das verschärft die Sache noch.«
»Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung, Lucy. Welche Sache meinen Sie?« Lucy deutete mit einem soßenverschmierten Kochlöffel hinter sich.
»Chili con Chili sin Carne.«
»Mir schwant nichts Gutes«, erwiderte Zweifel und hielt ihr die Flasche Wein vor die Nase, die er noch rasch im Feinkostladen besorgt hatte. »Ist Melzick schon da?« Lucy nahm die Flasche entgegen, studierte das Etikett und meinte:
»Sieht teuer aus. Zufall oder Absicht? Sie brauchen nicht zu antworten. Folgen Sie mir einfach, Herr Kommissar.« In der geräumigen Wohnküche war für zwei gedeckt. Zweifel schnupperte nach dem köstlichen Duft, der in der Luft lag.
»Hab sie nicht eingeladen«, sagte Lucy beiläufig und rührte in der gusseisernen Pfanne, in der etwas sehr Scharfes vor sich hin köchelte. Zweifel setzte sich zwanglos an den Tisch.
»Das glaube ich Ihnen nicht.«
»Ah ja? Und wie lautet Ihre Theorie?« Er stand auf und fragte nach einem Korkenzieher. Lucy deutete auf eine Schublade.
»Ich bin sicher, Sie haben sie eingeladen, aber sie wollte nicht«, sagte er und zog mit einem satten Plopp den Korken aus der Flasche. »Melzick ist sauer«, fügte er hinzu und roch an dem Korken. »Liege ich richtig?« Lucy seufzte. Sie schaltete den Herd aus, wischte mit dem Handrücken über ihre Stirn und drehte sich zu ihm um.
»Sauer ist gar kein Ausdruck. Sie ist so aus dem Häuschen, dass sie durch die Straßen marschiert, Parolen skandiert und den Leuten mit ihrem Transparent auf die Nerven geht.« Zweifel schaute sie fassungslos an.
»Transparent? Nur weil ich nach Augsburg gehe?«